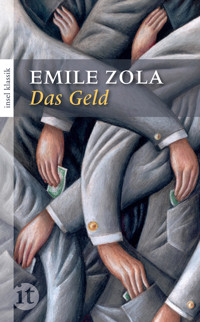Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Ein Blatt Liebe" ist ein Buch, das sowohl Zola-Liebhaber als auch Neueinsteiger ansprechen wird. Der Roman bietet einen Einblick in die gesellschaftlichen und psychologischen Probleme des 19. Jahrhunderts, die auch heute noch relevant sind. Mit seiner lebendigen Darstellung und seinem dynamischen Schreibstil wird das Buch den Leser von Anfang bis Ende fesseln und zum Nachdenken anregen. Für Liebhaber von literarischen Werken mit sozialer Relevanz und starken Charakteren ist "Ein Blatt Liebe" ein absolutes Muss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Blatt Liebe
Books
Inhaltsverzeichnis
1
Die Nachtlampe brannte auf dem Kamin hinter einem Buche, dessen Schatten eine Hälfte des Zimmers zudeckte. Es war ein mildes Licht, das die dicken Falten der Plüschvorhänge badete und die Spiegelscheiben des zwischen den beiden Fenstern aufgestellten Mahagonisilberschrankes bläute. Die bürgerliche Harmonie des Zimmers, dieses Blau der Vorhänge, der Möbel und des Teppichs nahm um diese Stunde eine unbestimmte Milde an. Und den Fenstern gegenüber bildete neben dem Schatten das ebenfalls mit Plüsch verhangene Bett eine dunkle Masse, nur von der Blässe der Bettdecken aufgehellt. Helene, die gekreuzten Hände in der ruhigen Haltung der Mutter und Witwe übereinandergelegt, atmete leicht auf.
Inmitten der Stille schlug die Pendüle eins. Die Geräusche des Stadtviertels waren erstorben. Hier auf diese Anhöhen des Trocadero sandte Paris bloß sein fernes Schnarchen. Helenes leiser Atemzug war so sanft, daß er die keusche Linie ihres Busens nicht hob. Sie genoß einen schönen, ruhigen und kräftigenden Schlaf. Ihr edles Profil umrahmte das zu mächtigen Flechten aufgesteckte kastanienbraune Haar; der Kopf lag leicht zur Seite geneigt, als ob sie lauschend entschlummert sei. In der Tiefe des Zimmers öffnete sich die Türe einer großen Kammer.
Kein Geräusch wurde laut. Es schlug halb. Der Pendel hatte in dieser das ganze Gemach beherrschenden Stille einen gedämpften Schlag. Die Nachtlampe schlummerte, die Möbel schlummerten und auf einem Schränkchen schlummerte neben einer verlöschten Lampe die Handarbeit. Helene behielt im Schlafe ihre ernsten und freundlichen Züge.
Als es zwei Uhr schlug, wurde dieser Friede gestört. Ein Seufzer kam aus der Finsternis der Kammer. Dann hörte man ein Knistern von Leinwand, und wieder trat Stille ein. Jetzt ein beklommener Atemzug. Helene hatte sich nicht gerührt. Plötzlich sprang sie empor. Ein wirres Kinderstammeln hatte sie geweckt. Sie fuhr mit der Hand nach den Schläfen; noch schlafumfangen, als ein dumpfer Aufschrei sie aus dem Bette jagte.
»Jeanne! Jeanne! Was ist dir? Antworte doch!« Und als das Kind schwieg, murmelte sie, im Laufen die Nachtlampe fassend:
»Ach Gott! sie war nicht recht munter; ich hätte mich nicht niederlegen sollen.«
Sie trat rasch in das anstoßende Gemach, wo wieder dumpfes Schweigen herrschte. Die ölgefüllte Nachtlampe aber warf einen zitternden Lichtschein, der an die Zimmerdecke einen runden Fleck zeichnete. Helene konnte, über die eiserne Bettstelle gebeugt, zuerst nichts unterscheiden. Dann sah sie in dem bläulichen Lichtschein, mitten unter zurückgeworfenen Bettüchern und Decken, Jeanne ausgestreckt, mit zurückgeworfenem Kopfe, starren und harten Halsmuskeln. Ein Krampf entstellte das liebenswürdige Gesichtchen, die Augen waren geöffnet und starrten auf den Rand der Vorhänge.
»Ach Gott! ach Gott!« rief Helene, »sie stirbt!« Und die Nachtlampe hinstellend, betastete sie ihr Kind mit zitternden Händen. Sie konnte den Puls nicht finden. Das Herz schien stillzustehen. Die kleinen Arme, die Beinchen spannten sich gewaltsam. Dann packte Helene die Angst, und wie besessen schrie sie auf:
»Mein Kind stirbt! Hilfe! Mein Kind! mein Kind!«
Sie kehrte in das Zimmer zurück, ohne zu wissen, wohin sie ging. Dann trat sie wieder in die Kammer und warf sich von neuem am Bette nieder, noch immer um Hilfe rufend. Sie hatte Jeanne mit den Armen gefaßt, küßte ihr Haar, tastete mit den Händen an ihrem Körper hin und flehte um eine Antwort, um einen Laut. Ein Wort, ein einziges Wort. Wo tat's weh? Verlangte sie noch ein bißchen Suppe von gestern? Ob ihr am Ende die Luft wieder zum Leben verhülfe? Und hartnäckig blieb sie dabei, einen Laut aus dem Munde des Kindes zu hören.
»Sage mir, Jeanne! sag mir doch ein Wort! Ich bitte dich!«
Und dabei nicht wissen, was anfangen! Und alles so gänzlich unerwartet mitten in der Nacht. Nicht einmal Licht. Helenes Gedanken verwirrten sich. Sie fuhr fort, zu ihrem Kinde zu plaudern. Im Magen mußte die Ursache dieses Anfalls sitzen; nein, im Schlund... Es würde nichts auf sich haben. Ruhe war nötig. Und sie machte eine gewaltsame Anstrengung, ihren Verstand beisammen zu halten. Aber die Empfindung, ihr Kind steif und starr in den Armen zu haben, schnürte ihr die Brust zu. Sie schaute es an, wie es so krampfverzerrt ohne Atem dalag, und versuchte zu überlegen. Plötzlich schrie sie auf, ohne es zu wollen.
Sie lief durch die Eßstube und die Küche:
»Rosalie! Rosalie!... Rasch, einen Arzt!... Mein Kind liegt im Sterben!« Das Dienstmädchen Rosalie, welches in einem Gelaß hinter der Küche schlief, schrie auf. Helene war zurückgekommen. Sie lief im bloßen Hemde, ohne die Kälte dieser eisigen Februarnacht zu fühlen. Wollte denn diese Rosalie ihr Kind sterben lassen! Eine Minute war kaum verstrichen. Sie lief wieder in die Küche und zurück in die Stube.
Und jäh, tastend, zog sie einen Unterrock an und warf ein Tuch über die Schultern. Sie stieß an Möbel und füllte mit der Hast ihrer Verzweiflung den Raum, in dem ein so tiefer Friede geschlummert hatte. Dann eilte sie in Pantoffeln, die Türen hinter sich offen lassend, die drei Stufen hinab, einzig von dem Gedanken beherrscht, einen Arzt zur Stelle zu schaffen.
Als der Pförtner die Schnur gezogen hatte, fand sich Helene mit summenden Ohren und wirrem Kopfe auf der Straße. Sie lief rasch die Rue Vineuse hinab und läutete beim Doktor Bodin, der Jeanne bereits behandelt hatte.
Ein Diener antwortete ihr endlich nach einer halben Ewigkeit, der Doktor sei zu einer Niederkunft geholt worden. Sie kannte keinen andern Arzt in Passy. Einen Augenblick lief sie die Straßen auf und ab, die Augen auf die Häuser gerichtet. Ein eisiger Wind wehte; sie ging mit ihren Pantoffeln auf einem leichten, am Abend gefallenen Schnee. Und vor ihr stand immerfort das Kind, und der angstvolle Gedanke, daß sie nicht sogleich einen Arzt fand, drohte sie zu töten. Da, die Rue Vineuse wieder hinaufeilend, hängte sie sich an einen Klingelzug. Sie wollte wenigstens fragen...
Als niemand zu kommen schien, klingelte sie von neuem. Der Wind klatschte ihr den dünnen Rock um die Beine, und die Locken ihres braunen Haares flatterten.
Endlich schloß ein Diener auf und sagte, daß Herr Doktor Deberle schon zu Bett sei. Sie hatte also bei einem Arzte geläutet! Der Himmel verließ sie nicht! Da schob sie den Diener beiseite und trat ins Haus.
Sie wiederholte:
»Mein Kind, mein Kind liegt im Sterben! Sagen Sie ihm, er solle kommen!«
Es war ein kleines Haus, überladen mit Vorhängen. Sie stieg ein Stockwerk hinauf, im Kampf mit dem Diener. Auf alle Einwände antwortete sie, daß ihr Kind im Sterben läge. In einem Zimmer erklärte sie, hier warten zu wollen. Aber sobald sie nebenan den Arzt aufstehen hörte, trat sie heran und sprach durch die Tür:
»Rasch, Herr Doktor, ich flehe Sie an ... mein Kind stirbt!«
Und als der Arzt im Hausrock, ohne Halsbinde, erschien, zog sie ihn fort, ließ ihm nicht Zeit, sich anzukleiden. Er – hatte sie erkannt. Sie wohnte im Nachbarhause und war seine Mieterin. Auch Helene erinnerte sich jetzt, als er sie, den Weg abzukürzen, durch eine Verbindungstüre zwischen den beiden Wohnhäusern nach dem Garten führte.
»Ach! es ist ja wahr,« flüsterte sie, »Sie sind Arzt, und ich wußte es.... Sehen Sie, ich bin schier von Sinnen. Ach bitte, bitte, beeilen wir uns!«
Auf der Treppe wollte sie ihm den Vortritt lassen. Sie hätte den lieben Gott selbst nicht höflicher bei sich einführen können! Oben war Rosalie bei Jeanne geblieben und hatte die auf dem Schränkchen stehende Lampe angezündet. Sobald der Arzt hereintrat, ergriff er die Lampe und leuchtete nach dem Kinde, das noch immer in schmerzvoller Starre dalag; bloß der Kopf hatte sich seitwärts geneigt, und rasche Zuckungen liefen über das Gesicht. Eine Minute lang sagte der Arzt nichts, preßte nur die Lippen zusammen. Helene schaute ihn angstvoll an. Als er diesen flehentlichen Blick der Mutter sah, flüsterte er:
»Es wird nichts auf sich haben; aber hier dürfen wir sie nicht lassen. Sie braucht Luft.«
Helene nahm die Kleine mit kräftigem Schwung auf die, Schulter. Sie hätte dem Arzt für sein gütiges Wort die Hände geküßt, und ein süßes Gefühl durchdrang sie. Aber kaum hatte sie Jeanne auf ihr eigenes Bett gelegt, als der arme Körper des Kindes von heftigen Krämpfen geschüttelt wurde. Der Arzt hatte den Schirm von der Lampe entfernt; weißes Licht füllte das Zimmer. Er trat zum Fenster, öffnete es und befahl Rosalie, das Bett aus den Vorhängen herauszuschieben. Helene stammelte:
»Aber sie stirbt, Herr Doktor! Sehen Sie doch nur, sehen Sie doch nur! ... Ich erkenne sie nicht mehr wieder!«
Er gab keine Antwort, sondern verfolgte aufmerksam den Anfall. Endlich sagte er:
»Treten Sie in den Alkoven! Halten Sie ihr die Hände, damit sie sich nicht kratzt!... So, sanft, ohne Gewalt... Beunruhigen Sie sich nicht! Die Krise muß ihren Verlauf nehmen!«
Und beide hielten, über das Bett geneigt, Jeanne, deren Glieder sich mit heftigen Stößen spannten. Der Arzt hatte den Rock zugeknöpft, den bloßen Hals zu verdecken. Helene blieb, wie sie das Haus verlassen hatte, in den Schal gehüllt, den sie über die Schultern geworfen hatte. Jeanne aber riß, als sie sich der festhaltenden Hände erwehrte, einen Zipfel des Schals fort und dem Arzte die Knöpfe der Jacke auf. Sie merkten nichts davon. Inzwischen ließ der Anfall nach. Die Kleine schien in eine große Ermattung zu sinken. Wenn er auch die Mutter über den Ausgang der Krise beruhigte, blieb der Arzt doch mit der Kranken beschäftigt und ließ sie nicht aus den Augen. Endlich stellte er an Helene, die in der Bettgasse stand, kurze Fragen.
»Wie alt ist das Kind?«
»Elf und ein halbes Jahr, Herr Doktor.«
Schweigen trat ein. Er schüttelte den Kopf, bückte sich, um Jeannes geschlossenes Augenlid zu heben und die Schleimhaut zu besehen. Dann fragte er weiter, ohne Helene anzuschauen:
»Hat sie schon früher Krämpfe gehabt?«
»Ja, Herr Doktor, sie sind aber mit dem sechsten Jahre ausgeblieben. Sie ist sehr schwächlich – seit ein paar Tagen merkte ich, daß sie nicht recht wohl war. Sie hatte Zuckungen, war nicht bei sich.«
»Ist Ihnen etwas von Irrsinn in Ihrer Familie bekannt?«
»Ich weiß nicht ... meine Mutter ist an Brustkrankheit gestorben.«
Helene zögerte beschämt, denn die mochte nicht eingestehen, daß ihre Großmutter im Irrenhaus gestorben war.
»Geben Sie acht!« sagte der Arzt lebhaft; »es kommt ein neuer Anfall.«
Jeanne hatte eben die Augen geöffnet. Sie schaute mit irrem Blick um sich, ohne einen Laut von sich zu geben. Dann wurde dieser Blick starr, der Körper warf sich nach hinten und die Glieder wurden steif. Sie war puterrot. Plötzlich wurde sie leichenblaß, und die Krämpfe begannen.
»Lassen Sie mich los!« fuhr der Doktor fort. »Nehmen Sie auch die andere Hand!« Er eilte zum Schränkchen, auf das er vorhin ein Arzneikästchen gestellt hatte. Mit einem Fläschchen kam er zurück und ließ das Kind daran riechen. Aber das war, als wenn sie ein furchtbarer Peitschenschlag getroffen hätte. Das Kind packte eine solche Erschütterung, daß es den Händen der Mutter entglitt.
»Nein, nein, keinen Äther!« schrie Helene, »Äther bringt sie außer sich.«
Es gelang ihren vereinten Kräften kaum, das Kind zu halten. Sie hatte heftige Zuckungen und bäumte sich auf Fersen und Nacken empor. Dann fiel sie zurück, schüttelte sich in einem Hinundher, das sie an beide Kanten des Bettes warf. Ihre Fäustchen waren geschlossen, der Daumen der Handfläche zugekehrt; zeitweise öffnete sie diese und suchte mit ausgestreckten Fingern Gegenstände im leeren Raum zu fassen, um sie zu zerdrücken. Sie traf auf den Schal ihrer Mutter und klammerte sich daran fest. Aber was Helene vor allem quälte, war, wie sie sagte, daß sie ihr Kind nicht mehr wiedererkenne; Ihr armer Engel mit dem süßen Gesichtchen hatte verzerrte Züge, die Augen traten aus ihren Höhlen und zeigten einen bläulichen Schimmer.
»Tun Sie etwas, ich bitte Sie flehentlich – ich fühle mich am Ende meiner Kräfte, Herr Doktor.«
Helene hatte sich eben der Tochter einer Nachbarsfrau in Marseille erinnert, die sich von einem ähnlichen Anfall nicht wieder erholt hatte und gestorben war. Vielleicht täuschte sie der Arzt, um sie zu schonen? Sie glaubte alle Sekunden, den letzten Hauch des Kindes im Gesicht zu verspüren. Dessen Atem stockte jetzt gänzlich. Und von Schmerz, Jammer und Schrecken übermannt, begann sie zu weinen. Ihre Tränen fielen auf die unschuldigen bloßen Glieder des Kindes, das die Decken wieder von sich geworfen hatte.
Der Doktor massierte mit langen geschmeidigen Fingern sanft den unteren Halsteil des Kindes. Die Heftigkeit des Anfalls nahm ab. Jeanne blieb nach einigen matten Bewegungen, erschöpft liegen. Sie war mit ausgestreckten Armen auf die Mitte des Bettes gesunken, und der Kopf, auf das Kissen gestützt, fiel auf die Brust. Es war, als ob man ein Christuskind sehe. Helene küßte sie lange auf die Stirn.
»Ist's zu Ende?« fragte sie halblaut. »Glauben Sie, daß noch weitere Anfälle kommen?«
Er machte eine ausweichende Gebärde.
»Jedenfalls werden die späteren weniger heftig sein.«
Er hatte Rosalie gebeten, ihm ein Glas und eine Karaffe zu bringen. Das Glas füllte er halb, griff nach zwei neuen Fläschchen, zählte die Tropfen ab und führte mit Helenes Hilfe, die dem Kinde den Kopf hielt, einen Löffel voll zwischen die aufeinandergepreßten Zähne. Die Lampe brannte sehr hoch und ihr weißes Licht beschien die Unordnung des Zimmers. Die Kleider, welche Helene, wenn sie zu Bett ging, über eine Stuhllehne legte, waren zu Boden geglitten und sperrten den Teppich. Der Doktor hob ein Korsett auf, um nicht darauf zu treten. Verbenenduft entstieg dem zerwühlten Bett und den umherliegenden Wäschestücken.
Die intime Häuslichkeit einer Frau verriet ihre Geheimnisse. Der Doktor holte selbst die Waschschüssel herbei, feuchtete ein Stück Leinwand und legte es dem kranken Kinde auf die Schläfe.
»Gnädige Frau, Sie werden sich erkälten,« sagte Rosalie, von Frost geschüttelt. »Man könnte jetzt vielleicht das Fenster schließen. Die Luft ist doch gar zu scharf.«
»Nein, nein!« rief Helene; »laß das Fenster offen! Nicht wahr, Herr Doktor?«
Schwacher Wind drang herein, die Vorhänge hebend. Der Schal war Helene, ohne daß sie es merkte, von den Schultern geglitten, die schneeige Weiße des Busens entblößend. Hinten ließ der gelöste Zopf wirre Strähnen bis auf die Hüften niederhängen. Sie hatte die Ärmel aufgestreift, um besser bereit zu sein, dachte ja an nichts anderes als an ihr Kind. Und der Arzt vor ihr dachte in seiner Geschäftigkeit auch nicht mehr an den offen stehenden Rock, an den von Jeanne in Unordnung gebrachten Hemdkragen.
»Richten Sie sie ein bißchen auf,« sagte er, – »nein, nicht so! Reichen Sie mir die Hand!«
Er faßte die Hand, schob sie selbst unter den Kopf des Kindes, dem er noch einen Löffel Arznei einflößen wollte. Dann rief er sie neben sich. Er bediente sich ihrer wie einer Assistentin, und Helene gehorchte willig, da sie sah, daß ihr Kind ruhiger zu werden schien.
»Kommen Sie – legen Sie ihr den Kopf an Ihre Schultern, ich will ihre Brust abhorchen.«
Helene tat es. Nun neigte sich der Arzt über sie, um sein Ohr an Jeannes Brust zu legen. Er hatte ihre bloße Schulter mit seinem Kinn gestreift, und während er dem Schlage des kindlichen Herzens lauschte, konnte er auch die Schläge des Mutterherzens zählen. Als er sich aufrichtete, begegnete sein Atem dem ihren.
»Von dieser Seite ist nichts zu befürchten,« sagte er mit Ruhe, während Freude in ihr Herz einzog. »Legen Sie die Kleine wieder hin, wir dürfen sie nicht länger quälen.« Ein neuer Anfall kam, aber er war weit schwächer. Jeanne ließ ein paar abgerissene Laute hören. Zwei weitere Anfälle folgten in kurzen Zwischenräumen. Das Kind war in einen Schwächezustand verfallen, der dem Arzte neue Beunruhigung zu machen schien. Er hatte es mit dem Kopfe sehr hoch gelegt. Fast eine Stunde lang blieb er sitzen und beobachtete es; er schien zu warten, daß der regelmäßige Gang des Atems wiederkäme. Auf der andern Bettseite wartete Helene, ohne sich zu rühren.
Nach und nach breitete sich großer Friede über Jeannes Gesicht. Die Lampe erhellte es mit ihrem matten Scheine. Das Gesicht des Kindes erhielt sein liebliches Oval wieder. Die geschlossenen Äugen hatten breite bläuliche und durchsichtige Lider, unter denen man den düstern Glanz des Blickes erriet. Die schmale Nase hob und senkte sich leicht, der ein wenig große Mund war von irrem Lächeln umspielt. So schlief sie mitten auf dem ausgebreiteten tintenschwarzen Haar.
»Diesmal ist es mit den Anfällen zu Ende!« sagte der Arzt halblaut, ordnete seine Fläschchen und schickte sich zum Gehen an.
»Oh! Herr Doktor!« flüsterte Helene, »lassen Sie mich nicht allein! Warten Sie noch ein paar Minuten! Wenn die Anfälle doch noch wiederkämen! Ihnen hab ich die Rettung des Kindes zu danken!«
Er machte ein Zeichen, daß nichts mehr zu befürchten stehe. Indessen blieb er, weil er sie nicht ängstigen mochte. Sie hatte Rosalie zu Bett geschickt. Bald erschien der Tag, ein milder, grauer Tag, über dem die Dächer bleichenden Schnee. Der Doktor schloß das Fenster. Beide tauschten inmitten des großen Schweigens mit leiser Stimme spärliche Worte. »Es ist nichts Ernstliches, glauben Sie mir. Bloß braucht's in ihrem Alter viel Sorgfalt. Wachen Sie vor allem darüber, daß ihr Leben gleichmäßig und glücklich, von allen Erschütterungen frei bleibt.«
Nach einer Weile sagte Helene:
»Sie ist so zart, so nervös ... ich vermag sie nicht immer zu regieren. Sie liebt mich mit Leidenschaft, mit einer Eifersucht, die ihr die Tränen in die Augen treibt, wenn ich ein anderes Kind liebkose.«
Der Arzt schüttelte den Kopf:
»Ja, ja, zart, nervös, eifersüchtig... Kollege Bodin hat sie in Behandlung, nicht wahr? Ich will mit ihm reden. Wir wollen eine energische Behandlung festsetzen. Sie steht in dem Alter, wo sich die Gesundheit des Weibes entscheidet.«
Als sie ihn so voll Eifer und Hingabe sah, fühlte Helene sich zur Dankbarkeit gedrängt.
»Ach! Herr Doktor! Wie danke ich Ihnen für die viele Mühe, die Sie gehabt haben!«
Da sie laut gesprochen hatte, beugte sich Helene über das Bett, aus Furcht, Jeanne geweckt zu haben. Das Kind schlief mit rosigem Gesicht, ein schwaches Lächeln auf den Lippen. In dem beruhigten Zimmer schwebte eine schläfrige Stille; alles ermattete in dem schwachen, durch die Scheiben dringenden Tageslichte.
Helene stand wieder in der Bettgasse. Der Doktor hielt sich am anderen Bettrande. Und zwischen ihnen schlummerte, leicht atmend, Jeanne.
»Ihr Vater war oft krank,« begann Helene mit weicher Stimme. »Ich – oh! ich habe mich immer wohl gefühlt.«
Der Doktor, der sie noch nicht angesehen hatte, hob den Blick und konnte nicht umhin zu lächeln. So gesund und stark war sie. Sie lächelte in ihrer ruhigen, freundlichen Weise zurück. Ihre herrliche Gesundheit machte sie glücklich. Indessen, er ließ keinen Blick von ihr. Niemals hatte er so ebenmäßige Schönheit gesehen. Groß, prächtig, war sie eine kastanienbraune Juno, das Haar von einem mit blonden Reflexen vergoldeten Braun. Wenn sie langsam den Kopf wandte, gewann ihr Profil die ernste Reinheit einer Statue. Ihre grauen Augen und weißen Zähne erhellten ihr Antlitz. Sie hatte ein rundes, ein wenig starkes Kinn, das ihr ein verständiges und entschlossenes Aussehen gab. Was aber den Doktor in Erstaunen setzte, war die erhabene Blöße dieser Mutter. Der Schal war gänzlich herabgeglitten. Der Busen lag bloß, die Arme blieben nackt. Eine dicke Flechte goldbrauner Färbung fiel auf die Schulter und verlor sich im Busen. In ihrem schlecht befestigten Rock und dem unordentlichen Haar bewahrte sie dennoch eine Majestät, erhabene Ehrbarkeit und Scham, welche sie keusch erscheinen ließ unter dem Blick dieses Mannes, in dessen Herzen eine große Verwirrung aufstieg.
Sie selbst prüfte ihn einen Augenblick lang. Der Doktor Deberle war ein Mann von fünfunddreißig Jahren, mit glatt rasiertem, länglichem Gesicht, klugen Augen und schmalen Lippen. Als sie ihn ansah, bemerkte sie ihrerseits, daß er den Hals entblößt hatte. Und so blieben sie Angesicht in Angesicht stehen, zwischen sich die entschlummerte Jeanne. Aber der eben noch unermeßliche Raum schien sich zu verengen. Das Kind hatte allzu schwachen Atem. Da zog Helene langsam ihren Schal wieder herauf und verhüllte sich, während der Doktor seinen Rockkragen zuknöpfte.
»Mama, Mama!« lallte Jeanne. Als die Schlafende die Augen geöffnet hätte, sah sie den Arzt und wurde unruhig.
»Wer ist das? wer ist das?« fragte sie. Die Mutter gab ihr einen Kuß.
»Schlafe, mein Süßes! Du bist krank gewesen, der Mann ist unser Freund!«
Das Kind tat verwundert, besann sich auf nichts. Der Schlummer übermannte Jeanne und sie schlief wieder ein, mit schwacher Stimme und freundlicher Miene lispelnd:
»Oh! Bin ich müde – Gute Nacht, Mütterchen! Wenn er dein Freund ist, wird er auch mein Freund werden!«
Der Arzt hatte sein Besteck an sich genommen. Er grüßte schweigend und zog sich zurück. Helene lauschte dem Atem des Kindes, dann verlor sie sich, auf dem Bettrande sitzend, in wirres Sinnen. Die Lampe, welche sie auszulöschen vergessen, brannte in den hellen Tag hinein.
2
Am andern Tage meinte Helene, es sei schicklich, dem Doktor Deberle Dank abzustatten. Die unsanfte Art, mit der sie ihn gezwungen hatte, ihr zu folgen, und die an Jeannes Bett verbrachte Nacht setzten sie in Verlegenheit, da ihr solcher Dienst weit über die gewöhnliche Besuchspflicht eines Arztes hinauszugehen schien. Indessen zögerte sie noch zwei Tage aus Gründen, die sie nicht hätte angeben können. Eines Morgens traf sie ihn und versteckte sich wie ein Kind. Sie war später über diese Schüchternheit sehr verdrießlich. Ihr ruhiges und grades Gemüt lehnte sich gegen diese in ihr Leben dringende Störung auf. Sie entschloß sich dann auch, noch am selben Tage dem Doktor ihren Besuch abzustatten.
Der Anfall der Kleinen war in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch gewesen und jetzt war es Sonnabend. Jeanne hatte sich völlig erholt. Doktor Bodin, der sehr beunruhigt gewesen war, hatte vom Doktor Deberle mit der Achtung eines armen, alten Stadtbezirksarztes für einen jungen, reichen und schon berühmten Kollegen gesprochen. Er erzählte indessen auch, daß das Vermögen schließlich vom Papa Deberle stamme, einem Manne, den ganz Passy in hohen Ehren halte. Der Sohn hätte eben bloß die Mühe gehabt, anderthalb Millionen und eine prächtige Praxis zu erben. Übrigens, setzte er rasch hinzu, ein gar stattlicher Herr. Er würde sich schmeicheln, mit diesem Kollegen über die teure Gesundheit seiner kleinen Freundin Jeanne zu beraten.
Gegen drei Uhr stieg Helene mit ihrem Töchterchen die Treppe hinunter; sie brauchten nur wenige Schritte in der Rue Vineuse zu tun, um vor der Tür des benachbarten Wohnhauses zu läuten. Beide gingen noch in tiefer Trauer. Ein Kammerdiener in Frack und weißer Binde öffnete. Helene kannte den großen, mit orientalischen Portieren behangenen Treppenflur sogleich wieder. Eine Flut von Blumen zur Rechten und Linken der Treppe erregte ihre besondere Aufmerksamkeit. Der Diener hatte sie in einen kleinen Saal mit Resedavorhängen und gleichfarbigen Polstermöbeln geführt. Er blieb stehen und wartete. Helene nannte ihren Namen:
»Frau Grandjean.«
Der Diener stieß die Tür zu einem schwarzgelben Salon mit Grandezza auf und wiederholte, sich verneigend:
»Frau Grandjean!«
Helene war's auf der Schwelle, als müsse sie sich zurückziehen. Sie hatte im Winkel des Kamins eine junge, auf schmalem Sofa sitzende Dame bemerkt, die mit ihren Kleidern dessen ganze Breite verdeckte. Ihr gegenüber saß eine ältliche Person, die weder Hut noch Schal abgelegt hatte. Es handelte sich also um einen Besuch.
»Verzeihung,« sagte Helene leise. »Ich wollte Herrn Doktor Deberle sprechen.«
Damit faßte sie Jeanne, die sie vor sich hatte eintreten lassen, wieder bei der Hand. Es störte und verwirrte sie, so plötzlich auf diese junge Dame zu stoßen. Warum hatte sie nicht nach dem Arzt gefragt?
Frau Deberle beendete soeben mit rascher, etwas scharfer Stimme eine Erzählung:
»Oh! es ist wunderbar, wunderbar! Sie stirbt mit einem Realismus! Da sehen Sie! So durchbohrt sie sich das Korsett, wirft den Kopf zurück und wird ganz grün... Ich versichere Sie! Man muß sie sehen, Fräulein Aurélie...«
Hierauf erhob sie sich, kam mit gewaltigem Rauschen ihrer Kleider an die Tür und sagte mit gewinnendem Liebreiz:
»Treten Sie doch ein, bitte... Mein Mann ist nicht da. Aber, glauben Sie mir, ich werde mich sehr, sehr glücklich schätzen ... Das muß wohl das kleine Fräulein sein, welches vor kurzem so viel gelitten hat. Bitte, nehmen Sie doch Platz!«
Helene mußte einen Stuhl annehmen, während Jeanne sich schüchtern auf den Rand eines Sessels setzte. Frau Deberle hatte sich wieder auf ihrem kleinen Sofa niedergelassen und plauderte mit niedlichem Lachen weiter:
»Heute ist grade mein Visitentag. Ja, ich empfange samstags. Da führt Pierre alles in den Salon. In der vergangenen Woche hatte er mir einen alten Oberst zugeführt, der das Zipperlein hatte.«
»Sie sind von Sinnen, Juliette!« flüsterte Fräulein Aurélie, die ältere Dame. Sie war eine verarmte alte Freundin, die schon an Frau Deberles Wiege gestanden hatte.
Es trat eine Pause ein. Helene warf einen Blick auf den Reichtum des Salons mit den schwarz und goldenen Vorhängen und Polstern, die Sternenglanz verbreiteten. Blumen standen in Fülle auf dem Kamin, dem Klavier, auf den Tischen; und durch die Fensterscheiben drang das helle Licht des Gartens, dessen entlaubte Bäume und kahlen Rasen man sah. Es war sehr warm, Dampfheizungstemperatur. Im Kamin lag ein einziges Scheit und verkohlte. Mit einem zweiten Blick wußte Helene, daß das Flimmern des Salons ein glücklich gewählter Rahmen sei, Frau Deberle hafte tiefschwarzes Haar und eine milchweiße Haut. Sie war klein, füllig, langsam und graziös. In all diesem Gold leuchtete unter der dichten, dunklen Frisur ihr blasser Teint im Widerschein des im Feuer vergoldeten Silbers. Helene fand sie bewundernswürdig.
»Krämpfe sind doch gar zu schrecklich,« hatte Frau Deberle die Unterhaltung wieder aufgenommen. »Mein kleiner Lucien hat sie auch gehabt, aber in sehr frühem Alter. Ach! was haben Sie für Angst ausstehen müssen, Sie Arme! Gott sei Dank, jetzt scheint ja das liebe Kind wieder munter zu sein.«
Und also weiterschwatzend, musterte nun die Frau des Doktors ihrerseits Helene, überrascht und von ihrer hohen Schönheit entzückt. Niemals hatte sie ein Weib mit einer so königlichen Miene, in solchem schwarzen Kleide, welches die hohe und strenge Witwengestalt verhüllte, gesehen. Ihre Bewunderung schuf sich in einem unwillkürlichen Lächeln Ausdruck, während sie mit Fräulein Aurélie einen Blick wechselte. Beide musterten jetzt die Besucherin mit so naivem Entzücken, daß Helene lächeln mußte.
Nun reckte sich Frau Deberle auf ihrem Sofa, und den am Gürtel hängenden Fächer fassend, fragte sie:
»Sind Sie gestern im Vaudeville gewesen, Madame?«
»Ich gehe niemals ins Theater,« erwiderte Helene.
»Oh! Die kleine Nannie ist herrlich gewesen, herrlich! Sie stirbt mit einem Realismus! Da sehen Sie! So durchbohrt sie sich das Korsett, wirft den Kopf zurück und wird ganz grün... Die Wirkung war großartig.«
Die Tür öffnete sich, der Diener meldete:
»Frau von Chermette – Frau Tissot...«
Zwei Damen traten in großer Toilette ein. Frau Deberle ging ihnen entgegen. Die Schleppe ihres schwarzen, mit Besatz überladenen Kleides war so schwer, daß sie ihr mit einem Hackenstoß aus dem Wege ging, sobald sie sich umwandte. Nun hörte man rasches Geplapper von Flötenstimmen.
»Wie liebenswürdig Sie sind!«
»Man sieht Sie ja gar nicht...«
»Wir treffen uns doch bei der Lotterie, nicht wahr?«
»Gewiß! Gewiß!«
»Oh! Wir können nicht Platz nehmen. Wir müssen noch in zwei Dutzend Häusern Besuch machen.«
»Aber Sie werden doch nicht gleich wieder davonlaufen wollen?«
Und schließlich setzten sich die Damen auf den Rand eines Sofas. Nun wurden die Flötenstimmen, um ein weniges schärfer, wieder laut.
»Nun, auch gestern im Vaudeville?«
»Oh! es war herrlich!«
»Man behauptet, sie verschlucke es, daher die grüne Farbe!«
»Nein, nein – die Posen sind prächtig. Aber sie mußten doch erst studiert werden ...«
»Es ist wunderbar! wunderbar!«
Die beiden Damen hatten sich erhoben und verschwanden. Der Salon fiel in seine frühere Ruhe zurück. Auf dem Kamin verströmten Hyazinthen durchdringenden Wohlgeruch. Einen Augenblick hörte man das Zanken einer Schar Sperlinge, die sich auf einem Rasenfleck herumbalgten. Frau Deberle zog den gestickten Tüllvorhang am Fenster ihr gegenüber hoch. Dann setzte sie sich wieder mitten in das Gold ihres Salons.
»Ich bitte um Entschuldigung – man wird so überlaufen ...«
Affektiert begann sie nun mit Helene zu plaudern. Sie schien deren Geschichte teilweise zu kennen, wahrscheinlich durch den Klatsch in dem ihr gehörenden Hause. Mit taktvoller Kühnheit, in die sich sogar Freundschaft zu drängen schien, erzählte Helene von ihrem Manne, von jenem schrecklichen Tode in einem Gasthofe, dem Hotel du Var in der Rue Richelieu.
»Und Sie waren eben angekommen, nicht wahr? Waren noch niemals vorher in Paris gewesen? Das muß fürchterlich sein, solcher Trauerfall bei unbekannten Leuten. Am Morgen nach einer langen Reise, und wenn man noch nicht einmal weiß, wohin man den Fuß zu setzen hat...«
Helene wiegte leise den Kopf, sie hatte schreckliche Stunden durchlebt. Die Krankheit, welche ihren Mann hinraffen sollte, war ganz plötzlich zum Ausbruch gekommen, am Morgen nach ihrer Ankunft, grade als sie zusammen hatten ausgehen wollen. Sie kannte keine Straße, wußte nicht einmal, in welchem Stadtviertel sie sich befand. Und acht Tage lang war sie mit dem todkranken Manne eingesperrt geblieben. Während sie ganz Paris unter ihrem Fenster hatte toben hören, war sie auf sich allein angewiesen, verlassen, einsam. Als sie zum ersten Male wieder den Fuß auf den Bürgersteig gesetzt, war sie Witwe. Der Gedanke an jenes große kahle, mit Arzneiflaschen gefüllte Zimmer, in dem noch nicht einmal die Koffer ausgepackt waren, verursachte ihr jetzt noch Schauder.
»Ihr Gemahl, hat man mir gesagt, war etwa doppelt so alt wie Sie?« fragte Frau Deberle mit dem Ausdruck tiefer Anteilnahme, während Fräulein Aurélie die Ohren spitzte, um kein Wort zu verlieren.
»Oh, nicht doch,« antwortete Helene, »er war kaum sechs Jahre älter als ich.«
Und dann verlor sich Helene in die Erzählung ihres Ehelebens. Sie sprach von der tiefen Liebe, welche ihr Mann für sie gefühlt, als sie noch bei ihrem Vater, dem Hutmacher Mouret, in der Rue des Petites in Marseille wohnte. Sie verschwieg nicht den hartnäckigen Widerstand der Familie Grandjean, einer reichen Zuckersiederfamilie, welcher die Armut des Mädchens ein Dorn im Auge war. Helene berichtete auch von der stillen und heimlichen Hochzeit, von ihrem eingeschränkten, kümmerlichen Leben, das sich erst besserte, als ein Oheim starb, der ihnen zehntausend Franken Rente verschrieben hatte. Damals hatte Grandjean, dem Marseille verleidet war, den Entschluß gefaßt, nach Paris zu gehen.
»Wie alt waren Sie denn, als Sie heirateten?« fragte Frau Deberle.
»Siebzehn.«
»Sie müssen sehr schön gewesen sein.«
Die Unterhaltung stockte. Helene schien gar nicht hingehört zu haben.
»Frau Manguelin,« meldete der Diener.
Eine junge Frau erschien, behutsam und verlegen. Frau Deberle erhob sich kaum. Es war eine der unter ihrem besonderen Schutze stehenden Personen, die sich für irgend etwas bedanken wollte. Sie blieb nur wenige Minuten und zog sich mit einer Verbeugung zurück.
Nun begann Frau Deberle die Unterhaltung von neuem. Sie kam auf den Abbé Jouve zu sprechen, den beide kannten. Er gehörte zur niederen Geistlichkeit von Notre-Dame-de-Grâce, der Pfarre von Passy. Seine Mildtätigkeit machte ihn zum beliebtesten und gern gehörten Priester des Stadtviertels.
»Er ist sehr freundlich zu uns gewesen,« sagte Helene. »Mein Mann hatte schon in Marseille seine Bekanntschaft gemacht. Sobald ihm mein Unglück zu Ohren gekommen war, hat er keine Mühe gescheut. Ihm hab ich zu danken, daß ich in Passy Unterkommen gefunden habe.«
»Hat er nicht einen Bruder?« fragte Juliette.
»Ja, seine Mutter hatte sich zum zweitenmal verheiratet. Herr Rambaud war ebenfalls ein Bekannter meines Mannes. Er hat in der Rue de Rambuteau ein großes Delikatessen- und Südfrüchtegeschäft. Er verdient, glaube ich, viel Geld.«
Dann setzte sie munter hinzu:
»Der Abbé und sein Bruder bilden meinen einzigen Hofstaat.«
Jeanne, die sich auf ihrem Stuhlrande langweilte, schaute ungeduldig zur Mutter auf. Ihr feines Gesichtchen drückte Schmerz aus, als ob ihr alles leid täte, was hier gesprochen wurde.
Frau Deberle merkte das Unbehagen des Kindes.
»Ei! Ein kleines Fräulein, dem es langweilig ist, verständig dazusitzen wie eine große Dame. Da sind Bilderbücher, mein Kind – auf dem Schränkchen da!«
Jeanne holte sich ein Album, aber ihre Blicke glitten flehend über das Buch zur Mutter. Helene, umstrickt vom Wohlbehagen, in dessen Mitte sie weilte, rührte sich nicht; sie war bei Besuchen hartnäckig und blieb gern stundenlang sitzen. Als der Diener aber jetzt nacheinander drei Damen meldete, Frau Berthier, Frau de Guiraud und Frau Levasseur, glaubte sie aufbrechen zu sollen.
»Aber, bitte, bleiben Sie doch – ich muß Ihnen doch meinen Jungen zeigen,« rief Frau Deberle lebhaft.
Der Kreis vorm Kamin erweiterte sich. Alle Damen sprachen auf einmal. Eine war darunter, die sagte, sie sei wie gerädert, und erzählte, daß sie seit fünf Tagen nicht vor vier Uhr morgens ins Bett gekommen sei. Eine andere beklagte sich bitter über die Ammen; man fände keine einzige anständige Frauensperson mehr unter ihnen. Dann kam die Unterhaltung auf die Näherinnen. Frau Deberle stellte die Behauptung auf, daß keine Frau ordentliche Damenkleider machen könne, dazu müsse man einen Mann nehmen. Zwei Damen tuschelten halblaut, und als Stille eintrat, hörte man drei, vier Worte: alle begannen zu lachen und fächelten sich mit den Fächern Kühlung zu.
»Herr Malignon,« meldete der Diener.
Ein langer junger Mensch trat ein, der sehr gewählte Kleidung trug. Er wurde erfreut begrüßt. Frau Deberle streckte ihm, ohne aufzustehen, die Hand entgegen:
»Nun! Gestern im Vaudeville?«
»Abscheulich!«
»Wie, abscheulich!... Sie ist wunderbar, wenn sie sich in ihr Korsett sticht und den Kopf zurückwirft.«
»Hören Sie auf! ... Dieser Realismus ist scheußlich!«
Die Diskussion begann. Realismus wäre sehr schnell gesagt. Aber der junge Mann wollte von Realismus gar nichts hören.