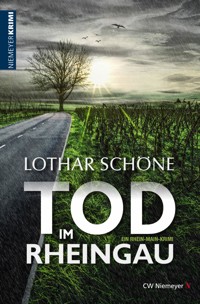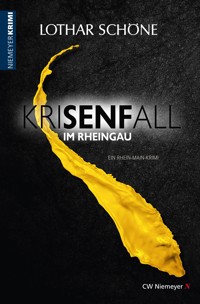7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der 2. Fall für Frau Wunder und Herrn Spyridakis Ein Mann wird tot aufgefunden – kurioserweise sitzt er an einen Grabstein gelehnt auf dem Friedhof. Ist er dort mit einem letzten Gebet auf den Lippen gestorben? Oder handelt es sich um einen perfiden Mord? Das Wiesbadener Kommissar-Duo Julia Wunder und Vlassopolous Spyridakis ermittelt. Die Geschichte spielt im Bankenmilieu, und Julia und Vlassi müssen auch Spuren nach Mainz verfolgen, wo sie wieder mal auf den Kollegen Ernst Lustig stoßen, der den Fall zu durchschauen vorgibt. Die Kommissare aus den rivalisierenden Städten raufen sich zusammen und entdecken bald, in welchem Sumpf der Tote wandelte – doch mit Witz und Humor klären sie den Fall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Titelseite
Impressum
Über den Autoren
1 Ich hasse Lügen
2 Eine Portion Lebensfreude
3 Manche Leute haben’s eilig
4 Natürlich dürfen Sie fragen
5 Mit spitzen Fingern
6 Nach Intimitäten frag ich am liebsten
7 Trau, schau, wem
8 Arsen und Banken-Knoblauch
9 Der sinkende Knecht
10 Abstieg eines Geldhauses
11 Grössere Dimensionen
12 Ein Treffen im Sam
13 Der artistische Vlassi
14 Sie merkelisieren!
15 Ich brauch mei Drobbe
16 Fall halb gelöst
17 Julia mit sechstem Sinn
18 Ein schrecklicher Vorfall
19 Führt Angst zum Tod?
20 Lesbische Kriminalität
21 Die grünen Wiedergänger
22 Mir liegt sehr an Ihrem Tod
23 Banken mögen’s giftig
24 Fehlt ein Pfund Fleisch im Körper?
25 Ein kriminalistisches Wunder
26 Schabbat Schalom in Schierstein
27 Sie machen mir Spass!
28 Was sind schon 95 Millionen?
29 Lassen Sie sich überraschen
30 Der Mann hat Humor
31 Autoren morden gern
Lothar Schöne
Ein Grab im Rheingau
Ein Rhein-Main-Krimi
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de
© 2017 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hameln
www.niemeyer-buch.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Carsten Riethmüller
Der Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.com
eISBN 978-3-8271-8332-3
EPub Produktion durch ANSENSO Publishing
www.ansensopublishing.de
Lothar Schöne, geb. in Herrnhut, arbeitete als Journalist, Hochschullehrer, Drehbuchautor und veröffentlichte Romane, Erzählungen und Sachbücher. Er erhielt eine Reihe von Preisen und Auszeichnungen, unter anderem das Villa-Massimo-Stipendium in Rom, den Stadtschreiber-Preis von Klagenfurt/Österreich und den von Erfurt, den Literaturpreis der Stadt Offenbach a.M., zuletzt 2015 den Kulturpreis des Rheingau-Taunus-Kreises. Sein Roman „Der blaue Geschmack der Welt“ wurde von den Lesern der Tageszeitung „Die Welt“ zum „Buch des Jahres“ gekürt, der Roman „Das jüdische Begräbnis“ in sechs Sprachen übersetzt. Derzeit wird die Verfilmung vorbereitet.
Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.
All denen, die es noch nicht wussten.
All denen, die es wissen wollen.
1 ICH HASSE LÜGEN
Der Raum war kahl. Nur ein Stuhl stand darin. Auf ihm saß ein Mann mit verbundenen Augen. Er saß so still, dass man auf den Gedanken kommen konnte, er sei tot. Vielleicht war es eine Puppe, die auf dem Stuhl drapiert war? Dazu passte allerdings nicht, dass die Füße der Puppe an den Stuhl gebunden waren. Und sah man hinter den Stuhl, erkannte man, dass die Hände ebenfalls gefesselt waren. Eine Puppe war das nicht, sondern ein Mensch, der noch lebte und eben versuchte, seine Hände auf der Rückseite des Stuhls freizubekommen.
Die Tür öffnete sich, und eine Person trat ein. Sie kam so leise in den Raum, dass es kaum zu hören war. Es war eine Frau. Sie trug Hosen, eine Jacke, Sportschuhe an den Füßen und Latexhandschuhe an den Händen und hielt einen Stuhl in der Hand, den sie seitlich vom Gefesselten absetzte. Das machte ein Geräusch. Der Mann auf dem Stuhl hielt sofort seine Hände hinter dem Rücken still, die gerade noch die Fesselung lösen wollten.
„Wie schön wäre es, seine Hände benutzen zu können“, sagte die Dame.
„Wer sind Sie?“ fragte der Gefesselte.
„Ach ja, wer bin ich? Das wüsste ich manchmal gern selbst.“ Die Hinzugekommene machte eine Pause und schien zu überlegen.
„Es tut mir leid, aber ich komme nicht drauf “, erwiderte sie schließlich und das klang fast so, als würde sie die Wahrheit sagen.
„Was soll das Ganze? Was für ein Spiel spielen Sie mit mir?“, fragte der Gefesselte. Er wollte zornig klingen, wirkte aber wie ein schlechter Schauspieler, also gar nicht überzeugend.
„Ein Spiel? Sie täuschen sich. Wir spielen keine Spiele.“
Die Frau, die nicht mehr jung war, aber auch nicht alt, und recht attraktiv wirkte, setzte sich auf den mitgebrachten Stuhl und schlug die Beine übereinander.
„Was wollen Sie von mir?“, fragte der Gefesselte.
„Es war nicht einfach, an Sie heranzukommen. Gerade so, als hätten Sie eine Ahnung gehabt, dass wir Ihnen auf der Spur sind.“
„Wollen Sie mich erpressen? Wollen Sie Geld?“
Die Dame beugte sich etwas vor und teilte vertraulich mit: „Nicht doch. Aber interessant ist, dass Sie sofort an Geld denken. Ist das eine Berufskrankheit, eine deformation professionelle, wie Sie als Gebildeter sagen würden?“
„Was soll das? Geben Sie mir eine klare Antwort. Wie viel wollen Sie?“
„Schade“, sagte die Frau und erhob sich lautlos, „ich habe Sie für klüger gehalten, aber Sie scheinen wirklich nur an Geld zu denken.“
Der Gefesselte schwieg für einige Augenblicke.
„Es gibt sonst nichts, was ich Ihnen bieten könnte“, sagte er dann und fragte vorsichtig: „Kommen Sie aus Frankfurt?“
„Könnte sein, könnte auch nicht sein. Und wir wollen doch nicht so bescheiden sein. Es gibt viel mehr, mit dem Sie uns dienen können.“
„Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden.“
„Aber Sie wissen noch, was Sie beruflich machen?“, fragte die Frau mit ironischem Unterton, „das haben Sie bestimmt nicht vergessen.“
„Sie kommen aus Frankfurt!“
Die Frau überging seinen Einwand: „Erzählen Sie mir etwas über den Harvest-Swap.“
Die Antwort kam schnell, vielleicht etwas zu schnell: „Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden.“
Die Dame sah ihn verärgert an. Ihre Reaktion erfolgte rasch. Sie griff unter ihre Jacke, zog eine kleine Pistole mit aufgesetztem Schalldämpfer hervor, entsicherte sie und schoss dem Mann seitlich ins rechte Knie. Ein dumpfes Geräusch ertönte, der Gefesselte schrie vor Schmerz auf. Er warf den Kopf nach hinten, sein Bein zuckte, und beinahe wäre er mit dem Stuhl umgekippt. Die Dame ging zwei Schritte vom Angeschossenen weg.
„Falsche Antwort“, sagte sie trocken, „ich hasse dumme Lügen.“
Der Gefesselte stöhnte, sein Bein wirkte nun tatsächlich wie das einer Puppe, es hing leblos an ihm.
„Das Knie ist ein empfindliches Organ, wenn man es beschädigt, kann es sehr schmerzen“, erklärte die Frau, als wolle sie medizinisch aufklären.
„Was tun Sie? Ich bin unschuldig“, ächzte der Angeschossene.
„Unschuldig?“
Die Stimme der Frau klang sehr ironisch. Sie hatte die Pistole weggesteckt.
„Was glauben Sie, wie vielen Leuten Sie Schmerzen bereitet haben?“, fragte sie.
„Aber es kam doch alles von Ihnen, aus Frankfurt“, stöhnte der Gefesselte.
„Neuerdings scheinen Sie nachzudenken, bevor Sie antworten. Dazu möchte ich Sie beglückwünschen. Wenn Sie noch einmal dreist lügen, wird es schlimmer für Sie“, sagte die Dame.
Aus dem Verletzten brach es hervor: „Was wollen Sie denn? Ich bin nur ein kleines Rädchen, Sie haben den Falschen erwischt!“
Ihm war offenbar klar geworden, dass die weibliche Stimme es blutig ernst meinte, vielleicht ahnte er auch, warum.
„Tun Sie nicht so, als ob Sie verhandeln könnten“, erwiderte die Frau scharf, „und machen Sie sich keine Gedanken darüber, ob wir den Richtigen erwischt haben. Auch Zwerge haben klein angefangen.“
Sie ging zwei lautlose Schritte auf den Gefesselten zu: „Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Sie lautete: Wie vielen Leuten haben Sie Schmerzen bereitet?“
„Ich ... weiß es nicht.“
„Sie wissen es nicht? Geben Sie sich etwas Mühe.“
Die Stimme der Fragestellerin klang beruhigend, doch was sie tat war beunruhigend. Sie zog nämlich ihre Latexhandschuhe straff, griff mit der rechten Hand nach dem angeschossenen Knie und verdrehte es zur Seite. Der Gefesselte stöhnte auf vor Schmerz.
„Schmerz ist etwas Furchtbares, nicht wahr?“
Von dem Angeschossenen kam ein wimmerndes Stöhnen.
„Ich warte auf Ihre Antwort. Wie vielen Leuten haben Sie Schmerzen zugefügt?“
„Ich weiß nicht ... vielleicht waren es ... einige. Aber ich glaube nicht ...“ Der Gefesselte stockte.
„Vielleicht? Einige? Sie glauben? Mir scheint, Sie neigen zur Untertreibung, Herr Kremer.“
„Sie kennen meinen Namen?“
„Ja, natürlich. Denken Sie, wir arbeiten ins Blaue hinein?“
Die Unbekannte machte eine Pause, dann sagte sie ohne jede Emotion: „Sie haben sehr viele Menschen betrogen und etliche in den Ruin getrieben. Ist Ihnen bewusst, wie schmerzhaft das ist?“
„Aber was wollen Sie?“, stöhnte der Verletzte, „ich kann doch nichts für meinen Beruf ...“
„Manche Kunden haben Sie gewarnt, andere nicht. Ganz nach Ihrem Gusto. Mir scheint, Sie wollten Gott spielen.“
„Ich bin unschuldig, ganz unschuldig, das muss man mir doch glauben ...“
„Überlegen Sie sich jedes weitere Wort gut“, unterbrach ihn die Frau vor ihm, „und denken Sie dabei an Ihr Knie. Ich rate Ihnen, nicht weiter zu lügen.“
Seltsamerweise wirkte ihre Stimme nicht unsympathisch.
„Wir haben Swaps und Fonds verkauft sowie auch andere Finanzprodukte“, erwiderte der Mann auf dem Stuhl unverzüglich.
Die weibliche Stimme entgegnete: „Kluge Menschen sagen, Sie haben aus Brot lediglich Steine gemacht und aus Lebensmitteln ausschließlich Dreck. Mit Ihren Lebensmittel-Fonds hat die Bank Millionen verdient, während Kinder in Indonesien und Afrika gestorben sind, weil Reis oder Mais zu teuer wurden.“
Der Verletzte stöhnte auf und war sich auf einmal sicher: „Sie kommen von der Zentrale, Sie wollen den Kulturwandel – aber Sie kommen zu spät. Das waren doch alles Ihre Ideen. Wir sollten Geld verdienen, die Effektiv-Rendite musste gesteigert werden.“
Die Dame machte zwei lautlose Schritte, als sie sprach, klang ihre Stimme spöttisch: „Geld verdienen ist das Wichtigste für Leute Ihres Schlags, ich weiß.“
„Wir haben diese Produkte verkauft“, bestätigte der Gefesselte, „und wir haben Geld verdient. Die Rendite ist auf nahezu fünfundzwanzig Prozent gestiegen.“
„Sie verkaufen Sie nach wie vor. Ihr oberster Chef ist stolz auf Sie.“
Der gefesselte Herr Kremer nickte und fügte unsicher an: „Dann ist doch ... alles in Ordnung.“
„Überhaupt nicht. Sie sagen mir nichts Neues.“
„Aber was soll ich Ihnen Neues sagen?“
„Sie haben Kunden gewarnt, davon haben Sie nicht gesprochen. Warum?“
Der Kopf des Gefesselten sank auf die Brust. Dachte er nach oder beabsichtigte er zu schweigen? Die Frau in den Sportschuhen ging zu ihm, legte ihre Hand auf sein angeschossenes Knie und verdrehte es. Herr Kremer schrie vor Schmerz auf.
„Ich warte“, sagte die Dame und strich ihre Latexhandschuhe glatt.
Unverzüglich antwortete er: „Es waren gute Kunden.“
„Zahlungskräftige meinen Sie.“
Herr Kremer nickte.
„Sie haben sich keine Gedanken darüber gemacht, dass Ihre guten Kunden andere warnen und das Geschäft verderben könnten?“
„Aber ... über Geld redet man doch nicht.“
Die Dame schwieg einen Moment, dann stellte sie eine andere Frage: „Wer hat die Swaps erfunden? Wer die Lebensmittelfonds?“
Der Angeschossene versuchte, sein rechtes Bein in eine Stellung zu bringen, die weniger schmerzhaft war. Leise begann er zu sprechen: „Das müssen Sie in Frankfurt doch besser wissen.“
„Ich möchte es aus Ihrem Mund hören“, sagte die Frau ruhig.
„Der Sachverhalt ist sehr komplex“, begann der Mann auf dem Stuhl, „und nicht einer Seite zuzuweisen, da die Entwicklung gemeinsam zwischen mehreren Fachabteilungen erfolgte ...“
Er kam nicht weiter, denn er hörte ein verdächtiges Geräusch und die verärgerte Stimme der Frau: „Keine Vorlesung!“
Die Unbekannte hatte ihre kleine Pistole hervorgezogen. Ein dumpfer Knall ertönte. Diesmal ging der Schuss in das linke Knie des Gefesselten. Der schrie auf und warf vor Schmerz den Kopf nach hinten.
Die Frau machte ein paar Schritte im Raum, sie wollte dem Gefesselten offenbar Gelegenheit geben, wieder zu sich zu kommen.
„Wissen Sie, was wir wollen?“, fragte sie nach einer Weile. Sie erwartete keine Antwort auf ihre rhetorische Frage, sondern fuhr fort: „Wir wollen Sie nicht umbringen. Wir wollen lediglich, dass der aufrechte Gang für Sie nicht mehr möglich ist.“
Ein Stöhnen war die Antwort.
Die Dame fuhr fort: „Der aufrechte Gang passt nicht zu Ihnen. Aber bei Verstockten kann man den Schmerz auch steigern.“
Mit schnellem Schritt ging sie zum Gefesselten auf dem Stuhl und verdrehte sein linkes angeschossenes Knie. Der Sitzende jaulte auf.
„Wenn Sie mir noch einmal eine vorgestanzte Antwort aus der Marketing-Abteilung Ihrer Bank geben, werde ich gegen Ihr Knie treten“, erklärte die Dame sachlich.
Herr Kremer gab nur ein Stöhnen von sich.
Die unbekannte Frau sah auf ihn hinab: „Schwallen Sie mich nicht mit fachmännischem Kauderwelsch zu. Werden Sie konkret. Wer sind die Urheber der toxischen Finanzprodukte?“
Der Mann auf dem Stuhl zwang sich zum Nachdenken, obwohl ihm der Schmerz fast die Besinnung raubte. Wenn er die Namen nannte, wussten sie, dass er wusste. Das konnte gefährlich für ihn sein. Wenn er aber nichts sagte, konnte es genauso gefährlich werden. Stockend kam es aus ihm hervor: „Die Abteilungen CTS und PBC ... haben die Swaps entwickelt.“
Die Frau legte ihre durch die Latexhandschuhe geschützte Hand auf sein Knie und sagte höflich: „Bitte keine Abkürzungen. Sonst tut es weh.“
Herr Kremer winselte: „Ich kenne sie nur mit den Kürzeln.“
Der Griff der Frau um sein Knie wurde härter. Der Angeschossene schrie auf.
„Wiehn“, ächzte er, „Hofmann.“
„Vornamen!“
„Birgit Wiehn, Jan Hofmann.“
„Na also, es geht doch. Wenn Sie sich Mühe geben, geht es“, sagte die Dame mit freundlicher Stimme.
Auf leisen Sohlen ging sie zur Tür. Dort drehte sie sich um und bemerkte wie nebenbei: „Ach übrigens, ich habe Sie vorhin angelogen. So wie Sie das mit vielen Ihrer Kunden auch getan haben.“
2 EINE PORTION LEBENSFREUDE
„Also, es klappt bei dir, du kommst morgen mit?“
Wolfgang Hillberger stand an der offenen Haustür und sah seiner Tochter fragend nach, die schon zwei Schritte nach draußen gegangen war und gerade ihren dunkelblauen Bogarthut aufsetzte.
„Wenn ich’s doch gesagt habe“, drehte sie sich um, „natürlich komm ich mit. Ich lass mir doch keinen Shakespeare entgehen. Noch dazu mit dir.“
„Das hast du schon öfter behauptet und bist dann doch irgendeiner banalen Leiche nachgestiegen. Wir dagegen schauen uns Kunstleichen von höchster Qualität an! Die Bühne hat da ganz andere Mittel“, erklärte Vater Hillberger im Brustton der Überzeugung.
„Du wärest überrascht, mit welchen Mitteln uns die Realität überrascht“, erwiderte Hauptkommissarin Wunder.
„Ach, was! Ist doch immer dasselbe!“, rief ihr putzmunterer Vater aus, „eine Kugel im Arsch und eine in der Brust. Da fehlt doch völlig die Raffinesse. Bei Shakespeare geht’s hinterlistig zu, es wird gemetzelt, da werden Söhne geköpft, Widersachern die Hände abgehackt, bei Titus Andronicus wird eine Festtafel zur Schlachtbank, von 25 Personen sind am Ende 14 tot. Da ist was los auf der Bühne!“
Julia sah ihren Vater streng an: „Wenn ich nicht wüsste, dass du sprichst, würde ich glauben, ein Action-Fan redet über den letzten Film von Quentin Tarantino.“
„Kenn ich, diesen Quentin, das wäre ein Mann nach Shakespeares Geschmack. Nur ist Shakespeare eben besser“, erwiderte Wolfgang Hillberger, der ehemalige Oberstudienrat für Englisch und Deutsch, und fuhr besänftigend fort: „Aber morgen brauchst du keine Angst zu haben, Töchterlein. Wir sehen ,Der Widerspenstigen Zähmung‘. Du kennst das Stück doch?“
Julia Wunder kam einen Schritt näher zu ihm: „So ungefähr.“
Ihr Vater zog eine Schnute, dann sagte er: „Es sollte in unseren Zeiten viel öfter gespielt werden, auch für Fälle wie dich.“
Seine Tochter lächelte ihn an.
„Ein Vater ist mit zwei Töchtern gesegnet“, erklärte er, „aber eine davon ist ein Problemfall. Ihrem Musiklehrer schlägt sie die Laute über den Schädel, und überhaupt tyrannisiert sie am liebsten die Männer. Im Gegensatz zu den meisten Feministinnen ist sie aber schön anzusehen, weshalb sie doch einen Verehrer findet. Und der bringt sie mit rauen Methoden zur Vernunft, er zerreißt schon mal ihre Kleider und lässt sie hungern. Kurzum: Ein scheinbar lieber Kerl entpuppt sich als Macho und demonstriert, wie man Problemfrauen behandelt.“
„Siehst du da Ähnlichkeiten zu mir?“
„Ja“, antwortete er ernst, „unbedingt!“ Er machte eine Kunstpause und grinste verschmitzt: „Du bist auch schön anzusehen.“
„Gute Antwort, Papa,“ sagte sie, „da hast du gerade noch mal die Kurve gekriegt.“
Er grinste sie an, und Julia gab ihrem Vater einen Kuss auf die Wange. Wolfgang Hillberger verbeugte sich galant, und seine Tochter machte sich auf den Weg zur Straße.
„Es gibt doch ein Happy End bei ,Der Widerspenstigen Zähmung?‘“, fragte sie beim Gehen ohne sich umzudrehen.
„Natürlich“, brummte der Vater ihr hinterher, „Shakespeare weiß, was wir erwarten.“
Julia drehte sich um: „Genau das ist der Unterschied zu meiner Arbeit: kein Happy End.“
„Leider, leider,“ brummelte der Papa ihr hinterher.
Als sie im Auto saß und von Eltville die Rheinuferstraße in Richtung Wiesbaden fuhr, sann sie eine Weile über ihren Vater nach. Er war auf wundersame Weise aufgeblüht, von der vermeintlichen Demenz war nichts mehr zu spüren. Und vermutlich lag das nicht an den Medikamenten, die er nach wie vor einnehmen musste. Aber der Umgang mit seiner Nachbarin hatte wie eine Verjüngungskur gewirkt und ihm eine Portion Lebensfreude geschenkt. Und das, obwohl er sie zu Beginn im Verdacht hatte, ihm Gift in die Gesundheitstees zu streuen. Inzwischen ging er mit Frau Becker sogar ins Theater und führte sie wie nebenbei in Shakespeares Welt ein. Morgen ging das allerdings nicht, sie war auf Verwandtenbesuch in Hannover – deshalb griff er auf seine Tochter zurück. Doch als Notnagel kam sich Julia überhaupt nicht vor. Sie liebte die Theaterbesuche mit ihm nach wie vor – leider waren sie selten geworden.
Das Handy der Hauptkommissarin gab einen Pfeifton von sich. Sie fuhr in eine Ausbuchtung der Rheinuferstraße in Walluf und zog das Gerät aus der Tasche, sie hatte vergessen, sich ihr Headset überzuziehen. Am anderen Ende vernahm sie Robert Feuer. So wie er Anklopfen im Präsidium für überflüssig erachtete, so meldete er sich auch nicht mit seinem Namen beim Telefonieren.
„Wo stecken Sie denn, Frau Wunder?“, hörte sie seine ungeduldige Stimme, „Sie müssen sofort ins Präsidium kommen. Hier wartet ein abstruser Fall auf Sie.“
Julia kam nicht zum Antworten, denn Kriminalrat Feuer hatte abrupt aufgelegt. Wahrscheinlich hoffte er, auf die Weise ihre Fahrt ins Büro zu beschleunigen.
*
Kommissar Vlassopoulos Spyridakis, von seinen Freunden nur Vlassi genannt, stand vor seiner Lieblingsdöner-Bude in der Dreililiengasse in Wiesbaden und richtete seinen Blick nach oben zu den Wolken. Es war Freitagnachmittag, und es hatte aufgehört zu regnen. Gute Vorzeichen für das Wochenende und die richtige Zeit für einen Imbiss, eine Portion Lahmacun hatte er sich verdient. Bei der Gelegenheit konnte auch ruhig die Sonne herauskommen, um den Tag auszuleuchten. Adil schob ihm den Teller zu: „Ein Päuschen, Commissario? So was ist ganz wichtig für den inneren Ausgleich.“
Vlassi nickte. Sein türkischer Freund hatte öfter philosophische Anwandlungen – aber hatte er nicht recht mit seiner Rede? Im Grunde machte man sich kaputt, wenn man vierundzwanzig Stunden am Tag Verbrechern nachjagte. Da drohte bei einer Festnahme nur der Schlaganfall, und vorher verirrte sich eine Kugel in die empfindlichen Weichteile des Commissario. Beides galt es zu vermeiden. Eine ausführliche Pause, einen Bissen im Mund, das gutmütige Gesicht Adils vor Augen – und schon sah die Welt freundlich aus.
„Was gibt es Neues von der Gangster-Front?“, fragte der Döner-Chef.
„Allerhand. Haben Sie nicht in der Zeitung gelesen, dass wir einen Drogenring ausgehoben haben?“
Adil machte große Augen: „Tatsächlich? Das ist mir entgangen.“
„Den ,Wiesbadener Kurier‘ müssen Sie lesen, da sind Sie auf dem neuesten Stand. Zur Not tut’s auch das Internet.“
Vlassi führte den ersten Happen zum Mund, kaute selig auf ihm herum und orderte mit vollem Mund eine Cola, als sein Handy Samba spielte. Er hatte sich diesen Klingelton gewählt, weil ihm die Vorstellung gefiel, an der Copacabana in Rio de Janeiro Verbrecher zu jagen. Adil horchte mit einer Cola-Flasche in der Hand auf.
„Anruf aus Brasilien?“, fragte er grinsend.
„Unsereins wird überall gebraucht“, antwortete Vlassi.
Er führte das Handy ans Ohr und hörte die Stimme seiner Chefin: „Herr Spyridakis, kommen Sie sofort zum Südfriedhof, wir haben da eine Leiche.“
„Auf dem Friedhof? Das halte ich für normal, dort versammeln sie sich immer“, entgegnete er, aber Julia Wunder hatte schon aufgelegt.
Adil stellte ihm die Cola-Flasche auf den Tisch. Vlassi trank einen langen Schluck und schnitt sich seelenruhig ein weiteres Stück vom Lahmacun ab. Adil schaute ihn neugierig an.
„Immer diese Leichen“, murrte der junge Kommissar.
„Sogar in Brasilien geben sie keine Ruhe, was!“
„Sie klopfen aus dem Jenseits an und wollen auf dem Friedhof noch gehört werden“, nickte ihm Vlassi zu, „ich verhör die Leiche natürlich, aber was soll sie sagen?“
„Ich bin tot!, sagt sie,“ erwiderte Adil ungerührt.
„Drei Worte nur, da wär’ ich schon begeistert. Aber diese Leichen, es ist immer dasselbe mit ihnen. Verstockte Zeitgenossen, die nicht den Mund aufkriegen.“
„Die Welt wäre schöner ohne Leichen“, ergänzte der Türke hinterm Tresen wie ein weiser Sufi-Lehrer.
„Recht haben Sie, Adil. Andererseits müssen Sie auch an mich denken. Was würde ich ohne Leichen machen? Ich wäre arbeitslos.“
„Sie könnten sofort bei mir anfangen, Commissario“, tröstete ihn Adil, „statt Leichen türkische Teigwaren!“
Vlassi sah ihn ernst an: „Darauf komme ich eventuell zurück.“
Kommissar Spyridakis nahm einen weiteren tiefen Schluck aus der Cola-Flasche und zog sein Portemonnaie aus der Tasche, um zu zahlen. Dazu brummelte er: „Muss zu meinem Toten. Der liegt schon auf dem Friedhof.“
„Was?“
„Der weiß eben, was sich gehört, der hat Manieren“, antwortete Vlassi und öffnete die Tür.
Adil rief ihm nach: „Soll ich den Rest vom Lahmacun einpacken?“
Doch der Kommissar winkte großmütig ab und verschwand in Richtung Langgasse.
3 MANCHE LEUTE HABEN’S EILIG
Vlassopolous Spyridakis kam von der Bierstädter Höhe. Schon von Weitem konnte er den Eingang zum Wiesbadener Südfriedhof erkennen. Er bestand aus zwei Gebäuden und einem verbindenden Mittelteil, in den ein großes Eingangstor und zwei kleinere Türen eingelassen waren. Die Gebäude glänzten hellbeige, strahlten eine gewisse Leichtigkeit aus und wirkten absolut freundlich, als wollten sie zum Probeliegen auf dem Friedhof einladen. Und da gerade die Sonne hinter zwei Wolken hervorlugte, konnte man mit etwas Fantasie glauben, in Mexiko zu sein und bei einem Highnoon ein einsames Friedhofs-Duell mit dem Knochenmann zu erleben. Jetzt müsste ich nur noch einen Sombrero aufsetzen, ging es Kommissar Spyridakis für einen Moment durch den Kopf, und die Szene wäre perfekt.
Gärtnereien hielten respektvoll Abstand vom Friedhofstor. Auf dem rechten Gebäude des Eingangs strebte ein Türmchen gen Himmel und mitten über der Einfahrt leuchtete eine große Uhr mit goldfarbenen Ziffern und Zeigern, als wolle sie auf die Vergänglichkeit allen Seins hinweisen, auch wenn es einem golden dünkt. Vor Friedhöfen empfinde ich immer eine gewisse Scheu, dachte Vlassi, wenn ich ihn betrete, fürchte ich vermutlich die Abwesenheit von Leben, diese Todesruhe, die zwischen den Grabsteinen herrscht. Auf dem Parkplatz vor dem Eingang standen einige Autos, er erkannte sofort den blauen Passat seiner Chefin und parkte neben ihm ein.
Im Innenhof schien es so ruhig, wie es auf einem Friedhof sein sollte. Aber das täuschte. Denn als Vlassi um eine Ecke herum ein paar Schritte auf dem schmalen Weg machte, wurde es höchst lebendig, von Todesruhe war nichts mehr zu spüren. Etliche Personen liefen herum, und hinter einem Grabstein entdeckte er seine Chefin, Hauptkommissarin Julia Wunder, die in ihrem hellblauen leichten Mantel und ihrem dazu passenden Damen-Bogarthut ganz reizend aussah. Aber nur keine Komplimente, dachte Vlassi, das leidet sie nicht bei der Arbeit. Er ging auf sie zu und fragte: „Mordet man jetzt schon die Toten?“
Julia wies mit dem Kopf auf ein Grab in der Nähe. Dort saß ein Mann angelehnt an den Grabstein und schaute ihnen entgegen, als wolle er gleich erstaunt fragen, wie er denn hierhergekommen sei. Vlassopolous ging neugierig näher. Auf den ersten Blick wirkte der Verblichene gar nicht übermäßig tot, machte vielmehr den Eindruck, als habe er ein Päuschen einlegen wollen und sich dafür ein Grab ausgesucht. Sein Kopf war rückseitig an den Grabstein angelehnt, und seine Arme hingen herab. Er trug einen dunkelblauen Anzug und ein weißes Hemd mit blau gestreifter Krawatte. Auf seiner Nase saß eine Brille mit filigraner Fassung, die etwas nach unten gerutscht war.
„Der Friedhofswärter hat ihn gefunden“, hörte er die Stimme seiner Chefin, „er hat die Polizei verständigt, und Kriminalrat Feuer hat mich sofort angerufen.“
„Verstehe“, kommentierte Vlassi, „eine Leiche mit Krawatte auf dem Friedhof und nicht im Sarg ist was Spezielles. Da wittert er Publicity.“
Julia Wunder nickte zustimmend und wollte gerade noch etwas erklären, als Vlassi schon weiter redete: „Vielleicht handelt es sich einfach um einen simplen Herzinfarkt, vielleicht wollte sich der Mann nach einem Grabbesuch ein bisschen ausruhen, und eh er sich versah, ereilte ihn ein Herzschlag, und er war plötzlich selber mausetot.“
Julia Wunder verzog den Mund: „Ich fürchte, Sie sind der Sache nicht ganz gewachsen.“
„Aber er guckt so fragend, vermutlich weiß er noch nicht, dass er tot ist.“
Vom Hauptgebäude schlurfte ein älterer Mann heran. Die Hauptkommissarin wandte sich dem Näherkommenden zu, während Vlassi unverdrossen in seiner Analyse fortfuhr: „Vielleicht ist es auch ein Selbstmörder und er hat sich der Einfachheit halber auf dem Friedhof umgebracht. Da ist er gleich am richtigen Ort. Bloß keine Umstände für die Hinterbliebenen.“
Der Nähergekommene war der Friedhofswärter, der bei der Polizei angerufen hatte. Ohne Aufforderung begann er zu sprechen: „Ich hab zuerst gedacht, dem Mann auf ’m Grab wär’ übel geworden, bis ich gemerkt hab, dass er tot ist. Is er doch, oder?“
Julia Wunder nickte.
„Ich hab ihn nicht angerührt“, fuhr der Friedhofswärter fort, „ich hab gleich das Präsidium angerufen.“ Er machte eine Pause und warf einen Blick auf den sitzenden Toten: „Manche Leut’ haben’s wirklich eilig, auf den Friedhof zu kommen.“
„Sie haben ihn also so gefunden, wie er jetzt dasitzt?“, fragte Julia.
Der Friedhofswärter nickte.
„Sie haben alles richtig gemacht“, erklärte sie, „die Kollegen von der Spurensicherung sind Ihnen dankbar, dass Sie den Mann nicht angefasst haben.“
Der Friedhofswärter warf einen nachdenklichen Blick auf den toten Mann im Anzug, als überlege er, ob der in ein Einzel- oder Familiengrab kommen werde. Eine wichtige Frage, die vielen aber erst nach dem Tod einfällt. Zum Glück entging Vlassi der nachdenkliche Blick des Friedhofswärters – aus Einzel- oder Familiengrab eine Theorie zu spinnen wäre ihm leichtgefallen. Der ältere Mann entfernte sich schlurfend.
Vlassi drehte sich zu seiner Chefin: „Der Mann hier auf dem Grab wirkt ganz unverletzt. Gehen wir überhaupt von Mord aus?“
Julia Wunder runzelte die Stirn. „Lieber Herr Spyridakis, Sie wollen doch nicht, dass ich an Ihnen zweifle. Vor allen Überlegungen kommt die Beobachtung. Schauen Sie sich den Toten mal genau an.“
„Ich würd’ ihm gern die Brille geraderücken ...“
Jetzt klang die Stimme Julias schon ernster: „Drängt es Sie zum Streifendienst? Sie sind hier nicht in einer Comedy.“
Kommissar Spyridakis merkte, dass er ein bisschen übertrieben hatte. Er ging in die Hocke und beugte sich vor.
„Der Anzug muss teuer gewesen sein“, stellte er fest.
„Was noch? Schweifen Sie nach unten!“, wies ihn Julia ungeduldig an.
„Hier am Knie ist ein Löchlein in der Hose.“
„Und auf der anderen Seite ist noch eines“, ergänzte Julia.
„Sie haben recht, hier ist noch eines. Was die Frage aufwirft: War dieser Mann ein schlampiger Typ, der seine Kleidung vernachlässigte?“
„Herr Spyridakis“, sagte Julia genervt, „fangen Sie mal an zu denken! Sie haben doch schon bewiesen, dass Sie dazu in der Lage sind.“
„Sie glauben doch nicht etwa, dass das Einschusslöcher sind?“
„Es kommt mir ganz so vor.“
Vlassi richtete sich auf: „Schüsse ins Knie. Kleinkalibrig. Kann man daran sterben? Diese Todesursache ist mir unbekannt.“
Julia, die vom Körperwuchs her viel Kleinere, sah ihn von oben an. „Sie müssen auch mal was Neues dazulernen.“
Sie selbst zog ihr Moleskine-Notizbüchlein hervor und notierte etwas darin.
Vlassi bemerkte es und fragte: „Benutzen Sie neuerdings auch Moleskine? Das verwenden sonst nur die Künstler ...“
„Ich weiß. Von van Gogh bis Henri Matisse, von Hermann Hesse bis Ernest Hemingway haben sich alle ihre Einfälle ins Moleskine notiert. Und jetzt auch ich“, sagte Julia.
„Ich wusste“, erwiderte Vlassi schlagfertig, „dass ich mit einer Künstlerin arbeite“, um gleich neugierig fortzufahren: „Was schreiben Sie denn da?“
„Ich mache mir eine Notiz. Welche wohl?“
Vlassi hatte keinen Schimmer, wollte aber seine Ahnungslosigkeit nicht preisgeben, er blieb stumm. Zum Glück kam in dem Moment ein Kollege von der Spurensicherung zu Frau Wunder und berichtete, dass der Tote eine Geldbörse bei sich trug, Inhalt 340 Euro und Kleingeld, zwei Kreditkarten, eine ec-Karte, Personalausweis und Führerschein. Beides ausgestellt auf den Namen Sebastian Kremer. Ein Handy habe man nicht gefunden.
Hauptkommissarin Wunder warf Vlassi einen auffordernden Blick zu, der unverzüglich die mitgeteilten Fakten in sein Notizbüchlein schrieb, das leider kein Moleskine war. Er stellte fest: „340 Euro sind noch da. Einen Raubüberfall können wir also ausschließen.“
Der Beamte der Spurensicherung nickte zustimmend, während Julia fragte: „Wie alt war der Tote eigentlich?“
Der Kollege schaute auf den Personalausweis: „Geboren am 23.9.1969, also 48.“
„Dafür sieht er aber ziemlich alt aus“, bemerkte Vlassi, „ich hätte den auf wenigstens sechzig geschätzt.“
„Der Tod lässt uns schneller altern, als uns lieb ist“, erwiderte Julia und ging in Richtung Haupttor, während ihr Bogarthut demonstrativ zu ihren Worten wippte.
4 NATÜRLICH DÜRFEN SIE FRAGEN
Der lange mit Linoleum ausgelegte Gang in der Unterwelt des Gerichtsmedizinischen Instituts roch wie immer streng nach Reinigungsmitteln. Hauptkommissarin Wunder und Kommissar Spyridakis waren auf dem Weg zur Rechtsmedizinerin Dr. Silke Hauswaldt, und während sie den Gang entlangschritten, informierte Vlassi die Chefin über seine neuesten Recherchen.
„Dieser Sebastian Kremer arbeitete bei der Germania Bank Wiesbaden, war zeitweise auch in Mainz beschäftigt. Die tauschen offenbar ihre Angestellten öfter mal aus.“
„Was hat er denn genau gemacht?“, fragte Julia.
„Er war der Chef der Effektenabteilung, also Wertpapiere ...“
„Wertpapiere?“
„Ja, ja, Aktien, Pfandbriefe, Obligationen und solche Sachen, die die Leute kaufen, wenn sie nicht wissen, was sie mit dem Geld sonst anstellen sollen.“
„Familie?“, fragte Julia.
„Eine Frau, keine Kinder.“
„Wo wohnt sie?“
„In Mainz. In der Vierzehn-Nothelfer-Straße.“
Julia musterte ihn im Gehen von der Seite.
„Die Straße heißt wirklich so“, erklärte er, „im Vorort Gonsenheim.“
„Da werden Sie den fünfzehnten Nothelfer spielen. Der Tod ihres Mannes muss ihr mitgeteilt werden. Psychologisch einfühlsam.“
Kommissar Spyridakis verzog das Gesicht: „Sie wissen doch, psychologisch bin ich nicht ganz so gut drauf.“
„Ach, das schaffen Sie schon, ich verlasse mich da ganz auf Sie.“
Julia grinste unmerklich und fragte: „Haben Sie schon die Bank angerufen?“
„Ja, der Direktor war über den Tod seines Effektenchefs entsetzt, jedenfalls hat er am Telefon so getan ...“
„Haben Sie was von Mord gesagt?“
„Kein Wort, ich hab geschwiegen wie ein Grab, man könnte sagen, wie das, auf dem Kremer saß.“
„Sehr gut, ich bin begeistert.“
Vlassi sah zweifelnd auf sie hinab, doch ihre breitkrempige Kopfbedeckung, es handelte sich um einen Reverse-Crown-Damenhut, verdeckte ihr Gesicht.
„Ich hab mich nur gewundert“, fügte er beflissen an, „dass er nichts Genaueres wissen wollte.“
„Schon mal merkwürdig“, nickte Julia, „da müssen wir persönlich hin, die unmittelbaren Reaktionen von solchen Leuten sind wichtig.“
Der listige Vlassi erkannte sofort die Möglichkeit, psychologisch was für sich zu tun: „Bei Frau Kremer ist doch auch die unmittelbare Reaktion enorm wichtig. Vier Augen sehen mehr als zwei. Sollten wir da nicht auch gemeinsam ...?“
Julia schaute zu ihm auf und bewegte ihren Hut verneinend hin und her. Dann öffnete sie eine Tür auf der linken Seite, und ein Obduktionsraum von etwa dreißig Quadratmetern wurde sichtbar. In dessen Mitte stand die hochgewachsene Dr. Silke Hauswaldt mit straff nach hinten gekämmtem und gegeltem brünettem Haar vor einem Gestell mit einer Leiche. Sie trug einen weißen Kittel und Latexhandschuhe und stellte ohne Begrüßung fest: „Einen ungewöhnlichen Toten haben Sie mir da ins Haus gebracht.“
„Wir denken halt immer auch an Sie“, bemerkte Vlassi, „diese normalen Leichen sind ja langweilig.“
Julia Wunder warf einen Blick auf den Leichnam, es war der Tote vom Friedhof, um dann Dr. Hauswaldt zu fragen: „Haben Sie schon die Todesursache feststellen können?“
„Noch nicht genau, aber ich habe einen Verdacht.“
„Schüsse ins Knie ...,“ setzte Vlassi an.
Silke Hauswaldt nahm ihm das Wort ab: „Ja, ja, die Kniescheiben sind zersplittert, Geschosse haben das bewirkt, so etwas ist schmerzhaft, aber verursacht nicht den Tod. Ich habe die Projektile herausgeholt. Sie stammen von einer kleinkalibrigen 6,35er Waffe. Der Tod ist etwa sechs bis acht Stunden vorher eingetreten.“
„Auf dem Friedhof ist der Mann also nicht gestorben?“, fragte Julia.
„Ist auszuschließen. Dann hätte ihm sein Mörder zwischen den Grabsteinen in der Nacht aufgelauert.“
„So was kann doch möglich sein“, mutmaßte Vlassopoulos, „vielleicht war das ein Nekrophiler, der sich mit anderen Nekrophilen auf dem Friedhof verlustieren wollte.“
„Der Friedhof ist nachts geschlossen“, klärte ihn seine Chefin auf und sah ihn scharf an: „Aber eine andere Überlegung könnten Sie jetzt anstellen.“
Vlassi antwortete prompt: „Wenn Herr Kremer nicht auf dem Friedhof den Tod gefunden hat, erhebt sich die Frage, wie man die Leiche dorthin gebracht hat.“
„Ausgezeichnet“, stimmte ihm Julia zu, „ich wusste doch, dass Sie denken können. Aber noch wichtiger ist eine andere Frage.“ Sie machte eine kleine Pause: „Welche?“
Man merkte ihrer Vorgehensweise an, dass sie die Tochter eines Lehrers war. Ihr Vater hatte sie in früheren Jahren mit ähnlichen Fragen traktiert, und die betrafen nicht nur Shakespeare. Als sie noch Schülerin und Studentin war, fand sie seine Fragen lästig, jetzt aber wusste sie, dass sie eine Menge von ihm gelernt hatte, gerade für ihr kriminalistisches Metier.
„Welche?“, wiederholte sie bohrend.
Vlassi schnitt ein nachdenkliches Gesicht, dann hatte er es: „Warum hat man die Leiche auf den Friedhof gebracht?“
„Sehr gut! Ich beurteile Ihre Chancen, einmal Hauptkommissar zu werden, günstig.“
Doch jetzt fiel Vlassi wieder zurück, denn er wiederholte gravitätisch: „Warum hat man die Leiche auf den Friedhof gebracht? Weil der Friedhof das natürliche Ende des menschlichen Lebens ist.“
Julia ließ den Kopf sinken: „Oh, Ihre Chancen zur Beförderung sind gerade wieder schlechter geworden. Denken Sie noch mal nach.“
Vlassi streckte sich, als würde seine körperliche Größe ihm einen Einfall bescheren, und Dr. Hauswaldt legte ihren Zeigefinger ans Kinn, sie schien ebenfalls nachzugrübeln.
Julia Wunder ließ die beiden einen langen Moment gewähren, dann teilte sie in bühnenreifem Hochdeutsch mit: „Meine Dame, mein Herr, wir haben die Leiche auf dem Friedhof gefunden, weil wir sie dort finden sollten.“
„Gerade ist mir dieser Gedanke auch durch den Kopf gegangen“, erklärte Kommissar Spyridakis eilfertig.
Julia erwiderte großmütig: „Ich wusste doch, dass ich mit Ihnen rechnen kann. Und jetzt kommt der nächste Akt: Warum sollten wir sie dort finden?“
„Warum wir sie dort finden sollten?“, wiederholte Vlassi und schnitt ein nachdenkliches Gesicht.
Aber Julia wandte sich schon an Frau Dr. Hauswaldt: „Und was ist mit Ihrem Verdacht? Was hat den Tod unserer Friedhofsleiche verursacht?“
Silke Hauswaldt hatte zu ihren Worten genickt, jetzt teilte sie mit: „Ich bin mir noch nicht sicher, muss noch einige Blut- und Gewebeuntersuchungen machen, aber soweit ich sehe, ist der Mann toxisch.“
„Toxisch?“, ließ sich Vlassi hören, als sei ihm das Wort unbekannt.
„Vergiftet also“, sagte Julia erstaunt, „warum dann zuerst die Kugeln ins Knie?“
„Das herauszufinden ist Ihre Aufgabe“, antwortete Frau Dr. Hauswaldt mit einer gewissen Erleichterung und streifte die Latexhandschuhe ab.
*
Das Haus in der Vierzehn-Nothelfer-Straße in Mainz-Gonsenheim machte einen großbürgerlichen und gediegenen Eindruck. Der fünfzehnte Nothelfer namens Vlassopoulos Spyridakis stieg eben aus seinem Dienstwagen, es handelte sich mal wieder um einen Opel Corsa und nicht den ersehnten Ferrari, den Vlassi für dringend notwendig erachtete. Er schaute sich um und stellte fest, dass er sich in einer wirklich seriösen Gegend befand. Die Häuser hielten einen gebührenden Abstand voneinander, die Gärten und Vorgärten wirkten gepflegt, auf der Straße strebten Bäume artig gen Himmel und nicht in irgendwelche andere Richtungen, und bei jedem Haus gab es eine Garageneinfahrt. Na ja, warum sollte ein Bankmensch auch in einem Abbruchviertel wohnen, gut verdient wird der Tote wohl haben. Kommissar Spyridakis ging mit zögernden Schritten auf das Haus Nr. 18 zu, er musste sich ganz und gar auf seine psychologische Aufgabe konzentrieren, einfühlsam musste er der Witwe Kremer den Tod ihres Mannes beibringen. Er ächzte leise, als er auf den Klingelknopf am Tor drückte, sicher war er nicht, dass er die Aufgabe meistern würde.
„Ja, hallo?“, ertönte eine Stimme in der Gegensprechanlage.
„Guten Tag, hier ist die Polizei, Spyridakis. Ich möchte bitte Frau Kremer sprechen.“
„Frau Kremer ist krank, sie liegt im Bett.“
Vlassi ging zuerst erleichtert durch den Kopf, dass er damit doch eigentlich von seiner Aufgabe entbunden war, er konnte sich schließlich nicht zu ihr ins Bett legen und ihr eine Geschichte von einem Toten auf dem Friedhof erzählen mit dem Nachsatz, dass dieser Tote leider ihr Mann sei. Dann aber packte ihn der Ehrgeiz, was sollte er denn seiner Chefin berichten? Doch höchstens, dass Frau Kremer selbst dem Tod nahe war, da wollte er nicht noch mithelfen – aber damit käme er bei ihr nicht durch.
„Hoffentlich nichts Ernstes“, erwiderte er mit besorgter Stimme, „es dauert bei mir auch nicht lang.“
Eine Weile war nichts zu hören, sodass Vlassi schon glaubte, die Dame am anderen Ende habe aufgehängt. Sie hatte aber nur nachgedacht und sagte jetzt: „Na, dann kommen Sie, aber fassen Sie sich bitte kurz.“
„Natürlich“, beeilte sich Vlassi zu antworten und verkniff sich die Floskel von der Polizei als Freund und Helfer.
Das Tor summte auf, und er schritt auf die Haustür zu, die sich zwei Schritte bevor er ankam öffnete. Vor ihm stand eine mittelgroße elegante Frau in einem hellgrauen Kostüm. Ihr Haar war brünett und kurz geschnitten, was sie jünger erscheinen ließ, als sie tatsächlich war. Ihr Gesicht strahlte so weiß, als hätte es noch nie einen Sonnenstrahl abbekommen, und ihre Züge wirkten nobel, ja irgendwie aristokratisch – jedenfalls stellte sich Vlassi so eine Aristokratin vor. Sie musste Anfang bis Mitte fünfzig sein, wirkte aber zehn Jahre jünger.
Kommissar Spyridakis stellte sich noch einmal mit seinem Dienstgrad vor, die Dame bat ihn herein und teilte mit, dass sie die Schwester von Frau Kremer sei, sie heiße Sabine von Rattay, mit Ypsilon am Ende und zwei t‘s in der Mitte. Vlassi nickte höflich, als habe er das schon geahnt, und wollte gerade ansetzen, auf diplomatische Art und Weise den Grund seines Besuchs zu erläutern, als ihm Frau von Rattay das Wort abnahm.
„Wir wissen es schon, Herr Spyridakis.“
„Ääh, was denn?“
„Der Gatte meiner Schwester ist tot.“
Innerlich atmete Vlassi auf, ließ sich aber nichts anmerken. Da war er ja um die Hiobsbotschaft noch mal herumgekommen. Glück muss der Mensch haben, wenn die psychologische Vorbereitung nicht zum Einsatz kommen kann.
„Eben deshalb bin ich gekommen“, erklärte er, „ich wollte es Ihrer Schwester persönlich mitteilen, das ist so üblich.“
Vlassi räusperte sich, wie er es aus Filmen von ernsthaften Kommissaren her kannte, und legte seine Hand an den Mund – das würde ihm sicher Punkte einbringen bei dieser vornehmen Frau von Rattay. Vorsichtig schob er nach: „Woher wissen Sie es denn?“
Sabine von Rattay sah ihn ernst an. „Es gibt Telefone. Man kann auch zwitschern. Wussten Sie das?“
Die meint Twitter, dachte Vlassi und lächelte süßsauer. Der Punkt ging an sie. Aber woher hatte sie so schnell diese Info?
„Darf ich fragen, wer Sie informiert hat?“
„Ja, natürlich dürfen Sie fragen“, antwortete Frau von Rattay, drehte sich um und ging nach hinten weg. Aus einiger Entfernung teilte sie mit: „Ich sage meiner Schwester Bescheid, dass Sie mit ihr sprechen wollen.“
Schon war sie in einem hinteren Gang verschwunden, und Kommissar Spyridakis stand allein in der Vorhalle. Die Frau ist nicht übel, dachte er, gar nicht übel, von der kann man als Kripomensch noch was lernen.
Kommissar Spyridakis musste eine Weile warten, bis schließlich im Gang zwei Frauen erschienen. Die eine kannte er schon, die andere sah Frau von Rattay nicht sehr ähnlich, ihr Gesicht strahlte weit weniger aristokratisch, die Nase stach spitz wie ein Messer vor, ihre Haare fielen halblang vom Kopf und besaßen Spaghetti-Format.
„Herr Spyridis“, sagte sie mit heller Stimme, „danke, dass Sie gekommen sind.“
„Spyridakis“, korrigierte Vlassi und fügte bescheiden hinzu: „Es ist meine Aufgabe, Sie zu informieren, Frau Kremer.“
„Ein Migräneanfall hat mich erwischt, Sie sehen ja, wie ich aussehe, mein Mann ist tot, ich fühle mich krank und elend, normalerweise empfange ich niemanden in diesem Zustand.“
„Ich will Sie auch gar nicht lange belästigen. Ich komme aber gern wieder, wenn Sie gestatten.“
Na, wenn das nicht die hohe Schule der Höflichkeit war, dachte er, mein letzter Satz könnte in die Fibel der Polizeiakademie eingehen, Kapitel Besuch bei Angehörigen von gerade Ermordeten.
„Natürlich können Sie wiederkommen“, antwortete prompt Frau Kremer, der Vlassis gute Manieren zu gefallen schienen, „aber um eines muss ich Sie inständig bitten!“
„Ja?“
„Finden Sie den Täter, finden Sie den Mörder meines Mannes!“
Die daneben stehende Frau von Rattay nickte zu den Worten ihrer Schwester, und Vlassi nickte ebenfalls: „Ja natürlich, wir sind schon dabei.“ Aber dann fiel ihm ein, dass er von Mord gar nichts gesagt hatte.
„Werden jetzt schon Bankangestellte wie Terroristen umgebracht?“, fragte Frau Kremer. „In welcher Gesellschaft leben wir denn?“
Sie wendete den Kopf hin und her, als könne sie immer noch nicht glauben, was ihrem Mann geschehen war. Vlassi wollte es ihr nachtun und auch sein Haupt voller Mitleid hin und her wenden, aber das kam ihm dann doch etwas zu viel an einfühlsamer Psychologie vor. Stattdessen sagte er: „Sie haben vollkommen recht, es ist unglaublich.“
Aber das war schon zu viel des Guten, denn Frau Kremer griff sich an den Kopf, als könne sie dadurch einen in ihm wütenden Schmerz in den Griff bekommen. Ihre Schwester nahm sie am Arm und führte sie in den Gang nach hinten.
„Ich gehe dann ... auch“, sagte Kommissar Spyridakis in die Leere hinein, bekam aber keine Antwort von den Damen, und so öffnete er die Haustür, ging zur Straße zurück, wo ihm am Auto einfiel: Sie hätte eigentlich fragen können, wo man ihren toten Mann gefunden hat. Nicht in einem Hinterhof, einer Spelunke oder im Bordell! Sondern auf dem Friedhof, stellen Sie sich vor! Vielleicht wusste die Witwe Kremer auch das. Meine Dame, nicht alles, was getwittert wird, entspricht auch den Tatsachen. Aber hier leider schon.
Als Vlassi hinterm Steuer saß und losfuhr, lobte er sich, einfühlsam war er gewesen, psychologisch hoch geschickt, und Einzelheiten hatte er auch nicht preisgegeben. Weshalb hätte er auch sagen sollen, dass der tote Herr Kremer toxisch war? Da hätte er ja die arme Witwe in eine noch schlimmere Migräne gestürzt.
*
Als Vlassi mit seinem Corsa in die Vierzehn-Nothelfer-Straße in Mainz einbog, um der Witwe Kremer seinen Kondolenzbesuch abzustatten, ging Julia Wunder eiligen Schrittes auf den Eingang der Germania Bank in Wiesbaden zu. Sie trug immer noch ihren blauen Reverse-Crown-Damenhut, der ihr etwas Verwegenes gab.
Das Gebäude der Germania Bank in der Wilhelmstraße war gerade renoviert worden und konnte doch nicht mit der Umgebung mithalten, zumindest architektonisch. Die gegenüberliegende Villa Clementine wirkte jedenfalls wesentlich prachtvoller, es handelte sich um einen Bau aus der Gründerzeit, der eine Atmosphäre verbreitete, als sei der deutsche Kaiser gerade erst gestern zu Besuch gewesen. Aber das war wie manches in der Stadt pure Augenwischerei. Denn die Villa Clementine beherbergte das Literaturhaus, und das ist eine völlig machtlose Institution, die höchstens mal einen Autor oder einen Zuhörer verärgert mit einer Chefin, die Literatur für Girlandenkunst hält, wenn sie überhaupt zu den Lesungen kommt. Das alles bleibt folgenlos, während es sich bei dem Geldhaus um einen machtvollen Global Player handelt, der über das Wohl und Wehe vieler Menschen entscheidet.
Hauptkommissarin Wunder öffnete die Glastür und ging zu der Dame dahinter, die für den Empfang der Kunden zuständig ist. Nach wenigen Worten von Frau Wunder war sie instruiert und eilte fort, um Bescheid zu geben. Es dauerte nur einen kleinen Moment, bis sie sich wieder blicken ließ, dann bat sie die Hauptkommissarin, ihr zu folgen. Man verließ den Kassenraum, es ging durch mehrere Türen in die hinteren Regionen der Bank, schließlich eine Treppe hinauf, bis sie vor einer Tür standen, an der die Empfangsdame klopfte. Von drinnen erscholl ein „Herein“, und Julia Wunder betrat den Raum, während die Empfangsdame zurückblieb. Hinter einem Schreibtisch erhob sich ein großer schlanker Mann mit Stirnglatze und kam auf sie zu. Er sah aus wie Mitte fünfzig, konnte aber auch jünger sein, ging es Julia durch den Kopf, und sie dachte an den Toten auf dem Friedhof. Diesen Bankmenschen sieht man ihr wahres Alter nicht an.
„Ich bin Jan Hofmann“, sagte der große schlanke Mann.
Hauptkommissarin Wunder stellte sich ebenfalls vor, der Direktor der Filiale bot ihr Platz an einem kleinen Konferenztisch an und fragte, ob sie einen Kaffee trinken wolle. Julia lehnte dankend ab.
„Ich komme wegen Herrn Kremer“, erklärte sie.
„Ja, ich habe schon von Ihrem Assistenten gehört, dass er gestorben ist, auf dem Friedhof ...“
„Auf dem Friedhof haben wir ihn gefunden“, ergänzte Julia Wunder.
„Was haben Sie damit zu tun? Ist er keines natürlichen Todes gestorben?“
„Ich fürchte nein, Herr Hofmann. Mein Kollege hat Sie offenbar nicht ganz aufgeklärt.“
Jan Hofmanns Miene verzog sich ins Mürrische: „Nein, das hat er offenbar nicht. Und Sie sind von der Mordkommission. Handelt es sich um einen ... Mord?“
Julia schnitt eine bedauernde Miene: „Wir müssen leider davon ausgehen. Es sieht so aus, als sei er das Opfer einer Gewalttat geworden. Und da müssen wir ermitteln.“
Jetzt sollte er fragen, dachte sie, wie wir seinen Angestellten Kremer gefunden haben. Als blutverschmierte Leiche, der man die Zunge herausgeschnitten hat? Oder war es ein sauberer Leichnam, dem leider die Hände gefehlt haben? Oder handelte es sich um einen Toten ohne Kopf? Was ist eigentlich das wichtigste Organ eines Bankers?
„Eine Gewalttat?“, fragte stattdessen der Direktor des Geldhauses und zog die Augenbrauen hoch. Er wirkte lediglich erstaunt, aber nicht entsetzt.
„Es sieht ganz nach Mord aus“, schob Julia nach.
Die beiden hatten nicht Platz genommen, und im Moment schien es auch ungünstig, sich zu setzen. Das würde arg nach gemütlichem Plausch aussehen. Jan Hofmann blickte Julia an, als hätte die Hauptkommissarin ihm mit ihrem letzten Satz einen unsittlichen Antrag gemacht, dann nahm seine Miene einen sachlichen Ausdruck an: „Mord! Wer sollte ihn denn ermorden?“
„Das ist genau die Frage, die wir uns auch stellen“, teilte ihm Julia Wunder genauso sachlich mit.
Julia behielt Hofmann im Blick, er schien für einen Moment irritiert – aber worüber? Es kam ihr so vor, als suche er nach Worten. Zu bedauern schien er den gewaltsamen Tod seines Mitarbeiters nicht, er fand jedenfalls kein Wort dafür.
„Was hat Herr Kremer denn genau bei Ihnen gemacht?“, fragte Hauptkommissarin Wunder.
Jan Hofmann atmete durch: „Er hat die Effektenabteilung geleitet.“
„Hat er auch Kunden beraten?“
„Ja, natürlich, er hatte seinen eigenen Kundenstamm.“
„Ist das üblich bei Ihnen? Hat jeder Ihrer Berater einen eigenen Kundenstamm?“
„Ja, wir legen Wert auf individuelle Betreuung.“
„Und Sie waren sein Vorgesetzter?“
Hofmann nickte.
„Gab es denn irgendwelche Unstimmigkeiten ...?“
Hofmann antwortete sofort: „Sie verdächtigen doch wohl nicht einen Kollegen?“
„Sie haben mich nicht ausreden lassen, Herr Hofmann. Ich meine Unstimmigkeiten zwischen Ihnen und Herrn Kremer?“
Hofmanns Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: „Überhaupt nicht.“
„Das ist ja schön“, sagte Julia mit sanfter Stimme, „da geht es ja bei Ihnen hier ganz paradiesisch zu.“
Der Direktor fühlte sich ertappt, er hörte die Ironie aus Julias Worten heraus: „Nein, das kann man natürlich nicht sagen. Auch wir hatten manchmal unterschiedliche Auffassungen, aber sehr selten.“
„Und worüber gab es diese seltenen unterschiedlichen Auffassungen?“
Jan Hofmann war hinter seinen Schreibtisch zurückgekehrt, Julia entging es nicht, und sie dachte: Der Schreibtisch als Bollwerk, vielleicht braucht er den Schutz des schweren Tisches.
„Ach, wissen Sie“, sagte Hofmann, „wir verkaufen hier Finanzprodukte, Aktien, Anleihen, Obligationen, Pfandbriefe und so weiter, da kann man schon mal unterschiedlicher Meinung sein.“
„Was die Gewinnaussichten angeht?“, fragte Julia.
„Es geht um die Zukunftserwartungen, die Zukunft wird unterschiedlich eingeschätzt, und nach diesen Einschätzungen werden Unternehmen beurteilt.“
Julia raffte sich zu einem kleinen Lacher auf: „Ich bin ein vollkommener Laie in diesen Dingen. Ich dachte, die Zukunft sei ein Buch mit sieben Sigeln. Da sehen Sie mal, wie unbedarft ich bin.“