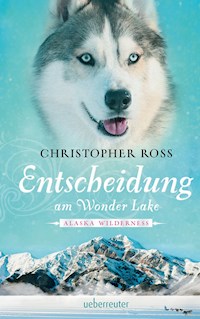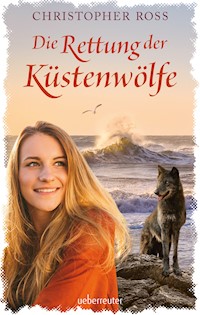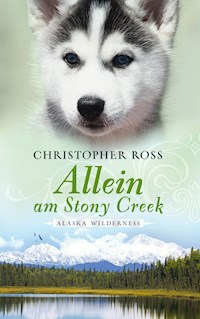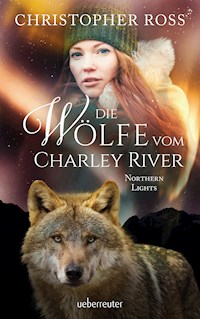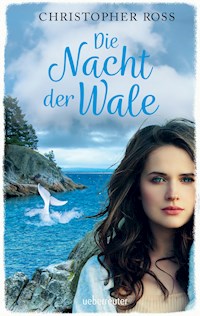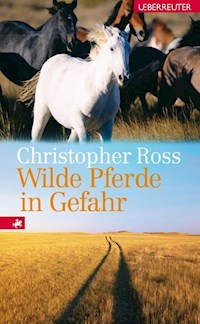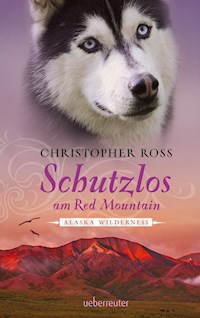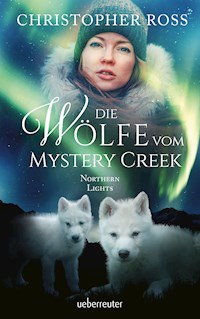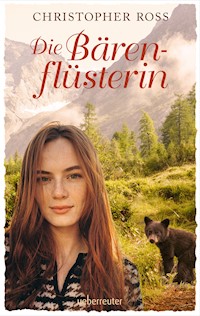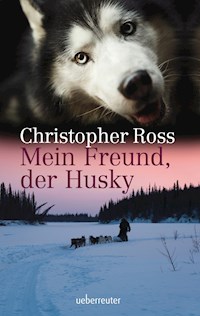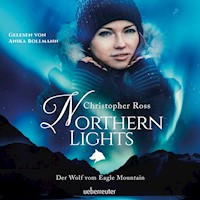5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein gefühlvolles Winter-Weihnachts-Abenteuer aus Alaska! Santa Claus wohnt am Nordpol, genauer gesagt, in North Pole, Alaska. Dort arbeitet auch Jenn, eine junge Husky-Züchterin. Sie hat sich gerade von ihrem Freund getrennt und muss mit ansehen, wie ihr Ex einen ihrer Welpen so stark tritt, dass er in Lebensgefahr schwebt. Doch damit nicht genug. Der Weihnachtsmann hat Ärger mit seiner missratenen Enkelin, ein junger Dieb will von der schiefen Bahn herunter, und Jennifer sucht in der Wildnis verzweifelt nach einem krebskranken Mädchen, von dem sie nur den Vornamen kennt. Nur gut, dass Mike aus Kalifornien etwas Sonne in ihr Leben bringt – doch auch er hütet ein Geheimnis... »Bei Ein Husky unterm Weihnachtsbaum« handelt es sich um eine Neuausgabe des 2013 bei Weltbild erschienenen Titel »Weihnachten mit Husky«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Der vorliegende Titel ist 2013 bereits unter dem Titel »Weihnachten mit Husky« bei Weltbild erschienen
ISBN 978-3-492-98370-9 © 2013 by Verlagsgruppe Weltbild GmbH © Piper Verlag GmbH, München 2017 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: solominviktor/Shutterstock und Sergey Bessudov/shutterstock und Standret/shutterstock Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Inhalt
Cover & Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nachwort
1
Jennifer Palmer gehörte zu den wenigen Auserwählten, die den Weihnachtsmann küssen durften. Jeden Mittag, wenn sie ihren Dienst begann, und jeden Abend, wenn ihre Schicht zu Ende war, hauchte sie dem alten Mann einen Kuss auf die bärtige Wange und schenkte ihm ein fröhliches Lächeln.
Der Weihnachtsmann hieß eigentlich George Langley, war im Sommer siebzig geworden und besserte seine karge Rente im Santa Claus Christmas Shop auf. Dort durften sich Kinder für fünf Dollar mit ihm fotografieren lassen. Der Weihnachtsladen war die größte Sehenswürdigkeit in North Pole, Alaska, einer kleinen Stadt südöstlich von Fairbanks, und hatte das ganze Jahr geöffnet. North Pole war nach dem Zweiten Weltkrieg von einer Immobilienfirma gegründet worden, die darauf spekulierte, dass eine Stadt, die nach dem Glauben aller amerikanischen Kinder die Heimat des Weihnachtsmanns war, zahlreiche Spielzeugfirmen anlocken würde. Ein Irrglaube, wie sich herausstellte. Geblieben war der Christmas Shop, in dem man Weihnachtsschmuck in allen Formen und Farben kaufen konnte.
»Merry Christmas«, verabschiedete Jenn sich von Erica. So grüßte sie die Inhaberin des Ladens selbst im Hochsommer. Sie war der älteren Dame mit dem bläulich gefärbten Haar unendlich dankbar für den Halbtagsjob, mit dem sie ihren Lebensunterhalt bestreiten und noch etwas Geld für ihre Huskys abzweigen konnte. Für den Rest kamen ihre wenigen Sponsoren auf, die Hundefutter-Firma Webster, die Bekleidungsfirma Swiss Fashion, dasMusher’s Magazinein Fairbanks und etliche Privatleute, die ihr Sparschwein fütterten.
Sie trat in die Kälte hinaus und zog die Kapuze ihres blauen Schneeanzugs über den Kopf. Eisiger Wind wehte ihr entgegen. Abseits der geräumten Straßen war das Land von einer dicken Schneeschicht bedeckt, und der abendliche Dunst hing so tief, dass sie den Waldrand jenseits des vierspurigen Highways nur als düstere Wand wahrnahm. Vereinzelte Schneeflocken wirbelten im Wind. Es war stockdunkel, wie immer im Winter, wenn die Sonne nur für ein paar Stunden als heller Streifen am östlichen Horizont zu sehen war. Die Lichter der zahlreichen Scheinwerfer verschmolzen mit dem Dunst.
»Ho, ho, ho«, grüßte der riesige Weihnachtsmann aus Kunststoff, der neben einem Plakat des Santa Claus Christmas Shop aus dem Schnee ragte, in einer Sprechblase die Autofahrer, darum bemüht, möglichst viele Leute in den Laden zu locken. Jenn winkte ihm zu und ging zu ihrem Wagen, einem rostigen Pick-up, der seine besten Jahre bereits hinter sich hatte, aber immer noch treu seinen Dienst verrichtete. Dazu gehörte auch der Transport der Huskys, die in dem hölzernen Aufbau auf der Ladefläche mitreisten, jeder in seinem eigenen Kasten. Der Einfachheit halber ließ sie den Aufbau auch dann auf dem Wagen, wenn sie nicht zum Training oder Rennen unterwegs war.
Obwohl Thanksgiving bereits zwei Wochen zurücklag und leuchtende Lichterketten mit roten und grünen Lämpchen über der Hauptstraße von North Pole hingen, war Jenn alles andere als weihnachtlich zumute. Der Grund für ihre bedrückte Stimmung war Kevin Turner, der junge Mann, den sie vor einem halben Jahr in dem kleinen Lokal, in dem sie am Wochenende manchmal als Bedienung aushalf, kennengelernt hatte. Er hatte sie zu einer Wanderung in den Denali National Park und nach dem ersten Schnee zum Langlaufen eingeladen, war einige Male mit ihr im Kino gewesen und hatte ihr schon nach wenigen Wochen gestanden, sich in sie verliebt zu haben. Seit er jedoch gemerkt hatte, dass sie nicht bereit war, ständig nach seiner Pfeife zu tanzen, war er beleidigt. Er wollte nicht kapieren, dass sie die meiste Zeit damit verbrachte, mit ihren Huskys für das berühmte Iditarod-Rennen zu trainieren, und zweieinhalb Jobs übernommen hatte, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Er war ein netter Kerl, solange es nach seiner Nase ging, sah blendend aus, ein Typ, nach dem sich selbst attraktive Frauen umdrehten, und der Sex mit ihm war phänomenal, aber er war leider auch ein Macho, der keinen Widerspruch duldete.
Sobald sie die Huskys gefüttert und selbst etwas gegessen hatte, wollte sie zu ihm fahren und die Beziehung beenden. Seit Thanksgiving, als er sie zu seinen Eltern geschleppt und so getan hatte, als wären sie bereits verheiratet, dachte sie darüber nach, sich von ihm zu trennen. Sie mochte keine Männer, die über sie bestimmen und ein Heimchen am Herd aus ihr machen wollten. Bisher hatte sie nur nicht den Mut aufgebracht, es ihm zu sagen. Bei einem Macho wusste man nie, wie er reagierte. Aber heute Abend würde sie mit ihm reden. Höchstpersönlich. So viel Rückgrat musste sein. Vom Schlussmachen per Handy hielt sie nichts.
Sie kniff die Augen gegen die Lichter der entgegenkommenden Fahrzeuge zusammen und überholte den Kombi eines Pizza-Dienstes. Unter den Reifen ihres Pick-ups spritzte schmutziger Schnee auf. Es hatte die ganze letzte Nacht geschneit, und die Räumfahrzeuge hatten ihre liebe Not mit den Schneemassen, auch auf dem vielbefahrenen Highway. Die Scheibenwischer bewegten sich im unregelmäßigen Takt. Als ihr Wagen an einer besonders glatten Stelle ins Schleudern kam und sie gerade noch verhindern konnte, dass sie einen Lieferwagen streifte, fiel ihr ein, dass ihr Pick-up dringend neue Reifen brauchte.
Sie fuhr auf die rechte Spur zurück und ließ sich mit dem Verkehr treiben. In der Ferne leuchteten bereits die Lichter von Fairbanks. Sie wohnte ein paar Meilen östlich der Stadt, abseits der Straße nach Chena Hot Springs in einem Blockhaus, das sie von einer wohlhabenden Hundezüchterin und ehemaligen Iditarod-Gewinnerin gemietet hatte. Noch vor der Stadt bog sie nach rechts ab und fuhr auf den Highway nach Osten, eine verlassene Straße, die nur teilweise geräumt war und sich durch einen endlos erscheinenden Fichtenwald zog. Die Scheinwerfer ihres Pick-ups geisterten über den Schnee und die Bäume, und sie musste nur einmal abblenden und bremsen, als ihr der Lieferwagen eines Paketdienstes entgegenkam und dicht an ihr vorbeifuhr.
Nachdem der Wagen an ihr vorbei war, entspannte sie sich. Sie hatte kein Glück mit Männern, sinnierte sie, schon auf der Highschool war sie mit dem falschen Jungen zum Abschlussball gegangen, und der junge Mann, den sie auf dem College kennengelernt hatte, war ein oberflächlicher Blender gewesen, der neben ihr noch zwei andere Studentinnen beglückt hatte. Nach dem College war sie kurze Zeit mit einem anderen Musher liiert gewesen, einem Naturburschen, dem sie auf dem Empfang vor dem Iditarod-Rennen begegnet war, doch als er gemerkt hatte, dass ihre Hunde schneller waren, hatte er sich schnell zurückgezogen. Und dann war Kevin in ihr Leben getreten.
Natürlich hatte sie sich auch gefragt, ob es an ihr lag. Sie war hübsch und lächelte gern, das behauptete jedenfalls Suze, ihre beste Freundin, aber kein Modepüppchen, das zwei Stunden brauchte, um sich zurechtzumachen und ständig nach der neuesten Mode gekleidet war. Das einzige Paar Highheels, das sie besaß, hatte sie beim Collegeabschlussball und zwei oder drei offiziellen Anlässen getragen, ansonsten bevorzugte sie Stiefel oder Laufschuhe. Ihre schulterlangen Haare, etwas blonder gefärbt, als es ihrer Naturfarbe entsprach, band sie meist zu einem Pferdeschwanz. Erica vom Santa Claus Christmas Shop hatte nichts dagegen, solange sie die Jeans und das Weihnachts-Sweatshirt im Dienst trug, im Gegenteil, die meisten Besucher erwarteten sogar, in Alaska von einer Frau wie ihr bedient zu werden. Und wenn sie dann noch erfuhren, dass sie im vergangenen Winter am Iditarod teilgenommen hatte und bereits für das nächste Rennen trainierte, war es ohnehin egal, wie sie gekleidet war.
Sie hatte sich nichts vorzuwerfen, bei einigen Dates hatte sie sogar einen Rock getragen, ihn beim nächsten Mal aber gleich wieder gegen Hosen ausgetauscht, weil sie sich darin einfach wohler fühlte. Ähnlich war es mit ihren Haaren. Die kunstvolle Frisur, die sich für ihr erstes Date mit Kevin in einem teuren Salon hatte machen lassen, war schon am nächsten Tag bei ihrem Trainingslauf mit den Huskys vom Winde verweht worden. Es war nicht gut, wenn man sich verstellte, auch wenn Suze behauptete, ihr würden die Männer in Scharen hinterherlaufen, wenn sie sich wie eine Lady kleiden und ein teureres Make-up leisten würde. »Schau dir die Tennisspielerinnen an oder Hope Solo, die Torfrau der Fußball-Nationalmannschaft, die machen außerhalb des Platzes alle auf Lady und gehen mit irgendwelchen Hollywoodstars aus.«
»Darauf kann ich verzichten«, hatte sie erwidert. »Mir reicht es schon, wenn uns die Fotografen während der Rennen so dicht auf den Pelz rücken.«
Vor einer scharfen Biegung lenkte Jenn den Pick-up auf eine verschneite Forststraße und fuhr ungefähr eine halbe Meile in den Wald hinein. Schon von Weitem hörte sie ihre Huskys bellen. Zwanzig Hunde lebten in den Hütten vor ihrem Haus, dazu kamen die sechs Welpen, die vor acht Wochen geboren worden waren und in einem gesonderten Zwinger oder wie jetzt im Haus herumtollen durften. Sie hatte das Licht im Wohnzimmer angelassen. Jeder Husky war mit einer Kette an seine Hütte gebunden, eine Vorsichtsmaßnahme, die verhindern sollte, dass die lebhaften Hunde aufeinander losgingen. Die Eimer, in die das Futter kam, hatte sie seitlich an die Hütten genagelt. Die ausladenden Äste herumstehender Fichten überschatteten die Zwinger.
Sie parkte vor ihrem Haus, einem zweistöckigen Blockhaus mit großen Fenstern und einer Veranda, die sich im Parterre um die Vorderseite und die Ostseite herumzog. »Hey, Skipper!«, rief sie, als sie ausgestiegen war und zu den Hunden lief. »Alles okay bei euch?« Sie bückte sich zu ihrem Leithund, einem kräftigen sibirischen Husky mit dichtem Fell, das im Schein der Lampe über dem Hauseingang weiß und silbern glänzte. »Wie ich euch kenne, habt ihr Hunger, stimmt’s? Ich bin schon unterwegs.«
Sie ging ins Haus und kehrte mit Trockenfutter und Wasser zurück. Die Huskys wussten, was in den Eimern war, und begrüßten sie noch stürmischer. Sie zerrten nervös an ihren Ketten und sprangen an ihr hoch. »Immer mit der Ruhe!«, rief sie. »Es ist genug für alle da.« Wie jeder Leithund bekam auch Skipper sein Fressen als Erster, eine große Portion des mit Proteinen angereicherten Webster’s Best ihres Sponsors, das ihn noch kräftiger machen und seine Ausdauer stärken sollte. Nur wenn sie ihn wie einen Anführer verwöhnte, behielten auch die anderen Huskys den Respekt vor ihm. »Lass es dir schmecken, Skipper!«, sagte sie. »Nur wenn du groß und stark bist, haben wir beim Iditarod eine Chance. Nicht, dass wir wieder abstinken wie beim letzten Rennen.« Damals war sie schon nach der vierten Etappe ausgeschieden, allerdings aus eigenem Verschulden, weil sie ihren Nachschub falsch organisiert hatte. Beim nächsten Rennen würden ihr ein paar Freunde helfen und dafür sorgen, dass an jedem Checkpoint neues Futter stand. Jerry Anderson, ein befreundeter Pilot, der hauptberuflich Urlauber über den Mount McKinley flog, hatte sich bereiterklärt, die Vorräte gegen ein geringes Entgelt zu transportieren.
Um keine Eifersucht aufkommen zu lassen, ging sie von einem Hund zum anderen, hatte für jeden ein paar nette Worte übrig oder kraulte ihn zwischen den Ohren. Sie war stolz auf ihr Gespann. Skipper war der unumstrittene Leader, aber auch die sechs anderen Huskys, die beim Rennen den Schlitten ziehen würden, konnten sich sehen lassen: Johnny, der junge Draufgänger, der mit jugendlichem Elan an jede Aufgabe heranging. Ice-T, der Einzige mit durchgehend rabenschwarzem Fell und beinahe so cool wie der gleichnamige Schauspieler. Rascal, nur einen Monat älter als Johnny und genauso energiegeladen. Honey, die energische Hundedame. Poncho und Jade, beide sehr bullig und kräftig und im Tiefschnee kaum zu schlagen. Und selbst unter den dreizehn anderen Huskys gab es einige vielversprechende Talente, die jetzt noch zu jung waren, aber vielleicht in ein, zwei Jahren dabei sein würden.
Obwohl Jenn noch nicht lange im Geschäft war, galt sie in Fachkreisen bereits als erfolgreiche Züchterin. Vor einem Jahr hatte sie zwei junge Huskys für eine stolze Summe verkaufen können, und auch der neue Wurf würde sicher einige wertvolle Hunde hervorbringen. Um an einem Rennen wie dem Iditarod teilnehmen zu können, brauchte man viel Geld, und solange man nicht so bekannt wie der letztjährige Gewinner war, tat man sich schwer, finanzkräftige Sponsoren und das nötige Bargeld zusammenzubekommen. Ihre Eltern lehrten an der University of Alaska in Anchorage und steuerten monatlich fünfhundert Dollar bei, aber selbst damit kam sie nur knapp über die Runden. »Aber das wird nächstes Jahr alles besser«, sagte sie so laut, als müssten es auch die Huskys hören, »wir gewinnen das Iditarod, kassieren ein Preisgeld und bekommen eine Million von einem finanzkräftigen Sponsor.«
Hunde, nicht nur Huskys, hatten immer eine bedeutende Rolle in Jenns Leben gespielt. Außer während ihrer Collegezeit, als sie im Studentenwohnheim gewohnt hatte, wo Haustiere streng verboten waren, hatte sie immer Hunde um sich gehabt, sogar ein Pekinese war einmal darunter gewesen. Ihre Eltern waren verrückt nach Hunden. Sie holten sie meist aus dem Tierheim, pflegten sie gesund und behielten sie entweder oder suchten nach einem neuen Zuhause für sie. Einen Golden Retriever, der sich ein Bein gebrochen hatte und sein ganzes Leben humpelte, hatte sie besonders in ihr Herz geschlossen, auch den Pekinesen, weil er so klein und hilflos gewesen war. Ihren ersten Husky hatte sie mit dreizehn kennengelernt, als sie mit ihren Eltern von Oregon nach Alaska gezogen war. Ihr Vater, der als Biologie-Professor unterrichtete, hatte eine Stelle an der University of Alaska in Anchorage angenommen. Jenn hatte sich in den Husky verliebt und sich geschworen, später einmal mit diesen Hunden zu arbeiten. Auch sie hatte Biologie studiert.
Aus dem Haus drang leises Jaulen, das bei den Schmatzgeräuschen der fressenden Hunde kaum zu hören war. »Hört ihr das?«, sagte sie zu ihnen. »Die Kleinen werden ungeduldig. Wird allmählich Zeit, dass ich ihnen was zu fressen bringe. Ihr kommt doch eine Weile ohne mich aus?« Sie kehrte mit den leeren Eimern ins Haus zurück und stellte sie in den kleinen Raum neben der Küche, in dem auch ihre Waschmaschine und ihr Trockner standen. Die Welpen, einer süßer als der andere, kamen ihr durch die Küche entgegen und begrüßten sie stürmisch, vor allem Brandy, der während der Geburt beinahe gestorben war und es nur Dr. William Penzler, dem Tierarzt, zu verdanken hatte, dass er überhaupt noch am Leben war. Ein schwarzweißer Rüde, den sie besonders ins Herz geschlossen hatte und entsprechend freudig begrüßte. »Da seid ihr ja, ihr Wilden! Ihr habt wohl Hunger? Keine Angst, es ist genug da.« Sie füllte die Fressnäpfe und beobachtete, wie die Kleinen sich darauf stürzten.
Sie waren mächtig gewachsen während der letzten Wochen und würden bald ihre eigenen Hütten bekommen, aber bis Weihnachten wollte sie die anhänglichen Tiere noch im Haus lassen. Ihr Wohnzimmer war groß, und um die auf Flohmärkten zusammengekauften Möbel war es nicht schade. Auf ein paar Kratzer mehr oder weniger kam es nicht an. Nur der erste Stock, zu dem eine Wendeltreppe vom Wohnzimmer hinaufführte, war für die Hunde tabu. Dort lagen das Schlafzimmer und ihr kleines Büro. Auf der Empore vor den Zimmern standen zwei Sessel, ein Regal mit Büchern und DVDs, eine Kommode mit Fernseher, Stereoanlage und DVD-Player, auch ein Geschenk ihrer Eltern.
Während die Welpen fraßen, zog sie Anorak, Mütze und Handschuhe aus und setzte heißes Wasser in der Küche auf. Bevor sie zu Kevin fuhr, brauchte sie einen Becher kräftigen Tee und ein Sandwich mit dem Chicken Salad, den sie vor zwei Tagen im Supermarkt gekauft hatte. Der Salat schmeckte göttlich, wahrscheinlich wegen des süßlichen Curry-Dressings, und würde ihr die nötige Kraft für die schwierige Aufgabe geben. Kevin gehörte nicht zu den Typen, die eine Abfuhr so einfach hinnahmen. Wahrscheinlich fühlte er sich in seiner Ehre getroffen und weigerte sich, die Trennung akzeptieren. Sie goss den Tee auf und schob die Toastscheiben für das Sandwich in den Toaster. Aus dem Kühlschrank holte sie den Chicken Salad. Eine Trennung war meist eine Katastrophe, ging es ihr durch den Kopf, egal auf welcher Seite man sie erlebte.
Ihr Handy klingelte. Sie zog es aus ihrem Anorak und checkte rasch die Nummer. Nicht auszudenken, wenn Kevin dran war und sie schon am Telefon darauf zu sprechen kam. Aber es war Suze. Ihre beste Freundin war mit ihr zusammen aufs College gegangen, hatte im dritten Jahr abgebrochen und bediente seitdem im Starbuck’s. Sie träumte davon, irgendwann selbst eine Filiale zu übernehmen.
»Hey Suze«, begrüßte Jenn sie, »wie geht der neue Frappuccino?«
»Blendend«, antwortete Suze.
Suze kannte sie wie kaum ein anderer und spürte selbst am Telefon, dass irgendetwas nicht stimmte, und weil sie sich für eine Expertin in Beziehungsfragen hielt und von ihrem Kummer wusste, erriet sie auch den Grund. »Sag bloß, du hast Kevin zum Teufel geschickt. Du hast Schluss gemacht, oder?«
»Noch nicht«, erwiderte sie und erzählte ihr, was sie vorhatte. »Er ist nicht der Richtige, Suze. Die ersten paar Wochen hielt er sich noch zurück, da spielte er noch den Gentleman und ließ mich sogar den Film aussuchen, den wir am Abend sehen wollten, aber jetzt …« Sie wechselte ihr Handy in die linke Hand, um mit der rechten die Brotscheiben aus dem Toaster zu holen. »Er ist ein Macho, Suze. Alles muss nach seiner Pfeife tanzen. Ich glaube, er hätte am liebsten, dass ich das Rennen aufgebe, meine Huskys verkaufe und das Heimchen am Herd für ihn spiele. Du hättest ihn sehen sollen, als wir bei seinen Eltern waren. Da hat er so getan, als wären wir verlobt und es wäre nur noch eine Frage der Zeit, bis ich bei ihm einziehe und seine Sklavin werde.«
Suze lachte. Sie war wesentlich unkomplizierter, was Männer betraf, und verließ sich auf One-Night-Stands, weil die meist schon wieder verschwunden waren, wenn man die Augen aufschlug. »Und das merkst du jetzt erst? Ich hab dir doch gleich gesagt, dass mit dem was nicht stimmt. Der hat irgendwas in den Augen, das mir schon damals Angst gemacht hat. Schick ihn zum Teufel, Jenn! Der edle Märchenprinz kommt noch früh genug.«
Jenn stieß bei dem Versuch, das Sandwich mit einer Hand zu schmieren, den Becher mit dem Chicken Salad um und fluchte leise. »Vor dem Rennen hab ich sowieso keine Zeit für Männer. Ich will unter die ersten zehn, Suze!«
»Abwarten, Jenn. Es kommt, wie es kommen muss.«
2
Jenn war gerade dabei, die Futtertröge der jungen Huskys wegzuräumen, als sie zufällig aus dem Fenster blickte und die Scheinwerfer eines Wagens näher kommen sah. Im Lichtschein der Lampe neben dem Eingang erkannte sie, wie er neben ihrem Pick-up parkte, ein dunkler Jeep Cherokee, schon etwas betagt und mit einem satten Klang, wie ihn die meisten Männer bevorzugten.
»Kevin!«, flüsterte sie erschrocken. Sie ging rasch in die Küche zurück, um nicht den Eindruck zu erwecken, als hätte sie nach ihm Ausschau gehalten, und räumte den Chicken Salad in den Kühlschrank zurück. Nervös wartete sie darauf, dass Kevin die Tür öffnete. »Kevin!«, rief sie, als er mit einer roten Rose die Küche betrat. Ihre Überraschung war nicht mal vorgetäuscht.
»Hey, Jenn«, begrüßte er sie mit dem verführerischen Lächeln, das sie von ihren ersten Dates kannte. »Hast du etwa schon gegessen? Ich wollte dich eigentlich in die Sports Bar am Old Steese Highway einladen, die haben eine neue Pizza mit Barbecue Chicken.« Er war ein hochgewachsener Mann mit einem kantigen Gesicht und einem Haarschnitt, der an seine dreijährige Dienstzeit bei der U. S. Army erinnerte, die er in einem Ausbildungslager in Alabama und in Deutschland verbracht hatte. Nur weil die Truppen aus Afghanistan abgezogen wurden, war er nicht zum Hindukusch versetzt worden. Mit regelmäßigem Fitnesstraining hielt er sich immer noch in Topform. »Was ist? Du willst mir doch keinen Korb geben?« Er reichte ihr die Rose.
Jenn griff danach und errötete. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Am liebsten wäre sie vor Verlegenheit und Scham im Erdboden versunken, so sehr brachte sie Kevins Verhalten aus dem Gleichgewicht. Einen Augenblick lang vermutete sie sogar, er hätte eingesehen, sich ihr gegenüber falsch benommen zu haben, und sich entschlossen, noch mal von vorn zu beginnen. Wie konnte sie einem Mann sagen, dass sie nichts mehr von ihm wissen wollte, wenn er ihr gerade eine rote Rose mitgebracht und sie zum Essen eingeladen hatte?
»Ich weiß nicht, Kevin«, suchte sie nach einem Ausweg, »ich hab gerade ein Sandwich gegessen und eigentlich keinen Hunger mehr. Tut mir leid …«
In seinen Augen blitzte Ärger auf und verschwand wieder. Mit dem überlegenen Lächeln eines Mannes, der glaubt, eine Frau sicher in den Fängen zu haben, umfasste er mit beiden Händen ihre Hüfte und zog sie zu sich heran. Er küsste sie gierig. Als sie kaum reagierte, sagte er: »Was ist mit dir los, Jenn? Hast du deine Tage? Und warum hast du den blödsinnigen Anzug an?«
»Ich wollte noch mal weg.«
Das Blitzen kehrte in seine Augen zurück. »Noch mal weg? Mit den Hunden? Hast du denn nichts anderes im Kopf als diese verdammten Huskys?«
»Ich wollte zu dir, Kevin«, erwiderte sie kleinlaut.
»Zu mir?« Er grinste siegessicher und verriet ihr mit seinem Blick, was er darunter verstand. »Das ist natürlich was anderes.« Er zog sie wieder zu sich heran. »Aber den Weg kannst du dir jetzt sparen. Und den komischen Anzug auch. Komm, lass uns nach oben gehen und ein bisschen … du weißt schon.«
Sie wand sich aus seiner Umklammerung. »Nicht jetzt, Kevin.«
»Nicht jetzt? Was soll das heißen?«
Sie erkannte, dass sie es ihm jetzt sagen musste, bevor es zu spät war und sie erneut einen langen Anlauf nehmen musste. Er würde sich nicht ändern. Er würde immer ein Macho bleiben und nur zufrieden sein, wenn sie sich so verhielt, wie es ihm gefiel. Und selbst wenn er sich geändert hätte … Auch sein charmantes Lächeln konnte sie nicht mehr verzaubern. Zu viel war während der letzten Wochen geschehen. Nichts Dramatisches, eher Kleinigkeiten, die ihr gezeigt hatten, dass sie nicht zueinander passten. Sie gab sich einen Ruck.
»Ich will nicht mehr, Kevin«, sagte sie.
»Du willst keinen Sex mehr?« Er starrte sie entgeistert an.
»Ich will … ich will Schluss machen, Kevin.«
Er kapierte nicht. »Schluss? Wie meinst du das?«
»Wir passen nicht zusammen, Kevin.« Sie wagte kaum, ihm in die Augen zu blicken. »Ich möchte, dass wir uns trennen. Tut mir leid, wenn ich dir das so ins Gesicht sage, aber ich weiß nicht, wie ich mich sonst ausdrücken soll.«
»Du willst mich zum Teufel jagen? Einfach so?«
»Tut mir leid, Kevin.«
Er brauchte einige Zeit, um die Nachricht zu verdauen. Sie spürte förmlich, wie die Erkenntnis, dass sie es ernst mit der Trennung meinte, sein Bewusstsein erreichte und ein ungläubiger Ausdruck in seine Augen trat. »Das meinst du doch hoffentlich nicht ernst. Du willst mir eins auswischen, weil ich vorgestern nicht mit dir ins Kino gehen wollte. Ich mag nun mal keine Liebesschnulzen, und diesen Brad Pitt kann ich schon gar nicht leiden.« Seine Augen füllten sich mit Tränen. »Sag, dass es nicht wahr ist, Jenn! Sag mir, verdammt noch mal, dass du mir nur einen reinwürgen willst! Sag es, Jenn!«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht mehr, Kevin.«
»Du kannst nicht mehr?« Der ungläubige Ausdruck in seinen Augen verwandelte sich in ein wütendes Blitzen. »Und das rotzt du mir einfach so hin? Nachdem ich dich meinen Eltern vorgestellt habe und wir uns schon so gut wie einig waren, dass wir heiraten würden? Du wartest, bis ich mit ’ner verdammten Rose bei dir auftauche, und sagst mir, dass ich verschwinden soll?«
Sie ahnte, dass er ihr die Rose aus der Hand schlagen würde, und legte sie rasch auf den Küchentisch. »Was hätte ich denn sonst machen sollen? Dich anrufen oder dir eine E-Mail schicken? Ich wollte es dir persönlich sagen.«
»Du meinst es wirklich ernst, was?« Seine Augenbrauen hoben sich.
»Ich kann nicht anders. Mach’s uns doch nicht so schwer!«
»So ist das also!« Sein Gesicht war gerötet, vor Wut und verletztem Stolz. »Du willst, dass ich so schnell wie möglich abhaue! Willst wahrscheinlich deine Ruhe haben oder mit deinen verdammten Kötern spielen! Die waren dir doch sowieso immer wichtiger! Machst wahrscheinlich auch mit ihnen rum!«
»Kevin!«
»Für die Köter tust du doch alles! Stehst den ganzen Tag in diesem Weihnachtsladen rum, beantwortest Briefe an den Weihnachtsmann, leckst deinen blödsinnigen Sponsoren die Stiefel, damit sie ein paar Dollar mehr rausrücken, fährst den ganze Morgen mit deinen Huskys durch die Gegend, und wenn ich mal frage, ob wir zusammen ausgehen können, jammerst du rum und sagst, dass du die Hunde nicht allein lassen willst.« Er deutete mit einer verächtlichen Handbewegung aus dem Fenster. »Was brauchst du auch zwanzig Hunde? Kosten ein halbes Vermögen, die Köter, und fangen schon zu bellen an, wenn du ihnen nicht alle fünf Minuten um den Bart gehst! Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du mit diesen Versagern das Iditarod gewinnst?«
»Ich versuche es. Ein Platz unter den ersten zehn wäre auch okay.«
Er hörte gar nicht hin, lief mit hochrotem Gesicht vor ihr auf und ab, blieb plötzlich stehen und starrte sie mit vorwurfsvoller Miene an. »Hast du einen anderen? Du hast einen anderen und führst mich schon die ganze Zeit an der Nase herum, stimmt’s?« Er beherrschte sich nur mühsam. »Gib’s zu, Jenn!«
»Ich hab keinen anderen, Kevin.« Sie versuchte ruhig zu bleiben. »Ich hätte gar keine Zeit für einen anderen.« Sie wagte kaum noch, ihm in die Augen zu blicken. »Aber mit uns … Das funktioniert nicht. Wir sind zu verschieden.«
Kevin wusste nicht, wohin mit seinem Zorn, sah Brandy um die Ecke kommen und verlor die Kontrolle. »Daran sind nur diese Köter schuld!«, schrie er. »Sie haben alles kaputtgemacht!« Er holte aus und trat den Welpen, so dass er winselnd ins Wohnzimmer rutschte und gegen einen der Sessel prallte. »Man sollte sie alle einschläfern, die elenden Köter!«
Jenn stieß einen Schrei aus und rannte zu dem verletzten Welpen. Der Arme lag mit schmerzerfüllten Augen auf dem Holzboden und schien sie verzweifelt um Hilfe zu bitten. Er zitterte am ganzen Körper, atmete aber. Irgendetwas musste gebrochen sein, und innere Verletzungen hatte er womöglich auch.
Sie streichelte ihn sanft und drehte sich weinend zu Kevin um. »Verschwinde!«, fuhr sie ihn an. Dicke Tränen rannen ihr über die Wangen, und sie schluchzte so heftig, dass sie kaum zu verstehen war. »Mach, dass du wegkommst, und lass dich hier nie wieder blicken! Hast du mich verstanden? Ich habe endgültig die Nase voll! Hau endlich ab, oder ich rufe die Polizei!«
Sie beachtete ihn nicht weiter und beugte sich zu Brandy hinab. Mit seinen zwei Monaten sah der Welpe so winzig und hilflos aus, dass sie ihn am liebsten aufgehoben und fest an sich gedrückt hätte. Sie tastete ihn vorsichtig ab und entlockte ihm ein schmerzerfülltes Jaulen. Die anderen Welpen waren näher gekommen und sahen in einer Mischung aus Angst und Verwunderung zu. »Ich bringe dich am besten gleich zum Tierarzt«, sagte sie zu Brandy. »Doc Penzler macht dich wieder gesund, ganz bestimmt!« Den Gedanken, dass er den Welpen einschläfern könnte, ließ sie nicht an sich heran.
Sie schlüpfte in ihren Anorak und hob ihn vorsichtig vom Boden auf. Er jaulte vor Schmerz. »Tut mir leid, Brandy!«, tröstete sie ihn. »Anders geht es leider nicht. Aber zu Doc Penzler haben wir’s nicht weit.«
Die erwachsenen Huskys spürten, dass etwas nicht stimmte, und bellten und jaulten nervös, als sie mit dem verletzten Welpen ins Freie trat. »Brandy geht es nicht besonders«, rief sie ihnen zu. »Ich bringe ihn zu Doc Penzler.«
Sie öffnete die Beifahrertür und legte ihn vorsichtig auf den Sitz. Mit ein paar Schritten war sie auf der anderen Seite und stieg ein. Kevin war bereits verschwunden. Im Rückspiegel sah sie, dass sie vergessen hatte, die Haustür zu schließen, rannte noch einmal zurück und warf sie zu, lief zum Wagen und fuhr auf die Forststraße zum Highway. Wenn Brandy innere Verletzungen hatte, und das war beinahe sicher bei dem heftigen Tritt, musste er so schnell wie möglich auf den Operationstisch. Es kam auf jede Minute an.
»Halte durch, Brandy!«, rief sie dem Welpen zu, ohne den Blick von der verschneiten Forststraße zu nehmen. Sie schlitterte mit sechzig Sachen über den glatten Schnee, verlor nur einmal die Kontrolle über den Wagen, als sie einem Eisbrocken auswich und beinahe in den Graben fuhr, und war froh, als sie endlich den geräumten Highway erreichte. Mit heulendem Motor raste sie der Stadt entgegen. »Keine Angst, Brandy, es dauert nicht mehr lange.«
Auf der breiten Straße herrschte kaum Verkehr, und der Boden war gestreut und griffig, aber Jenn war noch viel zu entsetzt, um sich zu entspannen. Wie hatte sie sich nur so in Kevin täuschen können! Auch ein impulsiver und in seinem Stolz verletzter Mann wie er durfte sich nicht auf diese schäbige Weise vergessen und einen hilflosen Welpen mit einem Fußtritt verletzen.
Warum hatte er nicht den Tisch und die Stühle umgeworfen? Warum keine Blumenvase an die Wand geworfen? Warum musste er sich ausgerechnet am kleinsten und hilflosesten Wesen in seiner Nähe vergreifen? Selbst wenn er sie geschlagen hätte, wäre sie nicht so wütend und enttäuscht gewesen wie jetzt.
Wer sich an einem so winzigen Wesen wie einem Welpen vergriff, gehörte hart bestraft, selbst wenn er sich gleich danach entschuldigte. Aber nicht einmal das hatte Kevin getan. Er war ein selbstgerechter und selbstgefälliger Macho, ein gemeiner Schläger, der sich früher oder später auch an ihr vergriffen hätte. Wie hatte sie auf ihn nur reinfallen können?
In der Stadt bog sie nach Süden ab und hatte freie Bahn. Es war bereits nach neun, und die meisten Leute saßen zu Hause vor dem Fernseher. Ein Weihnachtsbaum vor einem öffentlichen Gebäude erstrahlte in bunten Farben, und vor einem herrschaftlichen Privathaus fuhr ein Santa Claus aus roten und weißen Lichtern mit seinem Hundeschlitten über den schneebedeckten Rasen. Die Nase des weltberühmten Rentiers Rudolph leuchtete rot.
Sie hörte Brandy jaulen und trat das Gaspedal bis zum Anschlag durch. Ihr Pick-up schlitterte über eine gelbe Ampel, driftete ein wenig nach links ab und raste auf die nächste Ampel zu, die auch bereits auf Gelb geschaltet hatte. Sie schaffte es gerade noch über die leere Kreuzung, hatte aber schon eine Straße weiter einen Streifenwagen hinter sich, der sie mit flackernden Blinklichtern verfolgte. Ihr blieb nichts anderes übrig, als an den Straßenrand zu fahren.
Mit den Händen auf dem Lenkrad wartete sie, bis der Trooper in ihrem Außenspiegel auftauchte und langsam näher kam. Im Laufen rückte er seinen Gürtel mit der Pistole und dem Schlagstock zurecht. »Sie wissen, warum ich Sie gestoppt habe?«, fragte er. Er gehörte zur alten Garde, ein erfahrener Mann mit verkniffener Miene, dem man nichts mehr vormachen konnte.
»Ich war zu schnell«, antwortete sie nervös, »aber nur, weil kaum Verkehr war und ich dringend meinen verletzten Welpen zum Tierarzt bringen muss.« Sie gab den Blick auf den winselnden Brandy frei. »Ich schätze, er hat sich was gebrochen und innere Verletzungen. Ich muss dringend zu Doc Penzler!«
»Doc Penzler? Den kenne ich, der hat unseren Retriever auch verarztet.« Er blickte den Welpen prüfend an und erkannte wohl, dass er tatsächlich verletzt war. »Okay … fahren Sie hinter mir her! Ich bringe Sie hin. Bleiben Sie dicht hinter mir, okay?« Er kehrte zu seinem Wagen zurück und stieg ein.
Zu ihrem großen Erstaunen gab er ihr tatsächlich Geleitschutz und fuhr sie mit eingeschalteten Blinklichtern zu der Tierarztpraxis, die sich Doc Penzler mit zwei jüngeren Kollegen teilte. Die Notaufnahme hatte bis Mitternacht geöffnet.
Die Schwester staunte nicht schlecht, als Jenn und der Trooper den verletzten Brandy in den Vorraum brachten. Als sie erkannte, wie schlimm es um den Welpen stand, öffnete sie die Tür zu den Behandlungsräumen und ließ sie den Hund auf einen Operationstisch legen.
»Jennifer Palmer, nicht wahr?«
Jenn bejahte und wartete ungeduldig auf den Tierarzt, der im Stockwerk über der Praxis wohnte und sofort nach unten kam. »Brandy!«, rief er verwundert. »Ist das nicht der Welpe, der bei der Geburt beinahe gestorben wäre?« Er zog seinen Kittel an. »Was ist mit ihm?«
Sie erzählte es ihm, verschwieg aber den Namen des Übeltäters. In ihrer Stimme schwang Hoffnung mit. »Glauben Sie, Sie können ihn retten, Doc?«
»Dazu muss ich ihn erst mal untersuchen.« Er tastete den Welpen vorsichtig ab und merkte anscheinend, wie nervös sie war. »Sie warten am besten im Vorraum, Jennifer. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald ich ihn untersucht habe.«
Sie zog sich widerwillig in den Vorraum zurück und sah den State Trooper vor dem Kaffeeautomaten stehen. »Auch einen?«, fragte er, ohne sich nach ihr umzudrehen. »Die haben auch Latte und dieses ganze neumodische Zeug.«
»Eine heiße Schokolade wäre mir lieber.«
Er ließ ihr einen Becher raus und reichte ihn ihr. »Angesichts der Tatsache, dass Sie einen schwerkranken Patienten an Bord haben, will ich es bei einer Ermahnung belassen«, sagte er, nachdem sie sich gesetzt hatten. Die Stühle standen reihum an der Wand, meist windige Plastikstühle oder Metallhocker. Auf einigen Tischen lagen die üblichen Magazine. An der Wand hingen Fotografien von berühmten Film- und Fernsehtieren wie Lassie und dem Wolf aus »Der mit dem Wolf tanzt« und ein Kalender mit putzigen Haustieren.
»Wer hat den Welpen so zugerichtet?«, fragte der Trooper nach einer ganzen Weile. Auf seinem Namensschild stand James McFadden. »Ihr Mann?«
»Ich bin nicht verheiratet.«
»Ihr Freund?« Er nippte an dem heißen Kaffee und blickte sie forschend an. »Wäre nicht das erste Mal, dass ein Mann durchdreht und seine Wut an einem hilflosen Tier auslässt, wenn ihm irgendwas nicht in den Kram passt.«
»Mein Ex-Freund«, sagte sie nach einer längeren Pause. Sie blickte gedankenverloren auf den Tierkalender. »Er konnte nicht vertragen, dass ich mit ihm Schluss gemacht habe. Aber es ging einfach nicht mehr. Ich glaube, er war eifersüchtig auf meine Huskys, weil ich für das Rennen trainiere und wenig Zeit für ihn hatte. Mein Fehler. Er wollte wohl eher ein Heimchen am Herd.«
Der Trooper lächelte schwach. Er mochte um die Fünfzig sein, vielleicht auch älter. »Ich bin auch ein Macho, aber ich komme aus einer anderen Zeit. Damals waren die Frauen noch nicht so selbstbewusst wie Sie. Und vor allem fuhren sie noch nicht so schnell Auto. Aber ich hätte niemals einen hilflosen Welpen getreten, und wenn ich drei Mal den Laufpass bekommen hätte.« Er trank erneut einen Schluck. »Außerdem ist es strafbar. Wie heißt Ihr Ex?«
»Ich möchte keine Anzeige erstatten, Trooper.«
»Sergeant«, verbesserte er sie. »Warum nicht? Wollen Sie ihn etwa davonkommen lassen? Den Mann, der beinahe Ihren Hund zu Tode getreten hätte?«
»Ich will ihn nicht mehr sehen, Sergeant.«
Die Tür zu den Behandlungsräumen öffnete sich, und Doc Penzler kam zu ihr. »Ich will Ihnen nichts vormachen, Jennifer«, sagte er, nachdem er den Trooper mit einem Kopfnicken begrüßt hatte. »Es sieht nicht gut aus. Er hat sich die Schulter angebrochen und schwere innere Verletzungen. Wie es genau um ihn steht, kann ich Ihnen wohl erst in einigen Tagen sagen, wenn wir genauere Ergebnisse haben. Ich befürchte aber, wir müssen ihn einschläfern.«
»Kommt nicht infrage, Doc«, protestierte Jenn.
»Manchmal ist es unumgänglich«, sagte er. »Ich verspreche ihnen aber, dass ich alles tun werde, um sein Leben zu retten. Sobald ich mehr weiß, rufe ich Sie an. Ihre Nummer habe ich ja. Tut mir leid, Jennifer.«
»Mir auch«, sagte sie.
3
In dieser Nacht schlief sie kaum. Ihre Wut auf Kevin, der ein hilfloses Wesen so heftig getreten hatte, dass sein Leben in Gefahr war, und die Sorge um den verletzten Welpen versetzten sie in ständige Aufregung und Unruhe und ließen sie alle paar Minuten aus dem Schlaf schrecken. Sie öffnete schweißgebadet die Augen, wusch sich das Gesicht und wechselte das T-Shirt. Wie benommen blieb sie in ihrem Bett sitzen, nur um kurze Zeit später erneut wieder in einem Albtraum zu versinken und Kevin zu begegnen.
Selbst die Huskys wurden von ihrer Unruhe angesteckt. Sie heulten fast die ganze Nacht, und als sie ans Fenster trat, um nach ihnen zu sehen, bemerkte sie, dass einige vor ihren Hütten standen und wütend an ihren Ketten zerrten. Blondie, die Mutter des verletzten Welpen, blickte traurig in ihre Richtung, machte aber keine Anstalten, sich loszureißen, und schien zu ahnen, dass sie Brandy nicht helfen konnte. »Doc Penzler tut, was er kann«, sagte Jenn, obwohl die Hündin sie nicht hören konnte. »Er wird wieder gesund.«
Um halb vier, als sie wieder aus einem Albtraum schreckte, erkannte Jenn, dass sie nicht mehr einschlafen würde. Sie schaltete den Fernseher ein und langweilte sich bei der Predigt eines Evangelisten, der nur darauf aus war, seine Bücher und DVDs zu verkaufen und Spenden für seine Kirche zu sammeln, war aber zu schwach und zu träge, um einen anderen Kanal zu suchen. Für einen Spielfilm oder eine dieser blödsinnigen Comedy-Serien, die bei zahlreichen Sendern in einer Endlosschleife liefen, hätte sie sowieso keine Nerven gehabt. Als der Prediger einen scheinbar unheilbaren Rollstuhlfahrer auf die Bühne holte und ihm die Hand auflegte, und der sich wie einst Lazarus erhob und jubelnd die Arme emporstieß, schaltete sie ab und stand auf.
Nach einer ausgiebigen heißen Dusche ging es ihr etwas besser. Sie zog sich an, schlich an den Welpen im Erdgeschoss vorbei und kochte frischen Tee. Mit einem vollen Becher kehrte sie in ihr kleines Arbeitszimmer im ersten Stock zurück. Vor sieben wollte sie mit den Huskys nicht los, und bis dahin war noch genug Zeit, sich ihrem dritten Job zu widmen. Für das Fremdenverkehrsamt von North Pole beantwortete sie Briefe, die Kinder an den Weihnachtsmann geschrieben hatten. Nach der Legende lebte Santa Claus in North Pole, so hatten sie es in zahlreichen Filmen und Cartoons gesehen, und es war nur logisch, dass viele Kinder an »Santa Claus, North Pole, Alaska« schrieben. Die Briefe wurden gesammelt und Jenn und anderen Freiwilligen zur Beantwortung übergeben. Ein ganzer Stapel lag auf ihrem Schreibtisch.
Die Briefe der Kinder, meist mit bunten Zeichnungen verziert, besserten ihre Laune erheblich. Es war schon erstaunlich, was sich die Absender einfallen ließen, um den Weihnachtsmann zu beeindrucken. Natürlich waren auch die üblichen Wunschzettel dabei: Smartphones, Spielekonsolen, Süßigkeiten … Einer wünschte sich sogar eine neue Tante, weil seine eigene nie etwas mitbrachte. Mike aus Denver schrieb: »Lieber Santa Claus, den Wunschzettel habe ich schon meinen Eltern gegeben. Du weißt sicher, dass wir im Sommer umgezogen sind und jetzt in einem Vorort von Denver wohnen. Das Haus ist etwas kleiner als das alte und der Schornstein wesentlich schmaler. Deshalb wollte ich dich bitten, bis Weihnachten noch etwas abzunehmen, dass du auch hindurchpasst. Auf den Bildern, die ich von dir gesehen habe, warst du ziemlich dick.« Kayla aus Seattle hatte eine Zeichnung mit einem bunten Engel beigelegt und geschrieben: »Lieber Santa Claus, ich war dieses Jahr wieder sehr brav und hoffe, dass du meine Wünsche erfüllen kannst. Ich wünsche mir ein pinkfarbenes Smartphone für mich und eins für meine Barbie, damit ich sie auch von unterwegs anrufen kann.« Caroline aus Anchorage schrieb: »Ich schreibe dieses Jahr für meine Mom. Sie mag ›Jingle Bells‹ und ›Rudolph the Red-Nosed Reindeer‹, aber ›Last Christmas‹ von Wham geht ihr auf den Wecker, sagt sie. Sie möchte, dass du dir neue Lieder einfallen lässt.«
Jenn hatte natürlich ein paar Standardantworten in ihrem Computer gespeichert, schrieb die Kinder aber auch persönlich an. »Lieber Mike«, schrieb sie, »du glaubst ja nicht, wie anstrengend das Verpacken der Geschenke ist. Dabei verliere ich immer ein paar Pfunde. Vielleicht lässt du vorsichtshalber dein Fenster angelehnt …« Bei Kayla bedankte sie sich für die schöne Zeichnung: »Die ist wirklich toll geworden. Wegen des Smartphones rede ich mal mit deinen Eltern, die Dinger sind hier im Himmel äußerst knapp geworden.« Und mit Caroline war sie einer Meinung: »Ich traue mich gar nicht, es laut zu sagen, aber mir geht dieses ›Last Christmas‹ genauso auf die Nerven, und soll ich dir was sagen: Sogar Rudolph schüttelt sich jedes Mal. Aber es gibt genug andere Weihnachtslieder, und zur Not soll deine Mutter das Radio abschalten und stattdessen die Lieder aufrufen, die sie selbst runtergeladen hat.«
Jenn griff nach dem nächsten Brief, der in einem schmutzigen Umschlag ohne Absender und verschmiertem Stempel steckte, und wurde durch das morgendliche Jaulkonzert ihrer Huskys abgelenkt. Sie legte den Brief auf den Stapel zurück und blickte aus dem Fenster. Obwohl keiner der Hunde sie hören konnte, rief sie: »Ich weiß, ihr habt Hunger. Ich bringe euch gleich was, okay?« Seitdem sie für das Iditarod trainierte, gab sie den Huskys morgens und abends zu fressen, auch den Hunden, die nicht zu ihrem Gespann gehörten.
Nur gut, dass ich hier im Wald keine Nachbarn habe, dachte sie, als sie mit den Eimern in die morgendliche Kälte trat, und ihre Huskys begeistert zu jaulen und zu bellen begannen. »Ich hoffe, ihr konntet besser schlafen als ich«, sagte sie, als sie Skipper begrüßte und zwischen den Ohren kraulte. »Brandy hat bestimmt eine schwere Nacht hinter sich.« Sie ging von einem Hund zum anderen und kümmerte sich besonders liebevoll um Brandys Mutter. »Ich rufe gleich mal bei Doc Penzler an«, versprach sie ihr. »Keine Angst, er tut bestimmt alles, was in seiner Macht steht, um ihn wieder gesund zu machen.«
Nachdenklich kehrte sie ins Haus zurück und fütterte die Welpen. Die jungen Hunde ließen nicht erkennen, ob sie ihren Spielkameraden vermissten. Sie hatten wohl zu großen Hunger, um an irgendetwas anderes zu denken. Jenn sah ihnen eine Weile beim Fressen zu, zog ihren Anorak und die Handschuhe aus und ging in die Küche. »Die Hunde zuerst«, hieß eines der Gebote, das jeder Musher befolgte. So wie ein Cowboy sein Pferd versorgte, bevor er Eier mit Speck verspeiste, und seinen besten Freund nach der Arbeit abrieb und in den Mietstall brachte, kümmerte sich ein Musher um seine Hunde. Skipper wäre tödlich beleidigt gewesen, wenn Jenn vor ihm gefrühstückt hätte, auch wenn er sonst ihre Führungsrolle neidlos anerkannte und ihr blind gehorchte.
Jenn schlug zwei Eier in die Pfanne und schob zwei Brotscheiben in den Toaster. Ihr Hunger war nicht besonders groß, doch ohne ein ausreichendes Frühstück wollte sie nicht auf den Trail gehen. Der morgendliche Trainingslauf würde ihr guttun nach der Aufregung am vergangenen Abend und sie hoffentlich auf andere Gedanken bringen. Wie hatte sie mit Kevin nur sechs Monate befreundet sein können? Mit einem Mann, der sofort aufbrauste, wenn ihm etwas nicht in den Kram passte, und der sich in seiner Wut über eine Abfuhr am schwächsten Lebewesen abreagierte! Wie tief musste man gesunken sein, um so etwas zu tun? Was für ein Mensch musste man sein?
Ein Mensch mit zwei Gesichtern, das hatte sie schon während der vergangenen Monate erkannt und war doch immer wieder auf seinen Charme hereingefallen. Vielleicht hätte sie ihn schneller durchschaut, wenn sie ihm nicht so oft seinen Willen gelassen oder er öfter bei ihr übernachtet hätte. Er hatte nur einmal bei ihr geschlafen und schon damals auf die Huskys geschimpft. Die Hunde sind dir wohl wichtiger? Warum verkaufst du sie nicht und ziehst bei mir ein, dann könnten wir uns ein schönes Leben machen? Ich verdiene genug. Das waren noch die harmlosesten Bemerkungen gewesen. Er arbeitete in der Firma seiner Eltern, einem Versicherungsbüro, das sich auch um Finanzierungen kümmerte, wollte sich aber als Controller selbstständig machen.
Dass die meisten Frauen, und nicht erst, seitdem sie erfolgreich am Iditarod teilnahmen und das Rennen manchmal sogar gewannen, ihre eigenen Hoffnungen und Wünsche hatten und nicht am Herd enden wollten, war anscheinend noch nicht zu ihm durchgedrungen. Er benahm sich wie ein Hinterwäldler aus Alabama oder Georgia, der Frauen lediglich als schmuckes Beiwerk betrachtete und sie brauchte, um seine eigenen Bedürfnisse zufriedenzustellen. Natürlich hätte sie das früher erkennen und schon nach ein paar Tagen mit ihm Schluss machen sollen. Es war ihre Schuld, aber noch lange kein Grund, auf diese widerwärtige Weise auszurasten. Ihr blieb beinahe der Bissen im Halse stecken, als sie daran dachte, wie er Brandy getreten und der Welpe durch die Luft geflogen und winselnd liegen geblieben war.
Ohne daran zu denken, dass es noch keine sieben war, zog sie ihr Handy aus der Tasche und rief den Tierarzt an. Erst als es klingelte, blickte sie auf die Uhr. »Tierarztpraxis Dr. Penzler«, meldete sich eine verschlafene Stimme.
»Hier Jenn … Jennifer Palmer …«
»Haben Sie mal auf die Uhr gesehen, Jenn?«
»Entschuldigung … ich weiß … Ich habe Sie doch nicht geweckt?«, stammelte sie. »Ich wollte nur wissen, wie es Brandy geht … Geht es ihm besser?«
Doc Penzler räusperte sich ein paarmal. »Ich habe vor dem Schlafengehen nach ihm gesehen. Es geht ihm den Umständen entsprechend. Wie gesagt, genauere Auskunft kann ich Ihnen erst in ein paar Tagen geben.« Er schien nachzudenken und seufzte leise. »Machen Sie sich nicht allzu große Hoffnungen, Jennifer. Brandy ist ein robuster Bursche, aber die Verletzungen sind schwer, und ich glaube nicht, dass er noch mal auf die Beine kommt. Tut mir leid, dass ich Ihnen nichts anderes sagen kann. Rufen Sie mich übermorgen an, dann habe ich vielleicht schon eine endgültige Diagnose, aber wie gesagt … Es steht leider nicht besonders gut um Ihren jungen Freund.«
»Er darf nicht sterben, Doc! Machen Sie ihn gesund!«
»Ich gebe mir Mühe, Jennifer.«
Sie beendete das Gespräch und schob das Handy in ihre Hosentasche. In düstere Gedanken versunken, wusch sie ihr Geschirr und räumte es in den Schrank. Sie hatte gehofft, durch den Anruf etwas Erleichterung zu erfahren, doch das Gegenteil war der Fall. Obwohl der Arzt fast dieselben Worte wie am vergangenen Abend gebraucht und ihr noch einen Funken Hoffnung gelassen hatte, war seine Antwort wie ein endgültiges Todesurteil für sie gewesen. Sie stützte sich mit beiden Händen auf den Küchentisch und schloss die Augen. Brandy wäre nicht der erste Welpe, den sie verlieren würde. Vor einem Jahr war einer ihrer jungen Huskys an einem Virus gestorben, aber wie man das Leben eines so unschuldigen Tieres durch bloße Gewalt beenden konnte, wollte nicht in ihren Kopf hinein.
Wie immer, wenn sie von düsteren Gedanken geplagt wurde, hoffte sie, sich während einer Trainingsfahrt davon befreien zu können. Sie goss den restlichen Tee in eine Thermosflasche, stopfte sie in die Schlittentasche, die sie in dem Vorraum mit dem Hundefutter aufbewahrte, und packte noch ein paar Kekse dazu. »Seid schön brav!«, bat sie die Welpen, während sie in ihren Anorak schlüpfte und die Handschuhe anzog. »Bis Mittag bin ich zurück.«
Sie hatte es genauso eilig wie ihre Huskys, den Schlitten anzuspannen und endlich loszufahren. »Heya! Heya!«, schrie sie lauter als gewöhnlich, beinahe wütend, und trieb die Hunde auf die verschneite Forststraße nach Norden. Über ihr wölbte sich ein dunkler Himmel, der Mond und die Sterne hatten sich hinter dichten Wolken versteckt. Die Luft roch nach Schnee. »Lauf, Skipper! Geht das nicht schneller? Lauft, ihr Lieben, strengt euch gefälligst an!«
Der frostige Fahrtwind schaffte es nicht ganz, ihre trüben Gedanken zu vertreiben, linderte sie aber, und das rasante Tempo zwang sie, sich mit allen Sinnen auf den Trail zu konzentrieren. Es gab nichts Besseres als eine Schlittenfahrt, um ihre Gedanken wieder auf das Wesentliche zu lenken. Manche Leute rasten im Auto durch die Gegend oder turnten sich im Fitnesszentrum die Seele aus dem Leib, wenn sie vergessen wollten. Sie floh in die Wildnis und fand in der Natur auf den richtigen Weg zurück. »Heya! Heya!« Lauter als sonst feuerte sie die Hunde an, so schnell wie selten zuvor raste sie über den Trail. »So ist es gut«, rief sie zufrieden, »so gewinnen wir das Iditarod!«
Jenn kannte die Trails in ihrer Gegend wie ihre Westentasche und hatte Routen in allen Schwierigkeitsgraden ausgesucht, um sich so gut wie möglich auf das Iditarod vorzubereiten. Die schwierigste führte über die Forststraße, auf der sie sich gerade befand, und einen gewundenen Jagdtrail in die Ausläufer der Berge, über zahlreiche Hügelkämme schließlich auf einem schmalen Pfad, der sich steil nach unten wand, auf die Forststraße zurück. Eine Tour, die den schwierigen Trail des Iditarod-Rennes nur andeuten konnte, den Hunden und ihr aber alles abverlangte, vor allem auf den Steigungen.
Ungefähr vier Meilen von ihrem Blockhaus entfernt bog sie auf den Jagdtrail in die Berge ab. Beinahe wütend lenkte sie den Schlitten in den tieferen Schnee, beide Hände an der Haltestange und den Kopf gegen den hier böig auffrischenden Wind gesenkt. Der Trail war nur wenig breiter als der Schlitten, und es bedurfte ihrer ganzen Aufmerksamkeit und Konzentration, um nicht vom Weg abzukommen und im Tiefschnee zu versinken. Alle paar Schritte musste sie runter von den Kufen und den Hunden durch kräftiges Anschieben helfen. Mit heiseren Schreien feuerte sie das Hundegespann an.
Dass sie in ihrem Eifer zu weit ging und von den Huskys zu viel verlangte, merkte sie erst auf dem Jagdtrail, der außerhalb eines Wäldchens in die Berge führte. Auf einem vereisten Hügelkamm ließ sie die Hunde zu schnell gehen, verlagerte ihr Gewicht so stark, dass ihr Schlitten ins Schlingern geriet, und wurde durch die heftige Bewegung von den Kufen geschleudert. Sie rollte schreiend den steilen Hang hinunter und blieb fluchend im Tiefschnee liegen.