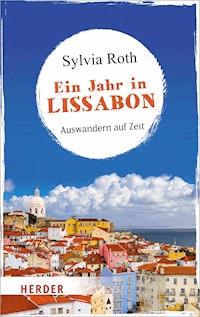
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie hatte sich rettungslos verliebt: Papierdecken, kunstvoll über den Tisch gebreitet, aus den Läden das Surren der Kaffeemaschinen, Schiffshupen vom Tejo her, die Frau, die in einem Holzkistchen ihren Kanarienvogel spazieren führte, der Kellner in Schwarzweiß, der eine Zigarette rauchte. Und die beiden alten Herren, die auf einer Parkbank ihr Nickerchen hielten. Sie konnte gar nicht anders. Sylvia Roth musste einfach nach Lissabon. Ein ganzes Jahr!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sylvia Roth
Ein Jahrin Lissabon
Reise in den Alltag
Impressum
Titel der Originalausgabe: Ein Jahr in Lissabon
Auswandern auf Zeit
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2016
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Designbüro Gestaltungssaal
Umschlagmotiv: © Sean Pavone – shutterstock
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book): 978-3-451-81151-7
ISBN (Buch): 978-3-451-06922-2
Inhalt
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Schnelles Dicionário
Setembro
ICH HATTE VIEL SORGFALT DARAUF VERWENDET, meine Koffer zu packen. Nicht nur mein grünes Sommerkleid und meine Sandalen waren ins Gepäck gekrochen, sondern auch ein paar warme Strickpullover und die Stiefel für den Winter. Ein Regenschirm gesellte sich zur Reiseversicherung, und mein Fotoalbum schlüpfte hinterher – unverhofft aufkeimendem Heimweh wollte ich mit durchblätterten Erinnerungen begegnen. Neben Fernando Pessoas „Buch der Unruhe“ begleitete mich ein Band über die großen portugiesischen Seefahrer, weil sich alles so aufregend anfühlte, als würde ich die nächsten zwölf Monate in ihrem abenteuerlichen Bugwasser schippern. Selbstverständlich reiste auch mein blau-weiß gestreifter Bikini mit, denn ich wusste: Das Meer ist nah. Und ganz zuletzt, ehe die Kofferschnallen zuschnappten, fügte ich den Straßenplan meiner neuen Stadt wie einen verheißungsvollen Kompass hinzu. Ja, in der Tat, ich hatte so vorausschauend gepackt, wie man es eben tun sollte, wenn man ein Jahr lang in die Fremde geht. Nur eines hatte ich vergessen: Ich hatte vergessen, Portugiesisch zu lernen.
Vielleicht hatte ich es auch einfach beharrlich verdrängt, Ausreden gab es schließlich genug. Mal stand mir ein Mangel an Zeit im Weg, mal ein Mangel an Disziplin. Immer, wenn mich meine Kollegen vor der Abreise fragten, ob ich denn schon Portugiesisch sprechen könne, verneinte ich mit leichtfertiger Geste. Das würde ich mir dann vor Ort draufschaffen, entgegnete ich und schickte dem erschrockenen „Mutig!“ meines Gegenübers noch ein neckisches Aperçu hinterher: Es gebe doch nichts Schöneres, als aufzubrechen, ohne sich vorher auszukennen. Vasco da Gama habe vor seiner Abreise ja auch nicht gewusst, was „Entdeckung“ in Sanskrit heißt.
Und nun, einen Tag nach meiner Ankunft in Lissabon, sitze ich mit ein paar italienischen Erasmus-Studenten in einem kleinen Zimmer einer Sprachschule nahe des Praça do Rossio und versuche, zu verstehen. „Percebes?“, fragt mich der Lehrer, und das Wort kommt in der Aussprache ganz und gar dreist daher, ohne Vokale, so, als hätte es polnische Vorfahren. „Prsbsch?“, wiederholt er, weil ich nicht reagiere. „Verstehst du?“ Nein, ich verstehe nicht. Denn das hat nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun, was da in meinem Buch steht. Da steht: p-e-r-c-e-b-e-r, Infinitiv für verstehen, wahrnehmen, erkennen. Und nicht prsbr. Ich schüttle den Kopf. „Estou confusa“, antworte ich, ich bin verwirrt. „Schtou“ korrigiert mich der Lehrer mit demonstrativ ausladender Bewegung der Kinnlade, „schtooouuuu“, „schtou cönfüsä“.
So ist das also. Die Portugiesen betrachten die Sprache als Mahlzeit – und deshalb reden sie mit vollem Mund. Sie kauen beim Sprechen. Sie essen die Vokale und spucken sie als Konsonanten wieder aus. Sie mauscheln stattliche, stolze lange Worte zu einem verworrenen Knäuel zusammen, der phonetisch auf einen einzigen Laut hinausläuft: „schsch“. Und wenn sie sich doch entschließen, einen Vokal zu verwenden, dann nur mit zugehaltener Nase. Meu Deus, Verzeihung, meu Deusch, das kann ja heiter werden.
Das Erste, was ich nach diesen vier Stunden Portugiesischunterricht mache, ist, zu flüchten. Ich stürze mich ins Gewirr schmaler und schmalster Gassen, streife ziellos nach rechts und nach links – und hadere: mit der Angst vor meiner eigenen Courage und den Fragen, die unerbittlich zu bohren beginnen. Was hatte ich mir nur dabei gedacht, meine Stelle zu kündigen, meine Wohnung aufzulösen und meine Freunde zu verlassen, nur, um einem Bedürfnis nach „Auszeit“ nachzugeben, das mir jetzt mehr als zweifelhaft erscheint? Was war so verlockend daran gewesen, ein einjähriges Kulturstipendium in Lissabon gegen mein Leben in Deutschland einzutauschen? Und woher, um Gottes Willen, hatte ich die Chuzpe genommen, zu meinen, ich könne all dies ohne Portugiesischkenntnisse tun? Was – außer Chaos – erhoffte ich mir von diesem unbedachten Seitensprung? Ich laufe und hadere, hadere und laufe, vorbei an Menschen und Hunden, Schaufenstern und Parkbänken, Straßenbahnschienen und Bushaltestellen. Bis ich endlich stehen bleibe, weil mir ein Duft in die Nase steigt. Ein Duft, der mich daran erinnert, dass es ein geheimes Gesetz gibt, das überall auf der Welt funktioniert: Wenn man verloren ist, kann man sich wiederfinden. Dort, wo es warm ist und wo es nach Essen riecht. Nach frischem Gebäck etwa. In Lissabon – so viel hatte ich bereits von dieser Stadt begriffen – tut es das alle zehn Meter, denn gefühlt alle zehn Meter gibt es eine Pastelaria. Eine Pastelaria in Portugal ist weder eine Bäckerei noch eine Konditorei. Sie ist ein Lebensort. Ein Ort, an dem man sich trifft und sich unterhält. Ein Ort, an dem man morgens kurz die Theke streift, um einen Kaffee zu inhalieren, ehe man zur Arbeit geht. An dem man mittags ein rustikales Essen zu sich nehmen kann, einen „prato do dia“. Und ein Ort, an dem man abends noch schnell ein paar „salgados“, ein paar salzige Kleinigkeiten, futtert, ehe man sich auf den Weg ins Kino macht.
Die meisten Pastelarias in Lissabon sind unprätentiös, sie haben keinen Stil und trotzdem unendlich viel Charme. Die Wände sind gekachelt oder auch nicht, die Theken verchromt und verglast, die Stühle und Tische aus Plastik oder Metall oder eben … eben irgendwie so, dass es sich gut sauber machen lässt. Wie bei einem Gebrauchsgegenstand ist Funktionalität von größter Bedeutung. Die eigentliche Einrichtung der Pastelarias ist das Gebäck, das sich in den Vitrinen befindet – und die Kellner, die dieses Gebäck verwalten. Sie sind wach und unglaublich schnell. Jede Bewegung ist gefüllt mit Effizienz, jedes Geschirrklappern ergibt Sinn. Mit sicherer Hand werden Unterteller geschichtet und Heerscharen von Tassen in die richtige Position gerückt. Die Zubereitung eines Kaffees ist von unübertroffen lakonischer Routine: Kaffee zapfen, Unterteller auf Theke, Tasse auf Unterteller, Löffel und Zucker dazu, servieren. Die Kellner arbeiten nicht, sie regieren, sie sind Herrscher eines unaufhörlich rotierenden kinetischen Kunstwerks.
Nun also, nachdem ich Gasse um Gasse hinter mir gelassen habe und endlich stehen geblieben bin, folge ich dem Duft in meiner Nase: Ich betrete eines dieser unaufhörlich rotierenden Kunstwerke, eines, das „Fabrico próprio“ auf seinem Namensschild verzeichnet hat, was auf eigene Herstellung verweist und deshalb besonders gelungenes Backwerk verspricht. Tatsächlich birgt die Vitrine ein Schlaraffenland, über das ich zärtlich meinen Blick schweifen lasse. Minutenlang. Dann hole ich Luft und beginne zu bestellen – mit dem Zeigefinger der rechten Hand. Ich bestelle einen Bolo de Arroz, eine Tarte de Amêndoa, ein Pastel de Nata, eine Tarte de Maçã und ein Mil Folhas. Zunächst schmeckt es nach süßem Reis, aber irgendwie auch nach Biskuit, dann nach Mandeln, nach Vanillepudding, nach Apfel und schließlich nach Blätterteig.
Das erste Stück beruhigt mich, das zweite macht mich glücklich. Beim dritten fühle ich mich ausgelassen, und ab dem vierten ist mir schlecht. Ich esse trotzdem weiter, denn mir scheint, ich habe eine ausgesprochen schmackhafte Form der Einbürgerung entdeckt. Ich gönne mir einen Bratapfel, weil es mich überrascht, so etwas Winterliches mitten im Spätsommer in einer portugiesischen Bäckerei zu finden. Und danach probiere ich noch zwei Sorten Kekse: die eine mit roter Marmelade in der Mitte und die andere mit Schokoladenkuvertüre. Zum Schluss soll es etwas Schlichtes, Unaufregendes, den Magen Beruhigendes sein, ein Pão de Leite, ein Milchbrötchen, das hier in Lissabon nicht rund, sondern in die Länge gezogen und wie eine Barke geformt ist. Und da passiert etwas, was mich zutiefst bewegt. Weil es so groß ist, schneidet der Kellner dieses Gebäckstück einmal in der Mitte durch, ehe er den Teller über die Theke schiebt. Es ist nur eine kleine Geste, doch hier in der Fremde erscheint sie mir wie ein unendlich großer Akt mütterlicher Fürsorge: Ein unbekannter Mensch teilt den Kuchen für mich, damit ich ihn leichter genießen kann. In diesem unscheinbaren Vorgang, der sich irgendwo in einer ebenso unscheinbaren Pastelaria nahe des Hospital dos Capuchos vollzieht, finde ich mein erstes Stück portugiesische Heimat. „Obrigada“, lächle ich dem Kellner zu, bevor ich mir das Pão de Leite in den Mund schiebe, danke schön. Ich glaube, ich bin soeben ein klitzekleines bisschen angekommen. Und deshalb, so glaube ich, kann es jetzt losgehen.
✽✽✽
Es war vor drei Jahren gewesen, als ich mich rettungslos verliebt hatte. Ich war zu einer viertägigen Kurzreise nach Lissabon geflogen – und wollte nicht mehr weg. Weil mich alles, was ich in dieser Stadt sah und erlebte, unmittelbar begeisterte: die Papiertischdecken, die bereitgelegt wurden, als ich mein Mittagessen aß, das Surren der Kaffeemaschinen, das aus den Läden in die Straßen drang, die Schiffshupen, die ich vom Tejo hörte. Ich verliebte mich Hals über Kopf in die beiden alten Herren, die auf einer Parkbank ihr Nickerchen hielten, in die Frau, die ein Holzkistchen mit einem Kanarienvogel spazieren trug, in den Schuhputzer, der sein Werkzeug ordnete, in den Metzger, der ein komplettes Spanferkel über die Straße wuchtete, in die Katze, die von ihrem Frauchen an der Schnur im Jutesack aus dem Fenster auf die Straße hinabgelassen wurde, und in den Kellner, der mit weißem Hemd und schwarzer Hose in der Tür stand, um eine Zigarette zu rauchen. Ich war von einer Sekunde auf die andere verschossen in die Poesie dieser Stadt und fühlte mich, während ich durch all diese Momentaufnahmen hindurchging, wie in einem Film, der gemeinsam von Fellini, Bergman und Kaurismäki gedreht wurde. Nur unter einer Bedingung hatte ich mich damals dazu überreden können, wieder ins Flugzeug nach Deutschland zu steigen – unter der Bedingung, zurückzukehren. Für länger. Für ein ganzes Jahr.
Sieben Stücke portugiesisches Gebäck, ein Bratapfel und ein Kellner waren nötig gewesen, um mich – gebeutelt, wie ich von einem ersten, unverhofft frühen Kulturschock war – an all das zu erinnern. Doch nun, da ich den Magen voll Lissabon habe, steigt Lissabon mir auch zurück ins Herz – begleitet von einer unbändigen, erwartungsvoll prickelnden Neugierde auf all das, was kommen wird.
Ich schiebe die leeren Kuchenteller weg, ziehe das Vokabelheft aus meiner Tasche und finde, dass es viel zu viele leere Seiten hat. Nichts als die zehn Wörter, die ich mir heute im Unterricht aufgeschrieben habe, steht darin. Dabei wartet es doch nur darauf, gefüllt zu werden! Mit Vokabeln. Und mit all den Besonderheiten des portugiesischen Alltags, über die ich in den ersten Tagen stolpere, weil sie so neu sind. So neu und ungewohnt. So aufregend anders eben. Vamos lá!
• Die erste Lektion, die ich in Lissabon erhalte, heißt Suppe. Sie könnte auch Herzlichkeit oder Gastfreundschaft oder Familie heißen, aber ich muss ja nicht gleich mit so großen Begriffen hantieren. Ich habe diese Lektion bereits gestern, zwei Stunden nach meiner Ankunft am Flughafen gelernt, als mir die Familie vorgestellt wurde, bei der ich die kommenden zwölf Monate leben werde. Die Mutter, Marta, ist eine fünfzigjährige schöne Lisboeta, nicht mit dunklen, sondern blonden Haaren und strahlend blauen Augen. Jorge, der Vater, begrüßt mich mit den Worten „Bem-Vindo à Lisboa“, willkommen in Lissabon, und Felipe, der einundzwanzigjährige Sohn, der die gleichen blauen Augen wie seine Mutter hat, findet es, glaube ich, nicht so erquickend, dass da jetzt eine Fremde ins Zimmer neben ihm einziehen wird. Aber das macht nichts. Denn jetzt wird erst einmal Suppe gegessen. Ja, ich weiß, mir scheint das auch überraschend und irgendwie unpassend für ein südliches Land, aber Suppe ist von immenser Bedeutung in Portugal. Man kann sie in jeder Pastelaria für einen Euro bestellen und etwas garantiert Köstliches, Hausgemachtes kriegen. Nicht, wie man meinen würde, etwas Leichtes, Kaltes, den Temperaturen Angemessenes. Sondern üppige, schwere, sämig pürierte Gemüsesuppen. Suppen, die ganz weich die Kehle hinunterrinnen und von innen wärmen. Suppen, die irgendwie zufrieden machen. Suppen, die stärken und stabilisieren. Sodass der Schock nicht ganz so groß ist, wenn Marta, die bisher ein sehr gutes Englisch mit mir gesprochen hat, mir nun eröffnet, dass wir ab morgen nur noch auf Portugiesisch reden werden. Weil ich es ja sonst nicht lerne. „Está bem?“
• In der zweiten Lektion erfahre ich, dass man in Portugal kein Englisch braucht. Nicht nur, weil Marta Portugiesisch mit mir reden will, sondern weil man hier nicht auf Worte wie O.K. angewiesen ist. Man hat hier nämlich sein eigenes O.K. Und das heißt: „Está bem?“, sprich: „Tá bejm.“ Man muss diese beiden Worte circa 872 Mal pro Tag anwenden und kann das in verschiedenen Schattierungen tun, herausfordernd, ermutigend, vorwurfsvoll, zärtlich. Manchmal kann man auch abkürzen und einfach nur bestätigend „Tá, tá“ sagen. Wenn die Sache sowieso schon klar ist. Oder wenn einem vor Schreck darüber, dass ab morgen nur noch Portugiesisch gesprochen werden soll, die Suppe im Hals stecken geblieben ist.
• Als Drittes erfahre ich, dass auch jetzt, wo ich mich verschluckt habe, trotzdem alles gut ist. Nicht 872, aber 623 Mal am Tag sagt man hier nämlich „Tudo bem?“ – Alles gut, alles klar? Meist im Zusammenhang mit einer Begrüßung verwendet, gibt es darauf die unterschiedlichsten Reaktionsmöglichkeiten. Wer gerade selber nicht so genau weiß, wie er sich in seiner Haut fühlen soll, der kann die Schultern zucken und etwas gequält ein „Mais ou menos …“ („Mehr oder weniger …“) durch die Lippen quetschen; wer sich gerade frisch verliebt oder im Lotto gewonnen hat, wirft seinem Gegenüber ein strahlendes „Sim, tudo óptimo!“ zu, alles suuuper! Laut Marta ist Ersteres die portugiesische und Letzteres die brasilianische Variante. Wer sich nicht in nationale Streitigkeiten einmischen möchte, kann aber auch neutral bleiben, sich für die dritte Option entscheiden, es genießen, endlich mal wieder einen Vokal aussprechen zu dürfen, und einfach nur sagen: „Sim, tuuuudo.“
• Als Viertes wundere ich mich darüber, dass Fado manchmal auch Reggae heißen kann. Marta stellt mir nämlich nun, da wir unsere Suppe gegessen haben, ein weiteres Familienmitglied vor: Bob Marley. Bob Marley ist ein gut genährter getigerter Kater mit einem weißen Fleck unter der Schnauze. Und wenn Bob Marley maunzt, sagt er nicht „Miau“, sondern „Machão“. Marta meint, das habe damit zu tun, dass Bob Marley vor zwölf Jahren, als kleines unschuldiges Kätzchen mit einer Hündin aufgewachsen ist und deshalb nie wusste, ob er nun bellen oder miauen soll. Ich habe da aber eine andere Theorie. Ich glaube, dass Bob Marley Portugiesisch spricht und deshalb nicht den Reggae, sondern den Fado im Blut hat. Das „ão“ am Ende des Wortes verweist eindeutig auf einen der wichtigsten portugiesischen Nasallaute, den Diphtong. Und den hat Bob Marley drauf wie kein anderer. Ich fände es überheblich, meiner frisch gewonnenen und so liebenswürdigen portugiesischen Gastfamilie gleich am ersten Tag mit Reformen ins Haus zu fallen. Ich möchte auch das Tier nicht unnötig verwirren. Deshalb behalte ich es erst einmal für mich, dass ich Bob Marley soeben umgetauft habe. Er ist nun nach einer der berühmtesten Fado-Sängerinnen aller Zeiten benannt und heißt Amália. Amália Rodrigues.
• Das Fünfte, was ich von den Portugiesen lerne, ist Höflichkeit. „Zzzzz … zzzzz“, zischt es in den ersten Tagen immer dann, wenn jemand auf den schmalen Trottoirs an mir vorübergeht. Anfangs zucke ich zusammen und frage mich, ob die Leute etwas gegen mich haben, dann identifiziere ich hinter den beiden Konsonanten ein Wort: „Com licença“, raunen mir die Menschen zu, was so viel wie „Sie gestatten“ bedeutet. Bei jeder Gelegenheit, egal, ob man eng an jemandem vorbeistreift oder sich im Café zu jemandem an den Tisch setzt, ja, letztlich immer dann, wenn man eine Grenze überschreitet und den Bereich des anderen betritt, wird um Erlaubnis gebeten. Und das geht weit über eine bloße Floskel hinaus.
An der Bushaltestelle reiht man sich gehorsam in einer Schlange auf – und selbst dann, wenn alles geregelt scheint, lässt beim Einsteigen in den Bus jeder dem anderen den Vortritt. Weshalb es passieren kann, dass manchmal vor lauter Beflissenheit gar nichts mehr geht. Im Innern des Busses mündet diese gute Erziehung in ein skurriles Bäumchen-Wechsel-dich-Spiel: Die Vorderen rücken nach hinten auf, um den neu zusteigenden Fahrgästen Platz zu machen, vor allem den älteren und gebrechlichen Menschen. Auch im Supermarkt herrscht Entgegenkommen: An der Kasse werde ich vorgelassen, weil ich zwei Salatköpfe weniger in meinem Einkaufskorb habe als die Dame vor mir. Und in der Straßenbahn bietet mir ein Herr seinen Platz an, damit der Kuchen, den ich in der Hand balanciere, wohlbehalten zu Hause ankommen kann.
• Für die sechste Lektion fehlt mir das richtige Wort, deshalb sage ich provisorisch, dass die sechste Lektion, die ich von den Portugiesen lerne, Dezenz ist. Weil ich mich hier in den ersten Tagen wie ein Elefant im Porzellanladen fühle. Wenn ich morgens mit nassen Haaren das Haus verlasse, im Gehen ein Stück Gebäck in mich hineinschlinge und mit einem kräftigen Schluck aus der Wasserflasche nachspüle, dann weiß jeder, aber auch wirklich jeder, dass ich eine Ausländerin bin. Eine Portugiesin würde sich weder ungeföhnt auf die Straße wagen noch ebendort essen oder trinken. Wenn ich, weil ich ein kleines bisschen lernfähig bin, darauf verzichte, auf der Straße zu frühstücken und stattdessen in eine Pastelaria gehe, um eine „Torrada“ zu verzehren – eines jener fluffigen Weißbrote, die getoastet und dick mit köstlicher gesalzener Butter bestrichen werden –, und mir dabei genüsslich die fettgetränkten Finger ablecke, dann weiß jeder, aber auch wirklich jeder, dass ich eine Ausländerin bin. Denn als Portugiese nimmt man die Torrada selbstverständlich mit Serviette in die Hand. Dafür sind die dünnen Papiertücher, die auf jedem Tisch in einer Metallbüchse bereitstehen, ja schließlich da.
• Als Siebtes muss ich einsehen, dass der Gehweg nicht nur den Fußgängern gehört. Genauso wenig, wie er nur den parkenden Autos vorbehalten ist. Nein, auch Tretminen haben ein Recht auf ein Zuhause. Deshalb kann man in einer pittoresken Stadt wie Lissabon gerne den Blick auf die Häuserfassaden und die Aussicht richten – doch es empfiehlt sich, bei einem Gang durch die Straßen immer auch den Boden im Auge zu behalten, eben wegen der Hundehaufen. Alle paar Meter findet sich einer, je nachdem frisch deponiert oder bereits von einem tolpatschigen Fuß, der meist einem Touristen gehört, zu einem schönen abstrakten Gemälde verteilt. Wer will, kann im Zusammenhang mit dieser Lektion auch lernen, den Vierbeinern bei der Verrichtung ihrer Arbeit auf dem Trottoir ebenso versonnen und liebevoll zuzuschauen, wie das die Besitzer tun.
• Als Achtes will ich einfach nicht akzeptieren, dass es hier nie eine Tüte zu viel gibt. „Não preciso do saco – Ich brauche keine Tüte“ ist einer der ersten Sätze, den ich absolut fehlerfrei aussprechen kann. Doch egal, wo ich einkaufe, und egal, ob ich sie will oder nicht – die Verpackung wird an jeder Kasse automatisch mitgeliefert. Garniert mit einem Lächeln der Kassiererin, die sich, schwankend zwischen Fassungslosigkeit und Mitleid, zu fragen scheint, warum ich meinen Feldzug gegen die Plastiktüten dieser Welt denn ausgerechnet auf portugiesischem Gebiet führen muss.
• Das Neunte, was ich lerne, ist spucken. Wenn man an der Straßenbahnhaltestelle steht und wartet, kann man sich die Zeit damit vertreiben, einfach mal zwischendurch auf den Boden zu spucken. Ein Hobby, das sich auch im Gehen ausüben lässt – vom Trottoir gezielt auf die Straße etwa. Doch diese Lektion, so fällt mir gerade auf, muss ich mir wieder abgewöhnen. Sie ist nämlich leider nur für Männer gedacht.
Ich könnte stattdessen mit dem Rauchen anfangen, weil das hier alle, insbesondere die Frauen, tun. Aber das überlege ich mir noch.
• Als Zehntes begreife ich, dass Anhalten manchmal besser ist als Laufenlassen. Öffentliche Toiletten in Lissabon sind eine Spezies für sich, denn entweder sind sie total verschmutzt oder aber mit einem Chlor-Reinigungsmittel so nachhaltig geputzt, dass man Gefahr läuft, die Nasenschleimhäute zu verlieren. Das Türschloss funktioniert nur selten, oft ist es gar nicht existent, sodass man ein bisschen akrobatisches Geschick unter Beweis stellen muss, um gleichzeitig sein Geschäft zu verrichten, sich vor unerwarteten Besuchern zu schützen und sich gegebenenfalls wegen des Chlorgeruchs die Nase zuzuhalten. Da die Abflussrohre alt und schnell überfordert sind, wird man außerdem in den meisten öffentlichen Toiletten, manchmal auch in Privatwohnungen, darum gebeten, das Papier nicht in die Kloschüssel, sondern in den bereitgestellten Korb zu werfen. Nicht selten hat der Korb einen Deckel und trägt so seinen bescheidenen Anteil dazu bei, die logistischen und gymnastischen Anforderungen der Unternehmung zu erhöhen. Es empfiehlt sich also, den Gang zur Toilette in Lissabon nicht leichtfertig, sondern mit einem gewissen Verantwortungsgefühl zu behandeln und zuvor eine kleine Meditation einzulegen, um sich mental zu sammeln.
• An der elften Lektion scheitere ich. Vorerst zumindest. Sie ist aber von immenser Bedeutung für den Alltag in Lissabon, sodass ich sie nicht einfach links liegen lassen darf. Doch ich denke, dass ich in diesen ersten beiden Wochen, die wie im Flug vergangen sind, so viel Neues gelernt und so viele Seiten in meinem Vokabelheft gefüllt habe, dass ich kurz durchatmen kann. Ich kann es mir erlauben, mich in Zuversicht zu üben, denn ich habe nun zwar keine solide, aber eine anfängliche Basis für den Alltag in Lissabon. Ich kann endlich meine Koffer auspacken, kann mit Marta und Jorge eine Suppe zu Abend essen und den Kater Bob Marley alias Amália Rodrigues ausnahmsweise – aber nur dieses eine Mal – bei mir im Bett übernachten lassen. Ich kann mich darauf freuen, dass morgen auch noch ein Tag ist. Morgen ist der 1. Oktober. Morgen kann es weitergehen. Mit meinem neuen Leben in Lissabon und der elften Lektion: „Hügel – oder Auf und Ab“.
Outubro
ANGEBLICH, SO WILL ES EINER DER VIELEN ENTSTEHUNGSMYTHEN, die sich um Lissabon ranken, sei die Stadt von Odysseus gegründet worden – auch er ein Seefahrer, vielleicht der erste der Weltgeschichte. Ein Meeresungeheuer habe sich ihm beim Schippern durch den Atlantischen Ozean in den Weg geschlängelt und er habe es kurzerhand „erlegt“ – auf den zusammengekringelten Überresten des Ungetüms sei die Stadt „Ulissipo“ mitsamt ihrer sieben Hügel, mitsamt ihrer „bucklichten“ Geografie entstanden. Wer Lissabon erstmals bereist, den besticht vielleicht am meisten diese hügelige Beschaffenheit und das, was sie mit sich bringt: dass sich beim Flanieren durch die Stadt immer zugleich auch ein Ausblick auf sie eröffnet, dass sich die Perspektive immer wieder überraschend von Zoom auf Vogelperspektive schaltet und man unverhofft Lissabon als Ganzes sehen kann. Mal liegt es einem zu Füßen mit seinem orientalisch anmutenden Kaleidoskop aus schmalen, steilen Gässchen und Treppen, seinem verwinkelten Chaos aus weißen Wänden und orangefarbenen Steinen. Mal kann man es von unten, aus der klaren Struktur der Baixa heraus, dabei betrachten, wie es sich zärtlich an die Hügel schmiegt. Immer jedoch zeigt es sich dem Auge, offenbart sich, bietet sich dar in seiner hinreißend kruden Gemengelage.
Schon bei meinem ersten Besuch vor drei Jahren hatten mich diese Anblicke fasziniert, und auch jetzt, im Alltag, bezaubern sie nicht minder. Nachdem nun aber zwei Wochen hinter mir liegen und meine Beinmuskulatur und ich begriffen haben, dass wir dieses Mal nicht als flüchtige Touristen hier sind, beschleicht mich beim Gedanken an Odysseus immer öfter die Frage, warum er die größeren sterblichen Überreste des Ungeheuers nicht einfach mit nach Griechenland genommen hat, als er sich auf den Nachhauseweg machte. Ich wandere gern, doch lieber im Gebirge als in der Stadt, noch dazu einer solchen, in der der Untergrund aus rutschigen, holprigen Pflastersteinen besteht, an denen sich die Zehen durch die Sohlen hindurch festkrallen müssen, um nicht kurzerhand wieder bergab zu gleiten. Wie manche Portugiesinnen hier mit Stöckelschuhen reüssieren können, ist mir ein absolutes Rätsel. Lissabon, so meine Theorie, besitzt eigene physikalische Gesetzmäßigkeiten, denn die Schwerkraft funktioniert hier anders als im Rest der Welt. Magneten scheinen unter den Trottoirs verborgen, und selbst die Treppenstufen sind definitiv höher und anstrengender als anderswo. Vielleicht muss man hier geboren sein, um die Steigung bewältigen zu können, immerhin sehe ich auch Achtzigjährige, die wacker bergauf unterwegs sind. Wohingegen die drei Radler, die mir bisher begegnet sind, immer nur abwärts fahren, weshalb ich sie bald im Verdacht habe, für die umgekehrte Richtung sich selbst und das Fahrrad in den Bus zu packen. Doch es hilft nichts, die Hügel sind da, die Pflastersteine auch, physikalische Gesetze lassen sich nicht außer Kraft setzen, höchstens überlisten, und so beschließe ich, ab sofort meinen inneren Schweinehund zu überwinden und zwei Mal pro Woche schwimmen zu gehen, um meine Kondition den Gegebenheiten Lissabons anzupassen.
Öffentliche Schwimmbäder sind rar in Lissabon, auf dem Stadtplan nicht eingezeichnet und auch in meinem Reiseführer nicht vermerkt. Es dauert eine Weile, bis ich mir von all meinen bisherigen Bekanntschaften ein ratloses Kopfschütteln abgeholt habe und dann doch noch per Zufall ein „piscina“ in meiner Nähe ausfindig machen kann. Und es dauert eine noch viel längere Weile, bis die Dame am Schalter,die kein Englisch spricht, alle verfügbaren Mitarbeiter des Hauses herbeigetrommelt hat, um mich in die komplizierte Logistik eines Stundenplans einzuweihen, der darüber verfügt, wann das Schwimmbad wegen der Schulklassen und Seniorenkurse geschlossen und wann es frei zugänglich ist – und wie viele Bahnen dann jeweils benutzbar sind. Die Notwendigkeit dieses ausgeklügelten Systems erschließt sich mir, als ich die Größe des Schwimmbads realisiere: ganze drei Bahnen breit, 15 Meter lang und 1,20 Meter tief, eine Miniatur gewissermaßen, dafür mit wunderhübsch bemalten Kacheln und durch die Fensterfront hereinfallenden Sonnenstrahlen versehen. Für ein Volk, das dem Wasser historisch und geografisch so eng verbunden ist, schwimmen die Portugiesen höchst ungern, viele Angehörige der älteren Generation haben es auch nie gelernt, mehr als einmal beobachte ich berührende Szenen, wie etwa eine junge Frau einer alten Dame das Schwimmen beibringt. Schwimmbäder, so lerne ich, sind auch weniger zum Schwimmen da als vielmehr zur Aquagymnastik – daher die geringe Wassertiefe. Folgerichtig begrüßt mich in der Umkleidekabine eine Gruppe fröhlich lärmender Hausfrauen, die sich mit dem Schlachtruf „Vamos trabalhar – Lasst uns arbeiten!“ in die brühwarmen Fluten stürzen, um unter der Anleitung des Bademeisters, eines Kolosses mit T-Shirt-Aufdruck „Nadador Salvador“ (was eigentlich „Rettungsschwimmer“ heißt, mich aber dazu verführt, ihn „Schwimmer Salvador“ zu nennen), ihre Muskeln zu trainieren und sie so für die Berge Lissabons zu stählen. Michael Jackson und ABBA helfen, Busen und Wasser in Wallung zu bringen, und während ich beginne, daneben meine Bahnen zu ziehen, kann ich staunend beobachten, wie sich die sorgsam unter Badehauben verborgenen Köpfe zu immer neuen Formationen gruppieren. Mal heben sich die Arme grazil aus dem Wasser, mal tauchen sie wieder unter, mal neigen sich die Schultern nach links, mal zeigt sich kess ein Fuß. Wie das Papier im Proust’schen Wasserglas entfalten sich Choreografien von einer solchen Eleganz, dass ich die Damen „as sereias de Lisboa – die Wassernixen von Lissabon“ taufe.
Doch nun kommt Nadador Salvador zu mir, und während ich mich noch frage, ob er mich vielleicht einladen will, an der Vorführung teilzuhaben, hat er nur einen Satz für mich übrig, den er aber drei Mal wiederholen und mit vehementer Zeichensprache untermalen muss, bis ich ihn sowohl sprachlich als auch inhaltlich verstanden habe: Es sei hier nicht erlaubt, im Bikini zu schwimmen, beim nächsten Mal müsse ich einen ganzteiligen Badeanzug tragen.
Wie in einer geheimen choreografischen Verabredung drehen sich die Köpfe der Sereias de Lisboa synchron zu mir. 21. Jahrhundert. Punkt. Europa. Punkt. Und ich darf nicht im Bikini schwimmen – Fragezeichen! Warum? Entspricht mein blau-weiß gestreifter Zweiteiler nicht den ästhetischen Anforderungen? Habe ich gegen hygienische, kulturelle oder religiöse Vorschriften verstoßen? Handelt es sich um eine Intrige, um Schikane, um Wichtigtuerei? Noch sind meine Portugiesischkenntnisse zu rudimentär, um eine Diskussion mit Nadador Salvador zu eröffnen. Ganz sicher ist mit ihm auch nicht zu spaßen, denn wer den Matador im Namen trägt und täglich Heerscharen von Seniorinnen in Bewegung versetzt, muss sich nicht unter Wert verkaufen. Es bleibt mir also nichts anderes übrig, als mich dem Gesetz zu beugen. Doch ich möchte es auf besondere Weise tun – und so, dass es den Eigentümlichkeiten der Stadt angemessen ist. Deshalb kaufe ich meinen Badeanzug nicht etwa im Sportgeschäft, sondern in der Baixa, Lissabons Unterstadt, in der sich ein altertümlicher Laden an den anderen reiht und nicht nur die Gebäude, sondern auch die in ihnen ausgestellten Waren unter Denkmalschutz zu stehen scheinen. Der eine Ladenbesitzer verkauft Knöpfe und Fadenrollen, der andere Strickwaren und Wolle, der nächste altmodische Kittelschürzen, Morgenmäntel – und immerhin drei Badeanzüge. Unmittelbar sticht mir ein Prachtstück für die Frau ab siebzig ins Auge, mit halblangem Bein und integriertem Spitzbusen-BH, floral in geschmackvollem Braun-Orange gemustert, dezent und glamourös zugleich mit feinen Goldfäden durchwirkt. Die Patina wird kostenlos mitgeliefert, denn hier schlummert ein Ladenhüter, der seit sicherlich vierzig Jahren nicht wachgeküsst wurde. Ob er denn nicht viel zu groß für mich sei, fragt mich der Verkäufer verstört, die Verwirrung ist ihm ins Gesicht geschrieben. Da ich ihm eine schlaflose Nacht ersparen will, erlöse ich ihn und sage, es sei ein Geschenk für meine Großmutter, woraufhin er mir das Fossil strahlend und sorgsam in Packpapier wickelt, ehe er es über die Theke schiebt. Die Frau Großmutter werde bestimmt zufrieden sein, solch eine gute Qualität gebe es heutzutage nur noch selten – und als ich beim nächsten Schwimmbadbesuch die Kinnlade von Nadador Salvador herunterklappen sehe, bin auch ich überzeugt, einen hervorragenden Kauf getätigt zu haben.
✽✽✽
Ich bin nun stolze Besitzerin eines hinreißenden Badeanzugs und einer zunehmend kräftiger werdenden Beinmuskulatur. Davon abgesehen kann ich zahlreiche weitere Lernerfolge verbuchen, die ich wie stolze Trophäen in meinem Notizbuch gesammelt habe:
•





























