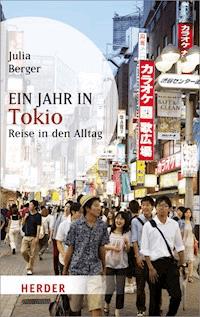
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Endlich wieder Tokio: Fremd und faszinierend hatte die riesige Stadt beim ersten Besuch auf Julia Berger gewirkt, nun wird sie für ein Jahr ihr Zuhause werden. Wie wird sich ihr Eindruck von Land und Leuten verändern? Was geschieht, wenn sie ihre alte Liebe wieder trifft? Und wie kann der Alltag in einer Stadt aussehen, die einem immer neue Rätsel aufgibt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Julia Berger
Ein Jahr in Tokio
Reise in den Alltag
Impressum
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2012
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlagkonzeption: Agentur RME Roland Eschlbeck
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: © Mauritius Images
ISBN (E-Book): 978-3-451-34673-6
ISBN (Buch): 978-3-451-06294-0
Inhalt
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Nach dem Jahr
Januar
4. Januar 2010
Wieder ein roter. Und nicht meiner. Die Koffer gleiten an mir vorbei, und rings um mich greifen Hände nach ihnen, ziehen sie vom Band, machen sich mit ihnen davon. Ich stehe da und schaue ihnen nach, wie verpassten Chancen.
Knapp fünfundzwanzig Kilo habe ich aus meinem alten Leben mit hierher genommen. Die Auswahl der Dinge, die mich um den halben Erdball begleiten sollten, ist einfacher gewesen, als ich mir das zunächst gedacht hatte. Denn selbst als ich mich nur auf das Nötigste beschränkte, war der Koffer im Nu bis an den Rand gefüllt gewesen. Alles andere musste zurück in mein altes Kinderzimmer – und steht nun zwischen den Ikea-Möbeln meiner Studentenzeit, Klamottenkisten, ausrangierten Tennisschlägern und leicht vergilbten Stofftieren.
Richtig verwundert hatte es meine Eltern nicht, als ich ihnen mitgeteilt hatte, dass ich für ein Jahr nach Japan gehen wollte. Immer wieder hatte ich ihnen von dem Land vorgeschwärmt, versucht, es ihnen ebenfalls nahezubringen. Doch ihre Gesichter, als ich ihnen zu Weihnachten statt der traditionellen Bratwürste selbst gemachtes Sushi servierte, hatten mich schließlich davon überzeugt, dass man Träume nicht teilen konnte. Besonders nicht, wenn sie in Algenpapier gewickelt sind.
„Und deine Wohnung in München?“, hatte meine Mutter gefragt.
„Ist ja eh nur ein WG-Zimmer. Da wollte ich ohnehin schon lange raus.“
„Und du findest da Arbeit?“
Das Architekturbüro, in dem ich arbeitete, hatte mir vor Kurzem gekündigt. Es war das erste Mal gewesen, dass ich länger als ein paar Monate in einem Büro angestellt gewesen war, zuvor hatte ich mich durch verschiedene Praktika gehangelt. Doch obwohl die Chefs und Kollegen dieses Mal nett gewesen waren, hatte mich die Kündigung nicht wirklich schockiert. Das „Pläneschrubben“, also das Zeichnen am Computer, machte mir einfach keinen Spaß. Bäumler, einer der Chefs im Büro „B2 Architekten“ und derjenige, mit dem ich bei meiner Arbeit am meisten zu tun hatte, schien nicht bemerkt zu haben, dass ich nicht besonders an dem Job hing. „Die Aufträge, Julia, die Aufträge fehlen einfach. Tut mir leid. Aber wenn du willst, kann ich mich bei den Kollegen mal umhören, ob sie jemanden brauchen.“ Ich wollte nicht. Das war doch ein Wink des Schicksals. Wie oft hatte ich in den letzten Monaten das Gefühl gehabt, mein Leben an ein Ziel verschenkt zu haben, das nicht das meine war. Jetzt war ich gezwungen, etwas zu ändern, und würde es auch tun.
„Mama, da findet sich schon was. Hat doch bis jetzt auch immer geklappt.“
Sie sagte nichts mehr, doch aus ihrem Blick las ich deutlich, was ihr auf der Zunge lag: „Kind, du bist schon 28. Meinst du nicht, du solltest dir langsam die Flausen aus dem Kopf schlagen?“
Dort hinten, das muss er sein! Ich fixiere den roten Koffer, der nun polternd auf das Band fällt. Gleich werde ich aus dem stickigen Saal verschwinden können. Die Einreiseprozedur hatte ich ja schon hinter mir, samt Fingerabdruck-Scan und Identifizierungsfoto. Das Multifunktionsgerät, das den Neuankömmlingen die persönlichen Merkmale entlockt und für die Ewigkeit speichert, hatte mich ein wenig an ein Hündchen erinnert. Daran waren vor allem die Scanner-Arme schuld, die sich dem Reisenden wie zwei Pfoten entgegenstreckten. Statt eines Gesichts wendet einem der Roboter einen Bildschirm zu, und ein bunter Schriftzug heißt den „Gaikokujin“, also Ausländer, in Japan willkommen. Hat sich der Einreisende dazu bequemt, seine Finger auf die Pfoten zu legen, knipst einen das Gerät mit seiner in die Stirn integrierten Kamera. Schöne neue Welt? Nun ja, ich hatte es jedenfalls hinter mir, ebenso den Temperaturscanner, der nichts an meinen Graden auszusetzen gehabt hatte, auch wenn es mir seit meiner Ankunft gleichzeitig heiß und kalt ist. Denn wenn ich nun endlich mein Gepäck habe, muss ich nur noch durch den Zoll – dann bin ich draußen, in diesem Land, nach dem ich mich so sehr gesehnt habe. Und werde Satoshi treffen. Wenn er gekommen ist, wie er es mir in seiner Mail versprochen hatte. Ich schnappe nach dem roten Koffer und wuchte ihn mit Schwung vom Band. Fast treffe ich dabei den Fuß des japanischen Familienvaters neben mir. Sein erschrockenes „Ah!“ macht mir meinen Fauxpas bewusst. Ich schenke ihm ein entschuldigendes Lächeln. Doch ihm ist seine Reaktion wohl peinlich. Oder aber er will verhindern, dass sie mir peinlich ist – jedenfalls sieht er mich gar nicht an.
Wie wird es sein, Satoshi wiederzusehen? Fast drei Jahre haben wir uns nicht getroffen, und auch schon lange nicht mehr telefoniert. Bei der verzögerten Verbindung über das Internet, den Sprachschwierigkeiten und der Tatsache, dass es wenige Gemeinsamkeiten in unserem Alltag gab, war es immer eine Tortur gewesen. Wer will schon immer über das Vergangene reden? Und dabei Gefühle ausgraben, von denen man nicht weiß, wie man sie einordnen soll?
Wir hatten uns in München kennengelernt. Er studierte dort als Austauschstudent Architektur, im selben Semester wie ich. Wir verstanden uns gut, er brachte mir etwas Japanisch bei, und wir unternahmen öfter etwas zusammen mit ein paar anderen Freunden. Und irgendwann auch ohne sie. Auf dem Weg zum Zoll werden die Erinnerungen immer lebendiger. Sein Akzent, und die Silben, die er an die deutschen Wörter anhängte, sodass sie japanisch klangen: „ich-o auch-o.“ Seine Verwunderung, dass Dallmayr ein Firmenname war, und nicht „Daruma-ya“, Laden für die typischen japanischen Daruma-Figuren, bedeutete. Der Tag, als er mir mit einem Anti-Mitesser-Pflaster auf der Nase die Tür seiner Studentenwohnung öffnete und ich mich beherrschen musste, nicht lauthals loszulachen, da ich noch nie einen Mann getroffen hatte, der sich Anti-Mitesser-Pflaster auf der Nase klebte.
Unter dem Porträt Ludwigs II. küssten wir uns das erste Mal. Den Platz hatten wir uns nicht bewusst ausgesucht. Aber das üppig Bayerische, das das Fraunhofer – eine Gaststätte im Münchner Glockenbachviertel – ausstrahlte, hatte uns einander vielleicht doch näher gebracht. Die Schatten der Hirschgeweihe auf der Wand, die verspielten Ranken der Stuckdecke, die hölzerne Wandverkleidung, die den Raum in eine irdische und eine himmlische Sphäre zu teilen schien. Das alte Parkett mit seinen schwarzen, abgetretenen Stellen, die wirkten, als ob sich die Beine der Holzstühle dort tief eingegraben hätten. Die beiden halb vollen Weißbiergläser vor uns, an denen wir uns bisher festgehalten hatten.
Ob Satoshi sich hier fremder fühlte als anderswo? Oder ob er darin eine zweite, andere Heimat erkannte? Seine Hand lag auf meinem Oberschenkel. Mein Gesicht an seiner Schulter. Dann seine Finger auf meiner Wange. Meine Lippen auf seinem Mund. Und König Ludwig sah über uns hinweg, in die unbestimmte Ferne.
Wenig später war sein Austauschsemester zu Ende und er ging zurück nach Tokio. Ein halbes Jahr später besuchte ich ihn dort – inzwischen mit jeder Menge Halbwissen über dieses Land und grundlegenden Japanischkenntnissen, die sich mein vom plötzlichen Abschied noch stärker entflammtes Herz gierig angeeignet hatte. Die drei Wochen gingen viel zu schnell zu Ende. Es war August, ich wohnte in Satoshis winziger Studentenbude ohne Klimaanlage und zerfloss in der Hitze des japanischen Sommers. Statt trauter Zweisamkeit zog ich oft mit dem Reiseführer alleine los – für Satoshi war es selbstverständlich, trotz Semesterferien jeden zweiten Tag an seinem Lehrstuhl an der Uni anwesend zu sein. Dass ich mich darüber – von Exfreunden anderes gewöhnt – aufregte, war klar. Dass er das – von Exfreundinnen anderes gewöhnt – nicht verstand, ebenfalls.
„Wir haben uns ein halbes Jahr nicht gesehen, und du hast kaum Zeit für mich!“
„Kaum Zeit für dich? Ich tue doch schon mein Bestes! Gestern waren wir in Kamakura, und morgen Abend sehen wir uns das Feuerwerk in Yokohama an. Ist das nichts?“
„Wieso kannst du nicht einfach mal daheim bleiben, nicht zur Uni gehen?“
„Was?“
Wenn wir zusammen unterwegs waren, musste ich ihm meist völlig das Ruder überlassen: etwa, wenn wir zusammen etwas essen gingen. In den kleinen, typischen Lokalen gab es nur japanische Speisekarten, und ich vertraute darauf, dass er etwas Genießbares bestellen würde. Es schien mir wie ein Wunder, dass jemand diese Zeichen lesen konnte, und dass mit dieser Sprache, die hauptsächlich aus „hai“ und „masu“ zu bestehen schien, Verständigung möglich war.
Nicht nur wegen Satoshi fiel mir die Rückkehr nach Deutschland damals schwer. Ich hatte gerade erst damit begonnen, das fremde Land kennenzulernen. Hatte mich daran gewöhnt, die Schuhe auszuziehen, wenn ich die Wohnung betrat, die Stäbchen so zu halten, dass damit Nahrungsaufnahme möglich war. Musste nicht mehr Ewigkeiten in einem der kleinen Supermärkte verbringen, um etwas zu essen zu finden, bei dem ich mir sicher war, dass kein „nattō“ – ein glibbriger, fermentierter Bohnenbrei – oder andere Arten von Bohnen verarbeitet waren. Hatte gelernt, dass volle U-Bahnen nicht bedeuteten, dass nicht noch zehn Leute zusteigen konnten. Und verneigte mich bereits automatisch etwas, wenn ich Leute begrüßte. Noch am Flughafen beschloss ich, irgendwann wiederzukommen, und als ob es dafür ein Pfand bräuchte, versprach ich mir selbst, in Deutschland weiter Japanisch zu lernen. Dieser Blick, den Satoshi mir zuwarf, bevor ich mich umdrehte! In ihm schien alles zu liegen, was ich jemals vermissen konnte.
Ich halte den Atem an, als ich endlich aus dem Zoll in den Warteraum trete. Ich sehe ihn sofort, wie er dort etwas zusammengesunken auf einem der Plastikschalenstühle sitzt und etwas in sein Handy tippt. Den Mantel, den er anhat, kenne ich – er hatte ihn bereits in München getragen, und die kleinen schwarzen Wollfussel auf seiner Oberfläche grüßen mich wie eine alte Freundin. Satoshi wirft kaum etwas weg. Solange die Dinge noch funktionieren, gibt es für ihn dazu keinen Grund. „Mottainai“, es ist schade drum, sagt man dazu in Japan. Allzu verbreitet ist diese Haltung im Land der aufgehenden Sonne heute nicht mehr. Ich mag es, wenn Menschen ihre Besitztümer ernst nehmen, auch wenn in Satoshis Fall – so gut kannte ich ihn schon – vielleicht doch eher Geiz der Auslöser der Genügsamkeit ist.
Zwischen ihm und mir stehen etwa zehn Japaner, die ich alle geschickt umkurve. „Schön, dass du gekommen bist.“ Ich nähere mich ihm seitwärts, und er blickt überrascht zu mir auf. „Oh! Da bist du ja!“ Er steht auf und wir stehen uns kurz verlegen gegenüber. In München hätte ich ihn sofort umarmt, aber in Japan? Selbst bei Paaren sieht man diese Begrüßungsgeste nicht allzu häufig. Unsere Blicke treffen sich – kein Zweifel, wir sind dieselben. Endlich umarmen wir uns, ziemlich vorsichtig.
„Lange her“, sagt er.
„Ja, lange her“, sage ich und löse mich einen Moment zu spät von seiner Schulter.
Er schnappt sich meinen Koffer: „Ikō, lass uns gehen! Wohin willst du?“
„Shinjuku. Ich habe fürs Erste ein WG-Zimmer bei einer ‚Monthly Mansion‘ gebucht und muss dort im Büro den Schlüssel holen.“
Der Blick aus dem Zugfenster zeigt eine von kleinen Siedlungen gesprenkelte Landschaft: Dunkle Holzhäuser mit dicken Keramikziegeln wechseln sich ab mit beigefarbenen Fertighäusern und Laubbäumen, die struppig zwischen Reisfeldern sitzen. In der Nähe des Flughafens Narita – der nicht in Tokio, sondern in der Nachbarpräfektur Chiba liegt – wirkt Japan noch recht ländlich. Nach und nach werden die Häuser dichter und die Bäume weniger, bis sich irgendwann die Stadt wie ein Teppich um uns ausbreitet. Wir überqueren breite Flüsse, die in enge Korsetts gepresst sind, fahren auf erhöhten Trassen und blicken auf die geschlossenen Vorhänge der Apartments der schmalen Türme, die unmittelbar neben den Gleisen aufragen.
Am Bahnhof von Ueno steigen wir in die Yamanote-Linie um, die Ringbahn, die viele der Zentren Tokios miteinander verbindet. Auch jetzt kann ich den Blick kaum von der Stadt, die da jenseits der Fenster an uns vorbeizieht, abwenden. Hochstraßen und Hochbahnen durchziehen sie wie dicke Adern. Zwischen den dicht gedrängten Bauten mit ihren unterschiedlichen Höhen, Formen und Farben tauchen immer wieder Leuchtreklamen und Bildschirme auf. Als hätte jemand eine Kiste Spielzeug umgekippt.
„Wenn du jetzt in Japan bist, werden wir nur Japanisch sprechen. In Ordnung?“, fragt Satoshi. Ich nicke und sage „un“, das unter Freunden das formale „hai“ für „ja“ ersetzt. „Aber mein Japanisch ist echt schlecht jetzt. Ich hatte einfach zu wenig Möglichkeiten zum Üben ...“ Satoshi, der neben mir sitzt, berührt leicht meinen Arm. „Das wird schon.“
Mir fällt auf, wie ruhig es in dieser Bahn ist. Nicht, dass das Abteil leer wäre – die Sitzplätze sind alle belegt, und auch an den meisten Halteschlaufen hängen die Pendler wie reife Äpfel: Geschäftsmänner in billigen Anzügen, Angestellte in züchtigen Kostümen, uniformierte Schulkinder. Dazwischen auch einige schräge Gestalten, die sich nicht so leicht in Schubladen einordnen lassen. Doch niemand in dieser Bahn spricht, die Menschen haben nichts miteinander zu tun und ignorieren sich daher, so gut es geht.
Zahlreiche Töne und Durchsagen, die das Schließen und Öffnen der Türen begleiten, das Kommen und die Abfahrt eines Zuges ankündigen, auf die Gefährlichkeit der Rolltreppe aufmerksam machen und vor dem Vergessen von Dingen warnen, begrüßen uns in Shinjuku. Es flimmert vor den Augen und sirrt in den Ohren – ich bin tatsächlich in Tokio, und die Stadt wirkt auf mich immer noch wie ein anderer Planet.
Die Formalitäten in der „Monthly Mansion“-Zentrale sind nach einigen Unterschriften und dem Hinterlegen der Kaution schnell erledigt. Als wir wieder in Richtung Bahnhof gehen, druckst Satoshi herum.
„Findest du den Weg in deine Unterkunft alleine? Ich muss leider gehen, ich hab noch einen Termin.“
„Nomikai darō?“, frage ich ihn augenzwinkernd. Aber auch wenn meine Vermutung stimmt und er wirklich mit seinen Arbeitskollegen zum Biertrinken geht, gehörte das in Japan ja meist doch noch irgendwie zur „Arbeitszeit“. Wie überhaupt Arbeit und Freizeit nicht immer klar zu trennen sind in diesem Land. Ich lasse mir nicht anmerken, wie traurig ich bin, dass die gemeinsame Zeit schon wieder vorbei ist.
„Wir treffen uns aber bald wieder, ja?“, frage ich ihn vor der Kontrollschranke der Japan-Rail-Linien im Bahnhof Shinjuku.
„Ja, hoffentlich“, antwortet er mit einem leicht gequälten Blick. Um uns herum wuseln die Menschen, drängen durch die Schranke, indem sie ihre Tickets in den Schlitz stecken oder die Dauerkarte auf den Sensor legen. Das gleichmäßige Piepen dieser Automaten ist der Soundtrack, als ich Satoshi nahe an mich heranziehe. So nah, dass ich den Duft hinter seinem Ohr riechen kann, den ich so mag. Satoshis Hand legt sich an meinen Hinterkopf, mit den Fingern teilt er mein Haar. Bin ich etwa doch nur wegen ihm nach Japan gekommen? Stecke ich schon seit Jahren in dieser Umarmung fest? Sind wir wie die Helden einer japanischen Seifenoper durch widrige Umstände getrennt worden, haben Tausende Kilometer voneinander entfernt gelebt und sind doch immer noch untrennbar verbunden? Haben wir nun die Chance auf ein Happy End? Und wie lange muss das Drama noch weitergehen, bis es so weit ist?
5. Januar 2010
Bei meinem Einzug gestern waren die Mitbewohner meines neuen temporären Zuhauses in Yoyogi allesamt ausgeflogen gewesen. Als ich nun von meiner ersten Stadttour zurückkomme, ist das Erste, das ich sehe, ein Italiener in Unterhose. Dass es ein Italiener ist, erkenne ich allerdings nicht an der Unterhose, sondern an seiner englischen Begrüßung, in der die Vokale lange nachschwingen. Eigentlich will ich nicht unbedingt in diese WG für Ausländer ziehen, in der man die Zimmer wochen- oder monatsweise mieten kann – aber für die erste Zeit in Tokio ist es eine gute Wahl, da es von Deutschland aus leicht zu organisieren gewesen war. Um eine richtige Wohnung zu mieten, braucht man in Japan einen Bürgen. Wäre ich Angestellte in einem internationalen Unternehmen, wäre das kein Problem: Für „Expats“ wird in der Regel alles Nötige geregelt, mit bürokratischem Kleinkram müssen sie sich kaum herumschlagen. Aber mit einem „Working Holiday Visa“, wie ich es mir geholt hatte, sieht die Sache anders aus: Das war eigentlich für Studenten gedacht, die durch die Welt reisen und für einige Monate ein Land genauer kennenlernen wollen. Als ich mein Gepäck in meinem Zimmer verstaut habe und wieder in die Küche komme, hat sich der Italiener zwar keine Hose angezogen, aber sich zumindest hingesetzt, sodass ich nicht mehr zwanghaft auf die nackten Beine schauen muss. Nicht, dass es besonders schöne oder besonders hässliche Beine wären. In der Küche steht nun auch ein Mädchen und schält einen Apfel, der Italiener – Marco – stellt sie mir als eine japanische Freundin vor. Aha. Hatte er wohl in Roppongi, einem der Stadtviertel Tokios, in dem besonders Ausländer gerne feiern, aufgegabelt. Sage ich natürlich nicht, sondern lächle freundlich.
Yoko, so heißt die Freundin, ist ein großer Italien-Fan, und wir unterhalten uns eine Weile zu dritt. Marco fragt Yoko, ob die so ruhig erscheinenden Japanerinnen zu Hause nicht auch laut werden, wenn ihr Mann mit einer anderen Frau geflirtet habe. Yoko antwortet ihm, dass das nicht so sei, dass Japaner ihre Gefühle nicht so zeigten und dass sie eher schwiegen, anstatt sich laut zu streiten. Dann sagt sie noch etwas auf Italienisch, und Marco übersetzt mir anschließend, dass Japanerinnen einfach zu intelligent seien, um wegen solcher Lappalien einen Streit anzufangen. Insgeheim frage ich mich, ob Yoko wohl Intelligenz mit Leidensfähigkeit verwechselt, nicke aber nachdenklich und ziehe mich in mein Zimmer zurück. Die Gespräche aus der Küche sind gut zu vernehmen, die Wände tatsächlich so dünn, wie ich befürchtet habe.
Das Schnarchen des Italieners – der zuvor noch übers Internet mit seiner daheim gebliebenen italienischen Freundin gestritten hatte – begleitet meine weitgehend schlaflose Nacht. Zum Glück ist Yoko schon vorher gegangen, sonst würde ich mich jetzt in eine Bar flüchten.
9. Januar 2010
„Hajimemashite, schön, euch kennenzulernen. Ich heiße Julia Berger, bin 28 Jahre alt (leises Raunen im Raum) und komme aus München. Ich habe Architektur studiert und ...“ Ich zögere kurz. Soll ich über meine Arbeit sprechen, die ich nun nicht mehr habe? Wie wenig mir der Job gefällt und das ich froh bin, gegangen worden zu sein? Ich entscheide mich dagegen und gehe gleich zu den „shūmi“ über, den Hobbies, „... lese und reise gern. Dōzo yoroshiku onegai shimasu, auf ein gutes Miteinander.“
Der Nächste in der Klasse ist dran und betet die grundlegenden Daten zu seiner Person herunter. Ich stelle fest, dass die meisten meiner Mitschüler in dieser Sprachschule in Shinjuku Japanologie-Studenten Anfang zwanzig sind und eine Vorliebe für Manga, Anime und Visual-Kei-Bands haben, also für japanische Comics, Zeichentrickfilme und metrosexuell gekleidete Rockbands. Das wäre allerdings auch nicht schwer zu erraten gewesen: Ein paar Mädchen sehen mit ihren langen welligen Haaren, künstlichen Augenbrauen, den Schleifen an den knappen Kleidern und den Teddybärchen an den Handtaschen aus wie lebende Barbiepuppen, oder eben wie die Fantasiefiguren in den Manga. Eine weitere Gruppe kommt etwas punkiger daher, anscheinend die Visual-Kei-Fraktion. Ich lächle in mich hinein: Für die Einheimischen – gerade für die Horden Schwarzer-Anzug-Träger, die sich morgens Richtung U-Bahn schleppen und ein ganz anderes Japan verkörpern – musste es sehr skurril wirken, Ausländer zu erblicken, die sich diesen Teil der japanischen Kultur so ganz und gar einverleibt haben.
Die nächsten Monate werde ich meine Vormittage mit diesem bunten Packen Menschen verbringen und dabei meine Japanischkenntnisse aufpolieren. Mit dem Unterricht in der Sprachschule fängt mein Leben an, etwas geregelter zu werden – eine Voraussetzung dafür, dass ich in Tokio wirklich im Alltag ankomme. Ich sitze in der Nähe der Tür und blicke deshalb schräg auf unseren Lehrer Herrn Yoneda, der uns gerade erklärt, was uns in den nächsten Wochen erwartet. Yoneda-sensei, also der werte Lehrer Yoneda, sieht aus, wie Lehrer wohl überall auf der Welt aussehen: ausgebeulte Cordhose, Karohemd, Nickelbrille, Bart. Er spricht langsam, und ich bin glücklich, weil ich bisher jedes Wort verstehe. Das Klassenzimmer ist durch Schiebeelemente vom benachbarten Raum getrennt, deutlich hört man, was die Lehrerin nebenan spricht. Das liegt aber nicht nur an der dünnen Wand, sondern auch daran, dass mein Ohr – wenn ich mich auf dem zu niedrig geratenen Stuhl nach hinten lehne – der Wand bis auf wenige Zentimeter nahekommt. Dafür, dass wir nicht nach vorne ausbüchsen können, sorgen die kleinen Tische, die im Klassenzimmer als Hufeisen aufgestellt sind.
Yoneda-sensei entfernt sich immer weiter vom Thema „Stundenplan“, und auch meine Gedanken gehen ihre eigenen Wege. Wann werde ich Satoshi wiedersehen? Ich möchte ihn gerne treffen, doch er sagt, er habe viel zu tun im Moment. Immerhin wird er mir an einem der nächsten Wochenenden helfen, eine dauerhafte Bleibe zu finden. Bei dem Gedanken hüpft mein Herz höher. Mein Blick schweift über den Notizblock meiner Nachbarin, den jede Menge Bleistift-Zeichnungen zieren. Die Szenen wirken, als hätte sie sie direkt aus einem Manga-Heft kopiert.
„Sieht toll aus!“, sage ich zu dem Mädchen, das Clara heißt und aus Spanien kommt.
„Arigato, danke“, antwortet sie mir auf Japanisch und lächelt mir zu. Ihre Haare sind dunkel und etwa schulterlang, zwei dicke rote Strähnen fallen ihr ins Gesicht.
„Sind das Figuren aus einem bestimmten Manga?“
Sie sieht mich ungläubig an. „Kennst du ‚Evangelion‘ nicht?“
Ich zucke die Schultern, und sie scheint kurz zu überlegen, ob ich sie wohl auf den Arm nehme. Dann stupst sie ihre Nachbarin, eine Französin, an: „Stell dir vor, sie kennt ‚Evangelion‘ nicht!“ Zwei Augenpaare – eines mit künstlichen Wimpern, das andere mit pechschwarzen Konturen – blicken mich mit wissenschaftlicher Neugier an. Sie scheinen nicht damit gerechnet zu haben, dass es so jemanden wie mich überhaupt gibt. Ich widme mich wieder den Erläuterungen von Yoneda-sensei, ziehe aber heimlich meinen Kalender aus der Tasche und mache mir eine Notiz. „Checken: Evangelion“.
22. Januar 2010
Kleine Erdbeben lassen in dieser Nacht das Stockbett meines WG-Zimmers in Yoyogi immer wieder erzittern. Das Grummeln des Erdbodens macht mir keine Angst, ich habe es in den letzten Tagen schon öfter gespürt und mich schnell daran gewöhnt. Dennoch liege ich wach im oberen Bett und starre an die Decke meines Zimmers. Es ist kalt, doch ich habe keine Lust auf die heiße, trocken-ranzige Luft aus der Klimaanlage, die die Alternative wäre. Sobald ein Auto vorbeifährt, dringt etwas Licht durch einen Spalt im Vorhang. Ich beobachte, wie es über die Sichtbetondecke wandert, über die Wände huscht und schließlich verschwindet. Die ersten beiden Wochen in Japan sind vorbei, und bis auf die üblichen bürokratischen Hindernisse, die es bei jedem Umzug gibt, war es eine tolle Zeit. Ich fühle mich unglaublich frei und habe das Gefühl, endlich das Richtige zu tun. Nur manchmal wird mir bewusst, dass ich hier ziemlich alleine bin, und dann ist da wie jetzt dieses Stechen in der Magengrube, das ich schwer einordnen kann. Ist es Einsamkeit? Oder doch eher Liebeskummer?
Satoshi. Die Zeit, die wir miteinander verbracht hatten, haftet stark an mir. Wie Natto, der glibbrige Bohnenbrei, an hölzernen Essstäbchen klebt, besetzt die Erinnerung mein Herz, füllt es aus, lässt mich nicht schlafen. Seit wir uns damals so nahe waren, habe ich ihn niemals ganz vergessen. Er hat einen Keim in mir gepflanzt, der nun wieder mit aller Kraft sprießen will.
Dabei ist diese Reise für mich doch mehr als nur das Wiedersehen mit alten Gefühlen. Dass ich letztlich die Koffer gepackt habe, hatte weder mit einem Mann noch mit dieser unbestimmten Sehnsucht nach Japan zu tun. Mich reizte vor allem etwas anderes: der Versuch, dem Fluss des Daseins zu entrinnen. Ich war von einer Schule in die andere gewechselt und am Schluss im Job gelandet. Ich hatte durch Zufall Freunde getroffen, manche davon waren geblieben, andere nicht. Manchmal ergab sich Liebe, manchmal ergab sich Ärger. Doch auf nichts davon war ich mit vollem Bewusstsein zugesteuert. In den letzten Jahren hatte ich mir immer stärker gewünscht, es zu versuchen: aufzustehen, die Richtung zu wechseln. Zu spüren, dass ich lebendig bin und nicht nur ein Teil eines Stroms, in dem ich mich – mal langsamer, mal schneller – bewege, bevor der große Wasserfall dem Ganzen ein Ende bereitet. Eine Veränderung kann eine kleine Neugeburt sein. Ich will eine große Neugeburt. Das Alte erst einmal komplett hinter mir lassen, neue Luft atmen. Es hätte vielleicht nicht Japan sein müssen. Aber Japan lag für mich so nahe.
23. Januar 2010
Vor mir liegt ein Berg von Zetteln, neben mir sitzt Satoshi und schnieft seine Erkältung weg, und über den Tisch hinweg sehe ich auf die Mundbewegungen einer Japanerin, die mir etwas erklärt, von dem ich gerade einmal fünf Prozent verstehe. Ich versuche, mich zu konzentrieren, aber es nutzt nichts. Nach kurzer Zeit zappt mein überfordertes Gehirn einen Kanal weiter und ich widme mich der Umgebung. Der Raum des Maklerbüros nimmt den gesamten ersten Stock eines Gebäudes in Okachimachi ein – da der Bau recht schmal ist, sitzen die Angestellten hier dennoch dicht gedrängt. Wie fast überall in Japan ist in die Fenster ein feiner Draht eingelegt, der es in kleine Vierecke unterteilt. Damit kann man innen in der Gewissheit arbeiten, dass man von außen nicht allzu sehr beobachtet wird. Der Ausblick ist kariert, aber ohnehin durch die nicht weit entfernt gegenüberliegende Wand begrenzt, sodass kein besonderer Augenschmaus verloren geht. An der Decke hängen Neonröhren, die sich in diesem Land einer großen Beliebtheit erfreuen. Es ist erstaunlich, wie gnadenlos die Japaner – die in traditionellen Wohnhäusern oft auf jedes Detail Wert legen – Räume ausstatten, in denen sich Menschen den ganzen Tag lang aufhalten müssen. Winzige Tische, unter die ein durchschnittlich großer Europäer bei normaler Sitzhaltung nicht einmal seine Knie schieben kann, vergilbte Wände, Decken mit Installationsleitungen, und dann noch die grellen, unbarmherzigen Leuchten. Matsumoto-san – so heißt mein Gegenüber – scheint die Atmosphäre nicht zu deprimieren, im Gegenteil, sie sprüht vor Energie. Ich betrachte Satoshi, der auf einem Blatt Notizen macht: seine schwarzen Haare, die im Moment ein wenig zu lang sind und ihm immer wieder ins Gesicht fallen, die Augen, die mir so seltsam vertraut sind, mir nun aber stets ausweichen. Den kleinen Mund mit den schmalen Lippen, die nur selten wirklich lächeln. Den braunen Schal um seinen Hals, der über und über mit dem Logo von Dolce & Gabbana bedruckt ist. Muss teuer gewesen sein. Ich wundere mich. Ist Satoshi nun auch dem Markenwahn verfallen? Wo ist sein Geiz geblieben? Oder ist das nur eines dieser weihnachtlichen Socken-Krawatten-Unterhosen-Geschenke, die man einfach so benutzt? Wobei mir meine Mutter noch nie Socken von Dolce & Gabbana geschenkt hat. Und japanische Familien sich zu Weihnachten eigentlich nichts schenken. Nur die Kinder bekommen vielleicht etwas. Und Liebespaare, denke ich plötzlich, die beschenken sich auch.
Satoshi spürt meinen Blick und unterbricht Matsumotosan, indem er mir den Zettel hinschiebt. Er hat mir genau aufgelistet, wie viel mich welche Wohnung kosten wird, und erklärt mir die verschiedenen Gebühren – von der Schlüsselpauschale über die Kaution und die Vermittlungsgebühr bis hin zum „Höflichkeitsgeld“, das man dem Vermieter zu überlassen hat – in einer Mischung aus Deutsch und Japanisch. Ich bin überwältigt. Gerade hatte ich noch überlegt, aufzugeben, mich in mein Italiener-Guesthouse zurückzuziehen und für den Rest des Jahres einfach einer dieser Ausländer zu sein, die kurz die Luft dieser Stadt schnuppern wollen und dann wieder verschwinden. Nun ist da Licht am Horizont!
Die Unterkunft, die ich schließlich besichtigen will, liegt nördlich von Tokio: etwas außerhalb, aber gut angebunden. Eigentlich handelt es sich eher um einen begehbaren Kleiderschrank als um eine Wohnung – mit Bad, Küche und Wohnraum kommt das Ganze auf etwa achtzehn Quadratmeter.
Matsumoto-san – die kleiner ist, als ich es im Sitzen vermutet hatte – tappst bestrumpft durch den leeren Raum und zeigt mir jeden Winkel. Schließlich klopft sie gegen die Wand: „Die ist dick! Im Gegensatz zu einem ‚Aparuto‘, da hört man alle Geräusche des Nachbarn. Und bei einem Erdbeben ist so ein ‚Mansion‘ auch sicherer.“
Ich bin etwas verwirrt. Aparuto? Mansion? Matsumoto versteht meine Frage nicht, doch Satoshi klärt mich auf. Unter Aparuto, also Apartment, versteht man in Japan billige Wohnungen in niedrigen, meist zweigeschossigen Gebäuden, die oft aus Holz konstruiert sind und die keinen gemeinsamen Eingang mit Pförtnerloge und Aufzug besitzen. Eine Wohnung in einem Mansion – keinem Landsitz, sondern einem höheren, aus Beton und Stahl gebauten städtischen Wohnkomplex – ist etwas teurer, dafür gilt sie als sicher, da es einen zentralen Eingang und einen Pförtner gibt, der gewisse Hausmeister-Aufgaben übernimmt.
Ob eine Wohnung sicher ist oder nicht – darüber habe ich mir in München nie Gedanken gemacht, und in Japan erscheint mir eine solche Sorge geradezu absurd. In die Wohnung in diesem „Mansion“ verliebe ich mich jedoch sofort: Sie befindet sich im neunten Stock mit Blick nach Süden. Obwohl das Haus etwas außerhalb der Stadt liegt, ist der Siedlungsteppich hier nicht zu Ende – ich sehe also über ein unendliches Häusermeer. Es dämmert, und überall gehen die Lichter an. Ich fühle plötzlich eine unbestimmte Wärme in mir. Diese Lichter sind wie ein geheimes Zeichen, als ob sich die Menschen damit gegenseitig zeigen wollten, dass sie nicht alleine auf der Welt sind. So etwas wie diese Lichter brauchte ich, um glücklich zu sein.
Satoshi, der inzwischen mit Matsumoto einige Mängel durchgegangen ist, tritt neben mich und flüstert mir zu: „Möchtest du noch eine andere Wohnung ansehen?“
„Nein. Die hier ist es.“
Matsumoto hat es wohl gehört, ist erleichtert und drängt zurück ins Büro, um die Formalitäten zu erledigen.





























