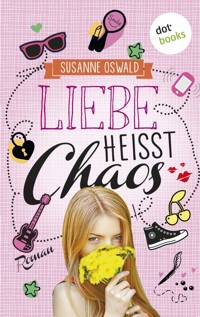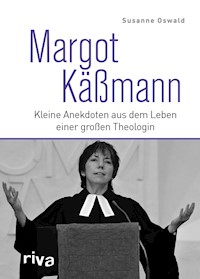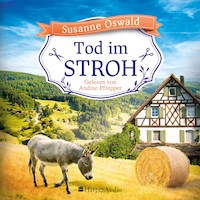9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Amrum
- Sprache: Deutsch
Fenja ist gerade kurz davor, sich in Hamburg einen Namen als Designerin zu machen, als ihre geliebte Tante Trude stirbt. Sie vermacht ihr ein Haus auf Amrum. An ihre Zeit auf der Insel hat Fenja wunderbare Erinnerungen, und trotzdem ist Trudes Testament für sie ein Albtraum: Ihre Tante verdonnert sie zu einem Zwangsjahr auf der Insel, wenn sie nicht leer ausgehen möchte. Das passt so gar nicht in ihre Zukunftspläne. Doch die Erinnerungen, die mit dem Erbe verbunden sind, sind zu wertvoll, um sie loszulassen. Schweren Herzens packt Fenja Mops und Kater und macht sich auf den Weg auf die Insel …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zum Buch:
Solltest du je an dir zweifeln, denk an mich. Das hatte Tante Trude in ihrem Brief an Fenja geschrieben – in ihrem letzten Brief. Und genau das tut Fenja jetzt, denn die Zweifel, ob sie das Richtige tut, sind größer als je zuvor. Trudes Haus zu betreten und zu wissen, dass Trude ihr nie wieder mit fröhlicher Stimme entgegenrufen oder ihre köstlichen Knopfkekse mit der richtigen Prise Inselluft backen wird, fühlt sich jedenfalls absolut falsch an. Doch dann stehen plötzlich Fenjas Freunde vor der Tür und füllen das Haus mit neuen Stimmen, neuem Leben und neuem Mut, und plötzlich kommt es Fenja gar nicht mehr so schwierig vor, der Insel und Trudes Idee von Glück und Freiheit eine Chance zu geben.
Zur Autorin:
Susanne Oswald schreibt mit Leidenschaft, und das spürt man in ihren Büchern. Gemeinsam mit ihrem Mann und dem Mops Töps lebt sie in Neuried in der Ortenau und betreibt dort neben ihrer Arbeit als Autorin eine Senfmanufaktur – die Senferia.
Der Originaltitel erschien 2019 unter dem Titel Ein Jahr Inselglück bei MIRA Taschenbuch.
Neuausgabe Copyright © 2019 by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Dieses Werk wurde durch die Literaturagentur Beate Riess vermittelt.
Covergestaltung von zero-media.net, München Coverabbildung von Rico Kdder / EyeEm / Getty Images E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783749905935
www.harpercollins.de
Widmung
Für alle Heldinnen,
die den Mut haben,
ihr eigenes Leben zu leben.
Und für jene,
die noch auf der Suche sind
nach diesem Mut.
Und ganz besonders für Katharina –
meine persönliche Heldin.
Kapitel 1
Prachtvoll. Dieses Wort drängte sich mir auf, als ich zusammen mit Coco an Rosenbeeten vorbei über den Steinplattenweg auf das Haus zuging. Prachtvoll und ehrwürdig, ergänzte ich in Gedanken und ließ meinen Blick über die schneeweiße Fassade und die in Erdtönen abgesetzten Simse wandern. Genau der passende Rahmen für diesen Anlass.
Entschlossen schob ich mit beiden Händen die schwere Eichentür auf, und wir betraten den kühlen Flur. Coco schnüffelte neugierig, während ich gar nicht anders konnte, als anerkennend die Augenbrauen zu heben und das aufwendig handgeschmiedete Treppengeländer ebenso wie die fein gearbeiteten Stuckverzierungen an den Decken zu bestaunen. Nobel ging die Welt zugrunde.
Unsere Schritte führten uns über glänzenden dunkelroten Marmor. Sonnenflecken, die durch ein Fenster über der Eingangstür ins Hausinnere fielen, tanzten über Wände und Boden. Das Holz der Treppe knarzte leise, als ich die ersten Stufen betrat.
Meine Nase kribbelte vom Bohnerwachsgeruch.
Mich auf die Details zu konzentrieren milderte meine Unruhe. Allerdings leider nur vorübergehend, das beklemmende Gefühl ließ sich nicht komplett vertreiben, was ja auch kein Wunder war. Alles in mir wehrte sich gegen diesen Termin. Ich wollte mich nicht mit Trudes Erbe auseinandersetzen. Es fühlte sich an, als würde sie mit der Verteilung ihres Besitzes erst endgültig sterben. Totaler Quatsch, sagte mein Verstand. Immerhin hatte ich an ihrem Grab gestanden, als die Urne versenkt wurde. Aber Verstand und Gefühl waren eben zwei unterschiedliche Angelegenheiten, und Zweiteres machte mir aller Vernunft zum Trotz schwer zu schaffen.
Mühsam schleppte ich mich die Stufen hinauf, als hätte ich bereits eine Mount-Everest-Besteigung in den Knochen und nicht nur einen gemütlichen Mopsspaziergang. Ich fühlte mich nicht wie Anfang dreißig, sondern eher wie sechzig – mindestens!
Im ersten Stock prangte rechts neben der Tür ein glänzend poliertes Messingschild: Dr. Ferdinand Waldmann – Notar. Beim Anblick des Namenszuges zog mein Magen sich noch fester zusammen. Während ich die Schrift musterte, holte ich tief Luft, wischte mir die vor Aufregung feuchten Hände an der schwarzen Stoffhose ab, die ich gestern erst fertig genäht hatte, und zupfte dann die Jacke zurecht.
Wenn ich dem Schicksal gegenübertreten musste, wollte ich dabei zumindest gut aussehen. Dass der kupferfarbene Blazer sehr gut zum Haselnusston meiner Haare passte, die im frisch geschnittenen Bob seidig mein Gesicht einrahmten, wusste ich. Und Henrik hatte es mir beim Abschied mit einem Pfeifen bestätigt. Er hatte mich einmal um meine eigene Achse gedreht und kommentiert: »Du könntest als Sandra-Bullock-Double gehen!«
Wie gern hätte ich die Sache umgedreht und Sandra Bullock stattdessen für mich zu diesem Termin gehen lassen. Ich verkniff mir einen Seufzer. Was erwartete mich? Was hatte Tante Trude wohl ausgeheckt?
Jetzt oder nie – ich musste es herausfinden!
Entschlossen drückte ich die Klinke nach unten, schob die Tür auf und blinzelte im nächsten Moment geblendet in das schräg durch hohe Fenster in den Raum fallende Sonnenlicht. Ich blieb stehen und versuchte etwas zu erkennen.
Wieder wurde mir bewusst, wie unpassend dieses Wetter doch war. Genau wie vor zwei Tagen bei der Beerdigung. Traurigkeit war schwarz, mindestens aber schmoddergrau. Auf keinen Fall jedoch passten das Himmelblau und fröhlich flirrende Staubpartikel im Sonnenlicht zu dem Anlass, der mich hierherführte. Es müsste regnen. Ach was, regnen, Dorsche und Seekatzen hageln müsste es, wie Tante Trude immer zu sagen pflegte. Wobei Trude das ganz sicher genau anders sehen würde. »Lass die Sonne scheinen, Fenchen«, würde sie sagen. Trude war der einzige Mensch gewesen, der mich Fenchen nennen durfte. »Die Sonnenstrahlen sollen auf meinem Grab tanzen. Und du sollst mit einem warmen, glücklichen Gefühl an mich und an unsere schönen Zeiten denken. Versprich mir das!« Ja, genau das würde sie sagen.
Ach Trude! Ich spürte, wie mir Tränen in die Augen stiegen. Die Erinnerungen überfluteten mich wie ein Tsunami. Sie war der wichtigste Mensch in meinem Leben gewesen. Mein Anker, wenn das Leben tobte. Auf Trude hatte ich mich verlassen können, ganz egal, was geschah.
Ich hatte sie schon immer sehr gemocht. Die Urlaube bei ihr – zusammen mit meinen Eltern – waren wundervoll gewesen. Und dann, zwei Tage nach meinem zehnten Geburtstag, kam die Zäsur. Mein Vater musste geschäftlich nach Asien, und meine Mutter wollte ihn begleiten. Ich sollte während dieser Zeit bei Trude auf Amrum bleiben. Doch das Flugzeug stürzte ab, es gab keine Überlebenden, und meine Zeit auf Amrum wurde gegen meinen Willen verlängert.
Für Trude war es selbstverständlich, das Sorgerecht für mich zu übernehmen. Etwas anderes kam gar nicht infrage. Zu Beginn hatte ich es gehasst, nicht zurückzukönnen. Hatte mich auf der Insel gefangen gefühlt. Aber Trude fing mich auf, tröstete mich, wenn ich nachts ins Kissen weinte, mich nach meinen Eltern sehnte, nach meinem früheren Leben, dem Alten Land. Seither waren Trude und ich unzertrennlich gewesen. Das hatte sich auch nicht geändert, als ich die Insel verlassen und mein Glück auf dem Festland gesucht hatte. Und jetzt? Sie hatte sich einfach so davongemacht. Dabei brauchte ich sie doch!
Coco fühlte meine Stimmung, sie sprang an mir hoch und leckte an meinen Händen. Während eine Träne über meine Wange rann, musste ich lächeln. Meine süße Coco. Sie war die beste Mopsdame der Welt. Ich beugte mich zu ihr hinunter und kraulte sie kurz hinterm Ohr, dann atmete ich die restliche Beklemmung mit ein paar energischen Atemzügen weg und konzentrierte mich wieder auf meine Umgebung.
»Guten Tag. Frau Petersen?« Die Stimme gehörte zu einer jungen Frau, die hinter einem Bildschirm saß und jetzt aufstand. Sie lächelte herzlich, als sie mir entgegentrat.
Ich nickte zaghaft.
»Kommen Sie, Doktor Waldmann erwartet Sie bereits.«
Der Notar nahm mich direkt am Eingang seines Arbeitszimmers in Empfang, schüttelte mir kraftvoll die Hand und wiederholte noch einmal sein Bedauern über meinen Verlust. Sein Beileid hatte er bereits telefonisch und schriftlich zum Ausdruck gebracht, deshalb nickte ich nur und ließ mich von ihm zu einem schweren Mahagonistuhl dirigieren. Seine grauen Haare wirkten ein wenig strubbelig und bildeten einen ungewöhnlichen Kontrast zu dem exakt sitzenden Anzug und den unter den Sakkoärmeln hervorblitzenden goldenen Manschettenknöpfen. Doktor Waldmann war ein distinguiert wirkender Mann, der mir aber – seinen Haarwirbeln sei Dank – dennoch auf Anhieb sympathisch war. Alles andere hätte mich auch gewundert, denn Tante Trude hatte große Stücke auf ihn gehalten, und sie hatte keine Leute mit Stock im Arsch gemocht, wie sie es immer sehr direkt auszudrücken pflegte. Nachdem ich Platz genommen und Coco sich unter den Stuhl gelegt hatte, ging der Notar um den ausladenden Schreibtisch – ebenfalls poliertes Mahagoni – herum, sortierte ein paar Papiere und räusperte sich.
»Schön, schön.« Sein Bariton umspülte meine geschundenen Nerven wie ein warmes Bad. Wohltuend zwar, doch an Entspannung war dennoch nicht zu denken. Er fuhr fort. »Nachdem Sie die einzige Verwandte sind und Ihre Tante keine weiteren Erben benannt hat, wollen wir, wenn Sie einverstanden sind, doch gleich in medias res gehen.«
»Entschuldigen Sie, Doktor Waldmann. Was ich nicht verstehe: Wenn ich wirklich die einzige Erbin bin, wie Sie gerade betonen – weshalb dann diese Geheimnistuerei? Was soll das Ganze? Hätte man mir nicht einen Erbschein ausstellen können und gut? Ich bin davon ausgegangen, dass ich heute einem bislang unbekannten Familienmitglied begegne, das Ansprüche auf das Erbe erhebt, oder dass meine Tante einen Teil ihres Vermögens in eine Stiftung umwandeln lassen will oder einem guten Zweck spendet.«
»Ich verstehe Ihre Verwirrung, Frau Petersen.« Er lächelte mich an und hielt einen Umschlag in die Höhe. »Wenn Sie bitte noch einen Moment Geduld hätten. Ihre Tante hat einen Brief an Sie bei mir hinterlegt und natürlich ein Testament. Ich werde das Testament verlesen. Im Anschluss bekommen Sie den Brief und können sich in aller Ruhe damit beschäftigen. Sollten Sie danach noch Fragen haben, beantworte ich diese selbstverständlich gern. Also – wollen wir?«
Offensichtlich eine rhetorische Frage, denn ohne meine Zustimmung abzuwarten vertiefte er sich wieder in seine Papiere. Mühsam zwang ich meine Ungeduld nieder. Ich kaute auf meiner Lippe und trommelte mit den Fingern auf die Stuhllehne, aber ich ließ den Notar seine Arbeit machen. Endlich begann er laut zu lesen. So zügig, dass mir keine Gelegenheit blieb, Zwischenfragen zu stellen. Zweimal setzte ich zwar an, doch jedes Mal hob er beschwichtigend die Hand und schüttelte leicht den Kopf, ohne seinen Vortrag zu unterbrechen. Ich nahm seine Worte auf, doch mein Verstand hatte zuerst Probleme, das Gehörte einzuordnen. Dann traf mich die Erkenntnis wie ein Schlag.
Was? Wie bitte?
Mit jedem weiteren Satz wuchs meine Fassungslosigkeit. Das konnte nicht ihr Ernst sein! Das hatte Trude doch nicht wirklich … Nicht ausgerechnet das! Der Schock verknotete sich in meiner Brust, nahm mir den Raum zum Atmen. Trude! Wie konntest du nur!?
»Frau Petersen? Hören Sie mich?«
Ich schlug die Augen auf und blickte in das besorgte Gesicht des Notars, der sich über mich beugte. Hastig richtete ich mich auf, denn ich war fast vom Stuhl gerutscht und hing seitlich auf die Armlehne gestützt. Doktor Waldmann nahm ein Glas Wasser vom Schreibtisch und hielt es mir entgegen. Dankbar ergriff ich es. War ich wirklich gerade für einen kurzen Moment ohnmächtig gewesen? Kein Wunder, bei dem, was mir gerade eröffnet worden war.
Ich hatte mir in den letzten Tagen alle möglichen Szenarien ausgemalt. Mit weiteren Erben hatte ich ebenso gerechnet wie mit einer Stiftung, die vielleicht einen Teil meiner Zeit und des Vermögens verschlingen würde. Oder dass ich das Haus behalten und mich dann eben mit Feriengästen rumplagen müsste, weil Trudehude wollte, dass ich die Immobilie als Sicherheit im Rücken hatte. Für diesen Fall hatte ich sogar schon geplant, Hannah zu fragen, meine Freundin auf Amrum, ob sie für mich die Verwaltung und Betreuung der Feriengäste übernehmen wollte. Aber auf die Variante, die mir gerade verkündet worden war, war ich nicht gekommen. So etwas konnte wirklich nur Tante Trude einfallen.
Immer noch reichlich verwirrt, trank ich, einfach um irgendwie die Zeit zu überbrücken, bis ich wieder einigermaßen klar denken konnte, ein paar Schlucke, und meine Lebensgeister erwachten neu. Coco versuchte, auf meinen Schoß zu klettern. Sie spürte, dass etwas nicht in Ordnung war, und winselte.
»Alles gut, meine Süße«, beruhigte ich meine aufgeregte Mopsdame. Dann wandte ich mich an den Notar, der mich immer noch alarmiert musterte. »Entschuldigen Sie bitte«, murmelte ich verlegen. Vermutlich hielt er mich für hysterisch.
»Es ist alles ein bisschen viel, ich weiß. Soll ich einen Arzt rufen?«
Das hätte mir gerade noch gefehlt! Schnell lehnte ich dieses Angebot ab. Sehr vehement, damit kein Zweifel aufkam. Genug Show für einen Tag, noch mehr Wirbel brauchte ich wirklich nicht. Außerdem war ich ja nicht krank, sondern nur schockiert. Das allerdings sehr.
»Es ist alles okay. Ich hab wohl nur vor Schreck vergessen zu atmen«, erklärte ich.
Als sein Blick den meinen weiter festhielt, zwang ich meine Wangenmuskeln zu einem Lächeln, schnappte das Glas, das ich vor mir abgestellt hatte, und trank es in einem Zug leer. »Sehen Sie? Alles gut. Ich bin fit.« Ich hob Coco hoch, die immer noch keine Ruhe gab. »Und jetzt sagen Sie mir bitte, dass ich mich verhört habe. Meine Tante hat das nicht wirklich so bestimmt.«
Nachdem er sich vergewissert hatte, dass ich nicht doch noch vom Stuhl kippte, ging er um seinen Schreibtisch herum und holte einen Umschlag.
»Es tut mir leid, aber genau das hat Ihre Tante verfügt. Das Testament ist unmissverständlich. Entweder Sie erfüllen ihren letzten Willen, oder das Erbe fällt an die Chanel-Stiftung. Komplett.« Er reichte mir den Umschlag. »Hier. Lesen Sie den Brief Ihrer Tante in aller Ruhe. Denken Sie über alles nach und teilen Sie mir Ihre Entscheidung mit. Sobald Sie das getan haben, werde ich alles Weitere in die Wege leiten.«
Unschlüssig drehte ich den Umschlag in meiner Hand. Was gab es da zu überlegen? Tante Trude hatte sich unmissverständlich ausgedrückt. Adieu, du geliebte Chanel-Tasche. Um dieses Schätzchen, das Tante Trude wie ihren Augapfel gehütet hatte, tat es mir in diesem Moment mehr leid als um alles andere. Aber die Bedingung erfüllen, nur damit ich an das Erbe kam? Für ein ganzes Jahr nach Amrum ziehen? Niemals!
»Danke, Herr Doktor Waldmann, aber da gibt es nichts zu überlegen. Nach den vielen Jahren der Vorbereitung stehe ich endlich am Anfang meiner eigenen Karriere. Ich will mich selbstständig machen und als Designerin etablieren. Gerade bin ich auf der Suche nach Räumlichkeiten für mein Atelier in Hamburg.« Ich zögerte kurz, dann setzte ich hinzu: »Ich kann nicht für ein Jahr auf eine Insel gehen, nicht ausgerechnet jetzt. Ich würde den beruflichen Anschluss verlieren. Von meinem Privatleben ganz zu schweigen.« Wieder machte ich eine kurze Pause, sortierte die Bilder und Gedanken, fühlte in mich hinein.
Ich hatte eine Schneiderlehre und ein Designstudium absolviert. Über Jahre hatte ich bei angesagten Labels assistiert, hatte Erfahrungen gesammelt und die Modebranche mit Licht und Schatten kennengelernt. Alles nur, um eines Tages selbst ein Label zu gründen. Nein. Ich konnte nicht, und – was noch wichtiger war! – ich wollte nicht. Es blieb dabei.
»Es ist unmöglich. Deshalb lehne ich das Erbe hier und heute ab«, erklärte ich also in festem Ton. Ich horchte meiner eigenen Stimme nach, sie klang sehr entschlossen, es schwang kein Zweifel mit.
Dafür zitterten meine Hände, und der Knoten in meinem Magen würde sich in diesem Leben wohl nicht mehr lösen. Ich hatte gerade ein Vermögen ausgeschlagen. Aber blieb mir denn eine andere Wahl? Ein Zwangsjahr auf der Insel – dieser Preis war definitiv zu hoch. Da hätte Trude mich ja gleich für ein Jahr ins Kloster sperren können. Was auch immer Tante Trude vorgehabt hatte, dieser Schuss war nach hinten losgegangen. Und zwar gewaltig. Meine Gedanken machten einen Sprung.
Henrik!
Oje, was würde Henrik sagen, wenn er die Neuigkeiten erfuhr? Er ging fest davon aus, dass ich ab heute eine gute Partie war. Andererseits liebte er mich ja wohl kaum wegen einer schicken Immobilie und eines dicken Bankkontos, beides hatte ich die letzten Jahre nicht besessen und würde es dann eben jetzt auch in absehbarer Zeit nicht mein Eigen nennen. Wenn ich irgendwann einmal reich wäre, dann aus eigener Kraft.
Doktor Waldmann blickte mich an, ich nickte und hielt seinem fragenden Blick stand. Er wartete ein paar Sekunden, dann verzog er den Mund zu einem verrutschten Lächeln und nickte nun ebenfalls.
»Ihre Tante ahnte, dass Sie so reagieren würden«, erklärte er. »Nun, für diesen Fall hat sie bestimmt, dass eine Frist von einer Woche besteht. Vorher darf ich Ihre Entscheidung nicht annehmen. Bitte melden Sie sich, falls Sie Ihre Meinung ändern.« Er zeigte auf den Umschlag in meiner Hand. »Lesen Sie den Brief und denken Sie in aller Ruhe nach. So eine Entscheidung sollte man nicht übers Knie brechen.«
Als ich aus dem Haus trat, grollte der erste Donner, ein Gewitter hatte sich zusammengebraut. Wenigstens passte das Wetter jetzt zu meiner Stimmung! Na, Tante Trude, hast du deinen Spaß? Ich schickte die Frage Richtung Himmel, schob den Umschlag in die Tasche und trieb Coco zur Eile an, damit wir es vor dem Regenguss nach Hause schafften. Ich würde mir einen Tee kochen, mich auf dem Sofa einkuscheln und in aller Ruhe lesen, was Tante Trude mir zu sagen hatte.
Und dann musste ich mit Henrik sprechen.
Kapitel 2
An die Reling gelehnt ließ ich meinen Blick über die schaukelnden Wellen in die Ferne wandern. Die Fähre pflügte langsam, aber stetig durch das Wasser, unaufhaltsam ging es der Insel entgegen.
Und? Bist du jetzt zufrieden? fragte ich stumm Richtung oben. Bestimmt saß Trudehude auf einer Wolke und lachte sich ins Fäustchen.
Ihr Plan hatte funktioniert – und es hatte noch nicht einmal die Woche gebraucht, die sie als Entscheidungsfrist gesetzt hatte. Ich wollte nicht. Wirklich und ganz und gar nicht. Alles in mir sträubte sich gegen das Inselexil. Aber hätte ich abgelehnt, hätte ich nicht einmal ein paar Erinnerungsstücke an Trudehude behalten dürfen. Es gab nur ganz oder gar nicht. Dazu kam, dass in meiner beruflichen Situation, mit dem Wunsch nach einem eigenen Atelier und mit nicht gerade ausgeprägten Rücklagen auf der Bank, natürlich auch der finanzielle Aspekt eine ziemliche Rolle bei der Entscheidung spielte. Auch wenn ich noch so laut kundtat, dass ich auf das Geld pfiff und es aus eigener Kraft schaffen wollte – es war eine wichtige Sicherheit für mich.
Henrik hatte mir vor Augen geführt, wie mein Weg ohne das Erbe sich vermutlich entwickeln würde. Von wirtschaftlichen Faktoren erzwungene Kompromisse auf allen Ebenen, sei es die Raumsuche, die Stoffauswahl oder mögliche Messeauftritte, die verboten teuer waren. Alles müsste ich mir erkämpfen und wäre auf die Unterstützung der Bank angewiesen. Mit all diesen Zwängen hätte ich meine Kreativität auf eine harte Probe gestellt. Natürlich wäre es nicht unmöglich gewesen, aber es wäre ein steiniger Weg.
Und dann hatte Henrik mir ausgemalt, wie sich alles entwickeln könnte, wenn ich finanziell unabhängig wäre und Entscheidungen treffen könnte, ohne jemanden um Erlaubnis zu fragen. Plötzlich taten sich Welten auf, die ohne Kapital unerreichbar schienen. Ich könnte in Stoffen schwelgen und meine Marke – von der ich immer noch nicht wusste, wie ich sie nennen wollte – ohne Betteleien bei Banken und erzwungene Kompromisse nach oben bringen.
Und so kam, was Trude genau so beabsichtigt hatte: Die nächsten zwölf Monate waren Amrum und ich Zwangsverbündete.
Eine Weile beobachtete ich das sich ständig verändernde Bild, das der Himmel bot. Die Wolken zogen über mich hinweg und formierten sich gemächlich zu immer neuen Gebilden. Ich sah Riesen aufmarschieren, eine Dampflokomotive tuckern, direkt gefolgt von einer Walfischmama mit zwei Jungen. Die Riesen wurden von Blumen tragenden Elefanten abgelöst, die sich zu einem sprudelnden Brunnen verbanden. Der Himmel steckte voller Geschichten. Dramatische Szenen wechselten sich mit romantisch angehauchten Momenten ab. Es war atemberaubend. Berührend. Ein Gefühl von riesengroß und winzig klein, das eine unbestimmte Sehnsucht in mir auslöste.
Etwas dieser Dynamik würde ich gerne in meine Entwürfe einfließen lassen. Vielleicht in ein Kleid, oder doch lieber in einen Mantel? Wenn es mir gelang, dieses Gefühl in Mode zu bannen, dann hätte ich vielleicht das gewisse Etwas, das nötig war, um in der Szene aufzufallen. Um einen eigenen Akzent zu setzen und unverwechselbar zu werden. Dann noch einen passenden Label-Namen, und ich würde das Modefeld von hinten aufrollen.
Würde.
Falls ich in der Einsamkeit der Insel überhaupt an meiner beruflichen Zukunft arbeiten konnte. Wahrscheinlicher war, dass meine Kreativität zwischen den Sandkörnern des endlosen Kniepsandes zermahlen werden würde und die Modeszene mich gnadenlos rechts überholte. Ich müsste tatenlos zusehen, wie die Welt sich weiterdrehte, während ich auf dieser verflixten Insel festsaß.
Zwischen den Wolken blitzten strahlendes Blau und die Sonne hervor. Perfektes Frühsommerwetter – und das Anfang Mai. Trotzdem hatte ich die Jacke geschlossen und das Tuch fest um Kopf und Hals gewickelt, denn der Wind pfiff bissig und hatte im Gegensatz zur Sonne noch kein Sommerlied angestimmt.
Pablos Transportbox stand zu meinen Füßen. Dank der Rosarotpillen schlief der Kater entspannt dem neuen Leben entgegen. Vielleicht hätte ich auch ein paar Pillen schlucken sollen? Etwas Rosarot würde meinen düsteren Gedanken guttun. Coco dagegen zeigte sich ganz ohne Medikamente mopsvergnügt. Mit dem Halstuch in maritimem Blauweiß, das ich ihr extra für die Reise genäht hatte und das perfekt zu ihrem schwarzen Fell passte, sah sie aus wie ein Matrosenmops. Am Rand hatte ich mit der Maschine Cocos Namen eingestickt.
Sie liebte Abenteuer – zumindest solange ich an ihrer Seite war. Wurde es gefährlich, konnte sie immer noch hinter mir in Deckung gehen. »Frauchen, du beschützt mich«, sagte ihr Blick in diesen Situationen dann immer. Im Moment drohte allerdings kein Ungemach, und so drückte Coco entspannt ihren Kopf gegen mein Knie und genoss den Trubel, der um uns herum herrschte. Zwischendurch gab es Streicheleinheiten der Mitreisenden, das kam meiner Mopsdame sehr entgegen. Auf charmante Art zeigte sie jedem sofort, welche Stelle sie bitte liebkost haben wollte, und das war in der Regel der Brustkorb bis zum Bauchnabel hinunter.
Ich hatte genug von dem glitzernden Wasserspiel und den Wolkengeschichten und schob mich samt Pablo und Coco auf einen der freien Sitzplätze. Als ich in meinem Rucksack kramte, witterte eine Möwe ihre Chance. Fast auf Augenhöhe der Fahrgäste segelte sie neben dem Schiff her und wartete darauf, Beute zu machen. Es sah aus, als stünde sie in der Luft, während sie sich den Hals nach möglichen Köstlichkeiten verrenkte. Aber sie hatte nicht mit Coco gerechnet. Frau Mops sorgte dafür, dass kein Krümel des Leberwurstbrotes verloren ging, mit dem ich jetzt meinen Mittagshunger stillte. Und von der Banane gab sie schon mal gar nichts ab, die war Chefmopssache. Die Möwe musste hungrig abziehen.
Immerhin hatte sie mir nicht aus Wut auf den Kopf gekackt – ganz hatte sich mein Glück also nicht verabschiedet.
Nachdem ich mich gestärkt fühlte, zog ich das Smartphone aus der Tasche. Mit zwei Klicks öffnete ich die Messenger-App und tippte.
FenjaBin gleich da. Ich freu mich … nicht.
HenrikKopf hoch. In vier Tagen ist Wochenende. Dann komm ich! Hab sogar drei Extrakte abgestaubt.
Fenja???
War Henrik etwa unter die Apotheker gegangen? Oder seit Neuestem Chemiker? Ich hatte keine Ahnung, wovon er sprach. Für die Antwort brauchte er nur Sekunden.
HenrikSorry. Drei Extratage! Verflixte Autokorrektur.
In vier Tagen. Wie schön! Aber dann? Selbst mit drei Extratagen würde seine Besuchszeit im Nu verfliegen. Die Zeit der Einsamkeit dagegen würde sich wie Stretch dehnen und ziehen.
Müde legte ich den Kopf gegen die Reling und schloss die Augen. Nicht schon wieder daran denken! befahl ich mir und konzentrierte mich auf meine Atmung, um die aufsteigende Verzweiflung niederzukämpfen. Doch natürlich ließen meine Gedanken sich nicht bremsen. Mein Unterbewusstsein kostete jede Möglichkeit aus, mir das Drama meines Lebens wieder vor Augen zu führen. Das Plappern der Touristen, das Klicken der Fotoapparate, das Brummen des Schiffsmotors, das Kreischen der Möwen und das Plätschern des Wassers verschmolzen zu einem Einheitsbrummen. Meine Gedanken wanderten rückwärts und landeten bei dem Moment, der mein gesamtes Leben ein zweites Mal auf den Kopf gestellt hatte.
Heute genau vor zwei Wochen war es gewesen. Die Erinnerung an die Geschehnisse erschütterte mich auch jetzt noch, nachdem ich die Herausforderung längst angenommen hatte und der Countdown für mein Inseljahr so gut wie gestartet war. Das würde ab dem Moment der Fall sein, in dem ich meine Füße auf den Inselboden setzte.
Ein Jahr. Was war schon ein Jahr?
Nichts, wenn es ein tolles Jahr war. Aber wie lange konnte ein Jahr sein, wenn man es nicht genoss?
Und für die Trennung von Henrik war es ewig im Quadrat. Solch eine Probe war schon für eine vollkommen intakte Beziehung eine Herausforderung. Für Henrik und mich wäre es ein Wunder, wenn wir es als Paar überlebten. Andererseits könnte uns nichts mehr erschüttern, wenn wir das geschafft hätten. Vielleicht tat uns die Trennung ja sogar gut, und die Sehnsucht weckte die etwas träge gewordene Leidenschaft.
»Echte Liebe übersteht alle Krisen«, hatte Tante Trude immer gesagt und dann mit einem Seufzen hinzugefügt: »Nur leider ist sie so selten wie eine Perle im Tintenfisch.«
Dass das zwischen Henrik und mir solch eine Perle war, daran hatte Trude gezweifelt, das wusste ich, auch wenn sie es nicht ausgesprochen und sich mit Ratschlägen zurückgehalten hatte.
Wie auch immer, ich musste meine Inselzeit irgendwie mit Sinn füllen, sonst würden sich die Tage, Stunden und Minuten in die Unendlichkeit ausdehnen. Sinn. Ha! Unsinn war das doch! Hanebüchener Quatsch. Von wegen Geschenk! Auch wenn ich Tante Trude nicht ernsthaft böse sein konnte, erschloss sich mir der Ansatz ihres Geschenkes auch jetzt noch nicht. Inzwischen hatte ich Trudes Brief schon viele Male gelesen. Das Original lag in meinem Koffer, aber eine Kopie steckte in meinem Rucksack. Die zog ich nun hervor und vertiefte mich aufs Neue in Trudes letzte Worte.
Liebes Fenchen,
unsere Seelen summen im gleichen Takt, genau wie zwei Nähmaschinen, die sich Seite an Seite die Nähte entlangschnurren. Ja, ich gebe es zu, ein merkwürdiger Vergleich, aber doch absolut passend für uns beide, oder? Immerhin habe ich dir das Nähen beigebracht und bin durchaus ein bisschen – ach was, ein bisschen – mächtig! stolz. Schließlich habe ich damit die Grundlage für deine Karriere legen können. Ich wusste seit deinem ersten Nähversuch (erinnerst du dich? Es war ein Rüschenröckchen!), dass du das Talent dafür hast. Solltest du je an dir zweifeln, dann denke an mich. Du bist fantastisch, du hast das Geschick und die Ideen und wirst deinen Weg gehen. Vertrau mir. Ich sehe dein Gesicht vor mir, wenn du das liest. Ich weiß genau, dass du jetzt lächelst. Behalte das, Fenchen! Lächeln ist das Garn, mit dem man die Seele flicken und sich Flügel zaubern kann. Das weißt du, das habe ich dir immer und immer wieder gepredigt.
So. Jetzt aber genug mit der Gefühlsduselei. Ich komme auf den Punkt. Du warst bei Ferdinand im Büro, und er hat dir das Testament vorgelesen. Jetzt sitzt du bestimmt mit angezogenen Beinen auf deinem Sofa, Coco an dich gekuschelt, und Pablo liegt auf dem Sessel und hat euch im Blick. So liest du diesen Brief.
Das heißt also, ich bin tot.
War ja beim Zustand meines Herzens nur eine Frage der Zeit. Los, komm, Fenchen, trockne die Tränen. Denk an unsere schönen Momente. Okay? Gut.
Bestimmt bist du fassungslos wegen meines Letzten Willens. Aber, liebes Fenchen, glaube deiner ollen Trudehude, es ist das Richtige. Ich habe die letzten Jahre so sehr mit dir gelitten. Jede Wunde, die die ungestüme Welt dir geschlagen hat, hat auch mich geschmerzt. Einmischen war nie mein Ding; ich bin der Meinung, jeder muss eigene Erfahrungen machen dürfen. Aber ich war immer da, wenn es zu stürmisch wurde. Ich war dein Hafen.
Jetzt bin ich nicht mehr da, deshalb muss ich sichergehen, dass du dir dein eigener Hafen sein kannst. Du musst zu dir und deiner Stärke finden. Und genau aus diesem Grund sorge ich nun dafür, dass du für ein Jahr ein paar Gänge runterschalten musst.
In dieser Zeit wirst du Gelegenheit haben, zu dir selbst zu finden. Du wirst dich neu und tiefer kennenlernen, als das möglich ist, wenn man mitten im Gewimmel des Lebens steckt. Das ist mein letztes Geschenk an dich. Nimm dir diese zwölf Monate, nimm dir dein Inseljahr und finde heraus, wo dein wirklicher Platz im Leben sein soll. Falls du nach dieser Frist entschlossen bist, dich von dem Haus und dem Inselleben zu trennen, dann sei es so. Meinen Segen hast du. Aber wer weiß – ich könnte mir vorstellen, dass Amrum die eine oder andere Überraschung für dich bereithält.
Komm, jetzt schmoll nicht länger. Du wirst doch nicht sauer sein wollen auf dein totes Tantchen? Siehste! Und denk daran: Immer wenn du die Nähmaschine surren lässt, bin ich bei dir.
Ich hab dich lieb. Immer!
Deine Trudehude
Ich ließ das Blatt sinken, schniefte und suchte in meiner Jackentasche nach einem Taschentuch. Ach, Tante Trude. Du ganz und gar unmögliche, du wunderbare Trudehude. Ich hab dich auch lieb, dachte ich.
Coco wurde unruhig und versuchte wieder einmal, auf meinen Schoß zu klettern. Sie konnte es kaum aushalten, wenn ich traurig war. Ich lächelte sie an und beruhigte sie, während mir Tränen vom Kinn tropften.
»Jungfrau?«, ertönte eine dunkle Stimme schräg vor mir.
Wie bitte? Das durfte doch wohl nicht wahr sein! Total perplex blinzelte ich gegen die Sonne und versuchte auszumachen, welcher Kerl mich derart plump anquatschte. Oder war es jemand, der nicht gut Deutsch konnte und »Junge Frau« hatte sagen wollen? Bevor ich etwas erkennen konnte, setzte sich die Person neben mich.
»Jungfrauen haben es diese Woche schwer. Mars und Saturn stehen im Quadrat. Venus und Merkur sind rückläufig, das blockiert zusätzlich. Machen Sie sich nichts draus, so eine Konstellation kann die Emotionen schon mal ein bisschen durcheinanderwirbeln. Das legt sich alles, und dann sieht die Welt wieder freundlicher aus.«
Der Kerl mit der dunklen Stimme war eine Frau! Sie klang wie die Frau Staatsanwalt aus dem Münster-Tatort. Sie sah ihr sogar ähnlich.
»Äh, nein, Fisch«, antwortete ich. Mein Mund war deutlich schneller als mein Gehirn. Verflixt! Wie kam ich dazu, einer wildfremden Frau mein Sternzeichen zu verraten? Und noch dazu einer Person, die derart distanzlos war? Normalerweise reagierte ich allergisch auf Menschen, die meinen Tanzbereich missachteten und mir ungefragt zu nahe kamen. Coco streckte sich zu meiner Sitznachbarin hinüber. Sie schnupperte und schnüffelte und begann immer heftiger mit dem Schwanz zu wedeln.
»Vors…«, setzte ich an, doch es war zu spät. Cocos Zunge hatte bereits einmal quer über die Wange der Frau Staatsanwältin geschlabbert. Hastig zog ich den Mops zurück. »Tut mir leid«, sagte ich. »Coco ist eine leidenschaftliche Küsserin.«
Schallendes tiefes Lachen erklang.
»Na dann«, donnerte die Frau. »Ich nehme das als Freundschaftsangebot. Hallo Coco, ich bin Elisabeth. Und ich glaube, dein Frauchen braucht auch dringend einen Kuss. Das hilft am besten gegen Tränen.«
Das ließ Frau Mops sich nicht zweimal sagen. Prompt bekam ich einen Nasenschlecker und wischte mir mit dem Jackenärmel übers Gesicht. Elisabeth musterte mich nachdenklich.
»Fisch also? Die stehen in den nächsten Tagen unter dem Einfluss von Mars. Bist du auf dem Kriegspfad? Liebeskummer? Ärger im Job?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Schlimmer«, sagte ich. »Viel schlimmer. Ich muss für ein Jahr auf Amrum leben.«
Doch statt der erwarteten Anteilnahme donnerte wieder dieses tiefe Lachen los.
»Na dann!«, sagte meine neue Bekanntschaft. »Das ist natürlich Höchststrafe.« Sie wischte sich Lachtränen aus den Augen. »Wenn ich daran denke, dass ich einen Haufen Geld hingeblättert habe, um für immer auf Amrum leben zu dürfen.« Sie gluckste noch ein paar Mal. »Magst du mir die Geschichte erzählen, die hinter deinem Zwangsjahr steckt?«
Kapitel 3
»Für ein Jahr?«, fragte Elisabeth mit Blick auf mein für diese Zeitspanne doch recht spärliches Gepäck. Die Fähre legte gerade an. »Ich kenne Menschen, die brauchen zwei Koffer, wenn sie eine Woche in den Urlaub fahren.«
Da sie lediglich für ein paar Stunden auf Stippvisite auf Föhr gewesen war und deshalb nur eine kleine Tasche bei sich hatte, half sie mir ganz selbstverständlich mit meinem Gepäck. Frau Staatsanwalt hatte sich nach dem etwas plumpen Start zu einer wunderbaren Reisebegleitung entwickelt. Wir hatten geplaudert, gelacht, und irgendwie passte die Wellenlänge zwischen uns so perfekt, dass ich das Gefühl hatte, wir wären langjährige Freundinnen. Kaum zu glauben, dass wir uns gerade erst kennengelernt hatten.
»Ich habe schon etliche meiner Sachen bei Trude im Haus, und was fehlt, bringt Henrik bei seinen Besuchen mit. Das werden sicher noch zwei oder drei Autoladungen voll«, erklärte ich.
Mit einem tiefen Ächzen hievte Elisabeth den größeren meiner beiden Koffer ans Ufer, während ich mich mit dem kleineren, Pablos Transportbox, Rucksack und Coco vom Schiff runter auf die Insel kämpfte. Kaum hatte ich Land unter den Füßen, blieb ich stehen und blickte auf die Uhr.
Dreizehn Uhr und zweiundfünfzig Minuten, Montag, der 10. Mai.
Wenn schon, dann sollte die Frist auch exakt laufen. In meiner Vorstellung spulte ich die Zeit vorwärts und sah mich heute in einem Jahr die Fähre zurück ins Leben nehmen.
Und jetzt Schluss mit Jammern! befahl ich mir.
Ich würde das Beste aus diesen zwölf Monaten machen und dafür sorgen, dass sie nicht nur so seicht dahinplätscherten, wie ich es mir in meiner dunklen Fantasie ausmalte. Vielleicht würde ich aber auch einfach lernen, das Plätschern zu genießen. Zumindest für die Zeit auf der Insel.
Über mir erklang ein heiserer Schrei, ich hob den Blick – klatsch … landete eine Portion Möwendreck auf meiner Schulter.
»Hey«, schrie ich, aber das ließ den Missetäter unbeeindruckt. Na prima. Vielen Dank auch, für dieses herzliche Willkommen, blödes Vieh! So viel zu meinen Glücksgedanken, die ich zu diesem Thema noch auf der Fähre gehabt hatte.
Empört blickte ich der Möwe hinterher, doch Elisabeth klopfte mir auf die Schulter – die saubere natürlich – und sagte: »Na dann! Das nenn ich mal ein gutes Omen! Hartelk welkimen üüb Oomram.«
Elisabeth und ich nahmen zusammen ein Taxi. Zuerst ging es zum Olsenhaus neben der alten Mühle in Nebel, wo Elisabeth seit ein paar Monaten wohnte. Während der Fahrt erzählte sie mir, dass es sie viel Geduld und Überredungskunst gekostet hatte, aber am Ende hatte sie gewonnen, sie hatte den Verkäufer überzeugt, ihr das Haus zu überlassen. Voller Stolz erzählte sie mir von dem Moment, als sie das erste Mal den Schlüssel ins Schloss gesteckt und die Tür zu dem Haus geöffnet hatte, das nun endlich ihr gehörte. Sie sagte, sie hatte damals Gänsehaut gehabt vor Glück, und selbst jetzt, als sie nur davon erzählte, stellten sich die Härchen auf ihren Armen schon wieder senkrecht.
Ich lauschte ihren Ausführungen staunend. Sie meinte das alles wirklich so. Ihr Herz hing an der Insel, und es war ihr größtes Glück, das Olsenhaus, in das sie sich vor Jahren bereits, während eines Urlaubs, verliebt hatte, ihr Eigen zu nennen.
Ich fragte mich, was mit mir nicht stimmte, da ich irgendwie der einzige Mensch zu sein schien, der nicht diesem Inselzauber verfallen war.
Ich mochte einfach das Gefühl nicht, von der Welt abgeschnitten zu sein. Die Abhängigkeit von Fährplänen und dem Wetter nervte mich. Was, wenn ich spontan sein wollte? Mal eben nach Hamburg, einen Stadtbummel machen? Oder in ein Konzert, die Oper oder ein Musical.
Idylle war gut und schön, aber doch nur, wenn ich die Wahl hatte. All das erklärte ich ihr wortreich.
Elisabeth lachte all meine Einwände weg.
»Wenn mir nach Festland ist, dann nehme ich die Fähre und schwupp, bin ich dort. Die paar Stunden. Wo soll das Problem sein?«, fragte sie.
Ich öffnete den Mund, um es ihr zu erklären, aber dann schloss ich ihn wieder, ohne dass ein Wort über meine Lippen gekommen war. Ich beobachtete die vorbeifliegenden Wiesen und schwieg nachdenklich.
Vielleicht hatte Elisabeth recht? Wo war das Problem? Hatte ich mich vor lauter Inselablehnung in eine Art Hysterie gesteigert? Es war Zeit, dass ich mich zusammenriss. Mir selbst zuliebe, aber auch wegen Coco, die wieder einmal winselte, um mir zu zeigen, dass sie mein Unbehagen spürte und für mich da sein wollte. Ich kraulte ihr Kinn und lächelte sie an.
»Problem oder nicht Problem«, sagte ich dann. »Jetzt bin ich hier, und das wird sich nicht so schnell ändern. Also werde ich das Beste draus machen.«
Trudes Haus lag in Süddorf links der Hauptstraße am Ende des Weges und damit am nächsten zu den Dünen. Das Gartentürchen knarzte leise, als ich es schloss, bevor ich Cocos Leine löste. Sie liebte dieses mit einem weißen Staketenzaun eingefasste Reich und konnte es normalerweise kaum erwarten, endlich lossausen zu dürfen.
Für Coco waren die Inselbesuche immer ein Mopsspaß vom Feinsten. Bei Trude im Garten durfte sie nach Herzenslust stromern und schnuppern, ganz anders als bei uns in Hamburg, wo sie die meiste Zeit an der kurzen Leine gehen musste. Ich dachte über die Formulierung meiner Gedanken nach, bei Trude, und betrachtete Garten und Haus. Es fühlte sich an, als wäre ich das erste Mal hier. Alles wirkte irgendwie fremd, und das, obwohl ich seit meiner Kindheit immer wieder viel Zeit hier verbracht hatte.
Das Haus stand da wie immer: weiße Fassade, Sprossenfenster, Reetdach. Aber es war nicht mehr das Trudehudehaus und ich nicht mehr die Besucherin. Bei Trude gab es jetzt nicht mehr. Nein. Jetzt war es das Fenjahaus, zumindest theoretisch und für ein Jahr. Es schien darauf zu warten, dass ich es mit neuer Energie füllte.
Den Garten hatte Trude liebevoll angelegt und so gestaltet, dass er nicht zu schnieke wirkte. Strandrosen wechselten sich mit Edelrosen ab und umrahmten die Grasfläche, die mehr Wiese als Rasen war. Natürlich und ein bisschen wild, aber dennoch nicht vernachlässigt. Beim Anblick der Blumen und Sträucher wurde mir klar, dass auch die Pflege der Beete und des Rasens künftig zu meinen Aufgaben zählte, wenn ich nicht alles verwahrlosen lassen wollte. Oha! Ich schickte schon mal vorab eine Entschuldigung Richtung Pflanzen. So erfolgreich Trude mir das Nähen und die Liebe zur kreativen Arbeit beigebracht hatte, so gnadenlos waren ihre Versuche, meinen Daumen ein wenig grün zu färben, im Ansatz gescheitert. Ich kannte die Stockrosen, Rhododendren und Holunder. Rosen konnte ich von Efeu unterscheiden – meistens –, aber dann war ich auch schon fast am Ende meines Gärtnerlateins. Rasenmähen ging noch. Das machte mir sogar Spaß.
Trude hatte einen manuellen Rasenmäher, und ich liebte es, das Teil kreuz und quer oder auch mal im Kreis über das Gras zu schieben und die Muster zu bestaunen, die auf diese Weise entstanden. Trude hatte immer so getan, als würde sie an meiner kreativen Mäh-Ader verzweifeln, und die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und dann sagte sie etwas wie: »Du wirst deine ersten Stoffdesigns wohl mit dem Rasenmäher entwerfen, so wie du hier zugange bist. Na, was soll’s. Haben die Nasenlüfter schon was zu gucken.«
Und immer konnte ich den Stolz in ihren Augen blitzen sehen, weil sie seit jeher fest überzeugt gewesen war, dass ich eine große Designerkarriere vor mir hatte. Wie Coco Chanel – mindestens!
Coco riss mich mit einem energischen Wuff aus meinen Überlegungen. Von wegen Mopsspaß! Sie stand zu meiner großen Überraschung immer noch an derselben Stelle und starrte Pablos Box an. Ach so, klar, sie wollte mit ihrem Katerfreund gemeinsam durch die Gegend streunen. Für den Kater war es das erste Mal auf der Insel, normalerweise war er immer in Hamburg geblieben, wenn ich Kurzurlaub auf Amrum gemacht hatte. Aber heute war nichts normal – und es ging auch nicht um einen Kurzurlaub.
»Nein, tut mir leid, Süße«, erklärte ich Coco also. »Pablo darf erst in ein paar Tagen raus. Erst mal muss er das Haus kennenlernen.«
Ich hatte keine Lust, gleich in den ersten Tagen sämtliche Nachbarn abzuklappern auf der Suche nach dem ausgebüxten Kater. Außerdem schwebte er sowieso noch auf rosa Wolken.
Wenn ihr Freund nicht durfte, wollte Coco auch nicht. Und so sauste sie statt in den Garten zielstrebig Richtung Haustür und wartete.
Ich kämpfte noch mit mir.
Vielleicht sollte ich zuerst einen Gartenrundgang machen? Das Haus schien mit einer magischen Sperre versiegelt zu sein. Ich konnte mir nicht vorstellen, den Schlüssel ins Schloss zu stecken, die Tür zu öffnen und einzutreten, ohne Trude, die mir mit ihrer fröhlichen Stimme entgegenrief: »Hallihallo mein Fenchen, da bist du ja! Komm, ich habe Tee gekocht. Und deine Lieblingsplätzchen sind auch schon fertig. Setz dich und erzähl mir von der weiten Welt.«
Trude hatte die weltbesten Knopfkekse gebacken. Das waren Dinkelvollkorn-Mandel-Kekse in Knopfoptik. Obwohl sie mir das Rezept verraten hatte, blieben meine Versuche immer hinter dem Geschmack ihrer Zauberkekse zurück. Ganz offensichtlich hatte sie eine Information zurückbehalten. »Die Inselluft, Fenchen«, hatte Trude stets behauptet. »Das ist diese besondere Würze, glaub es mir nur.« Natürlich konnte das nicht stimmen, denn auch meine Versuche in Trudes Küche kamen nicht ganz an ihre Kekse ran. Aber diese Argumentation ließ Trude kalt. Sie grinste und zwinkerte mir zu. Thema erledigt.
Der Gedanke an die Leere und Stille, die mich statt Tee, Knopfkeksen und Trudeschnack begrüßen würden, schnürte mir die Kehle zu.
Ein paar Touristen zogen laut plappernd die Straße entlang und warfen mir neugierige Blicke zu. Dem Klang ihrer Worte nach kamen sie aus Bayern. Pablo maunzte, offenbar ließ die Wirkung der Pillen langsam nach. Ich verwarf die Idee mit dem Gartenrundgang, atmete entschlossen durch und überwand die kurze Distanz bis zur Haustür.
Fast.
Einen letzten Schritt bevor ich das Ziel erreicht hatte, hörte ich eine Stimme hinter mir. Doch es waren nicht die bayrischen Nasenlüfter.
»Dann stimmt es also wirklich, det Wiif hat dir det Haus vermacht und du willst dich jetzt hier bei uns in Süddorf einnisten. Feni, ich sag dir, mach kein’ Quatsch. Verkauf mir den Schuppen, und alle sind glücklich und zufrieden. Du hast doch mit der Insel sowieso nichts am Hut. Hast dich ja die letzten Jahre kaum sehen lassen.«
Die Stimme war mir sehr vertraut – leider.
Es war Malte.
Ich hatte gewusst, dass ich ihm früher oder später begegnen würde, aber später wäre mir eindeutig lieber gewesen – Malte war unausstehlich. Im ersten Moment wollte ich den Schlüssel ins Schloss stecken und ins Haus fliehen, aber damit hätte ich den Kerl einfach gewinnen lassen. Er sollte auf keinen Fall denken, ich würde vor ihm abhauen. Und außerdem …
»Die Inselluft scheint jedenfalls auf Dauer nicht so gesund zu sein.« Bei diesen Worten drehte ich mich schwungvoll um und bemühte mich, dabei breit und betont freundlich zu lächeln. »Oder liegt es am Alter, dass du dir meinen Namen nicht merken kannst? Malti?«
Treffer – daneben. Malte lachte herzlich über meinen Konterversuch.
Gegen diese verflixte Ich-bin-der-König-der-Insel-Arroganz war ich schon vor sechzehn Jahren nicht angekommen. Ich vermutete, diese Selbstgefälligkeit hatte Malte Hinrichs direkt mit der Muttermilch aufgesogen. Was für ein Idiot! Damals schon und heute immer noch.
Ich blitzte ihn an und bemühte mich, nicht klein beizugeben. Warum, verflixt noch mal, sah dieser Kerl nicht aus wie ein Monster? Das würde seinem Charakter entsprechen. Aber nein. Wie er so dastand und mich von oben bis unten und wieder hinauf musterte, sah er aus wie aus einem Werbefilm entsprungen. Seine Haare hatten einen coolen Strubbellook. In Hamburg zahlten die Männer viel Geld für solch eine Frisur. Bei ihm brauchte es lediglich Inselwind. Auch daran hatte sich seit damals nichts geändert. Dieser Blick aus den wasserblauen Augen. Die vollen Lippen und der Dreitagebart. Verdammt! Je länger ich ihn betrachtete, desto mehr Erinnerungen stiegen in mir auf. Energisch schob ich die Bilder weg.
Der reale Malte ließ sich allerdings nicht so einfach wegschieben. Er stand da, auf sein Rad gelehnt, und grinste mich an.
Die Jahre hatten ihn eher noch attraktiver werden lassen. Er sah ein bisschen aus wie dieser zum Anbeißen süße Finne aus dieser Castingshow. Der Musiker mit der »Hühnerhaut«. Mist, wie hieß er nur? Während Malte mich fixierte, konnte ich keinen klaren Gedanken fassen. Und »Hühnerhaut«, wie der Finne es nannte, kroch mir selbst gerade die Arme hinauf.
Aber es war keine Begeisterung, sondern blanke Wut, die mir die Haare zu Berge stehen ließ. Schöne Hülle und abscheulicher Kern – bei Malte hatte sich nichts geändert.
»Wenn du wütend bist, siehst du noch süßer aus. Du bist immer noch eine Wucht, FenJA.«
Was für ein plumper Versuch, mich einzuwickeln! Verstand hatte er definitiv keinen ausgeprägten, sonst wäre ihm klar, dass er damit bei mir nicht weit kommen konnte. Mein Lächeln fühlte sich inzwischen ziemlich eingefroren an, doch ich hielt es tapfer aufrecht und legte all meinen Zorn in meinen Blick.
»Lass uns eins klarstellen, Malte: Wie ich aussehe, süß, sauer oder auch ungenießbar, das geht dich einen Möwenschiet an. Alles klar? Und ob es dir passt oder nicht: Ich bin jetzt auf der Insel, und hier bleibe ich, solange es mir gefällt. Basta.«
Leider war meine Rede ungefähr so erfolgreich, wie bei Windstärke zehn gegen den Wind zu spucken. Malte verschränkte die Arme vor der Brust, hob die Augenbrauen und nickte.
»Alles klar. Da du die Insel ja ohnehin hasst, kann es ja nicht lange dauern, bis du die Flucht ergreifst. Vergiss nur nicht, mir das Haus zu verkaufen, bevor du abhaust. Das würde mir echt gut in den Kram passen.«
Sein Blick hielt meinen fest.
Doch neben der Leichtigkeit und Lebensfreude lag eine Tiefe in seinen Augen, die ich dort früher nicht gesehen hatte. Ich spürte, wie meine Wangen heiß wurden, und riss meinen Blick energisch los.
»Ich … du …«
Vergeblich versuchte ich, Worte zu finden, die auch nur annähernd an die Wut herankamen, die in mir kochte. Gleichzeitig bemühte ich mich, meine Verlegenheit zu überspielen.
Er war noch genauso ein Stinkstiefel wie damals. Total von sich überzeugt, als würde die Welt sich nur um ihn drehen.
Da mir leider nichts Passendes einfiel, sagte ich lediglich: »Ach!«, und machte dazu eine wegwerfende Handbewegung.
Dann wandte ich mich um, ließ ihn stehen und stapfte zur Haustür. So schnell wie möglich schloss ich auf und schlüpfte samt Mops, Katerbox und Gepäck hinein.
Das alles verlief nicht so geschmeidig, wie ich es mir gewünscht hätte, aber nachdem ich zweimal mit dem Koffer an der Zarge hängen geblieben war, hatte ich es geschafft.
Schwer atmend lehnte ich mich von innen gegen die verschlossene Tür. Beim Blick durch das Flurfenster stellte ich fest, dass Malte davonschlenderte. Ich atmete erleichtert auf.
Ein Streit mit Malte Hinrichs war das Letzte, was ich in diesem Moment gebrauchen konnte. Der würde meine unversäumten Nerven so lange bearbeiten, bis sie fransten und endgültig rissen. Deshalb nahm ich mir vor, ihm in der nächsten Zeit so gut es irgendwie ging auszuweichen. Ich musste erst mein Gleichgewicht wiederfinden, mich akklimatisieren und stabilisieren. Wenn ich das geschafft hatte, dann konnte er sich auf was gefasst machen. Von wegen ich hätte mit der Insel nichts am Hut!
Dass er mit seinen Worten genau ins Schwarze getroffen hatte, musste ich ihm ja nicht auf die Nase binden.
Egal, wie sehr ich es hasste, hier festzusitzen, ihn ging das nichts an. Absolut nichts!
Die Erinnerung an damals, die sich hartnäckig in den Vordergrund schob, schob ich nicht minder beharrlich immer wieder weg. Heute war heute. Die Geschehnisse von vor sechzehn Jahren hatten keine Bedeutung mehr. Und mein Erbe würde Malte sich in diesem Leben sicher nicht unter den Nagel reißen.
Trude hatte zwar gesagt, dass ich das Haus nach dem Zwangsjahr verkaufen durfte, aber ganz sicher hatte sie dabei nicht an Malte gedacht. Der war genauso schlimm wie sein Vater Thies, vielleicht sogar noch schlimmer. Und mit dem alten Thies hatte Trude seit ich denken konnte Krieg. »Wenn du dem die Hand gibst, musst du hinterher die Finger zählen, Fenchen«, hatte sie gesagt. »Der Kerl rafft alles an sich, dessen er habhaft werden kann. Und außerdem ist er die Missgunst in Person. Der gönnt anderen Leuten den Dreck unter ihren Fingernägeln nicht, das sag ich dir.«
Immerhin bestand diese Abneigung nicht nur auf Trudes Seite. Wann immer ich das Pech hatte, dem alten Thies über den Weg zu laufen, hatte er umgehend begonnen, auf Trudehude zu schimpfen und sie schlechtzumachen.
Das war schon mehr als sich nicht leiden können. Die beiden gaben sich alle Mühe, kein gutes Haar am anderen zu lassen. Ich hätte ja zu gern die Geschichte gehört, die hinter dieser Wut steckte. Es war offensichtlich, dass dieser Streit eine massive Ursache haben musste. Aber wann immer ich versucht hatte, etwas aus Trudehude herauszukriegen, hatte sie sich verschlossen wie eine doppelt abgesteppte Naht.
Ich schüttelte die Gedanken an die Hinrichs ab und konzentrierte mich lieber auf mein Hier und Jetzt.
Koffer, Rucksack und Transportbox stellte ich in den Flur. Pablo ließ ich drin, er war ohnehin noch einmal eingeschlafen.
Am liebsten wäre ich zu ihm reingeklettert und hätte mich an ihn gekuschelt, aber abgesehen davon, dass ich nicht in die Box passte und Coco ganz sicher Einwände hätte, würde es an meiner Situation auch nichts ändern.
Unangenehme Aufgaben werden nicht besser, wenn man die Erledigung hinauszögert – auch das war eine von Trudes Weisheiten. Und wie immer musste ich ihr zähneknirschend recht geben. Mehr noch. Je länger ich hier stand und zögerte, desto mächtiger wurden die Ungeheuer, die meine Fantasie auf mich losließ. Genug gezögert! Vorsichtig öffnete ich die Tür zum Wohnzimmer und trat – Coco mir dicht auf den Fersen – ein.
Die Luft schlug mir schal und abgestanden entgegen. Ich beschloss, gut zu lüften und danach in diesem Raum mit Pablos Eingewöhnung zu beginnen.
Es sah aufgeräumt aus. Nur auf dem Tisch lag eine aufgeschlagene Zeitschrift, als würde Trude im nächsten Moment hereinkommen und weiterschmökern.
Ich schluckte und betrat das Esszimmer, das in die weiße Landhausküche mündete. Die Kühlschranktür stand offen, das Gerät war ausgeschaltet. Die Luft roch auch hier verbraucht, sodass ich zuerst die Terrassentür aufzog. Das Kreischen und Pfeifen der Vögel drang lautstark ins Haus hinein.
Ein Austernfischer stakste über den Rasen, und ich musste unwillkürlich lächeln, als er sein Konzert nach einer kurzen Unterbrechung fortsetzte. Dieses langsam ansteigende Pfeifen erinnerte mich immer an einen Dampfkessel, in dem das Wasser gerade anfing zu kochen. Und auch das Ende der Pfeifsalve passte zu diesem Bild, denn der Ruf ebbte langsam ab, als ließe der weniger werdende Dampf die Pfeife allmählich verstummen. Deshalb nannte ich die Austernfischer seit meiner Kindheit Dampfkesselvögel.
Ich lauschte dem Konzert ein Weilchen, es tat meinen angespannten Nerven gut. Erst nach ein paar Augenblicken setzte ich meine Inspektion im ersten Stock fort. Den Koffer wuchtete ich aufs Bett und ließ ihn liegen. Ausräumen konnte ich später noch.
Kapitel 4
Als ich gerade Trudes Kleiderschrank im Schlafzimmer inspizieren wollte, hörte ich, wie jemand den Schlüssel in die Haustür schob und öffnete. Im ersten Moment gefror mir das Blut in den Adern.
Panisch sah ich mich nach einer Waffe um und griff den Hocker, der in der Ecke neben der Kommode stand. Ich schlich zur Tür, überlegte, wie ich weiter vorgehen sollte. Runterwagen oder lieber abwarten? Und wie, verdammt, kam der Eindringling an den Hausschlüssel? Geklaut? Wann? Wo?
Vor lauter Nervosität konnte ich keinen klaren Gedanken fassen.
Musste ich auch nicht. Coco nahm mir die Entscheidung ab. Sie quetschte sich an mir vorbei durch den Türspalt und trappelte die Treppe hinunter.
»Coco, hallo, meine Süße. Wie schön, dich zu sehen. Wo hast du denn dein Frauchen versteckt? Hm?« Einen Moment Stille, dann: »Fenja, bist du da? Ich bin’s, Hannah.«
Mit einem erleichterten Schnauben ließ ich den Hocker sinken und stürmte die Treppe hinunter.
»Hannah, du verrückte Nudel. Weißt du eigentlich, dass ich dich beinahe erschlagen hätte?«
Vor lauter Überschwang und Gefühlschaos kamen mir die Tränen.
Hannah kannte ich seit meiner Kindheit, und wir waren immer gute Freundinnen gewesen, auch wenn der Kontakt zwischendurch monatelang abbrach. Sahen wir uns, war es, als wäre das letzte Treffen erst wenige Stunden her gewesen. Die Vertrautheit war da, und wir konnten ohne Stocken weiterplaudern.
Dass ich sie beinahe erschlagen hätte, ließ sie allerdings kalt. Stattdessen strahlte sie mich an.
»Fenja! Ist das schön. Ich freu mich so, dich zu sehen.« Dann fiel ihr der Anlass ein, der mich auf die Insel gebracht hatte. »Liebes, es tut mir so leid. Wir hatten alle so sehr gehofft, dass Trude es schafft.«
Ich schluckte und nickte. Sprechen konnte ich gerade nicht. Deshalb redete Hannah weiter.
»Ich wäre wirklich gern zur Beerdigung gekommen, aber ich hab es einfach nicht geschafft. War es sehr schlimm?« Sie schüttelte den Kopf und verdrehte die Augen. »Ich Idiotin. Natürlich war es sehr schlimm. Es tut mir so leid.«
Sie drückte mich wieder fest an sich, und ich genoss das Gefühl, gehalten zu werden.
»Stimmt es?«, fragte Hannah nach einiger Zeit. »Bleibst du jetzt auf Amrum?«
Es hatte sich natürlich rumgesprochen. Geheimnisse hielten sich auf Amrum nie lange, das war schon immer so und würde sich wohl auch nie ändern.
»Tja«, ich verzog das Gesicht. »Zumindest für die nächsten zwölf Monate. Das hat Trude eingefädelt, und wie du siehst, geht ihr Plan auf. Aber was machst du denn überhaupt hier?«
»Trude hat mir einen Schlüssel gegeben, für Notfälle. Nachdem sie den Herzinfarkt hatte und ins Krankenhaus gebracht worden war, bin ich hergekommen und hab nach dem Rechten gesehen.« Sie hob einen Korb hoch, ich sah Obst, Käse und Milch. »Ich hab den Kühlschrank ausgeräumt und alles mitgenommen, was hätte verderben können. Und da dieser Notar, Doktor irgendwas, mir gemailt hat, dass du heute ankommst, hab ich ein bisschen was eingekauft, damit du nicht verhungerst. Was ist? Bekomme ich einen Tee?«
Was für eine schöne Idee! Und was für ein warmes Gefühl, den Anfang nicht alleine bewältigen zu müssen, sondern einen lieben Menschen an meiner Seite zu haben. Ich musste Hannah in den Arm nehmen – noch einmal – und ihr ein Küsschen auf die Wange drücken.