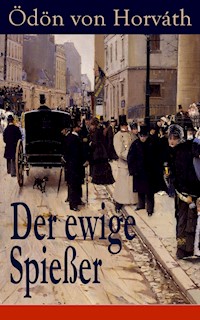Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der letzte Roman von Ödön von Horváth, die Lebensgeschichte eines Soldaten in Zeiten des Nationalismus. Nach dem Tod der Mutter und Meinungsverschiedenheiten mit dem Vater, zieht der Ich-Erzähler aus und muss sich fortan als Bettler durchschlagen. Neid und Missgunst zusammen mit seiner misslichen Lage bringen ihn nach und nach der nationalsozialistischen Ideologie näher. Im Krieg sieht er die Lösung seiner Probleme. Kurz bevor er an die Front zieht, verliebt er sich. Die Realität des Krieges und eine Verletzung bringen ihn schließlich zur inneren Umkehr und lassen Zweifel an der Richtigkeit seines Handelns aufkommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Kind unserer Zeit
Ödön von Horváth
Ein Kind unserer Zeit
© Ödön von Horváth 1938
Umschlagfoto: Columbus Avenue at Northampton Street / City of Boston Archives
© Lunata Berlin 2019
Inhalt
Ein Kind unserer Zeit
Der Vater aller Dinge
Das verwunschene Schloß
Der Hauptmann
Der Bettler
Im Hause des Gehenkten
Der Hund
Der verlorene Sohn
Das denkende Tier
Im Reiche des Liliputaners
Anna, die Soldatenbraut
Der Schneemann
Vorarbeiten und Varianten
I
Der Soldat
Der Vater aller Dinge
Hoch in der Luft
Abends im Dorf
Das verwunschene Schloß
Die Ballade von der großen Liebe
Am Rande der Zeit
Die Ballade von der Soldatenbraut
Anna, die Soldatenbraut
Das Vaterland ruft und nimmt auf das Privatleben seiner Kinder mit Recht keine Rücksich
Die Hymne an den Krieg ohne Kriegserklärung
Variationen über ein bekanntes Thema
Der Hauptmann
[Im Hause des Gehenkten]
Der Student
Der Gedanke
Der Bettler
Der Schneemann
Über den Autor
Ein Kind unserer Zeit
Roman
Der Vater aller Dinge
Ich bin Soldat.
Und ich bin gerne Soldat.
Wenn morgens der Reif auf den Wiesen liegt oder wenn abends die Nebel aus den Wäldern kommen, wenn das Korn wogt und die Sense blitzt, obs regnet, schneit, ob die Sonne lacht, Tag und Nacht – immer wieder freut es mich, in Reih und Glied zu stehen.
Jetzt hat mein Dasein plötzlich wieder Sinn! Ich war ja schon ganz verzweifelt, was ich mit meinem jungen Leben beginnen sollte. Die Welt war so aussichtslos geworden und die Zukunft so tot. Ich hatte sie schon begraben. Aber jetzt hab ich sie wieder, meine Zukunft, und lasse sie nimmer los, auferstanden aus der Gruft!
Es ist noch kaum ein halbes Jahr her, da stand sie bei meiner Musterung neben dem Oberstabsarzt. »Tauglich!« sagte der Oberstabsarzt, und die Zukunft klopfte mir auf die Schulter. Ich spürs noch heut.
Und drei Monat später erschien ein Stern auf meinem leeren Kragen, ein silberner Stern. Denn ich hatte hintereinander ins Schwarze getroffen, der beste Schütze der Kompanie. Ich wurde Gefreiter und das will schon etwas heißen.
Besonders in meinem Alter.
Denn ich bin fast unser Jüngster.
Aber eigentlich sieht das nur so aus.
Denn eigentlich bin ich viel älter, besonders innerlich. Und daran ist nur eines schuld, nämlich die jahrelange Arbeitslosigkeit.
Als ich die Schule verließ, wurde ich arbeitslos.
Buchdrucker wollte ich werden, denn ich liebte die großen Maschinen, die die Zeitungen drucken, das Morgen-, Mittag- und Abendblatt.
Aber es war nichts zu machen.
Alles umsonst!
Nicht einmal zum Lehrling konnte ichs bringen in irgendeiner Vorstadtdruckerei. Von der inneren Stadt ganz zu schweigen!
Die großen Maschinen sagten: »Wir haben eh schon mehr Menschen, als wir brauchen. Lächerlich, schlag dir uns aus dem Kopf!«
Und ich verjagte sie aus meinem Kopf und auch aus meinem Herzen, denn jeder Mensch hat seinen Stolz. Auch ein arbeitsloser Hund.
Raus mit euch, ihr niederträchtigen Räder, Pressen, Kolben, Transmissionen! Raus!
Und ich wurde der Wohltätigkeit überwiesen, zuerst der staatlichen, dann der privaten –
Da stand ich in einer langen Schlange und wartete auf einen Teller Suppe. Vor einem Klostertor.
Auf dem Kirchendach standen sechs steinerne Figuren. Sechs Heilige. Fünf Männer und ein Weib.
Ich löffelte die Suppe.
Der Schnee fiel und die Heiligen hatten hohe weiße Hüte.
Ich hatte keinen Hut und wartete auf den Tau.
Die Sonne wurde länger und die Stürme wärmer –
Ich löffelte die Suppe.
Gestern sah ichs wieder, das erste Grün.
Die Bäume blühen und die Frauen werden durchsichtig.
Auch ich bin durchsichtig geworden.
Denn mein Rock ist hin und meiner Hose gings ebenso –
Man weicht mir fast schon aus.
Viele Ideen gehen durch meinen Kopf, kreuz und quer.
Mit jedem Löffel Suppe werden sie ekelhafter.
Plötzlich hör ich auf.
Ich stell das Blech auf den steinernen Boden, es ist noch halb voll und mein Magen knurrt, aber ich mag nicht mehr.
Ich mag nicht mehr!
Die sechs Heiligen auf dem Dache blicken in die blaue Luft.
Nein, ich mag sie nicht mehr, meine Suppe! Tag für Tag dasselbe Wasser! Mir wirds schon übel, wenn ichs nur seh, diese Bettelbrüh!
Schütt sie aus, deine Suppe!
Weg! In den Dreck damit! –
Die Heiligen auf dem Dache schauen mich vorwurfsvoll an.
Glotzt nicht dort droben, helft mir lieber da drunten!
Ich brauch einen neuen Rock, eine ganze Hose – eine andere Suppe!
Abwechslung, Herrschaften! Abwechslung!
Lieber stehlen als betteln!
Und so dachten auch viele andere von unserer Schlange, ältere und jüngere – es waren nicht die schlechtesten.
Ja, wir haben viel gestohlen, meist warens dringende Lebensmittel. Aber auch Tabak und Zigaretten, Bier und Wein.
Meist besuchten wir die Schrebergärten. Wenn der Winter nahte und die glücklichen Besitzer daheim in der warmen Küche saßen.
Zweimal wurde ich fast erwischt, einmal bei einer Badehütte.
Aber ich entkam unerkannt.
Über das Eis, im letzten Moment.
Wenn mich der Kriminaler erreicht hätt, dann war ich jetzt vorbestraft. Aber das Eis war mir gut, er flog der Länge nach hin.
Und meine Papiere blieben lilienweiß.
Kein Schatten der Vergangenheit fällt auf meine Dokumente.
Ich bin doch auch ein anständiger Mensch und es war ja nur die Hoffnungslosigkeit meiner Lage, daß ich so schwankte wie das Schilf im Winde – sechs trübe Jahre lang. Die Ebene wurde immer schiefer und das Herz immer trauriger. Ja, ich war schon sehr verbittert.
Aber heut bin ich wieder froh!
Denn heute weiß ichs, wo ich hingehör.
Heut kenn ich keine Angst mehr, ob ich morgen fressen werde. Und wenn die Stiefel hin sind, werden sie geflickt, und wenn der Anzug hin ist, krieg ich einen neuen, und wenn der Winter kommt, werden wir Mäntel bekommen.
Große warme Mäntel. Ich hab sie schon gesehen.
Das Eis braucht mir nicht mehr gut zu sein!
Jetzt ist alles fest.
Endlich in Ordnung.
Adieu, ihr täglichen Sorgen!
Jetzt ist immer einer neben dir.
Rechts und links, Tag und Nacht.
»Angetreten!« tönt das Kommando.
Wir treten an, in Reih und Glied.
Mitten auf dem Kasernenhof.
Und die Kaserne ist so groß wie eine ganze Stadt, man kann sie auf einmal gar nicht sehen. Wir sind Infanterie mit leichten und schweren Maschinengewehren und nur zum Teil erst motorisiert. Ich bin noch unmotorisiert.
Der Hauptmann schreitet unsere Front ab, wir folgen ihm mit den Blicken, und wenn er beim dritten vorbei ist, schauen wir wieder vor uns hin. Stramm und starr. So haben wirs gelernt.
Ordnung muß sein!
Wir lieben die Disziplin.
Sie ist für uns ein Paradies nach all der Unsicherheit unserer arbeitslosen Jugend –
Wir lieben auch den Hauptmann.
Er ist ein feiner Mann, gerecht und streng, ein idealer Vater.
Langsam schreitet er uns ab, jeden Tag, und schaut nach, ob alles stimmt. Nicht nur, ob die Knöpfe geputzt sind nein, er schaut durch die Ausrüstung hindurch in unsere Seelen. Das fühlen wir alle.
Er lächelt selten und lachen hat ihn noch keiner gesehen. Manchmal tut er uns fast leid, aber man kann ihm nichts vormachen. Wie er möchten wir gerne sein. Wir alle.
Da ist unser Oberleutnant ein ganz anderes Kaliber. Er ist zwar auch gerecht, aber oft wird er schon furchtbar jähzornig und brüllt einen an wegen der geringsten Kleinigkeit oder wegen nichts und wieder nichts. Aber wir sind ihm nicht bös, er ist halt sehr nervös, weil er vollständig überarbeitet ist. Er möcht nämlich in den Generalstab hinein und da lernt er Tag und Nacht. Immer steht er mit einem Buch in der Hand und liest sein Zeug.
Neben ihm ist unser Leutnant nur ein junger Hund. Er ist kaum älter als wir, also auch so zirka zweiundzwanzig. Er möcht zwar oft auch gern brüllen, aber er traut sich nicht recht. Trotzdem haben wir ihn gern, denn er ist ein fabelhafter Sportsmann, unser bester Sprinter. Er läuft einen prächtigen Stil.
Überhaupt hat das Militär eine starke Ähnlichkeit mit dem Sport.
Man möcht fast sagen: es ist der schönste Sport, denn hier gehts nicht nur um den Rekord. Hier gehts um mehr. Um das Vaterland.
Es war eine Zeit, da liebte ich mein Vaterland nicht. Es wurde von vaterlandslosen Gesellen regiert und von finsteren überstaatlichen Mächten beherrscht. Es ist nicht ihr Verdienst, daß ich noch lebe.
Es ist nicht ihr Verdienst, daß ich jetzt marschieren darf. In Reih und Glied.
Es ist nicht ihr Verdienst, daß ich heut wieder ein Vaterland hab. Ein starkes und mächtiges Reich, ein leuchtendes Vorbild für die ganze Welt!
Und es soll auch einst die Welt beherrschen, die ganze Welt!
Ich liebe mein Vaterland, seit es seine Ehre wieder hat! Denn nun hab auch ich sie wieder, meine Ehre!
Ich muß nicht mehr betteln, ich brauch nicht mehr zu stehlen.
Heute ist alles anders.
Und es wird noch ganz anders werden!
Den nächsten Krieg gewinnen wir. Garantiert!
Alle unsere Führer schwärmen zwar immer vom Frieden, aber ich und meine Kameraden, wir zwinkern uns nur zu. Unsere Führer sind schlau und klug, sie werden die anderen schon hineinlegen, denn sie beherrschen die Kunst der Lüge wie keine zweiten.
Ohne Lüge gibts kein Leben. Wir bereiten uns immer nur vor.
Jeden Tag treten wir an und dann gehts zum Tor hinaus, im gleichen Schritt und Tritt.
Wir marschieren durch die Stadt.
Die Zivilisten sehen uns glücklich an, nur einige Ausnahmen würdigen uns keines Blickes, als wären sie böse auf uns. Das sind aber immer nur alte Männer, die eh nichts mehr zählen. Aber es ärgert uns doch, wenn sie wegschauen oder plötzlich sinnlos vor einer Auslage halten, nur um uns nicht sehen zu müssen. Bis sie uns dann doch erblicken, bis sie es nämlich merken, daß wir uns im Glas der Auslage spiegeln. Dann ärgern sie sich gelb und grün. Jawohl, ihr Herrschaften, ihr Ewig-Gestrigen, Ausrangierten, mit eurem faden pazifistischen Gesäusel, ihr werdet uns nicht entrinnen! Betrachtet nur die Delikatessen, die Spielwaren, Bücher und Büstenhalter – ihr werdet uns überall sehen!
Wir marschieren auch durch die Auslagen!
Es ist uns bekannt, wir gefallen euch nicht.
Ich kenne euch schon – durch und durch!
Mein Vater ist auch so ein ähnlicher.
Auch er schaut weg, wenn er mich marschieren sieht.
Er kann uns Soldaten nicht ausstehen, weil er die Rüstungsindustrie haßt. Als wärs das Hauptproblem der Welt, ob ein Rüstungsindustrieller verdienen darf oder nicht!
Soll er verdienen, wenn er nur treu liefert!
Prima Kanonen, Munition und den ganzen Behelf –
Das ist für uns Heutige kein Problem mehr.
Denn wir haben erkannt, daß das Höchste im Leben des Menschen das Vaterland ist. Es gibt nichts, was darüber steht an Wichtigkeit. Alles andere ist Unsinn. Oder im besten Fall nur so nebenbei.
Wenn es dem Vaterland gut geht, geht es jedem seiner Kinder gut. Gehts ihm schlecht, geht es zwar nicht allen seinen Kindern schlecht, aber auf die paar Ausnahmen kommts auch nicht an im Angesicht des lebendigen Volkskörpers.
Und gut gehts dem Vaterland nur, wenn es gefürchtet wird, wenn es nämlich eine scharfe Waffe sein eigen nennt –
Und diese Waffe sind wir.
Auch ich gehör dazu.
Aber so gibt eben noch immer verrannte Leute, die sehen diese selbstverständlichen Zusammenhänge nicht, sie wollen sie auch nicht sehen, denn sie sind noch immer in ihren plumpen Ideologien befangen, die im neunzehnten Jahrhundert wurzeln. Auch mein Vater ist solch einer von dieser Garde.
Es ist eine traurige Garde.
Eine geschlagene Armee.
Mein Vater ist ein verlogener Mensch.
Er war drei Jahre in Kriegsgefangenschaft, ab 1917. Erst Ende 1919 ist er wieder heimgekehrt. Ich selbst bin 1917 geboren, bin also ein sogenanntes Kriegskind, aber ich kann mich natürlich an diesen ganzen Weltkrieg nicht mehr erinnern. Und auch nicht an die Zeit hinterher, an die sogenannten Nachkriegsjahre. Nur manchmal so ganz verschwommen. Meine richtige Erinnerung setzt erst ein zirka 1923.
Mein Vater ist von Beruf Kellner, ein Trinkgeldkuli. Er behauptet, daß er durch den Weltkrieg sozial gesunken war, weil er vor 1914 nur in lauter vornehmen Etablissements arbeitete, während er jetzt draußen in der Vorstadt in einem sehr mittelmäßigen Betrieb steckt. Er hinkt nämlich etwas seit seiner Gefangenschaft, und ein hinkender Kellner, das kann halt in einem Luxuslokal nicht sein.
Aber trotz seiner Privattragödie hat er kein Recht, auf den Krieg zu schimpfen, denn Krieg ist ein Naturgesetz.
Überhaupt ist mein Vater ein Nörgler. Als ich noch bei ihm in seinem Zimmer wohnte, krachten wir uns jeden Tag. Immer schimpft er über die Leut, die das Geld haben, und derweil sehnt er sich nach ihnen – wie gern würde er sich wieder vor ihnen verbeugen, denn er denkt ja nur an sein Trinkgeld! Ja, er ist ein durch und durch verlogener Mensch, und ich mag ihn nicht.
Wenn er nicht zufällig mein Vater war, würde ich mich fragen: wer ist denn dieser widerliche Patron?
Einmal sagte ich zu ihm: »Hab nur keine Angst vor dem kommenden Krieg, du kommst eh nimmer dran mit deinem Alter!« Er blieb vorerst ganz ruhig und sah mich an, als würde er sich an etwas erinnern wollen. »Ja«, fuhr ich fort, »du zählst nicht mehr mit.« Er blieb noch immer ruhig, aber plötzlich traf mich ein furchtbar gehässiger Blick, wie aus einem Hinterhalt. Und dann begann er zu schreien. »So geh nur in deinen Krieg!« brüllte er. »Geh und lern ihn kennen! Einen schönen Gruß an den Krieg! Fall, wenn du magst! Fall!«
Ich ging fort.
Das war vor drei Jahren.
Ich hör ihn noch brüllen und sehe mich im Treppenhaus. Auf einmal hielt ich an und ging zurück. Ich hatte meinen Bleistift vergessen, ich wollte nämlich zu den Redaktionen, wo die Zeitungen mit den kleinen Anzeigen im Schaukasten hängen, um dort vielleicht eine Arbeit zu finden, irgendeine – ja, damals glaubte ich trotz allem noch an Märchen.
Als ich das Zimmer wieder betrat, stand mein Vater am Fenster und sah hinaus. Es war sein freier Tag in der Woche.
Er wandte sich mir nur kurz zu –
»Ich hab meinen Bleistift vergessen«, sagte ich.
Er nickte und sah wieder hinaus.
Was war das für ein Blick?
Hat er geweint?
Ich ging wieder fort.
Weine nur, dachte ich, du hast auch allen Grund dazu, denn eigentlich trägt deine Generation die Hauptschuld daran, daß es mir jetzt so dreckig geht – (damals war ich ja noch arbeitslos und hatte keine Zukunft).
Die Generation unserer Väter hat blöden Idealen von Völkerrecht und ewigem Frieden nachgehangen und hat es nicht begriffen, daß sogar in der niederen Tierwelt einer den anderen frißt. Es gibt kein Recht ohne Gewalt. Man soll nicht denken, sondern handeln!
Der Krieg ist der Vater aller Dinge.
Ich hab mit meinem Vater nichts mehr zu tun.
Ich kann es nicht ausstehen, das ewige Geweine!
Immer wieder hören müssen: »Vor dem Krieg, das war eine schöne Zeit!« – da werd ich ganz wild.
Mir hätt sie nicht gefallen, deine schöne Zeit!
Ich kann sie mir genau vorstellen nach den alten Photographien.
Du hattest eine Dreizimmerwohnung, warst noch nicht verheiratet und führtest, wie es seinerzeit hieß, ein flottes Junggesellenleben.
Mit Weibern und Kartenspiel.
Alle Welt hatte Geld.
Es war eine verfaulte Zeit.
Ich hasse sie.
Jeder konnte arbeiten, verdienen, niemand mußte hungern, keiner hatte Sorgen –
Eine widerliche Zeit!
Ich hasse das bequeme Leben!
Vorwärts, immer nur vorwärts!
Marsch – marsch!
Wir stürmen vor – nichts hält uns zurück!
Kein Acker, kein Zaun, kein Strauch –
Wir treten es nieder!
Marsch – marsch!
So stürmen wir vor und gehen auf einer Höhe in Deckung, um die Straße, die unten vorbeizieht, zu beherrschen.
Vorerst sinds nur noch Manöver.
Aber bald wirds ernst, die Zeichen werden immer sichtbarer.
Und der Krieg, der morgen kommen wird, wird ganz anders werden als dieser sogenannte Weltkrieg! Viel größer, gewaltiger, brutaler – ein Vernichtungskrieg, so oder so!
Ich oder du!
Wir schauen der Wirklichkeit ins Auge.
Wir weichen ihr nicht aus, wir machen uns nichts vor –
Jetzt schießen Haubitzen.
In der weiten flimmernden Ferne.
Man hört sie kaum.
Sie schießen vorerst noch blind.
Unten auf der Straße erscheinen zwei radfahrende Mädchen. Sie sehen uns nicht.
Sie halten plötzlich und sehen sich um.
Dann geht die eine hinter einen Busch und hockt sich hin. Wir grinsen und der Leutnant hinter mir lacht ein bißchen.
Der Feldwebel schaut mit dem Feldstecher hin.
Jetzt surrt es am Himmel. Ein Flieger. Er fliegt über uns hinweg.
Das Mädchen läßt sich nicht stören, sondern blickt nur empor.
Er fliegt sehr hoch, der Flieger, und kann sie nicht sehen. Das weiß sie.
An uns denkt sie nicht.
Und derweil werdens doch immer wir Infanteristen sein, die die Kriege entscheiden – und nimmer die Flieger! Obwohl man von ihnen so viel spricht und von uns so wenig. Obwohl sie die eleganteren Uniformen haben – werden sehen, ob sie das taugen, was sie sich einbilden! Die denken, sie legen ein Land von droben einfach in Trümmer und wir Infanteristen hätten dann einfach die Trümmer nur zu besetzen – ohne jede Gefahr! Eine bessere Polizei. Abwarten!
Werden sehen, ob wir überflüssig sind! Oder gar zweiten Ranges!
Nein, ich mag die Flieger nicht!
Ein hochnäsiges Pack.
Und die Weiber sind auch so blöd, sie wollen nur einen Flieger.
Das ist ihr höchstes Ideal!
Auch die zwei da drunten auf der Straße – jetzt winken sie ihm begeistert zu.
Alle Kühe wollen mit einem Flieger tanzen!
Winkt nicht, ihr Tiere – er schaut auch auf euch herab, weil ihr nicht fliegen könnt!
Jawohl, wir schlucken den Staub der Straßen und marschieren durch den Dreck! Aber wir werden dafür sorgen, daß der Dreck himmelhoch staubt!
Nur keine Angst!
»Um Gotteswillen!« kreischt der Leutnant.
Was ist denn los?!
Er starrt auf den Himmel –
Dort, der Flieger!
Er stürzt ab!
»Der linke Flügel ist futsch«, sagt der Feldwebel durch den Feldstecher.
Er stürzt, er stürzt –
Mit einer Rauchwolke hinter sich her –
Immer rascher.
Wir starren hin.
Und es fällt mir ein: Komisch, hast du nicht grad gedacht: stürzt ab –?
»Mit denen ists vorbei«, meint der Leutnant.
Wir waren alle aufgesprungen.
»Deckung!« schreit uns der Feldwebel an.
»Deckung!« – – –
Drei Särge liegen auf drei Lafetten, drei Fliegersärge. Pilot, Beobachter, Funker. Wir präsentieren das Gewehr, die Trommel rollt und die Musik spielt das Lied vom guten Kameraden.
Dann kommt das Kommando: »Zum Gebet!«
Wir senken die Köpfe, aber wir beten nicht.
Ich weiß, daß bei uns keiner mehr betet.
Wir tun nur so.
Reine Formalität.
»Liebe deine Feinde« – das sagt uns nichts mehr. Wir sagen: »Hasse deine Feinde!«
Mit der Liebe kommt man in den Himmel, mit dem Haß werden wir weiterkommen – –
Denn wir brauchen keine himmlische Ewigkeit mehr, seit wirs wissen, daß der einzelne nichts zählt – er wird erst etwas in Reih und Glied.
Für uns gibts nur eine Ewigkeit: das Leben unseres Volkes.
Und nur eine himmlische Pflicht: für das Leben unseres Volkes zu sterben.
Alles andere ist überlebt.
Wir treten an.
Ausgerichtet, Mann für Mann.
Ich bin der neunte von rechts, von den Größten her. Der Größte ist einsachtundachtzig, der Kleinste einssechsundfünfzig, ich einsvierundsiebzig. Gerade richtig, nicht zu groß und nicht zu klein.
So äußerlich gesehen, gefall ich mir ja.
Das verwunschene Schloß
Heute ist Sonntag.
Da haben wir frei. Von vierzehn bis zweiundzwanzig Uhr.
Nur die Bereitschaft bleibt zurück.
Gestern bekam ich meinen zweiten Stern und heute werde ich zum erstenmal mit zwei Sternen am Kragen ausgehen.
Der Frühling ist nah, man hört ihn schon in der Luft.
Wir sind zu dritt, zwei Kameraden und ich. Wir haben weiße Handschuhe an und reden über die Weiber.
Ich rede am wenigsten, ich denk mir lieber meinen Teil.
Die Weiber sind ein notwendiges Übel, das ist bekannt. Man braucht sie zur Sicherstellung einer möglichst großen Zahl kinderreicher, erbgesunder, für das Vaterland rassisch wertvoller Familien. Aber ansonsten stiften sie nur Wirrwarr.
Ich könnt darüber manches Lied zum besten geben!
Besonders die älteren Jahrgänge und vor allem die ganz Gescheiten. Die laufen dir nach, weil du sportlich ausgebildet bist, und wenn du ihnen zu Gefallen warst, dann werden sie arrogant. Sagen: dummer Junge, grün, naß hinter den Ohren und dergleichen. Oder sie kommen mit dem Seelenleben daher und dann werdens ganz unappetitlich.
Eine nicht mehr ganz junge Frau hat keine Seele zu haben, sie soll froh sein, wenn man sie anschaut. Sie hat kein Recht, einem hinterher mit Gefühlen, wie zum Beispiel Eifersucht oder sogenannter Mütterlichkeit, zu kommen. Die Seele ist im besten Falle ein Vorrecht der jungen Mädchen.
Die dürfen sich eine solche Romantik fallweise noch leisten, vorausgesetzt, daß sie hübsch sind. Aber auch die romantischen Hübschen wollen, schon im zartesten Jungmädchenalter, nur einen Kerl mit Geld.
Das ist das ganze Problem.
Ich bewege mich lieber in männlicher Gesellschaft.
Mein Kamerad sagt grad, daß sich dereinst vor dreihundert Jahren ein großer Philosoph gefragt hätt, ob die Weiber überhaupt Menschen sind?
Man könnts schon bezweifeln, das glaub ich gern.
Bei dem weiblichen Geschlechte weißt du nie, woran du bist.
Da findest du keine Treu und keinen Glauben, immer kommens zu spät, ein Nest voller Lügen, usw.
Und obendrein sollst du noch auf ihr Inneres eingehen – Denn das verlangen sie.
Aber das ist keine Betätigung für einen richtigen Mann.
Jaja, die Herren Weiber sind ein Kapitel für sich!
Sie bringen dich auf die Welt und bringen dich auch wieder um. –
Die Straßen der inneren Stadt sind leer, denn hier gibts nur Geschäfte und hohe Bürohäuser und die haben heute zu. Die Arbeiter der Stirn und der Faust, sie feiern daheim, essen, schlafen, rauchen – heut werdens kaum Ausflüge machen, denn es regnet immer wieder.
Zwar nur ein bißchen, aber es ist halt unsicher. Still ists in der inneren Stadt, direkt friedlich, als wärens alle ausgestorben.
Wir hören uns gehen, jeden Schritt. Es klappert auf dem Asphalt.
Und ich bemerk es wieder, daß wir uns spiegeln.
In den vornehmen Auslagen.
Jetzt gehen wir durch ein Korsett.
Jetzt durch einen Hummer und einen Schinken so zart –
Jetzt durch seidene Strümpfe.
Jetzt durch Bücher und dann durch Perlen, Schminken, Puderquasten. –
Zerreißt sie, zertrampelt sie!
Es ist fad in der inneren Stadt und wir gehen zum Hafen hinab. Dort ist nämlich ewig Betrieb.
Du kannst es zwar nicht erblicken, das weite Meer, denn dieses beginnt erst weiter draußen, aber herinnen liegen bereits die fremden Schiffe mit den schwarzen und gelben Matrosen.
Wir gehen die breite Allee zum Hafen hinab.
Sie wird immer breiter und lauter.
Rechts und links beginnen die Sehenswürdigkeiten – große und kleine Affen, dressiert und undressiert. Schießbuden und Spielautomaten, ein Tanzpalast und die dickste Dame der Welt. Ein Schaf mit fünf Füßen, ein Kalb mit zwei Köpfen – Karussell neben Karussell, Schaukel neben Schaukel und eine bescheidene Achterbahn, direkt bemitleidenswert. Wahrsagerinnen, Feuerfresser, Messerschlucker, saure Gurken und viel Eis. Tierische und menschliche Abnormitäten. Kunst und Sport. Und dort hinten am Ende das verwunschene Schloß.
An den ersten Schießbuden gehen wir noch vorbei, aber bei der vierten oder fünften können wir es nicht mehr lassen, es zwingt uns zu schießen. In dieses Schwarze zu treffen ist für uns ein Kinderspiel und das Fräulein, das unsere Gewehre ladet, lächelt respektvoll.
Wenn Soldaten schießen, schauen immer viele zu. So auch jetzt. Besonders zwei Fräulein sind dabei, sie lachen bei jedem Schuß, als gälte er ihnen. Dadurch erregen sie unsere Aufmerksamkeit. Mir gefallen sie nicht, aber meine Kameraden fangen mit ihnen an. Ich will ihnen prinzipiell nicht im Wege stehen, so als überflüssiges Rad am Wagen, und überlasse sie ihrem Schicksal.
Sie gehen tanzen, ich bleib allein zurück.
Ich schau ihnen nach.
Nein, diese beiden Fräulein könnten mich nicht interessieren –
Die eine hat krumme Beine, die andere hat überhaupt keine Beine und wo der Hintern sitzen soll, sitzt nichts. Und die erste hat vorn einen schwarzen Zahn und einen schmutzigen Büstenhalter. Nein, mich stören diese Kleinigkeiten der Liebe, ich bin nämlich sehr anspruchsvoll.
Ich betrete das Hippodrom.
Dort reiten zwei andere Fräulein und ein Kind.
Die Musik spielt, die Peitsche knallt, die alten Pferde laufen im Kreis.
Das Kind hat Angst, die Fräulein sind sehr bei der Sache.
Das Kind verliert seine Matrosenmütze und plärrt, die beiden Fräulein lächeln.
Ihre Röcke sind hoch droben und man kann es sehen, daß sie dort nackt sind, wo der Strumpf aufhört. Die könnten mir schon gefallen, besonders die Größere!
Aber ein reitendes Fräulein täuscht.
Denn ein Fräulein hoch zu Roß kann gar leicht gefallen, das ist keine Kunst. Aber wenn sie hernach herunten ist, dann merkt mans erst, was in Wirklichkeit los ist – ich kenn das schon, diese Enttäuschungen!
Jetzt steigen sie aus dem Sattel und die Größere gefällt mir noch immer. Und die Kleinere auch.
Aber sie haben schon einen Kavalier.
Ein kleines Männchen, eine elende Ratte.
Die beiden hängen sich in die Ratte und lächeln: »Wir wollen noch reiten – bitte, bitte!« »So oft ihr wollt«, sagt die Ratte.
Ich blicke nach der Preistafel.
Einmal reiten kostet fünfzig.
Und so oft ihr wollt?
Viel zu teuer für mich.
Aber so treibens halt die feschen Weiber!
Lieber eine alte Ratte, die nach Geld stinkt, als ein junger durchtrainierter Mann, der außer seiner selbst nur zwei silberne Sterne am Kragen besitzt.
Da nützen auch die weißen Handschuhe einen großen Dreck.
Ich verlasse das Hippodrom und wandle langsam die Buden entlang, ohne ein direktes Ziel.
Rechts gibts den Mann mit dem Löwenkopf und links die Dame mit dem Bart.
Ich bin etwas traurig geworden.
Die Luft ist lau – ja, das ist der Frühling und nachts konzertieren die Katzen. Wir hören sie auch in der Kaserne.
Der Abend kommt und am Horizont geht der Tag mit einem lila Gruß. Hinter mir ist es schon Nacht.
Und wie ich so weiterwandle, treffe ich einen unangenehmen Gedanken: es fällt mir auf, daß diese Ratte im Hippodrom mein Volksgenosse ist. Und ich sehe mich im Kasernenhof stehen und schwören, für das Vaterland zu sterben, jederzeit für unser Volk.
Also auch für diese elende Ratte?
Nein, hör auf! Nur nicht denken! Durch das Denken kommt man auf ungesunde Gedanken.
Unsere Führer werdens schon richtig treffen!
Und da kommt ein zweiter Gedanke, ich kenne ihn schon.
Er begleitet mich ein Stück und läßt mich nicht los.
»Eigentlich«, sagt er, »liebst du ja niemand« – Ja, das ist wahr.
Ich mag keine Seele leiden –
Auch mich nicht.
Eigentlich hasse ich alle.
Nur unseren Hauptmann nicht. –
Und weiter wandle ich die Buden entlang dem Ende zu und erreiche das verwunschene Schloß mit seinen Giebeln und Türmen und Basteien. Die Fenster sind vergittert und die Drachen und Teufel schauen heraus.
Aus dem Lautsprecher tönt ein leiser Walzer. Es ist eine alte Musik. Sie wird immer wieder übertönt, diese Musik, durch Gelächter und Gekreisch. Das sollen die Leute von sich geben, die drinnen sind. Man solls nämlich draußen hören, daß es ihnen drinnen gefällt.
Aber ich kenne das schon.
Alles Schwindel!