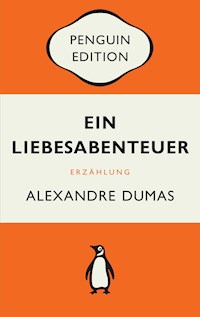
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Penguin Edition
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer Begegnung, wie sie in jedem Leben nur einmal vorkommt.
Dichter in den besten Jahren trifft junge Schauspielerin – aus einer intimen Episode gestaltet Alexandre Dumas eine hinreißende Erzählung über die Liebe. Als er von Lilla Bulyowsky, einer fünfundzwanzigjährigen Mimin aus Budapest, gebeten wird, sie in die Welt der französischen Künstler einzuführen, betont sie: «Aber nur das, und nicht mehr.» Ab da stellt sich die Frage aller Fragen: Bleibt es beim erotischen Knistern, oder schafft es der charismatische Lebemann, die Angebetete zu erobern?
Dumas' kleines Prosawerk ist ein fulminantes Lesevergnügen voll geistreicher Dialoge und unvergesslicher Figuren, und das an den romantischsten Schauplätzen Europas: auf der Grand-Place in Brüssel oder auf einer Schifffahrt auf dem Rhein.
PENGUIN EDITION. Zeitlos, kultig, bunt. – Ausgezeichnet mit dem German Brand Award 2022
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Große Emotionen, große Dramen, große Abenteuer – von Austen bis Fitzgerald, von Flaubert bis Zweig.Ein Bücherregal ohne Klassiker ist wie eine Welt ohne Farbe.
Alexandre Dumas (1802–1870) kam als Enkel eines französischen Marquis und einer schwarzen Sklavin zur Welt. Er arbeitete als Sekretär des Herzogs von Orléans, ehe er durch ein Historiendrama Berühmtheit erlangte. Ab 1844 schuf er mit Abenteuerromanen wie Die drei Musketiere und Der Graf von Monte Christo Klassiker der Unterhaltungsliteratur, deren pseudohistorische Helden sich trotz widrigster Umstände behaupten. Aufgrund seiner Abstammung und dunkleren Hautfarbe sah sich der Autor zeitlebens rassistischen Schmähungen und Vorurteilen ausgesetzt.
Ein Liebesabenteuer in der Presse:
«Diese federleichte, frivole Komödie aus dem Jahr 1856 begeistert heute noch mit gewitzten Dialogen.» Hörzu
«Ein ungemein unterhaltsames, leichtfüßig erzähltes und zugleich literarisch äußerst vertracktes und spannendes Büchlein.» Frank Dietschreit, RBB Kulturradio
«Federleicht und frivol … Bei Dumas knistert es zwischen den Zeilen besser als in jedem Erotik-Klassiker.» Harald Schwiers, Kurier
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Alexandre Dumas
EIN LIEBESABENTEUER
Aus dem Französischen von Roberto J. Giusti
Mit einem Nachwort von Romain Leick
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Une aventure d’amour.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2014 der deutschsprachigen Ausgabe by Manesse Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Regg Media in Adaption der traditionellen Penguin Classics Triband-Optik aus England
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-28269-1V001
www.penguin-verlag.de
I
Eines Morgens im Herbst 1856 öffnete mein Diener – ich hatte ihm ausdrücklich Anweisung gegeben, mich nicht zu stören – die Tür meines Arbeitszimmers, und da ich höchst vielsagend das Gesicht verzog, meinte er: «Monsieur, sie ist ausgesprochen hübsch.»
«Wer denn, du Schwachkopf?»
«Die Person, wegen der ich mir erlaube, Monsieur zu stören.»
«Hübsch oder nicht, was schert es mich? Du weißt sehr wohl, dass ich für niemanden zu sprechen bin, wenn ich arbeite.»
«Und außerdem kommt sie», so fuhr er fort, «auf Empfehlung eines Freundes von Monsieur.»
«Wie heißt dieser Freund?»
«Er wohnt in Wien.»
«Wie dieser Freund heißt?»
«Ach Monsieur, ein komischer Name, ein Name wie ‹Rubin› oder ‹Diamant›.»
«Saphir1?»
«Jawohl, Monsieur, Saphir, so heißt er.»
«Dann ist es etwas anderes; führ sie hinauf ins Atelier und bring mir einen Hausmantel herunter.»
Mein Diener ging hinaus.
Ich hörte, wie leichte Schritte an meiner Tür vorübergingen; alsbald kam Monsieur Théodore herunter, meinen Hausmantel über dem Arm.
Wenn ich einem Diener ein solches Zeichen der Wertschätzung zuteilwerden lasse, nämlich ihn «Monsieur» zu nennen, dann weil er sich entweder durch Dummheit oder durch Listigkeit hervortut.
Drei Exemplare dieser Gattung, wie sie einem schöner nicht begegnen, habe ich um mich gehabt: Monsieur Théodore, Monsieur Joseph und Monsieur Victor.
Monsieur Théodore war lediglich dumm, das jedoch auf vortreffliche Weise.
Letzteres halte ich hier nur nebenbei fest, damit die Herrschaft, bei der er derzeit in Diensten ist, so er denn überhaupt eine Herrschaft hat, ihn nicht mit den beiden anderen verwechselt.
Im Übrigen hat die Dummheit gegenüber der Listigkeit einen großen Vorteil: Man sieht immer recht bald, dass man einen Dummkopf zum Diener hat, aber man bemerkt immer zu spät, dass man einen Spitzbuben zum Diener hat.
Théodore hatte seine Günstlinge; meine Tafel ist immer von so großem Umfang, dass zwei oder drei Freunde mit daran Platz nehmen können, auch wenn sie unangemeldet erscheinen. Nicht immer erwartet sie ein gutes Mahl, aber immer ein guter Empfang.
An den Tagen nun, an denen es nach Monsieur Théodores Geschmack gutes Essen gab, setzte Monsieur Théodore diejenigen unter meinen Freunden oder Bekannten, die er den anderen vorzog, davon in Kenntnis.
Allerdings sagte er je nach dem Grad der Feinsinnigkeit der Betreffenden zu den einen: «Monsieur Dumas hat heute Morgen gesagt: ‹Es ist lange her, dass ich den werten Soundso zuletzt gesehen habe; es wäre schön, wenn er mich fragen würde, ob er sich heute bei mir zum Diner einfinden könnte.›»
Und in der Gewissheit, einem Wunsch zu entsprechen, fand sich der Freund zum Diner ein.
Bei den anderen, weniger feinsinnigen begnügte Théodore sich damit, sie mit dem Ellbogen anzustoßen und zu sagen: «Heute gibt es etwas Gutes zu essen; kommen Sie doch.»
Und der Freund, der ohne diese Einladung wahrscheinlich nicht gekommen wäre, stellte sich daraufhin zum Diner ein.
Ich führe hier nur dieses eine Detail der komplexen Persönlichkeit des Monsieur Théodore an; wollte ich das Porträt vervollständigen, würde ich ein ganzes Kapitel dafür brauchen.
Nun also zurück zu dem von Théodore gemeldeten Besuch.
Mit meinem Hausmantel bekleidet, wagte ich mich zum Atelier hinauf. In der Tat traf ich dort eine bezaubernde junge Frau an, sie war von hohem Wuchs und hatte einen strahlend weißen Teint, blaue Augen, braunes Haar und wunderschöne Zähne; sie trug ein perlgraues, hochgeschlossenes Taftkleid, ein Tuch von arabischem Schnitt und Stoff und einen dieser bezaubernden Hüte, die beim Pariser Geschmack leider ein wenig in Ungnade gefallen sind und die selbst hässlichen oder nicht mehr ganz jungen Frauen so gut stehen, dass man sie in Deutschland «der letzte Versuch»2 nennt.
Die Unbekannte reichte mir einen Brief, auf dessen Umschlag ich das unleserliche Gekritzel des armen Saphir erkannte.
Ich steckte den Brief in die Tasche.
«Ach», sagte die Besucherin mit stark ausgeprägtem fremdländischem Akzent, «Sie lesen ihn nicht?»
«Unnötig, Madame», antwortete ich, «ich habe die Handschrift wiedererkannt, und Ihr Mund ist so liebreizend, dass ich aus ihm zu hören begehre, was mir die Ehre Ihres Besuches verschafft.»
«Nun, ich hatte den Wunsch, Sie zu sehen, das ist alles.»
«Wie schön! Sie haben doch nicht eigens dafür die Reise von Wien hierher unternommen?»
«Wer sagt Ihnen das?»
«Meine Bescheidenheit.»
«Pardon, aber als bescheiden gelten Sie eigentlich nicht.»
«Nun ja, es gibt Tage, da bin ich eitel.»
«Welche sind das?»
«Die, an denen andere über mich urteilen und an denen ich selbst mich vergleiche!»
«Mit denen, die über Sie urteilen?»
«Sie sind geistreich, Madame … So machen Sie sich doch die Mühe, Platz zu nehmen.»
«Wenn ich nur hübsch wäre, hätten Sie mich also nicht dazu aufgefordert?»
«Nein, dann hätte ich Sie zu etwas anderem aufgefordert.»
«Gott, was sind die Franzosen eingebildet.»
«Das ist nicht unbedingt ihr Fehler.»
«Nun, als ich Wien verließ, um nach Frankreich zu kommen, wünschte ich mir nur eines.»
«Und das wäre?»
«Einfach nur Platz zu nehmen, und nichts weiter.»
Ich stand auf und verneigte mich. «Hätten Sie wohl die Güte, mir zu sagen, mit wem ich die Ehre habe?»
«Ich bin Bühnenkünstlerin, ungarischer Nationalität; ich heiße Madame Lilla Bulyowsky3; ich habe einen Gatten, den ich liebe, und ein Kind, das ich vergöttere. Hätten Sie den Brief unseres gemeinsamen Freundes Saphir gelesen, darin hat er Ihnen das alles mitgeteilt.»
«Glauben Sie, dass es unvorteilhaft für Sie war, es mir selbst zu sagen?»
«Ich weiß es nicht; mit Ihnen nimmt das Gespräch so eigenartige Wendungen!»
«Es steht Ihnen frei, es wieder auf einen Weg zu bringen, der Ihnen zusagt.»
«Wie schön! Denn Sie versetzen ihm ständig Rippenstöße, um es in die rechte oder linke Richtung zu drängen.»
«Vor allem in die linke.»
«Das ist genau die Richtung, die ich nicht einschlagen will.»
«Schreiten wir also geradeaus und auf rechtem Weg dahin.»
«Ich fürchte nur, dass Ihnen das nicht möglich ist.»
«Doch, doch, Sie werden schon sehen … Sagen Sie nochmals, was Sie vorhin gesagt haben; Sie sind …?»
«Bühnenkünstlerin.»
«Was spielen Sie?»
«Alles: Drama, Komödie, Tragödie. Ich habe zum Beispiel fast alle Ihre Stücke gespielt, von ‹Catherine Howard› bis ‹Mademoiselle de Belle-Isle›4.»
«Und an welchem Theater?»
«Dem von Pest.»
«Also in Ungarn?»
«Ich sagte Ihnen doch, dass ich Ungarin bin.»
Ich stieß einen Seufzer aus.
«Sie seufzen?», fragte Madame Bulyowsky.
«Allerdings; eine der bezauberndsten Erinnerungen meines Lebens ist mit einer Ihrer Landsmänninnen verknüpft.»
«Da sehen Sie! Nun drängen Sie uns schon wieder nach links.»
«Das Gespräch, aber doch nicht Sie. Stellen Sie sich also vor … Aber nein, fahren Sie fort.»
«Nicht doch. Sie wollten eine Geschichte erzählen; erzählen Sie sie.»
«Wozu?»
«Na, um mich zu unterhalten! Lesen kann Sie jeder, aber Sie zu hören ist nicht jedem vergönnt.»
«Sie wollen mich bei meinem Stolz packen.»
«Ich will Sie nirgendwo packen.»
«Dann befassen wir uns lieber nicht mit mir. Sie sind also Bühnenkünstlerin, Sie sind der Nationalität nach Ungarin, Sie heißen Madame Lilla Bulyowsky, Sie haben einen Gatten, den Sie lieben, ein Kind, das Sie vergöttern, und Sie kommen nach Paris, um mich zu sehen.»
«Zunächst einmal.»
«Sehr schön; und danach?»
«Möchte ich sehen, was man in Paris so sieht.»
«Und wer zeigt Ihnen alles, was man in Paris so sieht?»
«Sie, wenn Sie wollen.»
«Sie wissen aber, was die Leute sagen werden, noch ehe man uns dreimal zusammen gesehen hat …»
«Nämlich?»
«Dass Sie meine Geliebte sind.»
«Was macht das schon?»
«Recht so!»
«Zweifellos ist es recht so; wer mich kennt, weiß ohnehin, dass es nicht stimmt, und was kümmert es mich, was Leute sagen, die mich nicht kennen?»
«Sie sind eine Philosophin.»
«Nein, ich bin nur logisch. Ich bin fünfundzwanzig Jahre alt; man hat mir so oft gesagt, ich sei hübsch, dass ich mir dachte, besser, ich glaube es, solange es wahr ist, als später, wenn es nicht mehr stimmt. Sie meinen doch nicht etwa, ich hätte Pest verlassen und wäre ganz allein, sogar ohne Kammermädchen, nach Paris gekommen in der naiven Überzeugung, man werde schon nicht über mich herziehen? Nun, das hat mich nicht abgehalten; sollen sie über mich herziehen! Meine Kunst geht vor!»
«Was Sie nach Paris führt, ist also ein künstlerisches Anliegen?»
«Nichts anderes; ich wollte eure großen Dichter kennenlernen, um zu sehen, ob sie den unseren ähneln, und eure großen Bühnenkünstler, um zu sehen, ob es für mich etwas von ihnen zu lernen gibt; ich habe Saphir um einen Brief für Sie gebeten, er gab ihn mir, und da bin ich. Können Sie mir ein paar Stunden widmen?»
«So viele Stunden Sie wollen.»
«Nun denn, ich habe einen Monat, den ich in Paris bleiben kann, sechstausend Franc, um sie für meine Einkäufe sowie für mein Vergnügen auszugeben, und tausend Franc, um damit nach Pest zurückzukehren. Tun Sie so, als hätte Saphir Ihnen einen Studenten aus Leipzig oder Heidelberg geschickt statt einer Bühnenkünstlerin aus Pest, und treffen Sie entsprechend Ihre Arrangements.»
«Sie werden also mit mir zu Abend essen?»
«Immer dann, wenn Sie frei sind.»
«An diesen Tagen gehen wir ins Theater.»
«Sehr gut.»
«Legen Sie Wert darauf, dass eine dritte Person dabei ist?»
«Nicht den geringsten.»
«Und es ist Ihnen gleichgültig, was die Leute über uns reden?»
«Hätten Sie Saphirs Brief gelesen, dann hätten Sie gesehen, dass diesem Thema ein ganzer Absatz gewidmet ist.»
«Ich werde Saphirs Brief lesen.»
«Wann denn?»
«Wenn Sie gegangen sind.»
«Dann geben Sie mir zwei oder drei Empfehlungsbriefe, und ich gehe: einen für Lamartine5, einen für Alphonse Karr6 und einen für Ihren Sohn. Apropos: Ich habe seine ‹Kameliendame›7 gespielt, ich meine, die von Ihrem Sohn.»
«Für ihn brauche ich Ihnen keinen Brief zu geben; wir können morgen Abend zusammen essen, wenn Sie möchten.»
«Sehr gern. Übrigens hat man mir erzählt, dass Madame Doche8 in der ‹Kameliendame› ganz bezaubernd war.»
«Madame Doche wird mit uns essen und es übernehmen, Sie irgendwohin auszuführen.»
«Wohin denn?»
«Wohin sie will. Man muss in dieser Welt auch mal etwas dem Zufall überlassen.»
«Eines Tages erzählen Sie mir Ihre Geschichte mit meiner Landsmännin.»
«Wenn Ihnen das denn Freude macht …»
«Gewiss doch.»
«Wann?»
«Wenn ich Sie darum bitte.»
«Wunderbar!»
«Und jetzt zu meinen Briefen: Sie müssen wissen, dass ich seit sechs Jahren für diese Reise nach Paris spare. Ich komme wahrscheinlich niemals wieder, ich habe keine Zeit zu verlieren.»
Ich ging in mein Arbeitszimmer hinunter und schrieb die zwei oder drei Briefe, um die Madame Bulyowsky mich gebeten hatte; ich stieg wieder hinauf und überreichte sie ihr.
Ich wollte ihr gerade einen Handkuss geben, als sie mich ohne Umstände auf beide Wangen küsste.
«Habe ich Ihnen nicht angekündigt, dass Sie es mit einem Studenten aus Leipzig oder Heidelberg zu tun haben?»
«Doch.»
«Also nach deutscher Art: Handschlag oder Umarmung.»
«Dann schon lieber die Umarmung; es gibt in Frankreich eine Redensart über schlechte Entlohnung, die lautet, dass man nehmen muss, was man kriegen kann.9 Dann also bis morgen, zum Diner.»
«Bis morgen, zum Diner. Wo?»
«Hier.»
«Um welche Zeit?»
«Um sechs Uhr.»
«Sehr gut; nehmen Sie es mir bitte nicht übel, wenn ich mich um ein paar Minuten verspäte.»
«Folglich darf ich es Ihnen auch nicht zugutehalten, wenn Sie ein paar Minuten zu früh dran sind?»
«Nein, denn es macht mir Freude, mit Ihnen zusammen zu sein, und wenn ich zu früh dran bin, dann zu meinem eigenen Vergnügen. Bis morgen.»
Und sie stieg beschwingt die Treppe hinab, drehte sich aber auf dem Treppenabsatz um, um mir ein letztes Mal freundschaftlich zuzuwinken.
An der Tür zu meinem Arbeitszimmer stieß ich auf Monsieur Théodore, der lächelnd und mit weit aufgerissenen Augen dastand.
«Nun, Monsieur sieht, dass ich nicht ganz so blöd bin, wie er sagt?»
«Nein», gab ich zurück, «Sie sind noch dümmer, als ich glaubte.»
Damit betrat ich mein Arbeitszimmer und ließ ihn bass erstaunt zurück.
II
Einen Monat lang aß ich zwei- oder dreimal die Woche mit Madame Bulyowsky zu Abend, und zwei- oder dreimal die Woche begleitete ich sie ins Theater.
Ich muss sagen, dass unsere étoiles10 sie kaum beeindruckten, Rachel11 ausgenommen. Madame Ristori12 war nicht in Paris.
Eines Morgens kam sie zu mir.
«Ich reise morgen ab», sagte sie.
«Warum reisen Sie morgen ab?»
«Weil mir gerade noch genug Geld bleibt, um nach Pest zurückzukehren.»
«Brauchen Sie welches?»
«Nein; in Paris habe ich gesehen, was ich wollte.»
«Wie viel haben Sie noch?»
«Tausend Franc.»
«Das ist um die Hälfte mehr, als Sie brauchen.»
«Nein; denn ich fahre nicht direkt nach Wien.»
«Lassen Sie mal Ihre Reiseroute hören!»
«Bitte sehr: Ich fahre nach Brüssel, Spa und Köln; dann rheinaufwärts bis nach Mainz und von dort nach Mannheim.»
«Was zum Teufel wollen Sie in Mannheim? Werther hat sich dort eine Kugel in den Kopf gejagt, und Charlotte ist verstorben.»13
«Ich werde Madame Schröder14 aufsuchen.»
«Die Tragödin?»
«Ja, kennen Sie sie?»
«Ich habe sie einmal in Frankfurt spielen sehen; aber ihre beiden Söhne und ihre Tochter kenne ich gut.»
«Ihre beiden Söhne?»
«Ja.»
«Ich kenne nur einen, Devrient15.»
«Den Schauspieler; ich kenne auch den anderen, den Priester, der in Köln wohnt, hinter der Kirche Sankt Gereon16. Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen einen Brief für ihn mit.»
«Danke, es geht mir um seine Mutter.»
«Was wollen Sie von ihr?»
«Ich bin Ungarin, das habe ich Ihnen schon gesagt; ich spiele Komödien, Dramen und Tragödien auf Ungarisch. Nun bin ich es aber leid, nur sechs oder sieben Millionen Zuschauer anzusprechen; ich möchte auf Deutsch Theater spielen und damit dreißig oder vierzig Millionen Menschen erreichen. Und dazu will ich Madame Schröder aufsuchen, ich will mit ihr eine Szene auf Deutsch probieren, und wenn sie mir Hoffnung macht, dass ich in einem Jahr gemeinsamer Arbeit den Akzent ablegen kann, den ich noch habe, dann verkaufe ich ein paar Diamanten, wohne jeweils in der Stadt, in der sie wohnt, folge ihr als Gesellschaftsdame, als Kammermädchen, wenn sie das will, und nach einem Jahr werde ich die Bühnen Deutschlands erobern … Aber was haben Sie denn?»
«Was ich habe? Ich bewundere Sie.»
«Nein, Sie bewundern mich nicht wirklich, Sie finden das eher einfach: Ich bin furchtbar ehrgeizig, ich hatte große Erfolge, und ich will noch größere.»
«Bei Ihrer Willenskraft werden Sie die haben.»
«Heute essen wir zusammen zu Abend, nicht wahr? Wir gehen ein letztes Mal ins Theater; Sie geben mir ein paar Briefe für Brüssel, denn dort mache ich einen oder zwei Tage halt und schicke mein ganzes Gepäck nach Wien voraus; wir sagen einander Adieu, dann reise ich ab.»
«Warum sollen wir einander Adieu sagen?»
«Aber das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Weil ich abreise.»
«Mir ist ein Gedanke gekommen.»
«Und der wäre?»
«Ich habe in Brüssel zu tun. Und statt Ihnen Briefe zu geben, reise ich mit Ihnen; allein werden Sie sich zu Tode langweilen, machen Sie sich nichts vor.»
Sie fing an zu lachen.
«Ich war sicher, dass Sie mir das vorschlagen würden», sagte sie.
«Und Sie waren von vornherein entschlossen, darauf einzugehen?»
«Ehrlich gesagt, ja. Ich habe Sie eben sehr gern.»
«Danke.»
«Und wer weiß, ob wir einander jemals wiedersehen! Also abgemacht, wir reisen morgen.»
«Also morgen, einverstanden; mit welchem Zug?»
«Mit dem um acht Uhr morgens. Ich muss los.»
«Schon?»
«Ich habe enorm viel zu tun; der letzte Tag, Sie verstehen … Apropos …»
«Was?»
«Wir fahren nicht zusammen, wir treffen uns dort per Zufall …»
«Warum das denn?»
«Weil ich mit Bekannten fahre.»
«Mit Bekannten aus Wien?»
«Ja.»
«Ihr Gewissen genügt Ihnen also nicht mehr?»
«Es sind Dummköpfe.»
«Fällt uns nichts Besseres ein?»
«Das Bessere ist der Feind des Guten.»
«Fahren Sie doch morgen Abend statt morgen früh.»
«Dann fahren die Wiener auch erst morgen Abend, denn sie sind fest entschlossen, mit mir zu fahren.»
«Und bis wohin fahren sie mit?»
«Bloß bis Brüssel.»
«Warten Sie; wir machen es folgendermaßen: Wir fahren beide morgen Abend.»
«Sie bestehen darauf?»
«Ich bestehe darauf; das können Sie doch wirklich für mich tun, Teufel auch! So viel war es bislang ja nicht.»
«Soll das ein Vorwurf sein?»
«Nein, nur eine Feststellung.»
«Also machen Sie Ihren Vorschlag, und dann sehen wir weiter.»
«Wir nehmen also den Zug morgen Abend; es kommt nicht einmal zu einer Begegnung; Sie steigen mit Ihren Wienern in irgendeinen Waggon; ich sehe Sie einsteigen und weise einen der Bahnangestellten auf Sie hin; ich steige meinerseits allein in einen Waggon; beim zweiten oder dritten Halt klagen Sie darüber, dass Sie am Ersticken sind; der Bahnangestellte bietet Ihnen an, in einen nicht so vollen Waggon umzusteigen; Sie gehen darauf ein, Sie kommen in den meinen, wo Sie alle Luft bekommen, die Sie brauchen … und wo Sie die ganze Nacht ruhig schlafen.»
«Und wo ich ruhig schlafe?»
«Ehrenwort.»
«Das ließe sich in der Tat so arrangieren.»
«Arrangieren wir’s?»
«Abgemacht.»
«Dann bis heute Abend?»
«Nein, bis morgen.»
«Wollten wir nicht zusammen Abend essen?»
«Unmöglich; wenn ich am Abend fahre, muss ich mit meinen Wienern Abend essen.»
«Dann sehen wir uns erst am Zug wieder?»
«Ich werde versuchen, im Laufe des Tages noch bei Ihnen vorbeizuschauen.»
«Schauen Sie nur.»
Ich gewöhnte mich allmählich daran, dass unter diesem Taft und unter dieser Seide, wo ich eine hübsche Frau vermutet hatte, ein bezaubernder Kamerad zu entdecken war.
Wir gaben einander die Hand, und Lilla brach auf.
Am nächsten Tag erhielt ich folgende kurze Nachricht:
Unmöglich, Sie aufzusuchen, ich schlage mich mit meinen Schneiderinnen und meinen Modehändlerinnen herum. Ich nehme genug mit, um in Pest einen Laden aufzumachen. Ich weiß nicht, wie ich es hätte schaffen sollen, wenn ich heute Morgen gefahren wäre.
Bis heute Abend. Gute Nacht.
LILLA
Die Worte «Gute Nacht», kräftig unterstrichen, kamen mir einigermaßen ironisch vor.
«Gute Nacht», wiederholte ich, «aber wer weiß, was noch passiert.»
Am Abend war ich eine halbe Stunde vor Abfahrt am Zug. Ich weiß nicht, ob ich je Gelegenheit haben werde, den Eisenbahngesellschaften umfassend für all die Aufmerksamkeit zu danken, die mir seitens des Personals zuteilwird, sobald ich in einem jener Gänge erscheine, an deren Türen mit fetten Buchstaben diese heiligen Worte geschrieben stehen:
UNBEFUGTENISTDERZUTRITTVERBOTEN
Ich suchte den Bahnhofsvorsteher auf und erklärte ihm die Situation.
Er begann zu lachen.
«Nicht, was Sie denken», sagte ich.
«Wirklich nicht?»
«Ehrenwort!»
«Ach! Gut, aber unterwegs …»
«Glaube ich nicht.»
«Spielt keine Rolle. Viel Glück!»
«Geben Sie acht: Einem Jäger wünscht man kein Glück.»
Ich stieg in meinen Waggon, und der Bahnhofsvorsteher schloss mich hermetisch ein, dann hängte er ein Schild an den Griff meiner Tür, auf dem in fetten Lettern diese Worte geschrieben standen:
ABTEILRESERVIERT
Sobald ich hörte, wie die Reisenden lärmend zu ihren Plätzen eilten, steckte ich den Kopf aus meiner Tür und rief den Zugführer, ich wies ihn auf Madame Bulyowsky hin, die mit ihren drei Wienern und ihren vier Wienerinnen einen Waggon bestieg, und erklärte ihm, welche Gefälligkeit ich von ihm erwartete.
«Welche ist es?», fragte er.
«Die hübscheste.»
«Also die mit dem Hut à la Mousquetaire?»
«Genau.»
«Na, Sie haben ja den Bogen raus!»
«Ist das Ihre Meinung?»
«Klar doch!»
«Nun, die meine ist es nicht.»
Der Zugführer sah mich mit spöttischem Gesichtsausdruck an und ging kopfschüttelnd davon.
«Schütteln Sie nur den Kopf, so viel Sie wollen, es ist eben so», sagte ich, ganz verdrossen, dass ich meine Unschuld nicht glaubhaft machen konnte.
Der Zug fuhr ab. Als wir den Bahnhof von Pontoise erreichten, war es schon dunkel.
Meine Tür öffnete sich, und ich hörte die Stimme des Bahnhofsvorstehers sagen: «Steigen Sie ein, Madame, hier ist es.»
Ich streckte die Hand aus und half meiner schönen Reisegefährtin, die beiden Stufen zu nehmen.
«Ach! Da sind Sie ja endlich!», rief ich.
«Ist Ihnen die Zeit lang geworden?»
«Das will ich meinen, ich war ja allein.»
«Nun, mir ist sie gerade deswegen lang geworden, weil ich Gesellschaft hatte. Ein Glück, dass ich die Augen schließen und an Sie denken konnte.»
«Sie haben an mich gedacht?»
«Warum nicht?»
«Ich bin der Letzte, der Sie deswegen schelten würde. Nur, in welcher Weise haben Sie an mich gedacht?»
«In allerinnigster Weise.»
«Pah!»
«Aber ja, ich schwöre Ihnen, dass ich Ihnen zutiefst dankbar bin für die Art und Weise, wie Sie sich mir gegenüber verhalten.»
«Ach! Tatsächlich?»
«Ehrenwort!»
«Das ist immerhin etwas. Aber wenn Sie erst einmal in Wien angekommen sind, machen Sie sich über mich lustig.»
«Nein, denn Sie dürfen darauf zählen, dass ich nicht nur eine anständige Frau bin, sondern mich darüber hinaus für eine Frau von Geist halte.»
«Bin ich denn ein Mann von Geist?»
«Vor aller Welt und für alle Welt, ja.»
«Und für Sie?»
«Für mich sind Sie mehr als das: Sie sind ein Mann mit Herz. Und jetzt geben Sie mir einen Kuss und wünschen Sie mir eine gute Nacht; ich bin sehr müde.»
Ich küsste sie auf deutsche oder auf englische Art, wie auch immer man es nennen mag. Was sie mit einem Kuss erwiderte, der für eine Französin äußerst vielsagend gewesen wäre; dann machte sie es sich in ihrer Ecke bequem.
Ich sah ihr dabei zu und sagte mir, wenn es ein Mann einer Frau gegenüber an Respekt fehlen lässt, dann ganz gewiss, weil die Frau es so will.
Sie wechselte zwei- oder dreimal die Position, seufzte leise, öffnete die Augen wieder, sah mich an und sagte: «Wirklich, ich glaube, ich fühle mich wohler, wenn ich den Kopf an Ihre Schulter lehne.»
«Sie fühlen sich vielleicht wohler», antwortete ich lachend, «aber ich werde mich mit Sicherheit schlechter fühlen.»





























