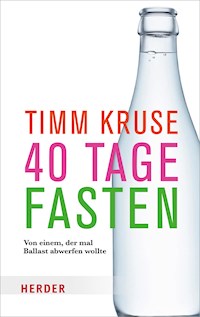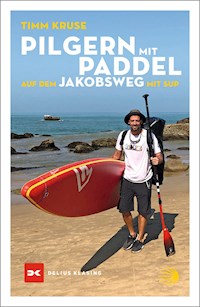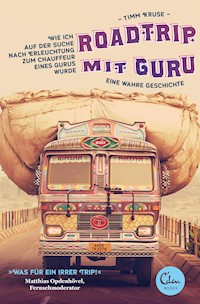Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Delius Klasing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Abenteuer & Fernweh
- Sprache: Deutsch
Mit einer Million Paddelschläge die Donau entlang Vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer: Als erster Mensch fährt Timm Kruse mit dem Stand Up Paddelboard (SUP) den längsten Fluss Europas entlang. Auf seiner Tour wird er dutzende Male von der Wasserschutzpolizei angehalten, heult mit Schakalen, paddelt im serbischen Fernsehen, bricht sich in Ungarn den linken Daumen, wird wieder und wieder von Wildfremden zum Essen eingeladen, schläft in einer Millionärsvilla und einem Dracula-Palast, sinkt bei Kilometer null am Schwarzen Meer heulend ins Wasser und stellt fest: Das Ziel ist auch nur irgendein Ort. • Ein spannender und tiefgründiger Reisebericht eines außergewöhnlichen Abenteurers. • Eine engagierte Kampagne für ein offenes Europa ohne Grenzen. • Eine Aufforderung, das eigene Limit zu überwinden und Freiheit zu erleben. • Ein Geschenk für Leser, die Outdoor-Abenteuer lieben. SUP-Mission Europa Timm Kruse ist überzeugter Abenteurer und wagt es immer wieder, die Komfortzone zu verlassen und seine eigenen Grenzen zu testen. Er hat schon 40 Tage lang gefastet, ist um die Welt gesegelt und war ein Jahr als Chauffeur eines Gurus unterwegs. Seine Stand-Up-Paddling-Tour die Donau entlang ist für ihn mehr als ein Outdoor-Abenteuer, sie ist seine "SupMission Europe". Für die Donau-Anrainer hat der europäische Gedanke Wohlstand und Frieden gebracht. Und dennoch scheint die Union mehr und mehr zu zerbrechen, als ob die europäische Idee ihre Strahlkraft verloren hätte. Timm Kruse, Abenteurer, Fernsehredakteur und Wissenschaftsjournalist, versucht auf seiner Reise herauszufinden, warum die Menschen vergessen haben, dass Freiheit keine Selbstverständlichkeit ist. Erkunden Sie mit ihm das Phänomen der Freiheit mitten in Europa!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Danach
Deutschland
Tag 1, Donaueschingen–Immendingen
Tag 2, Immendingen–Hausen im Tal
Tag 3, Hausen im Tal–Scheer
Tag 4, Scheer–Rottenacker
Tag 5, Rottenacker–Ulm
Tag 6, Ulm
Tag 7, Ulm–Blindheim
Tag 8, Blindheim–Neuburg an der Donau
Tag 9, Neuburg an der Donau–Stausacker
Tag 10 Stausacker–Regensburg
Tag 11 Regensburg–Straubing
Tag 12, Straubing–Vilshofen
Österreich
Tag 13, Vilshofen–Engelhartszell
Tag 14 Engelhartszell–Aschach
Tag 15 Aschach–Steyregg
Tag 16 Steyregg–Freyenstein
Tag 17, Freyenstein–Rossatzbach
Tag 18, Rossatzbach–Nationalpark Donau-Auen
Slowakei und Ungarn
Tag 19, Nationalpark Donau-Auen–Gabčíkovo, Slowakei
Tag 20, Gabčíkovo, Slowakei–Ács, Ungarn
Tag 21, Ács–Gran
Tag 22, Gran–Budapest
Tag 23, Bogyiszló–Baja
Tag 24, Baja
Kroatien und Serbien
Tag 25, Baja, Ungarn–Batina, Kroatien
Tag 26, Batina, Kroatien–Bođani, Serbien
Tag 27, Bođani, Kroatien–Neštin, Serbien
Tag 28, Neštin–Novi Sad, Serbien
Tag 29 Novi Sad–Slankamenački Vinogradi, Serbien
Tag 30, Slankamenački Vinogradi–Belgrad
Tag 31, Belgrad–Smederevo
Rumänien, Bulgarien, Moldawien und die Ukraine
Tag 32, Smederevo, Serbien–Baziaş Rumänien
Tag 33, Baziaş, Rumänien–Boljetin, Serbien
Tag 34, Boljetin–Tekija, Serbien
Tag 35, Tekija, Serbien–Izvoru Frumos, Rumänien
Tag 36, Izvoru Frumos–Basarabi, Rumänien
Tag 37, Basarabi, Rumänien–Vidin, Bulgarien
Tag 38, Vidin–Lom, Bulgarien
Tag 39, Lom–Nedeia, Rumänien
Tag 40, Nedeia–Gârcov, Rumänien
Tag 41, Gârcov, Rumänien–Swischtow, Bulgarien
Tag 42, Swischtow–Slivo Pole, Bulgarien
Tag 43, Slivo Pole–Tutrakan, Bulgarien
Tag 44, Tutrakan, Bulgarien–Cegani, Rumänien
Tag 45, Cegani, Rumänien–Giurgeni
Tag 46, Giurgeni–Brăila
Tag 47, Brăila–Nowosilske, Odessa, Ukraine
Tag 48, Nowosilske, Ukraine–Tulcea, Rumänien
Tag 49 Tulcea, Rumänien–Sfântu Gheorghe, Schwarzes Meer
Tag 50, Schwarzes Meer
Dank an
Bildteil
FÜR EUCH AUF DEM WEG.
Sat by the river and it made me complete.Keane
DANACH
Flughafen Bukarest, 44°34‘37.8”N 26°05‘29.5”E
Es ist schön, heute nicht zu paddeln. Meine Arme sind so schwer, dass ich kaum die Kraft besitze, diese Zeilen zu tippen. Meine Augen brennen wie Feuer – ich habe mir eine Bindehautentzündung eingefangen. Ich bin entsetzlich müde. Die ganze Last der vergangenen Wochen fällt von mir ab.
Ich habe einen Fensterplatz mit Beinfreiheit bekommen. Das Glück der Reise scheint mit mir zurück nach Deutschland zu fliegen. Neben mir sitzt ein Mann um die dreißig. Sein Hemd spannt; es sieht aus, als hätte er es vor fünf Minuten aus der Reinigung geholt. Er tippt eine Nachricht in sein Handy – auf Deutsch. Wie fremd mir der »Landsmann« vorkommt – wie ekelhaft dieses Wort klingt. Ich fühle mich nicht mehr als Deutscher. Noch nicht einmal als Europäer. Eher wie ein staatenloser Wilder. Wie ein Urmensch. Ein Wassermensch. Als stammte ich aus einer Zeit, in der es noch keine Reisepässe gab. Die zivilisierte Welt kommt mir vor wie ein Spuk.
Als sich die letzten Passagiere gesetzt haben, hievt sich mein Nachbar auf den freien Platz am Gang. Der Sitz zwischen uns bleibt jetzt leer. Er wünscht sich bestimmt einen gepflegteren Sitznachbarn, einen rasierten, gebügelten, mit weißen Augäpfeln. Oder bilde ich mir das nur ein?
Ich bin der einzige Passagier mit ungepflegtem Vollbart an Bord. Auch der einzige mit struppigen Haaren, roten Augen und schlangenartig trockener Haut an den Unterarmen. Der einzige mit Kapuzenoberteil, dreckigen Jeans und Flip-Flops. Vermutlich auch der einzige mit Schwielen an den Händen, Hornhäuten unter den Füßen und keinem Gramm Speck am Körper.
Ich unterscheide mich deswegen so deutlich vom Rest der Passagiere, weil ich vor fast zwei Monaten in Donaueschingen auf einem Stand-up-Paddelboard die verrückteste Reise meines Lebens begonnen habe: 3.000 Kilometer auf der Donau – von der Quelle bis zur Mündung, eine Million Paddelschläge, zehn Länder, vier europäische Hauptstädte. Ich wurde dabei dutzende Male von der Wasserschutzpolizei angehalten, habe mit Schakalen geheult, paddelte im serbischen Fernsehen, habe in Ungarn meinen linken Daumen gebrochen, wurde wieder und wieder von Wildfremden zum Essen eingeladen, habe in einer Millionärsvilla und einem Dracula-Palast geschlafen und bin bei Kilometer 0 am Schwarzen Meer heulend ins Wasser gesunken.
»Boarding completed«, sagen die Lautsprecher. Ich muss fast lachen – »Paddle boarding completed«, heißt es für mich.
Als wir in der Luft sind, erkenne ich von oben die Donau. Ihre Arme schlängeln sich ins Schwarze Meer. Vor ein paar Tagen stand ich noch da unten auf meinem Brett. Ob man mich aus der Luft als Teil der Szenerie hätte wahrnehmen können? Vermutlich nicht. Aber ich konnte die Flugzeuge sehen und wünschte mich nach oben. Jetzt ist der Wunsch in Erfüllung gegangen – und ich wünsche mich nach unten.
DEUTSCHLAND
TAG 1, DONAUESCHINGEN–IMMENDINGEN
Donaueschingen, 47°57‘02.6”N 8°31‘14.5”E /Immendingen, 47°57‘24.8”N 8°46‘19.1”E
Was habe ich mir da nur aufgehalst?
Mehrere Fernseh-Teams halten ihre Kameras auf mich. Ein Mann vom Hörfunk führt ein lebloses Interview mit mir. Die Zeitungs-Redakteurin fragt, ob ich einen Hang zum Extremen hätte. »Ganz offensichtlich«, muss ich zugeben. Ich bin schrecklich nervös. Zuschauer gucken mich neugierig an, Stadtbeauftrage und Wildfremde geben mir Ratschläge, ein Hund knurrt mich an, und die Donau führt zu wenig Wasser. Ich würde die ganze Tour am liebsten abblasen. (Fotos 1+2)
Seit Tagen kann ich kaum essen. Nichts ist schlimmer als die Zeit vor einem Abenteuer. Ich habe Angst, etwas vergessen zu haben. Mein Gepäck macht mir Sorgen – 25 Kilo plus ein kleiner Karren zum Ziehen des Boards an Land sind viel zu viel. Das Brett wird sich damit wie ein Wal durch die Donau bewegen. Auch mein Körper verhält sich nicht ganz so, wie ich mir das wünschen würde. Vor drei Tagen taten mir nach dem Training so sehr die Handgelenke weh, dass ich sie kaum noch bewegen konnte.
Zum Glück begleiten mich in den ersten Tagen zwei Freunde. Sie machen Filmaufnahmen, schießen Fotos und füttern damit die sozialen Netzwerke und Medien, sie koordinieren und organisieren. Ein bisschen Unterstützung tut mir anfangs gut. In zwei Tagen fahren sie zurück in den Norden, in meine Heimat, und ich bleibe allein zurück. Allein auf der Donau – wie ich es mir gewünscht hatte. Wovor ich jetzt schreckliche Angst habe. Ab dann ist die Donau mein Zuhause. Eine 3.000 Kilometer lange Heimat. Unvorstellbar!
Mein erster Kontakt mit diesem Fluss war furchtbar peinlich. Zwei Fernseh-Teams wollten meine Vorbereitungen filmen. Also stieg ich ein bisschen östlich von Donaueschingen aufs Brett, war von der starken Strömung überrascht, paddelte rückwärts, um zu verlangsamen, schlug quer, blieb mit der Finne an einem Stein hängen und klatschte ins Wasser. Die Kameraleute ließen sich nichts anmerken und taten, als sei nichts geschehen. Das machte alles nur noch schlimmer.
Gestern traute ich mich gar nicht mehr auf den Fluss und schaute mir lieber das kitschige Quellbecken im Schlosspark von Donaueschingen an, wo die Donau offiziell ihren Anfang nimmt. Ich stellte mir kurz vor, in dieser schweigenden Kleinstadt zu Hause zu sein und schauderte. (Foto 3)
Nachdem es die ganze Nacht geschüttet, gedonnert und geblitzt hatte, ist der Wasserpegel leicht gestiegen, doch befahrbar ist der Fluss an der ausgemachten Stelle weiterhin nicht. Ich muss mein Brett zwei Kilometer flussabwärts ziehen – dahin, wo Brigach und Breg »die Donau zu Weg« bringen. Was für ein hässlicher Schüttelreim. Wie ein Ypsilon ergießen sich die beiden Flüsse und vereinen sich zur Donau.
Eine Moderatorin von RegioTV fragt, wie ich auf die Idee gekommen sei, vom Schwarzwald ins Schwarze Meer zu SUPen. Ich kann’s ihr nicht richtig erklären.
»Die Donau hat mich schon immer fasziniert«, sage ich. »Und SUPen liebe ich seit Jahren. Irgendwann hat sich beides zusammengefunden und in meinem Kopf eingenistet. Ich habe gar keine Wahl. Ich muss diese Tour einfach machen. Sonst würde mich dieser Traum ewig verfolgen. Und das wäre unerträglich*.«
Erst als das Interview beendet ist und die Reporterin ihr Mikro wegpackt, fallen mir die richtigen Antworten ein: Das Leben muss mir die Möglichkeit zum Abreisen bieten. Das gehört zu mir wie die Hoffnung, das Essen, die Luft oder der Sex. Vielleicht will ich auch einfach nur meinem eigenen Leben aus dem Weg gehen. Oder ich will herausfinden, wer ich bin, wenn ich die Komfortzone verlasse. Es ist mal wieder Zeit, mich besser kennenzulernen. Ich käme mir feige vor, wenn ich mich davor drücken würde.
Hoffentlich war ich nicht zu pathetisch im Interview – das passiert mir leicht. Gerade bei Frauen mit Mikros. Vielleicht haben auch die feierlichen Sprüche und die steinerne Wächterfigur am Quellbrunnen ihre Wirkung getan. Aber wie sollte ich sonst erklären, dass ich regelmäßig eine Pause brauche vom Alltag, vom Komfort. Zwischendurch benötige ich immer wieder ein freischwebendes Leben, um danach unsere Zivilisation wieder wertschätzen zu können. Vielleicht ist es auch die vage Angst, die Befürchtung, ein belangloses Leben zu leben. Angst, nicht alles aus diesem einen Leben herauszuholen.
»Was sagen Ihre Familie und Ihre Freunde dazu?«
»Sie halten mich für verrückt«, antworte ich. »Ich frage mich hingegen, warum ich nicht schon viel früher auf die Idee gekommen bin.«
Vielleicht entspringt die Eingebung für diese Reise auch meiner Herkunft: Ich komme ursprünglich aus Lippe-Detmold, der einzigen Region weltweit, die nichts zu bieten hat – vor allem kein Wasser. Durch Lippe fließt kein einziger Fluss, die Lippe selbst fließt am Kreis Lippe vorbei, die Lipper erfreuen sich an einem lächerlichen Stausee, auf dem sie Windsurfen lernen. Lipper sind Hardcore-Landratten – ich wollte schon immer anders sein.
Als ich im Frühjahr mit einem alten Freund aus Detmold meine Bedenken über die Donau-Tour teilte, stellte er die entscheidende Frage: »Was willst du lieber? Arbeiten oder durch zehn Länder paddeln?«
Ich zurre noch einmal mein Gepäck fest und halte eine Hand in den Fluss. Eigentlich wollte ich die Temperatur testen, aber jetzt kommt mir die Bewegung wie ein Shakehand vor. Dabei stelle ich mit Schrecken fest, dass die Strömung noch heftiger ist als bei meiner Blamage vor zwei Tagen. Dann steige ich aufs Brett und bin plötzlich unterwegs. Ich drehe mich vorsichtig um – ich darf auf keinen Fall schon wieder reinfallen – und winke zurück.
Nach der ersten Biegung bin ich allen Blicken entschwunden und spüre zum ersten Mal seit Tagen eine gewisse Erleichterung. Das Loskommen ist viel schwieriger als das Reisen selbst. Sobald ich den Kontakt zum Land verloren habe, ist alle Angst verschwunden. Die Angst kann nicht mitkommen, sie bleibt zu Hause – diese Erfahrung habe ich auf jeder Reise gemacht. Ich kann mir auch schlecht 3.000 Kilometer lang vor Angst in die Hosen machen! (Foto 4)
Mein Brett manövriert sich wegen des Gepäcks schwerfällig wie eine Bugsierbarkasse. Die Donau fließt mit mehr als 5 km/h, addiert man meine Paddelgeschwindigkeit hinzu, bin ich zweistellig unterwegs.
Der Anfang einer langen Reise ist so intensiv, dass sich jedes Detail ins Gedächtnis brennt. Der ganze Fluss liegt vor mir, all die vielen Kilometer, die wilde Natur. Noch bin ich frisch, jungfräulich, zivilisiert. Matratzengewöhnt. (Foto 5)
Mein Paddel ist mein Wanderstock. Die Donau mein Jakobsfluss. Ich vermute, dass mich diese Reise verändern wird. Ich weiß nur noch nicht, inwiefern.
Ich kann die Landschaft genießen: Störche, Milane, Otter und Fische. Der Schwarzwald trödelt an mir vorbei, am Ufer stehen kilometerlang nur Brennnesseln, Bäume liegen umgestürzt im Wasser und versperren den Weg. Ich kämpfe mich durchs Geäst, paddele weiter und höre plötzlich ein seltsames Rauschen: das erste Wehr. Ich zerre mein Brett aus dem Wasser, lasse das Gepäck angebunden, greife die Finne, schleife alles mühsam rückwärtsgehend über einen Acker und lasse meinen Wal wieder in die Donau gleiten. Auf den nächsten Kilometern muss ich ein Dutzend Wehre und kleine Stromschnellen passieren. Diese Arbeit ist anstrengender als das SUPen selbst.
Ich stelle fest, dass mich der Fluss führt. Ich muss fast nichts tun, und er zeigt mir automatisch den direkten Weg vorbei an größeren Steinen und flachen Stellen durch eine ereignislose, deutsche Wildnis. Ich werde mutiger: In den Stromschnellen bleibe ich jetzt stehen. Die Angst, reinzufallen und auf Steine zu knallen, wird langsam geringer. Trotzdem komme ich mir verletzlich vor, anfällig. Feige, unerfahren.
Meine beiden Freunde begleiten mich weiter von Land aus, warten auf Brücken und Anlegestellen. Machen Aufnahmen, winken, sprechen mir Mut zu und wissen gar nicht, wie gut es tut, am Anfang dieses Abenteuers vertraute Gesichter zu sehen. Sie sind mir in diesem Moment die nächsten Menschen. Ich bin mit einem GPS-Sender ausgerüstet, der es ihnen leichter macht, mich zu finden. Sie haben sogar extra eine Homepage – www.gekritzeltes.de – gebaut, auf der man meine genaue Position verfolgen kann. (Foto 6)
Zwischendurch bin ich kilometerlang allein. Ich singe laut vor mich hin, muhe den Kühen zu und weiche einem Schwan aus, der angriffslustig auf mich zu schwimmt. Mein Herz klopft, als hätte mich gerade ein Tiger angefaucht und nicht dieses weiße, eitle Biest. Anschließend fällt mir ein, dass ich mein Paddel als Waffe gegen das Tier hätte benutzen können. Ab jetzt machen mir Schwäne keine Angst mehr.
Mir fallen aus dem Nichts die Zubringerflüsse der Donau ein: Iller, Lech, Isar, Inn, fließen rechts zur Donau hin. Altmühl, Naab und Regen, sind der Donau links gelegen. Wieso mussten wir das in der Schule lernen? Kennt jemand die Zuflüsse des Rheins? Oder der Elbe? Was macht das Besondere der Donau aus, sodass jedes Schulkind seine Zuflüsse auswendig lernen muss?
Vielleicht ist die Donau tatsächlich so etwas wie die Lebensader unseres Kontinents – mit ihren zehn Ländern, vier Hauptstädten, ihren 80 Millionen Anrainern. Ich mache diese Reise vor allem, weil dieser Fluss der internationalste Fluss der Welt ist. Mehr Abwechslung gibt es auf keiner Paddeltour der Erde.
Nach fünf Stunden auf dem Brett wird das Wasser immer flacher. Aus der eben noch 20 Meter breiten Donau ist ein Rinnsal geworden. Ich wurde schon gewarnt, dass die Donau irgendwann versickern würde, bin dann aber doch überrascht, als ich auf dem Trockenen sitze und der Fluss vollkommen verschwunden ist. (Foto 9)
Ich packe meine Taschen zusammen und trage Rucksack, Brett und Paddel durch das trockene Donaubett. Da ich keinen Handy-Empfang habe, wandere ich so lange durch den Fluss, bis mir meine beiden Freunde begegnen. Ich werfe mein SUP aufs Dach ihres Wohnmobils, lege mich auf den Rücksitz und kann nicht mehr.
Während ich diese Zeilen schreibe, nach der ersten Etappe und 35 Kilometern auf dem Wasser, ist mir weiterhin flau im Magen, obwohl sich mein Körper gut anfühlt und die Schwielen an den Händen erträglich sind. Die Jungs sitzen draußen und trinken das Freibier von unserem Sponsor. Ich sitze im Wohnmobil und frage mich, ob ich diese Tortur 60 weitere Tage durchstehen kann.
*Den Film findet man im Internet unter den Stichworten »Regio TV«, »Timm Kruse«, »SUP«: www.schwaebische.de/landkreis/landkreis-ravensburg_video,-timm-kruse-paddelt-auf-seinem-sup-von-donaueschingen-bis-ans-schwarze-meer-_vidid,137609.html
TAG 2, IMMENDINGEN–HAUSEN IM TAL
Immendingen, 47°57‘24.8”N 8°46‘19.1”E /Hausen im Tal, 48°05‘05.0”N 9°02‘24.3”E
Erneut wache ich mit flauem Gefühl im Magen auf. Da es über Nacht geschüttet und gewittert hat, durfte ich bei meinen Freunden im Wohnmobil schlafen. Sie sind gnädig und lassen mich langsam in das Abenteuer steigen. Ich kann nichts essen, steige aufs Brett und paddele mir die Angst aus dem Leib.
Immer wieder setzt meine Finne auf. Schon jetzt sieht das Ding aus, als wäre es mit einer Kettensäge bearbeitet worden. Ich muss aufpassen, dass mir nicht die ganze Box herausbricht, in der die Finne befestigt ist. Zur Not hätten meine Freunde noch ein Ersatzbrett im Wohnmobil. Aber darauf will ich mich nicht verlassen. Außerdem sind meine tüchtigen Helfer mitsamt samt Ersatzbrett in zwei Tagen verschwunden.
Beim Paddeln falle ich ständig auf die Knie, lege alles Gewicht nach vorn, damit die Finne ein bisschen höher aus dem Wasser kommt. Der Trick funktioniert einigermaßen. Alle paar Hundert Meter schleife ich trotzdem über Steine und Felsen und malträtiere meine schöne Carbon-Finne. Natürlich könnte ich die Finne abbauen und somit Bodenkontakt vermeiden. Doch ohne sie könnte ich praktisch nicht geradeaus fahren. Das SUP würde sich dann ohne Strömungsantrieb wie ein Kreisel durch das Wasser bewegen.
Wenn es gar nicht weitergeht, steige ich ab, ziehe das Heck übers Wasser und wate durch das Donaubett, bis es wieder tiefer wird. Meine Hände schmerzen, weil das Trageseil am Heckring meines Bretts in die Handflächen schneidet. Ich muss mir Schläuche besorgen, durch die das Seil läuft, um das Tragen zu erleichtern.
Bisher ist die Reise eine Tortur: Ich SUPe nie länger als 30 Minuten am Stück. Dann unterbrechen Wehre, Stauwerke, umgestürzte Bäume, Rampen oder zu seichtes Wasser meine Tour. Meine Turnschuhe reißen an den Seiten schon auf, weil ich mich verbotenerweise die Steinrampen herunterhangele. Dabei hebe ich das Brett am Heck an, lasse den Bug mithilfe der Strömung über die Steine rutschen und klettere durch teilweise hüfthohes Wasser hinter meinem Brett her. (Foto 10)
Das Gefälle beträgt etwa 20 Grad, die Wassertemperatur viel weniger, die Rampen sind ungefähr zehn Meter lang. Die Kraft des Wassers ist immens. Vor jedem Wehr stehen Warnschilder, »Lebensgefahr«, doch ich nehme diese nicht ernst. Ich weiß, dass Menschen in Wehren schon ersoffen sind, an denen das Wasser keinen halben Meter tief war. Doch ich weigere mich, mein Brett vor jeder Rampe über Land zu schleifen. Mein kleiner Karren hält nicht auf dem unebenen Untergrund. Und bisher konnte ich gut über die Hindernisse klettern. (Fotos 11–13)
Auf einer Brücke steht eine ganze Horde Rentner. Sie jubeln und winken mir zu. Kurz komme ich mir vor wie Forrest Gump, als er zu seinem langen Lauf aufbricht und ihm ganz Amerika in den Medien und im echten Leben folgt. Vielleicht hat sich meine Aktion wirklich herumgesprochen und Menschen kommen in Scharen, um mich anzufeuern. Wir fotografieren uns gegenseitig, winken noch einmal, und dann sehe ich einen meiner beiden Freunde neben der Brücke stehen. Wahrscheinlich haben sie die Begrüßungszeremonie organisiert. Also doch kein Forrest-Gump-Effekt.
Ein paar Kilometer später begegne ich zum ersten Mal anderen Wassersportlern. Kajaks und Kanus mit streitenden Familien, grölenden Jugendlichen und verzweifelten Paddlern, die es nicht schaffen, ihr Gefährt geradeaus zu steuern. Viele sprechen mich an, ob ich mich auf einer großen Tour befände. Wegen des Gepäcks. Einigen erzähle ich, dass ich bis ins Schwarze Meer paddeln möchte, aber nicht sicher sei, ob ich das schaffte. Alle sind begeistert und wünschen mir Glück. Da wird mir wieder klar, wie verrückt mein Unterfangen ist und wieviel Glück ich brauche, um tatsächlich am Schwarzen Meer anzukommen.
Zu Beginn meiner Tour standen nicht alle Ampeln auf Grün. Familie, Kollegen, Freunde und Bekannte rieten mir von einer zweimonatigen Tour quer durch Europa dringend ab. Die Gefahren seien nicht einzuordnen. Wie wolle ich an Nahrung und Trinkwasser kommen? Was, wenn mich jemand überfallen würde? In den meisten Regionen hätte ich kein Handynetz. Ich würde mich sicherlich verfahren. Mein Körper würde solche Strapazen niemals durchhalten. Danach hätten andere meinen Job als Reporter übernommen, ich sei dann arbeitslos. Und so weiter. Ich machte es trotzdem. Gerade deshalb vielleicht. Ich konnte gar nicht anders.
An der nächsten Umsteigestelle vor einem Wehr steht ein Kamerateam. Ich winke den Kollegen glücklich zu – hat es der SWR also doch noch geschafft, meine Tour ins Programm zu hieven. Die Redakteurin begrüßt mich herzlich und fragt seltsamerweise, was ich von den vielen Motorradfahrern an der Donau hielte. (Foto 14)
»Motorradfahrer?«, frage ich. »Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ist das hier ein Problem?« Langsam schwant mir, dass das Team nicht meinetwegen gekommen ist, sondern wegen irgendwelcher lärmenden Biker.
»Ja«, sagt die Mikrofonhalterin. »Hier fahren täglich mehr als 1.000 Motorräder durch. Das ist doch entsetzlich.«
»Sie möchten jetzt bestimmt von mir hören, dass ich das auch ganz entsetzlich finde. Richtig?«
Die Dame nickt.
»Also von mir aus können wir auch einen O-Ton türken, wenn Sie möchten«, sage ich im Scherz und benutze bewusst den politisch unkorrekten Ausdruck, um im Fernsehjargon zu sprechen. Zu meiner Überraschung antwortet die Kollegin: »Warum nicht?«
»Im Ernst?«, frage ich. Sie nickt.
Der Kameramann hält auf mein Gesicht; die Redakteurin fragt mich zum zweiten Mal, was ich zu dem Motorradlärm zu sagen hätte.
»Das nervt schon ziemlich«, sage ich. Schließlich war ich ja auch jahrelang als Reporter unterwegs. »Da will man einen schönen ruhigen Tag auf der Donau verbringen, und dann rasen diese Wahnsinnigen an einem vorbei.« Ich mache »Wiuuumm, wiiuuummm« und drehe meinen Kopf schnell von rechts nach links.
Die Kollegin ist überglücklich. Auf so einen schönen O-Ton habe sie den ganzen Tag gewartet. Nächsten Donnerstag soll die Reportage in der »Abendschau« laufen.*
»Und was ist mit meiner Tour?«, frage ich und erkläre, dass ich vom Schwarzwald ins Schwarze Meer SUPen würde.
»Ach so, ja. Da können wir ruhig auch noch mal einen O-Ton machen. Ich könnte das Thema ans Studio Ulm weitergeben.«
Damit hätten dann fünf verschiedene Redaktionen des SWR das Thema auf dem Schreibtisch liegen. Mal sehen, ob jemand doch noch darüber berichtet. Ich verabschiede mich höflich, schäme mich, den öffentlich-rechtlichen Beschwerde-Journalismus unterstützt zu haben und paddele weiter.
Hinter mir höre ich dunkles Grummeln. Ein Gewitter zieht auf und nähert sich. Die Zeit zwischen Blitz und Donner wird immer kürzer. In der Ferne sehe ich ein Dorf. Bis dahin muss ich es schaffen. Zum ersten Mal stelle ich mich in den Surfschritt, also ein Bein vor das andere und haue mit dem Paddel in die Donau, dass es spritzt. Als Blitz und Donner nur noch drei Sekunden auseinanderliegen, gelange ich unter eine alte Holzbrücke.
In den letzten Minuten vor dem schützenden Dach der mittelalterlichen Konstruktion schießen mir alle meine Versprechungen durch den Kopf. Ich musste meiner Familie und vielen Freunden hoch und heilig schwören, vorsichtig zu sein, insbesondere sollte ich bei Gewitter unbedingt an Land gehen, auf gar keinen Fall zu nah an Wehre heranpaddeln und mir sichere Plätze zum Schlafen suchen. An das letzte Versprechen habe ich mich gehalten – weil ich bisher mein Zelt noch nicht aufbauen musste.
Ich lege mein SUP auf die Böschung, klettere den Damm hoch und suche Schutz in der Brücke. Sie gehört zu einem Kloster, ist aus Holz gebaut, dicke Eichenstämme bilden das Dach. Ich lege mich auf einen der Stützpfeiler, nicke im Halbschlaf noch einem Priester oder Pfarrer zu und schlafe ein. Plötzlich schieße ich aus dem Schlaf auf – was, wenn die Donau durch das Gewitter so schnell gestiegen ist, dass mein Brett fortgespült wurde? Ich renne zur Böschung und sehe mein Brett ungerührt am Ufer liegen.
Ich zurre meine Sachen fest und paddele weiter. Von weitem ragen immer wieder Kirchtürme aus den Bergen und Felsen heraus. Jeder Pfarrer braucht hier sein eigenes Kraftwerk. Kein Dorf ohne Kirche, keine Kirche ohne Kraftwerk, kein Kraftwerk ohne entsetzliche Mühsal für den Paddler.
Nach noch nicht einmal 28 Kilometern Tagespensum, kurz hinter dem Kloster Beuron (Foto 15), kann ich nicht mehr. Ich rufe meine beiden Freunde an und frage, ob wir einen Platz zum Zelten suchen könnten. Zufällig finden wir einen hübschen Ort auf einer Wiese direkt unterhalb eines Hauses, das auch zur Kirche gehört. Ein Pastor in Zivil erlaubt uns, dort zu übernachten. Aber nur, weil mein Zelt aus Camouflage ist und es die Polizei somit wohl kaum sehen könne.
»Kann die Polizei denn verbieten, dass Sie auf Ihrem Grundstück Camper übernachten lassen?«, frage ich den Mann. Er wirkt seltsam schüchtern und macht auf mich nicht den Eindruck, als könnte er in der Kirche eine Predigt halten.
»Man weiß nie«, sagt er und geht zurück in sein Haus.
Ich baue mein Zelt auf. Meine beiden Freunde filmen mein gesamtes Equipment (Foto 16), machen ein paar Interviews mit mir und gehen dann in ihr Wohnmobil – »Facebook füttern und so«. Mich lassen sie bewusst allein.
Mitten in der Nacht wache ich auf. Meine Hüfte und meine Schultern schmerzen. Außerdem ist mir kalt. Mit Schrecken stelle ich fest, dass meine aufblasbare Isomatte nicht dichthält. Ich blase sie also erneut auf und schlafe sofort wieder ein.
Mein letzter Gedanke ist mal wieder, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich diese Reise wirklich durchziehen möchte.
* Hier kann man die Sendung sehen: www.youtube.com/watch?v=FY6ckTRTaZ4.
TAG 3, HAUSEN IM TAL–SCHEER
Hausen im Tal, 48°05‘05.0”N 9°02‘24.3”E /Scheer. 48°04‘05.5’N 9°17‘52.7’E
Es ist noch nicht einmal 6 Uhr früh, als mich die Drohne meiner Freunde über meinem Zelt weckt. Sie machen letzte Aufnahmen und wollen dann zurück in den Norden fahren. (Fotos 7+8)
Wir umarmen uns lang, sie sprechen mir Mut zu, hauen mir mehrmals viel zu fest auf meine muskelverkaterten Schultern, steigen in ihr Wohnmobil und machen sich auf den Weg nach Hamburg. Meine morgendliche Übelkeit kehrt zurück. Ab jetzt bin ich auf mich selbst gestellt. Ich sitze vor meinem Zelt und kann nicht glauben, dass ich ab jetzt allein durch dieses Abenteuer schreiten muss.
Ich packe meine Sachen, stelle fest, dass wir ein ganz akutes Schneckenproblem in Deutschland haben und pflücke die klebrigen Biester vom Zelt und werfe sie in die Donau. Anschließend trage ich mein Brett hinterher, schnalle meine Taschen und den Rollwagen ganz bewusst fest und weiß, dass das Abenteuer erst jetzt richtig beginnt.
Vor mir türmen sich riesige Kalksteinwände auf. Die Donau wird rauer und voller. Nur die Wehre bleiben. Noch dazu weisen mich jetzt Verbotsschilder darauf hin, dass ich mich mitten in einem Naturschutzgebiet befinde und hier auf keinen Fall paddeln darf. Strafe bis zu 10.000 Euro. Den ganzen Tag begegnet mir kein Mensch. (Foto 17)
Die Natur ist überwältigend schön auf dieser Strecke, und mir wird zum ersten Mal klar, dass ich genau diese einsamen Momente in der Natur gesucht habe, egal, ob im Schwabenland oder in Kroatien. Ich stelle mein Paddel aufs Brett, stütze mein Kinn darauf, lasse mich treiben und bin zum ersten Mal wirklich glücklich und entspannt.
Gleichzeitig stelle ich fest, dass ich hier ein Eindringling bin. Die armen Stockenten fliehen vor mir. Das Weibchen haut immer zuerst ab; sie ist wachsamer und ängstlicher. Der Erpel folgt ihr stets mit ein bisschen Abstand; treu und ergeben.
Auch die Schwäne haben hier Angst vor mir. Sie watscheln beim Start klatschend übers Wasser. Erst nach 30, 40 Metern schaffen sie es, ihre gewaltigen Körper mit den Schwingen in die Lüfte zu hieven. Mir schießt der Gedanke durch den Kopf, dass ich gern mal für einen Tag mit einer dieser Kreaturen tauschen würde. Einfach und natürlich in und mit der Natur sein. Und fliegen können.
Doch dann kommt das nächste Wehr, und ich frage mich, warum hier jeder Pastor seine Hindernisse in die Natur bauen durfte und mir in dieser Gegend das Paddeln verboten wird.
Ich paddele mit einem Biber um die Wette. Irgendwann findet der Nager den Menschen langweilig. Er holt tief Luft und taucht mit einem kleinen Aufschwung ab. Rechts und links von mir liegen abgenagte Bäume im Wasser.
Ein Roter Milan scheint mich seit Donaueschingen zu begleiten. Störche, Fischreiher und Rüttelfalken fliegen nur wenige Meter vor meinem Brett übers Wasser. Einige Vögel versuchen, mich anzuscheißen. Doch bisher spritzten die grauen Bomben neben mir ins Wasser. Mir kommt das Ulmer Münster in den Sinn, das im Zweiten Weltkrieg auf sagenhafte Weise als einziges Gebäude im Bombenhagel stehengeblieben ist.
Es gackert und kreucht um mich herum. Die Wälder sind vollkommen unberührt. Am Ufer und im Dickicht herrscht das totale Chaos, und doch ist alles in Ordnung. Nicht vorzustellen, dass dieser Bach zum Fluss und irgendwann zum Strom wachsen wird. Dass er Länder teilt, Soldaten patrouillieren lässt. Noch ist die Donau Teil eines Ganzen, sie trennt nichts. Niemand kann an einer Seite des Ufers stehen und die auf der anderen Seite hassen oder fremd finden. Doch vielleicht existiert all dies auf späteren Donaukilometern gar nicht, und ich bin auf den Alarmismus der Medien hereingefallen. Ich werde es in den kommenden Wochen herausfinden.
An einem besonders steilen Wehr schlägt mein SUP quer und meine Finne bricht heraus. Zum Glück kann ich sie aus der Donau fischen und wieder einbauen. Wie durch ein Wunder ist der Finnenkasten weiterhin unbeschädigt. Wer auch immer dieses Brett geklebt hat, versteht sein Handwerk. Vermutlich ein Chinese oder Bangladeshi, und von der Donau hat er noch nie gehört.
Der Fluss schießt zwischen Kalkfelsen hindurch. Es wäre unmöglich, gegen die Strömung anzupaddeln. Hier gibt es kein Zurück. Ich rausche mit 10 km/h über Steine und Gräser. Immer wieder schabt meine Finne über den Boden. Lange geht das nicht mehr gut. Als sich das Wasser wieder beruhigt, entdecke ich ein Stechpaddel im Unterholz. Es muss ein unglücklicher Paddler in den Stromschnellen verloren haben. Wie er wohl ohne Paddel sein Boot manövriert hat?
Die nächste Rampe scheint leichter zu überwinden zu sein als die vorherigen. Ich steuere mein SUP ganz nach rechts, weil am Rand normalerweise die Strömung am schwächsten ist. Obwohl die Stelle insgesamt nicht so steil ist, fließt hier das Wasser trotzdem in hoher Geschwindigkeit herunter. Die Wassertemperatur beträgt höchstens 15 Grad. Doch ich bin so mit Adrenalin überschwemmt, dass ich nichts merke und mich nur auf mich und das Brett konzentriere. Auf einer Brücke über mir stehen zwei Biker und filmen meinen Kampf mit dem Wasser. Die Aufnahmen würde ich gern sehen.
Als sich mein Fuß unter einem Stein verklemmt und ich eine schwere Verletzung fürchten muss, lasse ich mein SUP los und ziehe mich mit beiden Armen gegen die Strömung zurück, um meinen Fuß zu befreien. Das SUP schießt davon und kracht mit der Finne auf einen Felsen. Trotz des Rauschens höre ich es knacken. Beim Griff unters Heck stelle ich fest, dass die Finne weg ist – es ist ein Wunder, dass sie bis jetzt gehalten hat. Ich taste noch ein bisschen im Wasser herum, doch gibt es keine Möglichkeit, das Ding wiederzufinden.
Ich lege mich aufs Brett und fahre jetzt ohne Finne bäuchlings die Rampe herunter. Unkontrolliert schabe ich über runde Felsen, presche durch kleine Stromschnellen und Wasserfälle, bis die Donau wieder ruhig weiterfließt.
Klitschnass steuere ich mein Brett an Land und stelle erleichtert fest, dass der Finnenkasten immer noch keinen Schaden davongetragen hat. Auch die Unterseite des Bretts hat kaum Schrammen abbekommen. Jedes feste Brett aus Plastik oder Carbon wäre mittlerweile schrottreif. Aber mein aufblasbares Board funktioniert im Fluss wie ein Autoreifen. Ich kann fahrlässig Hindernisse übermangeln wie ein Auto Bürgersteigkanten, das Brett gibt nach und zeigt sich unversehrt. Ich darf es nur nicht übertreiben.
Vor der Tour haben viele Freunde und Bekannte, die ich vom Wassersport kenne, über mein i-SUP, also »inflatable stand up paddelboard«, gelästert. Sie meinten, das Ding würde niemals 3.000 Kilometer halten. Doch im Moment bin ich froh über meine Entscheidung, kein festes Brett genommen zu haben. Es hat bisher auch nicht ein Millibar Luft verloren und ist mit zwei Bar immer noch prall wie ein Autoreifen. Auf dem Meer macht ein festes Board sicherlich mehr Sinn. Aber auf einem Fluss, der keine Wellen und jede Menge Untiefen hat, ist ein i-SUP die bessere Wahl.
Ich hole meine Ersatzfinne aus der Tasche und schwöre mir, ab jetzt vorschriftsmäßig alle Rampen zu umlaufen. Sollte ich hier draußen ohne Finne weiterfahren müssen, hätte ich ein echtes Problem.
Nur ein paar Minuten später gelange ich ans nächste Wehr. Dieses Mal mit Bootsrutsche. Ich sehe, wie vor mir ein Zweierkajak die Rutsche herunterrast. Doch Kajaks haben keine Finne. Ich lege an, beschaue mir die Rutsche genau und schätze die Chancen, dass meine Finne genügend Platz hat auf fifty-fifty. Also drücke ich einen roten Knopf und warte, bis die Ampel auf Grün schaltet. Vor mir fährt eine Rampe hoch, staut das Wasser auf über einen halben Meter an, dann springt die Ampel um, und ich stürze mich in den einen Meter breiten Betonkanal. Ich rase mit Höchstgeschwindigkeit die Bootsrutsche herunter und werde ohne Randberührung von der Strömung nach zehn Sekunden wieder in die Donau gespuckt. Solche Dinger sollten gesetzlich vorgeschrieben werden. (Foto 18)
Baden-Württemberg ist fest in der Hand des Klerus. Überall stehen Kirchtürme herum, manchmal sogar zwei pro Dorf. Auf jedem Gipfel prangt ein Kreuz, und auf jedem Fels steht eine Kapelle. (Foto 19)
Meine Kräfte verlassen mich. Ich bin heute wegen der vielen Wehre und Rampen nicht sonderlich weit vorangekommen. Trotzdem beschließe ich, an einer Umsteigestelle Rast zu machen. Es ist 17 Uhr, vielleicht sollte ich hier einfach schlafen.
Am Ufer steht eine Frau mit Hund und zwei Kindern. Schon am »Hallo« höre ich die Sächsin. Es klingt eher wie »Hollö«. Sie hilft mir, mein Brett an Land zu ziehen und sieht dann mein Stechpaddel.
»Das klingt vielleicht unglaubwürdig, aber das ist unser Paddel.«
»Das ist ja ein Zufall«, sage ich. Ihr achtjähriger Sohn guckt auf mein Brett und sagt: »Ja, das habe ich gestern verloren.«
»Und wie bist du dann weitergepaddelt?«, frage ich ihn.
»Gar nicht. Die anderen sind gepaddelt.«
»Wir haben ein Viermann-Kajak. Also hatten wir noch drei weitere Paddler an Bord«, sagt die Mutter.
Der Junge nimmt das Paddel und läuft zu seinem Vater, der auf einem Parkplatz direkt neben der Donau an einem Wohnmobil herumschraubt. Als der Vater seinen Sohn mit dem Paddel sieht, schaut er überrascht auf und winkt mir dankend zu.
»Wir waren gestern keine Stunde auf dem Wasser, als unser Boot von einem Metallstift aufgeschlitzt wurde«, ruft der Mann.
»Wie kann das denn passieren?«, frage ich.
»Wir wurden in einer Kurve nach außen gedrängt und kamen zu nah ans Ufer. Dort hat ein Metallstift unser Plastikboot über 30 Zentimeter aufgerissen. Wir sind sofort gekentert und mussten das kaputte Kanu dann fast fünf Kilometer durch den Wald tragen. Eigentlich hätten wir es auch einfach liegen lassen können.«
Mir wird wieder klar, wie viel Glück ich bisher gehabt habe. Vielleicht ist mein Brett aber auch leichter zu manövrieren. Immerhin war die Familie zu viert mit Hund unterwegs, und Kinder sind meist keine guten Paddelhilfen.
Wir unterhalten uns noch ein bisschen, dann bricht die Familie in ihrem Camper auf in Richtung Frankreich. Vielleicht finden sie noch jemanden, der ihr Boot reparieren kann.
Während ich mein Zelt am Ufer aufbaue, kommen zwei gedrungene, ein bisschen finster aussehende Typen auf mich zu – Fischereiaufsicht. Ich grüße freundlich und baue weiter auf. Meine Angel liegt in meinem Gepäck und wurde auf dieser Reise noch nicht einmal unerlaubterweise benutzt.
Sie fragen mich, was ich hier machen würde.
»Zelten«, sage ich.
»Angeln tun Sie nicht?«
Ich verneine. »Was wäre denn, wenn?«
»Dann würden wir Ihre Angellizenz prüfen und gegebenenfalls die Polizei informieren. Und das wird dann richtig teuer.«
»Na, da hab ich ja nochmal Glück gehabt.«
Die beiden schauen mich irritiert an, grüßen noch einmal den Herrgott und ziehen davon.
Erst jetzt merke ich, dass auf der anderen Seite schon wieder eine Kirchturmuhr bimmelt – und zwar alle Viertelstunde. Wieso kann sich diese überholte Institution eine solche Lärmbelästigung herausnehmen? Als ob nicht jeder Mensch heutzutage eine Uhr tragen würde oder zumindest eine Uhr im Handy zur Verfügung hätte. Doch jetzt ist es zu spät, das Zelt steht. Ohrenstöpsel möchte ich nicht tragen, aus Angst, möglicherweise Diebe nicht zu hören.
Mein SUP habe ich mit einem Schloss an einem Pfahl angebunden. Dazu habe ich einen Sicherheitsalarm unter dem Brett befestigt. Wenn es jemand wegtragen wollte, würde ein lautes Piepen ertönen. Das sollte doch jeden Dieb in die Flucht schlagen.
Zur weiteren Sicherheit habe ich noch eine besonders starke Taschenlampe dabei, die man Dieben in der Dunkelheit direkt ins Gesicht hält. Das soll sie blenden und verunsichern. Ich hoffe, dass ich das Ding nie benutzen muss.
TAG 4, SCHEER–ROTTENACKER
Scheer, 48°04‘05.5”N 9°17‘52.7”E /Rottenacker, 48°13‘51.3”N 9°41‘16.2”E
Zum ersten Mal wache ich allein auf – ohne meine Freunde. Sie haben mir eine Nachricht geschickt, dass sie gut in Hamburg angekommen sind.
Ich nehme mir vor, in den kommenden Tagen alles in Ruhe zu genießen. Ich will nicht durch dieses Abenteuer hetzen. Warum sollte ich etwas beschleunigen wollen? Das hieße lediglich, dass mich etwas anderes mehr interessiert als das, was ich gerade mache. Ich will mich mit Bedacht über den Fluss bewegen, die Reise in ihren einzelnen Abschnitten würdigen. Ohne Tagesziel, ohne Effizienz, ohne To-do-Liste. Nur mit der Aussicht, eines fernen Tages am Schwarzen Meer anzukommen.
Noch bin ich völlig unerfahren in meinem Abenteuer. Wie viele Fehler liegen noch vor mir? Wieviel werde ich dazulernen? Wie häufig werde ich über mich selbst den Kopf schütteln?
Das Schönste am Reisen ist, dass man nicht weiß, was man nicht weiß.
Bislang verstehe ich diesen Fluss nicht. Seine Strömungen und Strudel folgen scheinbar keinen Gesetzmäßigkeiten. Nur in Kurven gilt die Fliehkraft, und außen ist die Strömung am Stärksten. Aber sonst blubbert es manchmal, als wollten Tiere an die Oberfläche steigen, Kreisel und Strudel ziehen in Ringen übers Wasser und schieben mein Boot zur Seite. Dann fühlt es sich an, als hätte ich schon wieder meine Finne verloren.
Manchmal fahre ich für mehrere Kilometer durch metertiefes Wasser, dann setzt meine Finne plötzlich wieder auf und knirscht durch den Kies. Auch die Farbe des Wassers verändert sich nach jeder zweiten Biegung. Mal ist die Donau pechschwarz, dann wieder braun, später grün und manchmal sogar blau. Es gibt Kilometer, an denen das Wasser regelrecht steht, und dann fließt der Fluss wieder mit mehr als zehn Stundenkilometern durch die Natur. Meist bewegt sich vor Wehren nichts. An den Stromschnellen weiß ich mittlerweile, wo ich ohne aufzusetzen am besten durchkomme. Mittlerweile gelingt es mir, Unterwassersteine zu orten und ihnen rechtzeitig auszuweichen. Sie verraten sich, denn sie verursachen immer einen Strudel hinter sich.
Es gibt Abschnitte, an denen ich wie über eine schlingernde Wiese fahre. Seegras wabert in der Strömung, und meine zerkratzte Finne reißt ganze Büschel mit sich. Dann muss ich bäuchlings nach hinten ans Heck kriechen und die Finne von dem Zeug befreien – erstens bremst das Seegras, zweitens reagiert das Brett schlechter in der Strömung, wenn die Finne nicht frei ist. (Foto 20)
Immer wieder tauchen goldfarbene Inseln in der Donau auf. Ich würde dort gern einmal übernachten, habe aber Angst, dass das Wasser über Nacht steigen und mich wegspülen könnte. Oder ist die Donau so perfekt reguliert, dass es nur noch in Ausnahmefällen Hochwasser gibt? Haben die Begradigungen und künstlichen Flussbetten die Gewalten der Natur komplett im Griff? Durch die vielen Schleusen und Wehre müsste sich der Wasserstand der Donau millimetergenau pegeln lassen. Doch ganz im Griff werden wir Menschen die Natur nie haben – zum Glück.
Noch vermisse ich unsere Zivilisation nicht. Mein Zelt reicht mir als Schlafstätte. Geschirr, ein festes Dach, Wasserklosetts oder elektrischen Strom brauche ich nicht. Die Nächte sind so kurz, dass ich auch kein Licht benötige. Bis 10 Uhr abends ist es so hell, dass ich draußen noch lesen könnte – was wegen der Mücken nicht geht. Doch in meinem Zelt habe ich Ruhe vor den Biestern und eine Gemütlichkeit, die es in keinem Haus geben kann. Zum Glück gibt es beleuchtete E-Reader, sodass ich ein 80 Gramm schweres Gerät mit hunderten von Büchern dabeihabe.
Viele Freunde haben mir gesagt, dass sie mich um meine Tour beneiden. Ich weiß, dass sie die Nähe zur Natur meinen. Den Ausstieg aus dem Arbeitsalltag und die Freiheit. Was sie nicht bedenken sind die Strapazen, die nassen Klamotten, die Ungewissheit. Die Einsamkeit, die kalten Nächte.
Das Leben der anderen sieht immer leichter aus als das eigene.
Ich bin ständig hellwach. Ich weiß nie, was hinter einer Kurve lauert, wie ich das nächste Wehr überwinde, wo ich schlafe, wo ich Nahrung kaufen kann, was das Wetter bringt. Jeder Flussmeter zwingt mich in die Gegenwart. Meine Gedanken schweifen fast nie ab. Ich bin ständig präsent und nie entspannt. Das ist der große Unterschied zur Komfortzone, in der sich jeder auskennt, in der man keinen Eventualitäten begegnet. Der Gegensatz zu der Welt, in der alles durchgeplant ist.
Das Problem ist nur, dass wir unsere Komfortzone auf räuberische Weise ausgebaut haben. Wir fahren riesige Autos, leben in überteuerten Angeberwohnungen, besitzen Kühlschränke groß wie Kleiderschränke und kaufen mehr Kleidung im Jahr als Menschen vor hundert Jahren in ihrem ganzen Leben. Wir verschicken täglich mehr Nachrichten als unsere Ahnen in drei Generationen. Wir leben freiwillig in einem riesigen Menschen-Zoo, weil es uns in der freien Wildbahn zu gefährlich geworden ist. Und wenn jemand mal für zwei Monate den Zoo verlässt, bekommt er von seiner Familie Mails voller Sorge, von seinen Kollegen ein Kopfschütteln und von den meisten Menschen die Ferndiagnose »verrückt«. Wir sind schon so lange Käfiginsassen, dass unsere Spezies völlig vergessen hat, dass sich das wahre Leben außerhalb des Käfigs abspielt.
Gestern fragten mich Fußgänger am Ufer, wo ich denn hinwolle mit so viel Gepäck. Als ich sagte »Ins Schwarze Meer« schlug die Frau die Hände vor dem Mund zusammen, als hätte ich ihr gerade glaubhaft den Weltuntergang prognostiziert.
Häufig winke ich Anglern oder Spaziergängern zu. Nur die wenigsten winken zurück. Meist schauen sie schnell zur Seite, als würden sie auf keinen Fall Kontakt zu dem Humanoiden auf seinem neuartigen Sportgerät haben wollen. Alles Neue macht Angst. Alles Fremde erst recht. Die Menschen hier sind nicht fremdenfeindlich. Sie sind fremdenängstlich. Die Feindlichkeit ist der nächste Schritt.
Auf einer Umtragestelle steht plötzlich eine Band. Sie spielen Lieder von den Rolling Stones und winken mir zu. Wieder kommt das Forrest-Gump-Gefühl in mir hoch. Meine Eitelkeit ekelt mich an. Aber dieses Mal stimmt es sogar – ein bisschen. The Anythings finden mein Abenteuer so toll, dass sie mir ein Ständchen spielen. Jetzt erinnere ich mich auch, dass mir der Sänger eine Nachricht auf Facebook geschickt hat. Ich hatte ihm gesagt, dass ich nach drei, vier Tagen durch Scheer paddeln würde. Wenn er mich auf dem GPS verfolgt, könnte ein Treffen klappen.
Ich gehe an Land, wippe ein bisschen im Takt mit den Hüften und singe bei »Dead Flowers« von den Rolling Stones laut mit. (Foto 21) Danach umarmen wir uns spontan. Der Sänger ist einer von diesen Typen, die mir sofort vertraut vorkommen. Wie ein alter Freund. Einer, dem ich mich nicht erklären muss. Der meine Lebensart schätzt und vermutlich ebenfalls ein unkonventionelles Leben führt. Auch ein Abenteurer, der sich das Leben ein bisschen schwerer macht, als es sein müsste. Der aber seine Kraft aus den Unwägbarkeiten zieht und erhobenen Hauptes durchs Leben geht.
Die Band hat Zuschauer angelockt. Eine Frau – um die 60, seltsam vertraut tuend, als kennten wir uns schon lang, mit Hund – gratuliert mir zu der hervorragenden Idee, Europa auf dem SUP durchqueren zu wollen. Aber ich solle aufpassen, dass nicht zu viele Ausländer die Donau hochkommen. Genug sei genug.
»Ich habe nichts gegen Ausländer«, sage ich konsterniert.
»Genug ist genug«, sagt sie noch einmal. Ich frage mich, was »genug« bedeuten soll und wovor sie Angst hat. Sind hier zu viele Ausländer gelandet? Gibt es in diesem Nest überhaupt Ausländer? Hat sich die Frau je mit Ausländern unterhalten?
Ein Bandmitglied hat Bier aus einer benachbarten Kneipe geholt – für mich sogar ein alkoholfreies. Wir stoßen an – auf die Freiheit, den Rock ’n’ Roll und auf das Leben.
Die Frau, für die kein Bier mitgebracht wurde, verabschiedet sich und drückt mir »alle Daumen und die Zehen noch dazu«. Wie freimütig sie ihre Angst vor Ausländern äußert, zeigt, dass dieses Thema in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis zum Alltagsgespräch gehört. Ich frage mich, wie weit diese Angst in dieser Region verbreitet ist. Als die Frau gegangen ist, ärgere ich mich, dass ich mich nicht länger mit ihr unterhalten habe. Wie soll ich ihre Ängste verstehen, wenn ich nicht nachhake? Aber in diesem Moment war die Band wichtiger.
Leider sind die Bandmitglieder für später verabredet, sodass ich den Abend allein verbringe. Es ist 20:30 Uhr, und im ganzen Dorf gibt es kein einziges offenes Restaurant mehr. Lediglich ein Dorfgasthof etwas außerhalb hätte noch warme Küche. Ich beschließe, in eine Kneipe zu gehen, Salzstangen zu essen und das Champions-League-Finale zu gucken. Als es 3:1 für Real steht, gehe ich zurück in mein Zelt, stinke entsetzlich nach Rauch, trage eine seltsame Unruhe in mir und stelle nach einer halben Stunde mit Entsetzen fest, dass meine aufblasbare Isomatte jetzt schon, nach 20 Minuten, platt ist. Das Loch muss noch größer geworden sein.
Mitten in der Nacht versuche ich, die Matte mit einem Fahrradflicken zu reparieren. Doch das Loch befindet sich genau am Rand, und meine Flicken wollen dort nicht halten. Auch der Kleber, um mein SUP zu reparieren, haftet nicht vernünftig auf der Matratze. Ich verbringe also die Nacht auf einer platten Matte und wache mit schmerzenden Hüft- und Schulterknochen auf.
TAG 5, ROTTENACKER–ULM
Rottenacker, 48°13‘51.0”N 9°39‘42.9”E /Ulm, 48°23‘17.8”N 9°59‘08.2”E
Im Moment bin ich reicher als die meisten Menschen um mich herum – reicher an Zeit und reicher an täglicher Erfahrung. Während ich mein Leben diesem Reichtum anpasse, schwirren die seltsamen Reaktionen meiner Freunde und meiner Familie durch meinen Kopf. Einige bewundern mich für die Tour, andere beneiden mich. Viele, die länger über mein Abenteuer nachdenken, interpretieren meine zunehmende Freiheit als Kritik an ihrem eigenen Lebensstil. Als würde meine Sicht auf unsere Gesellschaft ihre eigenen Werte in Frage stellen. Bevor sie ernsthaft überlegen, etwas an ihrem Leben zu ändern – zum Beispiel weniger arbeiten, weniger konsumieren, weniger saufen, weniger sorgen, weniger schwarzmalen – stecken sie mich in die Vagabunden-Schublade, zu den Unverantwortlichen und Egoistischen.
Dabei versuche ich niemanden zu bekehren. Ich freue mich über jeden, der nicht aussteigt. Sonst wäre die freie Welt von Vagabunden überlaufen und die Donaustrände so überfüllt wie der Ballermann in den nordrheinwestfälischen Sommerferien.
Meine Reise unterliegt keiner Ideologie. Ich will auch keine sozialen Missstände aufzeigen oder gesellschaftliche Kritik üben. Ich will keine Politik machen oder für etwas kämpfen. Ich will einfach nur meine Freiheit genießen.