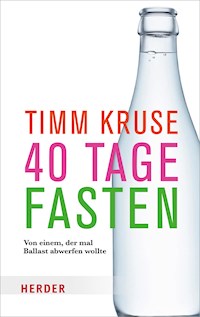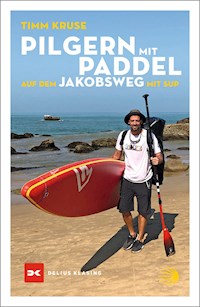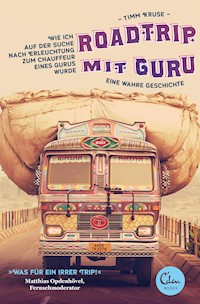
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eden Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mit 38 Jahren trifft Timm Kruse bei einem Festival auf einen indischen Guru und lauscht gebannt seinen Worten. Die Begegnung verändert etwas in ihm – von heute auf morgen lässt er seine Familie und sein altes Leben hinter sich und begibt sich auf die Suche nach Erleuchtung. Ehe er sich versieht, lebt er im Ashram des Gurus in Indien, geht als sein Chauffeur mit ihm auf Weltreise durch Kanada, die USA und Europa. Doch je länger er mit dem Guru unterwegs ist, desto mehr beginnt das Bild des Erleuchteten zu bröckeln. Ist er am Ende etwa auch nur ein ganz normaler Mensch? Authentisch und mit viel Witz erzählt Timm Kruse von seiner spirituellen Reise und gibt einen faszinierenden Einblick in das Leben eines waschechten Gurus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
ROADTRIP MIT GURU
Wie ich auf der Suche nach Erleuchtung zum Chauffeur eines Gurus wurde
Eine wahre Geschichte
TIMM KRUSE
Für G
»You can check out anytime you like, but you can never leave.« – The Eagles
Inhalt
Der Weg
Anfang
Indien I
Intermezzo I
Indien II
Intermezzo II
Schweden I
Spanien
Kanada
USA
Kurze Pause
Korrespondenz
Europa I
Intermezzo III
Schweden II
Europa II
Das Ende
Der letzte Trip
Drei Jahre später
Impressum
Der Weg
In dieser ganzen Geschichte habe ich ein einziges Mal mit dem Guru Fußball gespielt. Für eine Sekunde oder zwei. Auf einem Autobahnrastplatz in Niedersachsen. Während unserer insgesamt Zwölftausendkilometertour quer durch Europa war Fußball die letzte Verbindung zu meinem alten Ich.
Der Ball flog zwischen zwei Wohnmobilen und einem Multivan hin und her. Drei weiß gekleidete Jünger versuchten, den Ball so lange wie möglich in der Luft zu halten und von einem zum nächsten zu passen.
Einer der drei Jünger war ich.
Plötzlich stand der Guru zwischen uns. Sofort passte einer von uns so gefühlvoll wie möglich zum Meister. Es war in diesem Moment die größte Ehre, das Leder mit ihm zu teilen. Der Gebenedeite berührte zum ersten Mal in seinem Leben einen Fußball. Da ihm keinerlei Grenzen gesetzt waren, setzte er zu einem gewaltigen Schuss an – als schlüge er einen Fünfzigmeterpass in Richtung Autobahn. Ohne Ballgefühl erwischte er die Pille aus voller Wucht mit dem Knie und seine Sandale flog davon. Der Ball hingegen landete unter der Nase unseres Angebeteten, sein zotteliges Haupt klappte nach hinten und sein Hut segelte auf den Asphalt der Raststätte Damma Berge. Was dann geschah, war nicht zu erklären: Der Gesalbte verharrte in genau dieser Position; sein Fuß in der Luft, sein Hinterkopf auf dem Rücken. Das Standbein angewinkelt. Meliertes Haupthaar und struppiger Bart standen parallel zur Autobahn. Es sah fast so aus, als wäre die Zeit stehen geblieben – wie auf einem Standbild von Monty Pythons Ministry of Silly Walks. Wenn nicht der Ball neben dem Guru langsam ausgetippt und weggerollt wäre.
So viel Gewalt hatte dieser holde Mensch während seiner 39 heiligen Jahre in dieser Reinkarnation nie erfahren. Was in diesem unwiderruflichen Moment geschah, durfte nicht geschehen. Ein von Gott Gesandter wird nicht geschlagen. Erst recht nicht mitten ins Gesicht. Vor allem nicht von einem Lederfußball namens Teamgeist. Nach der Zeit, die eine Sandale braucht, um aus zehn, zwölf Metern auf die Bürgersteigkante zu schlagen, fing sich der Guru wieder. Sein Kopf kreiste nach vorne, seine Haare fielen herab. Seine alabasterfarbene Fußsohle traf auf den Boden. Die Knie gerade durchgestreckt. Nur sein Gesicht erschien leicht verändert. Nicht die Nase, die vielleicht ein bisschen gerötet war. Vielmehr der Ausdruck im Allgemeinen. Vergleichbar mit einem Erdhörnchen, dem ein Blitz die Schwanzspitze versengt hatte. Der Guru hob seinen Hut auf und schlüpfte ungelenk in seine Sandale. Benommen stakste er davon. Nach wenigen Metern schaute er sich kurz um. Doch von der Szene war nichts übrig geblieben. Selbst der Ball verharrte außer Sichtweite. Als würde er sich verstecken. Wir standen da wie erstarrt.
Wenige Wochen nach Teamgeists Volltreffer existiere ich als Jünger nicht mehr. Und noch ein wenig später fange ich an, alles aufzuschreiben: Vor meinem inneren Auge tauchen schlafende Elefanten in Schlaglöchern indischer Highways auf; ich sehe mich mit weiß gekleideten Amerikanern einen Hügel hinunterkullern. Ich fauche wie ein Krokodil, um meinem Körper Inner Yoga beizubringen. Ich streichele die schweren Brüste einer jungen Schwedin und habe Heimweh nach Deutschland. Zwischendurch erscheint mir der Leibhaftige. Vielleicht ist es aber auch der Heiland. Wer könnte das unterscheiden?
Ich reise in neun Monaten durch zwölf Länder. Ich gehe zu Fuß, fahre auf Schiffen und mit der Bahn, fliege mit dem Flugzeug und lege Tausende von Kilometern mit dem Auto zurück. Denn ich bin der Chauffeur dieses Gurus.
Dabei sitze ich jetzt wieder in diesem alten Leben. Am gleichen Schreibtisch in der gleichen Wohnung. Ich komme mir vor wie ein umgepflanzter Baum. Zum ersten Mal mag ich Deutschland. Außerdem spielt Gladbach die beste Saison seit den Siebzigern.
Das Klingeln meines Handys reißt mich aus meinem brüchigen Glauben an mein Vaterland. Ich gehe nicht ran. AshramHandy steht auf dem Display. Es sind immer die gleichen scheinheiligen Anrufe von den Lakaien des Gurus. Wie es mir geht und was ich mache.
Ich hätte meine Nummer ändern sollen. Diese Anrufe zerren an meinen feinen Wurzeln. Mein Zustand ist nicht witterungsbeständig. Vor einer Woche bin ich am Morgen nach einem solchen Anruf weinend aufgewacht. Zum ersten Mal kam die Trauer hinter der Wut zum Vorschein. Ich weiß, dass ich Jahre brauchen werde, um diese Geschichte zu verarbeiten.
Vom Guru selbst habe ich nie wieder etwas gehört. Seine letzten Worte an mich waren: »I love you!«
Der Guru saß neben mir auf dem Beifahrersitz. Zwischendurch hatte seine Nase angefangen zu bluten. Das tat sie jetzt nicht mehr. Er hatte seit Teamgeists Volltreffer kein Wort geredet. Die Damma Berge lagen zweihundert Kilometer hinter uns. Wir befanden uns kurz vor Köln, wo Hunderte von Anhängern auf uns warteten.
Ich navigierte uns mit 120 Stundenkilometern durch ein Gewirr von Autobahnen. Zwischen dem Guru und mir hockte seine heimliche Geliebte. Aber davon wusste ich in dem Moment noch nichts. Hinter mir waren Betten und Bänke doppelt und dreifach belegt. Dazu kauerten einige Fans des Heiligen auf dem Boden. Ein Dutzend weiß gekleideter Jünger befand sich in diesem Moment nicht im viel besungenen Hier und Jetzt. Vor unseren geistigen Augen sahen wir immer wieder Teamgeist zuschlagen. Selbst wer nicht dabei gewesen war, sah es jetzt vor sich. Alle hörten das Klatschen des Leders auf die nun faustgroß platt gequetschte Nase des Angehimmelten.
Teamgeist hatten wir in den Damma Bergen zurückgelassen. Ich hatte ihn beim Ausparken noch an einem Gebüsch liegen sehen. Ihn mochte ich.
Wir sprachen kein Wort. Fragen lauerten in unseren Köpfen: Wie konnte das geschehen? Wer hatte den Pass gespielt? Warum passierte einem Heiligen so etwas? Wir drei Fußballer kamen uns vor wie Verfemte. Ich schämte mich besonders, denn ich hatte Teamgeist damals mit in den Ashram gebracht. Aber das wusste niemand.
Mittlerweile krochen wir über die Autobahn. Das Rheinland war verstopft. Im Wohnmobil herrschte eine Stimmung wie bei Fußballfans nach einem verlorenen Finale. Plötzlich hielt eine der engsten Vertrauten des Vollkommenen einen Zettel unter seine malträtierte Nase. Das Papier war gefaltet, wie es früher die Mädchen in der Grundschule machten, wenn sie Ja-Nein-Vielleicht-Briefchen verschickten. Der Guru friemelte das Papier auseinander, als wollte er die Falttechnik studieren. Ich schielte zu ihm herüber. »I like you«, stand in großer, krickeliger Schrift auf dem Briefchen. Nach fünfzig Staumetern sagte ich: »Ich mag dich auch, Guruji«, und steuerte das Wohnmobil besonders sanft in die Fahrbahnmitte. »Ich auch«, hörte ich von hinten. Und noch ein »Ich auch«. Und noch eins. Bis alle durcheinanderriefen. Ein Ich-mag-dich-Guruji-Sturm brach los. Das Wohnmobil jubelte und schaukelte. Der Stau löste sich auf. Wir waren wieder glücklich.
Bis der Guru ganz langsam den Kopf drehte. Er blickte jedem von uns nacheinander ins Gesicht. »No«, sagte er ernst. »Ihr mögt nicht mich. Ihr mögt nur euch selbst. Und ihr wollt, dass ich euch mag, dass ich euer Ego mag. Das ist alles. Seid ehrlich. Seid authentisch. Seid glücklich.«
Wir mussten tanken. Der Autohof hieß Zum Truckstop. Wer keine Lederweste trug, fiel auf. Menschen in weißem Baumwollgewand mit Schal erst recht. Da ich mich seit Monaten nicht rasiert hatte, sah ich aus wie einer von ihnen auf heilig getrimmt. Ich bestellte Kaffee. Eigentlich wollte ich einen Latte Macchiato. Aber ich fürchtete, man würde mich nicht verstehen.
Die Trucker glotzten. Ich konzentrierte mich auf meinen Atem, um nicht rot zu werden.
»Äi, Beate, was’n dir passiert?«, rief plötzlich ein Mann mit Ziegenbart neben mir. Eine übel zugerichtete Kollegin hatte missmutig den Laden betreten. »Hab mich geprügelt. Mit so’ner Nuttä!« Die Frau war um die fünfzig. Sie hatte ein violettes Auge und eine Wunde über der Hakennase. Ich musste an die Szene in Kill Bill denken, in der Uma Thurman einem Sarg entsteigt und total verstaubt eine Kneipe betritt. »Scheiße!«, raunzte ein Vollbart mit Zopf. »Egal!«, bellte Beate. »Ich hab ihr dafür voll mit de Stiefels inne Fotze getreten.«
Plötzlich hatte ich eine Erscheinung. Diese Beate leuchtete wie eine Neonreklame für Michelin-Reifen und bewegte sich in Zeitlupe, wie in einem überstrahlten Stummfilm, bei dem sich die Hitze des Projektors langsam durch die Bilder frisst. Die Truckerin kam mir auf einmal wie ein vollkommenes, göttliches Wesen vor. Ich erkannte die gesamte Macht eines unermesslichen Schöpfers in dieser ramponierten Frau. Ich hatte die wichtigste Lehre unseres Gurus in absoluter Vollkommenheit begriffen: Gott macht vor nichts halt.
In diesem Moment wurde mir plötzlich alles klar: Würde ich derbe Frauen mit geschwollenen Augen, Narben und Tätowierungen anhimmeln, wäre Beate mein Guru. Es war eine gesellschaftliche Konvention, dass ich an die Göttlichkeit eines zotteligen Inders glaubte. Nirgends stand geschrieben, wie ein Erleuchteter auszusehen hatte oder wo er herkommen müsste. War der ganze Erleuchtungs-Hokuspokus nur eine Illusion?
Der Guru hätte mir zugestimmt, dass Beate genauso erleuchtet war wie er selbst. Auch hätte er zugegeben, dass sie bestimmt besser Fußball spielen konnte. Wozu also dieses Theater um den Guru, dieses Huldigen, diese Erhöhung? Ich schaute Beate vollkommen selbstverloren, erleuchtet und ein bisschen verliebt an. »Was’n mit dem?«, fragte Beate meinen ziegenbärtigen Nachbarn. »Is’n Heiliger oder so«, antwortete er – nicht ohne Respekt. Ich trank Schluck um Schluck meinen Kaffee aus und sagte beim Hinausgehen: »Danke, Beate. Danke!«
Ich schritt mit möglichst viel Würde über den verregneten Asphalt, als ich den Guru im Tankstellenshop entdeckte. Er stand vor einem Fußball, der an einem Faden von der Decke hing. Der Ball hieß nicht Teamgeist, sondern Bolzmann und trug das Tankstellen-Logo wie ein Tattoo auf seiner Lederhaut. Als der Guru sah, dass ich ihn beobachtete, setzte er ein Lächeln auf und winkte mich zu sich. »Very dangerous is it, those toys?« Ob solche Spielzeuge gefährlich wären, fragte er in seiner eigentümlichen Aussprache und der indischen Grammatik. »Es kommt drauf an, wer sie benutzt«, erwiderte ich. Er schaute mich scheinbar verwundert an. Aber dann wirkte es, als blickte er durch mich hindurch. Oder gar in mich hinein. Obwohl es brütend heiß war, lief ein eiskalter Schauer meinen Rücken hinunter. Der Guru wandte sich ab. Ich blieb verwirrt zurück.
Welche Macht hatte der Guru über Menschen, insbesondere über mich? Wie weit trug mein Glaube an seine übersinnlichen Fähigkeiten zu dem Schauer bei? Was hatte er wirklich drauf? Wenn er Gott war, sollte seine Göttlichkeit gefälligst auf mich abfärben. Davon war nichts zu spüren.
Jahre später muss ich mir – und allen anderen – eingestehen, dass ich den Guru liebte. Ich bewunderte ihn. Und ich hasste ihn. Ich war eifersüchtig und neidisch. Ich gierte nach seiner Erleuchtung. Seine Wollust und Maßlosigkeit machten mich wütend. Sein Hochmut und seine Faulheit widerten mich an. Seine Großzügigkeit ließ mich meinen eigenen Geiz erkennen. Ich projizierte alle extrem menschlichen Gefühle auf ihn. Er bildete den Mittelpunkt meines Lebens. Alles hing nur von ihm ab. Wie schrecklich.
Alle Namen in diesem Buch, die in direkter Verbindung mit dem Ashram stehen, habe ich geändert; denn erstens weiß ich jetzt, wozu der Guru und seine Gefolgschaft fähig sind, zweitens wahre ich damit die Privatsphäre der auftretenden Personen und drittens möchte ich mit diesem Buch niemanden verletzen oder gar bekehren.
Ein paar Belege aus der Zeit mit ihm gibt es – Briefe, E-Mails, Fotos und Filmaufnahmen. Auf einem Foto sehe ich sehr froh aus. Im Hintergrund steht der Guru mit den Händen in den Hüften, den Kopf zur Seite geneigt. Er schaut kokett in die Kamera, als wollte er sagen: »Seht, wie glücklich ich alle mache!«
Bis zum heutigen Tag glauben Jünger auf fünf Kontinenten an die übersinnlichen und gottgleichen Fähigkeiten dieses Mannes. Sie haben ihm Millionen von Euros, Rupien, Kronen und Dollars gegeben und sind fest davon überzeugt, dass dieser holdselige Zausel die Welt retten kann.
Anfang
Lange bevor Ashrams und Gurus in meinem Kopf herumspukten, war ich ein kleiner Junge mit einem großen Traum: Ich wollte Fußballprofi werden. Ich spielte jeden Tag, teilweise stundenlang. Der Dorfbolzplatz des VfL Hiddesen im Landstrich mit dem widersprüchlichen Namen Ostwestfalen lag einen Kilometer von meinem Elternhaus entfernt. Wenn ich dort niemanden antraf, radelte ich zurück auf unseren Bauernhof und kickte bis zum Sonnenuntergang mit mir selbst. Unser Scheunentor hatte ich zum Fußballtor umfunktioniert. Ich zirkelte den Ball aus allen Winkeln in den Kasten, den ich mit bunter Kreide auf die riesige Holzwand gemalt hatte. Ich war Karl-Heinz Rummenigge, Klaus Fischer und der Kaiser in einer Person. Ich sah aus wie Gladbachs Torwart Wolfgang Kleff mit Locken, kannte jedes Ergebnis der laufenden Saison, die WM-Paarungen aller Zeiten und ich wusste genau: Irgendwann würde jemand kommen, der mich entdeckte. Einer der großen, dicken Bundesligamanager würde sich zufällig auf unseren Hof verlieren. Mit einem fetten, weißen, aufgemotzten Mercedes-Benz S-Klasse, beigefarbenem Streifenanzug und prunkvollem Goldkettchen. Er würde in unserer Hofeinfahrt stehen und sofort erkennen, dass ich das größte Talent seit Uwe Seeler war. Der Talenthändler würde meinem Vater eine Million Mark anbieten. Doch mein Papa würde sagen: »Nee, nee, mein Freund. Für diesen Jungen musst du fünf Millionen hinblättern.«
Der große Manager ließ sich mein ganzes Leben lang nicht blicken. Weder auf unserem Bauernhof noch in der Schule. Nicht im Studium oder im Urlaub. Weder in meiner Freizeit noch bei der Arbeit. Selbst als ich durch Glück Redakteur beim Fernsehen wurde und Filme über Vulkane, Klofrauen und Fußballstars produzierte, kam er nicht. Ich hatte ein Leben lang auf meinen Manager gewartet. Auf einen Typen, der mein Leben in die Hand nehmen und mir sagen würde, was zu tun sei. Der genau wüsste, wie ich wann, wo und warum zu sein hätte.
Und dann, ganz plötzlich, stand dieser Manager vor mir. Bei einem Festival. Auf einer Treppe in einem kargen Messebau in Blaufingen. Er trug weiße Gewänder, hatte lange, lockig-strähnige Haare, einen buschigen Vollbart und dunkle Haut. Er war so etwas wie ein Bundesligamanager für Indienfans und Nationaltrainer aller Erleuchteten. Um ihn herum standen vier ebenfalls weiß gewandete weibliche Heiligkeiten, alle um die dreißig, teilweise hübsch. Ich starrte sie mit offenem Mund an. Bis mich sein Blick traf. Seine Augen waren dunkel wie die Unendlichkeit. Seine Pupillen bohrten sich direkt in meine Seele. Der Guru lehnte mit überkreuzten Beinen an einem Treppengeländer und lächelte entspannt in diese Horde der Suchenden. Dabei nickte er langsam, fast wie in Zeitlupe, mit dem Kopf. Schaute er sich die Verwirrung der Menschheit an? Versuchte er zu retten, was zu retten war? Plötzlich wurde mir klar, dass ich auch gerettet werden wollte. Dass ich endlich nicht mehr auf ein Scheunentor schießen, sondern Kapitän in der Champions League der Erleuchteten sein wollte.
Das Sunrise Festival in Blaufingen war spirituelle Messe, Musikfestival und Meditationsorgie in einem. Ich war wegen der Musik von Krishna Das und Deva Premal gekommen, zwei westlichen Weltstars indischer Folk-Musik. Dass dies der Beginn meines drastischsten Lebenseinschnitts sein sollte, ahnte ich nicht. Denn dies war nicht meine Welt. Noch nicht.
Bevor ich den Guru traf, bummelte ich unschuldig über das Gelände und wehrte Leute ab, die mir Engelsfiguren, Edelstahlpyramiden und Aura-Lesungen andrehen wollten. Diese Leute mit Bimmelkettchen an den Füßen und Blumen im Haar sprachen von Energien, genossen ihren Atem und hörten nicht auf, sich zu umarmen. Waren sie wirklich so glücklich, wie sie aussahen?
Hier kannte mich niemand. Ich konnte sein, wie ich wirklich war oder wie ich gern sein wollte, ohne Scham. Ich besuchte so viele Workshops wie möglich – spielte schiefe Melodien auf einer Tonflöte, klopfte meinen Körper systematisch ab, um meine Chakren zu öffnen, übte mich in Hechelatmung, um an mein innerstes Ich zu gelangen. Schaden konnte das alles nicht, oder? Bis plötzlich eine alte Schulfreundin vor mir stand. Hatte sie gesehen, wie ich gestern im Hopserlauf an einer Lachmeditation im Park teilgenommen hatte? Auch sie war in Blumenstoffe gewandet und lächelte beseelt. »Du hier? Wusste gar nicht, dass du was mit Spiritualität am Hut hast.«
»Ich auch nicht!«
Sie wirkte natürlicher als früher. Tat diese spirituelle Welt den Leuten doch gut? Vielleicht wäre aus uns damals etwas geworden, wenn ihre Mutter etwas lockerer gewesen wäre. Sie hatte ihrer Tochter den Umgang mit mir verboten, weil ich in meiner Heimatstadt den zweifelhaften Ruf eines angeblichen Grasdealers und fanatischen Fußballers besaß.
»Kommst du nachher mit in den Park? Da hält Sri What einen Satsang.«
»Sri What?«
»Ja. Der Guru. Kennst du ihn nicht? Er ist der Obama der Spirituellen. Du musst ihn kennenlernen! Halb vier im Park.«
»Und was hält der da?«
»Einen Satsang. So was wie’n Vortrag.«
»Okay«, sagte ich, ohne zu wissen, was mich erwartete. »Ich bin dabei.« Sie lächelte und lief weiter.
Unter einer gewaltigen Magnolie saß Sri What in der Mitte des Parks auf einer Art Thron. Goldene Tücher umhüllten ihn. Seine schwarzen Augen waren hellwach und schienen jede einzelne Bewegung wahrzunehmen. Ich war erneut fasziniert von ihm. Um ihn herum scharwenzelten eifrige Anbeter und bereiteten alles für seinen Auftritt vor. Sie verlegten Kabel, schlossen Boxen an und stimmten Gitarren.
Eine seiner Helferinnen beugte sich zum Guru herab. Ihr Gewand war weit geschnitten und ich saß günstig. Sie übte eine fast ebenso starke Anziehung auf mich aus wie der Guru. Allerdings war ihre Anziehungskraft weniger spiritueller Natur. Als sie sich vom Guru abwandte, trafen sich plötzlich unsere Blicke. Mich durchfuhr es wie ein Blitz. Manchmal kann ein einziger Blick zwischen Mann und Frau eine verlangende Unruhe auslösen. Für nicht einmal eine Sekunde schauten wir uns in die Augen. Ich ahnte nicht, was diese Sekunde für Konsequenzen haben würde.
Dann ging sie davon. Ihr Kopf war gesenkt.
Ich hockte 15 Meter vom Guru entfernt neben einem Fliederbusch. Von der Klassenkameradin war nichts zu sehen. Langsam füllte sich die Wiese vor dem Guru. Viele hielten die Hände vor dem Gesicht gefaltet und verneigten sich. Der Meister grüßte freundlich zurück. Eine große, blonde, weiß gekleidete Frau beugte sich zu ihm herab, empfing eine Anweisung und eilte heilig davon.
Der Guru war ungefähr einen Meter achtzig groß. Seine Wangenknochen standen unter dem Bart hervor. Sein Gesicht wirkte apart, fast nobel. Als wäre er einem Hollywoodfilm mit edlen Recken entstiegen. Mit gestutztem Bart und weniger zotteligen Haaren wäre er ein extrem attraktiver Mann gewesen. Vielleicht versteckte er sein gutes Aussehen hinter der haarigen Fassade, um nicht darauf reduziert zu werden.
Die Atmosphäre im Park war äußerst friedlich. Mindestens zweihundert schweigende Menschen hockten vor dem Guru. Mir kam niemand aufgesetzt devot vor. Alle schienen fokussiert aufmerksam. Wahrscheinlich wollte jeder seine Energie einsaugen. Genau wie ich.
Der Guru schloss die Augen. Er wirkte jetzt noch bescheidener. Leise Gitarrenklänge ertönten, steigerten sich und bildeten einen ruhigen Rhythmus. Jemand fing an zu singen. Ganz klar und wunderschön. Es war eine Stimme wie aus Licht: Jaya Rama, Jaya Jaya Rama klang es durch den Park. All meine Skepsis und Zweifel waren verflogen. Ich schloss die Augen. Fast alle sangen mit. Ich bekam das gleiche Gänsehautgefühl wie im Stadion, wenn die Mannschaften einlaufen und Tausende Kehlen Die Elf vom Niederrhein singen.
Ohne es zu merken, sang ich mit: »Jaya Rama, Jaya Jaya Rama.« Es klang fast wie »Mönchengladbach, Mönchen, Mönchen-Gladbach«. Fremde Silben flossen aus meinem Körper, verbanden sich mit den Klängen der Gitarre und den Gesängen. Ich stand auf, ohne es zu wollen, klatschte im Takt in die Hände und hüpfte im Kreis. Ich war plötzlich kein Fußballfan mehr, sondern ein Spiritueller. Da alle um mich herum ebenfalls klatschten und hüpften, fiel ich nicht auf. Selbst der Guru gebärdete sich, als hätte sein Lieblingsverein gerade das Derby gewonnen. Er wirbelte bei achtzig Umdrehungen pro Minute mit ausgestreckten Armen im Kreis, während sich seine Füße bedenklich in den staubtrockenen Grund bohrten. Schließlich landete er erschöpft mit herabhängenden Armen auf seinem Thron.
Atemlos hockte auch ich mich hin. Nach einer Viertelstunde öffnete der Guru die Augen. Ich sah zum ersten Mal, dass Schwarz funkeln kann. Er schaute in die Runde. »How are you?« Profaner hätten die ersten Worte nicht sein können. Doch selbst wenn der Guru gefragt hätte: »Seid ihr auch alle da?«, hätte ich weitergelächelt. Ich hatte das deutliche Gefühl, zur richtigen Zeit mit den richtigen Menschen am richtigen Ort zu sein. Ich fühlte mich wie nach einem gewonnenen Elfmeterschießen. Am liebsten wäre ich aufgesprungen und hätte laut gejubelt und gegrölt: »Jaaaa. Mir geht’s saugut!«
»Möchte jemand eine Frage stellen?« Der Guru lächelte breit und einladend. Blitzweiße Zähne kamen unter Barthaaren zum Vorschein. Die Brauen des Meisters nahmen die Form eines Zirkumflex an. Langsam wurde das Schweigen peinlich. Aber nur für einen kurzen Moment. Dann meldete sich ein etwa dreißigjähriger Mann mit langen, fettigen, blonden Haaren: »Wie erlange ich Erleuchtung?« Der Guru lachte und erklärte: »Du kannst Erleuchtung gar nicht erlangen, da alle Wesen bereits erleuchtet sind. Es ist, als ob sich ein Vogel, der gerade auf dem Boden sitzt, wünscht, dass er fliegen könne. Erleuchtet sein zu wollen ist Unsinn.«
So einfach war das? Der Mann gefiel mir. Alles war erleuchtet!
»Aber was ist dann überhaupt Erleuchtung?«, fragte der blonde Mann weiter. »Möchtest du wirklich Erleuchtung, oder möchtest du ein Guru sein?«, antwortete der Guru. Um mich herum lachten fast alle. Ich wusste nicht, worüber. Guru wäre ich auch gern gewesen, mit oder ohne Erleuchtung. »Nach Erleuchtung kannst du nicht suchen. Sie passiert einfach. Ohne dein Zutun. Vergiss alles, was du über Erleuchtung zu wissen glaubst. Sonst erfährst du nur deine Vorstellung von Erleuchtung. Nicht aber Erleuchtung selbst.«
Alle hörten schweigend zu. Einigen stand der Mund offen. Irgendwie hatte es der Guru geschafft, uns alle mit wenigen Sätzen vollkommen in seinen Bann zu ziehen. Er schien das zu haben, wonach hier alle suchten: Einigkeit mit allem.
»Lasst uns annehmen, dass es so etwas wie Gott gibt. Einverstanden?« Alle nickten. »Nennen wir Gott lieber Existenz. Existenz ist alles, was ist. Wenn du also gern erleuchtet wärst, sträubst du dich gegen Existenz. Gegen das Leben. Gegen Gott. Wenn du also gern ein Guru wärst, dann willst du etwas anderes sein, als du schon bist.« Mir erschien diese Argumentation logisch. Doch war ich damals weit davon entfernt, sie zu verstehen.
»Erleuchtung ist nichts Exotisches. Sie ist ganz normal. Ganz natürlich. Sie wird dir auch nicht durch die Kraft eines Gurus verliehen. Vergiss es!« Dabei lachte er und machte eine wegwerfende Bewegung mit der Hand.
»Erleuchtung ist nicht von deinem Guru abhängig. Es gibt Gurus, die wollen angebetet werden. Sie sind egoman. Eine erleuchtete Person kennt keine Form. Sie ist hohl wie ein Bambusrohr, durch das der Wind bläst und einen Ton erzeugt.« Der Guru blickte sich um. Seine Augen funkelten wieder. Dann spitzte er die Lippen, formte die Zunge zu einer offenen Röhre und gab einen langen, dunklen, pfeifenden Ton von sich. Ich wusste nicht, ob ich lachen sollte.
»Dieser eine Ton reicht dir aber nicht. Du willst eine Bambusflöte sein. Gott soll dich bespielen und Melodien erzeugen, von denen die Beatles nur träumen könnten. Stimmt’s?« Um mich herum brummten einige zustimmend.
»Was willst du wirklich? Möchtest du ein anderes Leben leben? In einer anderen Welt? Zu einer anderen Zeit? Eine Superflöte sein? Das geht aber nicht! Das Leben geschieht nur jetzt. Es geschieht genau so, wie es jetzt geschieht. Nicht anders. Es hat keine Vergangenheit, keine Zukunft und keine Absicht. Es ist formlos. Gurulos. Schmeiß alle Vorstellungen von Erleuchtung weg, bis die Sehnsucht nach Erleuchtung verschwindet. Erst dann wirst du erkennen, dass du bereits erleuchtet bist.«
Der Guru schloss die Augen. Die letzten Sätze waren so schwer, dass meine Lider wie durch eine fremde Macht zufielen. In mir breitete sich ein langes, tiefes Schweigen aus. Ich war glücklich. Vollkommen glücklich. Ich wollte nichts anderes sein, als ich war. An keinem anderen Ort. Zu keiner anderen Zeit. War ich erleuchtet?
Es folgten noch Dutzende Fragen nach Heiligen, Gelassenheit und Wanderwegen, nach Tsunamis, Lottozahlen, Heuschrecken und Ernteerträgen, nach Nelken, dem Hermannsdenkmal und Revolutionen. Der Guru wusste in seiner offensichtlichen Gottverbundenheit auf alles eine passende Antwort. Doch ich hörte nicht mehr richtig zu, so glücklich war ich. Dieser Mensch sprach direkt zu meiner Seele: Wir waren bereits alle erleuchtet. Ich wollte sofort alles hinschmeißen, mir ein ruhiges Plätzchen suchen und befreit von Arbeit, Leistung und Druck leben. Ich blickte mich um. Jeder hatte ein sanftes, wissendes, zufriedenes Lächeln auf dem Gesicht. Ein Leuchten breitete sich aus, als hätte es Heiligkeit geregnet. Nach einer Stunde erhob sich der Guru, öffnete seine Arme und lud alle ein, aus ihm zu trinken. Seine Ergebenen sangen im Hintergrund: »Komm, komm, trink aus mir, komm, komm, natürliche Schönheit.« Wenn Wolken am Himmel gestanden hätten, wären sie aufgerissen und ein Lichtstrahl hätte die Szenerie in Gold getaucht.
Es bildete sich eine Schlange aus etwa fünfzig Menschen, die alle im Energiefeld des Heiligen baden und von seiner Göttlichkeit nippen wollten. Ich war berauscht, schloss mich an und stand irgendwann vor den ausgestreckten Armen des Gurus. Er zog mich zu sich. Ich ließ es geschehen. Er roch fremd, aber angenehm, nach Öl aus Zedern oder so etwas. Ich atmete laut aus, schmiegte mich an seine Schulter. Er drückte gezielt auf einige Punkte an meinem Rücken. Sein linker Daumen lag auf meinem dritten Auge. Plötzlich brach es aus mir heraus – nein: Mein Herz brach auf. Schleusen öffneten sich und ich fing an zu heulen wie ein kleines Kind. Es schüttelte mich. Ich vergaß alle Scham und bekam einen regelrechten Heulkrampf. Ich war angekommen. Wo, wusste ich nicht. Bei wem, interessierte mich nicht. Mit dem Bundesligamanager hatte das nichts mehr zu tun. Es war alles viel, viel größer.
Der Guru nahm mich sanft bei den Schultern, blickte mir tief in die Augen und sagte: »Come, come!« In dem Moment wusste ich, dass ich alles aufgeben musste und zu ihm gehen würde. Ein gellender Schmerzensschrei entwich meiner Kehle. Ich sank auf die Knie und umklammerte den Heiligen. Meine Tränen tropften auf seinen Lunghi. Meine Hände krallten sich in den Stoff. Meine Stirn sank auf seine Tennissocken, die nicht nach Boris Becker rochen. Schließlich kroch ich auf allen vieren davon, zurück zu meinem Fliederbusch. Ich merkte, dass Menschen mich anstarrten. Es war mir egal. Nichts war mehr wichtig. Ich weinte hemmungslos ins Gras. Plötzlich kam der Gedanke auf, dass die alte Schulfreundin mich so sehen könnte. Ich fuhr hoch und blickte mich um. Es standen noch immer Leute an, um den Gottgleichen zu umarmen. Einige guckten verstohlen zu mir herüber. Die Bekannte sah ich zum Glück nicht.
Erleichtert wischte ich mir Tränen und Grashalme aus dem Gesicht. Plötzlich bekam ich einen Lachanfall. Eine Mischung aus Blöken und Wiehern dröhnte aus mir heraus. Es hallte über die gesamte Wiese. Ich warf mich bäuchlings auf den Boden, jauchzte, grölte und gackerte über mich selbst. Ich hämmerte mit den Fäusten Grashalme platt. Ich nahm dunkel wahr, dass andere ebenfalls anfingen zu lachen. Ich konnte mein Geheule von vorhin nicht begreifen; ich feixte und brüllte über meine Angst, von dieser Schulfreundin beobachtet zu werden. Wie lächerlich! Es interessierte niemanden, ob ich heulte oder lachte, ob ich gut oder schlecht dastand. Es war nicht einmal wichtig, ob ich existierte.
Als ich mich wieder beruhigt hatte, entdeckte ich den Verkaufsstand von Sri What. Gierig saugte ich alle Informationen auf. Hochglanzbroschüren, hübsche Flyer und sogar ein kleiner Prospekt; alles professionell. Die gehetzte blonde Frau von vorhin erzählte mir mit Schweizer Dialekt, dass jeder im Ashram willkommen sei. Sie würden per Wohnmobil durch Europa touren. Spätestens ab November seien sie dann wieder an ihrem Hauptsitz in Indien. Während ich mit ihr sprach, kamen mir wieder Tränen. Ich wehrte mich nicht dagegen, sondern stammelte: »Der Guru kann meine Gedanken lesen. Er hat ›Come, come‹ zu mir gesagt. Heißt das: ›Komm in meinen Ashram? Trau dich? Sei frei?‹« Sie blickte mich ruhig an. »Erlaube dir, dein Leben zu leben. Das heißt ›Come come‹.« Ich nickte und wusste, dass in dem »Come, come« auch »Bye-bye« steckte. Gehe zu ihm, verlasse alles, was du dir aufgebaut hast, lege dein altes Leben ab.
Dass er zu jedem Menschen »Come, come« sagte, war mir vor Ergriffenheit damals entgangen. So wie sich Angler »Petri Heil« wünschen, sagen Sri Whatler »Come, come« zueinander.
Als ich nach insgesamt fünf Tagen spirituellen Vollrauschs wieder zu Hause ankam, besuchte ich die Homepage von Sri What im Internet. Über Weihnachten und Silvester würde er in Andhra Pradesh, einem Staat im Südosten Indiens, ein Erleuchtungsseminar geben. Die Versprechungen der Homepage waren zu verlockend: »Entledige dich innerhalb von zehn Tagen deiner alten Persönlichkeitsstrukturen und durchlaufe eine Transformation zur inneren Befreiung.« 650 Euro plus Kost und Logis. Ich hätte gedacht, dass Erleuchtung teurer wäre, und buchte.
Draußen läuteten Glocken. Drei Kirchen bimmelten um die Wette, um Sünder anzulocken. Es war Sonntagvormittag in Kiel. Ich saß im Bett und blickte aus dem Fenster. Ich wünschte mir, im Himmel stünde in Neonschrift, was ich tun sollte. Vielleicht hätte ich in die Kirche gehen und Gott um Rat fragen sollen. Aber Gott war mir noch nie ein guter Ratgeber gewesen. Mein Blick wanderte langsam zur anderen Betthälfte. »Gabi?« Seit drei Jahren lebten wir zusammen. »Ich werde eine Auszeit nehmen.« Sie blickte mich durchdringend und fragend an. Obwohl sie gerade erst aufgewacht war, sah sie hellwach aus. »Wovon?«
»Von hier.«
Sie schwieg. Seit Blaufingen hatte ich mich innerlich zurückgezogen. Gabi hatte seit Tagen keine Chance mehr gehabt, an mich heranzukommen. »Ich muss mal wieder losziehen.« Ich erzählte ihr vom Guru und meiner Idee, für zwei Monate nach Indien zu gehen und diesen Meister ein bisschen besser kennenzulernen.
»Und der NDR?«
»Der NDR kommt auch gut ohne mich klar. Zwei Monate kriege ich durch.« Wir arbeiteten beide beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Gabi als Nachrichtensprecherin, ich als Filmemacher. Dort hatten wir uns kennengelernt. Ich hatte sie von der ersten Sekunde an geliebt. Doch es hatte über ein Jahr gedauert, bis ich mich traute, mit ihr auszugehen. Die Angst, dass meine Liebe nicht erwidert werden könnte, war zu unerträglich gewesen. Nach einem weiteren halben Jahr hatten wir uns zum ersten Mal geküsst. Noch ein halbes Jahr später hatten wir endlich unsere Ängste überwunden und waren zusammengekommen. Seitdem waren wir glücklich und hatten beide das Gefühl, den Partner fürs Leben gefunden zu haben. Und jetzt setzte ich alles aufs Spiel. »Für einen Guru?« Gabi hatte Tränen in den Augen.
»Nein, für eine neue Möglichkeit, unser Leben zu leben.«
»Ich brauche keine neue Möglichkeit für mein Leben.«
Ich fing an, aufzuzählen, was uns an der Stadt, dem Job, den Freunden und Bekannten nicht gefiel. Wie oft wir überlegt hätten, uns von allem zu befreien.
»Aber doch nicht, um bei einem Guru zu leben.«
In diesem Moment kam Lilly, Gabis Tochter, ins Schlafzimmer. Sie war neun. »Was ist ein Uhu?«
»So was wie Jesus«, antwortete ich. »Oder jemand, der mal so werden könnte wie Jesus.« Lilly legte sich zwischen uns. »Ihr müsst Weihnachten und Silvester ohne mich feiern.« Wir schwiegen.
Erst ein Weihnachten hatten wir gemeinsam gefeiert. Damals waren wir zu meinen Eltern nach Detmold gefahren. Sie hatten sich gefreut, dass ich endlich eine ernsthafte Beziehung führte. Gabi hatten sie von Anfang an gemocht. Sie strahlte die Bodenständigkeit aus, die mir in den Augen meiner Eltern immer gefehlt hatte. Gabi war die Erde und ich die Luft. Gemeinsam waren wir ein ziemlich gutes Paar.
Ich tröstete Gabi mit der Aussicht, sie im Februar in Thailand zu treffen. Außerdem hatte sie mir wenige Tage zuvor gestanden, eine Pause von mir gebrauchen zu können. Ob ich nicht mal wieder allein Urlaub machen wollte. Ich hatte nämlich gerade vierzig Tage lang gefastet. Es hatte sich dabei um einen weiteren ambitionierten Versuch gehandelt, Erleuchtung zu erlangen. Eine harte Probe für unsere Beziehung. Gabi fühlte sich von Extremen überstrapaziert und sehnte sich nach Normalität. »Wieso genießen wir unser Glück nicht einfach? Wieso musst du immer wieder Ausnahmesituationen schaffen? Wir führen eine Stressbeziehung.«
Gabi war leider schon erleuchtet. Deshalb erzählte ich ihr nicht viel von Blaufingen und meinen Gedanken, mit diesem Guru um die Welt zu ziehen. Wahrscheinlich wusste ich selbst nicht, wie weit ich gehen würde.
Gabi ist bis heute absolut bodenständig. Den größten Gefallen tue ich ihr mit jeder Zeile, die ich nicht über sie schreibe.
Indien I
Ende November in Deutschland. Draußen herrschten minus zwei Grad. Noch konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich mich mal nach der Kälte und Gemütlichkeit eines deutschen Winters zurücksehnen würde.
Kurz vor dem Abflug nach Indien war ich beim Klettern im Wald von einem Baum gefallen und schwer umgeknickt. Mein Knöchel war blau und melonenartig angeschwollen. Im Moment des Sturzes war mir ein Gedanke durch den Kopf geschossen: »Jetzt muss ich wenigstens nicht nach Indien.« Mein Unterbewusstsein hatte alles erkannt. Nur mein Ego war zu stur und wollte unbedingt zu diesem Guru und seiner Gefolgschaft.
Acht Stunden Flug; der Fuß pochte entsetzlich. Als ich in Mumbai landete, erschlug mich die Hitze des Treibhauses Indien. Ich prallte gegen eine Wand von 38 Grad Celsius. Sofort kamen alte Erinnerungen an meine früheren Besuche in dieser Stadt hoch. Die Slums, die Schlaglöcher, die Bettler und die Ratten. Mir grauste vor dem Moloch. Bis ich im Taxi saß und das Fenster öffnete und wieder diesen eigenartigen Geruch wahrnahm. Wenn Lebendigkeit einen Geruch hat, dann hat er sich in Mumbai manifestiert.
Ich schlief wie immer im Stadtteil Colaba in einer billigen Herberge direkt neben dem stinkenden Hafenbecken. Hier kostete das Zimmer hundert Rupien die Nacht – umgerechnet ein Euro fünfzig. Ich hinkte zu bekannten Cafés und Kneipen. Doch was war mein geschwollener Fuß im Vergleich zum Elend dieser Stadt? Ich schämte mich für das Geld in meinen Taschen.
Zum fünften Mal befand ich mich in diesem Land. Wie jedes Mal fragte ich mich anfangs, was zum Teufel ich hier machte. Es dauerte immer Tage, bis mich das Land gepackt hatte. Es kam mir vor, als wäre ich noch gar nicht richtig gelandet.
Jemand hatte mir einmal erzählte, dass die Seele nicht so schnell reisen könne wie ein Flugzeug. Sie bräuchte immer eine gewisse Zeit, um den Körper einzuholen. Ich lief also seelenlos durch dieses rote, riesige Land. Die Inder nennen es Mutter. Wenn die Menschen nicht ständig lächeln würden, wäre das Leid unerträglich. Sie geben sich nicht ihrem Schicksal hin, sondern tragen es mit Würde. Ich blieb stehen und betrachtete diese seltsame Welt. Inmitten von Dreck- und Schuttbergen kämmte eine Frau ihre pechschwarzen langen Haare. Sie war wunderschön. Sie verkörperte Indiens Armut und Anmut. Währenddessen zerrten Kinder an meinen Kleidern. Hunde bellten mich an. Schweiß lief mir in die Augen. Ich war auf entrückte Weise glücklich.
Ich nahm den Nachtzug nach Goa. Ich saß stundenlang in der offenen Waggontür, meine Beine baumelten knapp über Eisen und Schwellen. Zeit und Raum klapperten rhythmisch unter mir entlang. Mein Rucksack hing angekettet im Gang. Sitzplätze gab es nur noch auf dem Boden oder dem Dach. Kurz nach Mitternacht erschien das Kreuz des Südens am Himmel. Langsam fühlte ich mich wieder heimisch in diesem Land, das mich immer vor ein Rätsel gestellt und mich deshalb wohl wieder hergelockt hatte. Als ich am Türrahmen angelehnt aufwachte, dämmerte es bereits.
Auf einem abgelegenen Strand im Süden Goas, des kleinsten Staats Indiens, lebte seit Jahrzehnten ein Yogi. Ich hatte ihn vor Jahren entdeckt, als ich nach Einsamkeit gesucht hatte. Ich hatte die saufenden Engländer und kiffenden Israelis, die unter Palmenlametta bei Rockmusik Steine nach Hunden warfen, nicht länger ertragen können. Der Yogi war zwischen sechzig und hundert Jahre alt. Es war unmöglich, sein genaues Alter zu schätzen. Yogis altern anders als andere. Sie ernähren sich bewusster, meditieren ständig und machen abstruse Dehnübungen. Außerdem reden sie kein Wort zu viel. Dieser Yogi besaß einen niederländischen Pass, war in Surinam aufgewachsen und hatte sein halbes Leben in buddhistischen Klöstern verbracht.
Bei Ebbe gelangte ich durch eine Furt zum Strand des Yogis. Er lebte hinter einer schmalen Felsspalte auf einem Plateau im Urwald mit Blick auf den Ozean, der bei Flut keine zwanzig Meter von seinem Lager entfernt war. Außer einer Feuerstelle, ein paar Büchern und einem Moskitonetz besaß er nichts. Noch nicht einmal Kleidung; er trug nur ein kleines Tuch um die Lenden, das mit einer Schnur über den Hüftknochen zusammengebunden war. Er hieß Go und lächelte wenig. »Wozu auch?«, erklärte er mir. »Die meisten Menschen lächeln, damit andere zurücklächeln. Nur dann sind sie sicher, dass sie gemocht werden. Mich muss man nicht mögen.« Dann lächelte er trotzdem.
Einmal fragte ich ihn: »Bist du erleuchtet?«, und er antwortete lapidar: »Yes, aber das ändert auch nichts.« Danach beobachtete er eine Mücke, die Blut aus seinem Unterarm saugte. »Faszinierend, oder? Diese kleine Mücke weiß genau, wo ich eine Akupunktur benötige.« Als die Mücke volltrunken davonflirrte, ging er in den Indischen Ozean und schwamm fast eine Stunde lang. Anschließend wälzte er sich am Strand, rieb seine Haut mit Sand ab und setzte sich zu mir. Ich fragte ihn, ob er glaubte, in seinem früheren Leben ein Fisch gewesen zu sein. »Mein früheres Leben interessiert mich nicht. Das jetzige ist weitaus spannender.« Ich bat ihn, mir zu erklären, welche Meditationsform er unterrichtete. Er schüttelte den Sand von seinem Körper wie ein nasser Hund. »Vipassana. Das heißt, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Du schweigst zehn Tage lang, bewegst dich in extremer Zeitlupe, gehst im Meer aufs Klo, schläfst auf dem Dschungelboden und meditierst die ganze Zeit. Spinnen, Schlangen und ähnliches Getier sollen dich dabei unterstützen. Vipassana ist die größte Qual, die sich ein Westler antun kann. Danach wirst du allerdings eine ungefähre Ahnung davon haben, was Erleuchtung bedeutet.« Go hatte diese Art von Meditationen wiederholt drei Monate am Stück durchgezogen. »Da schaffst du doch zehn Tage!« Durch das Schweigen und die Zeitlupe würde Stille einkehren, erzählte er. »So viele Menschen wollen meditieren lernen und wissen nichts von Vipassana. Das ist schade, denn es ist die einzig wahre, echte Form der Meditation. Es ist die Essenz aller spirituellen Übungen. Die wenigsten Menschen besitzen die Reife für diese Übung. Freu dich drauf!«
Die nächsten zehn Tage waren tatsächlich die größte Qual meines Lebens. Aber sie bescherten mir auch Momente vollkommenen Glücks und absoluter Harmonie. Vielleicht bekam ich tatsächlich für wenige Sekunden einen Geschmack von Erleuchtung.
Als ich am Tag danach hinter der Furt den ersten Kaffee trank, war ich so unendlich dankbar für diese köstliche Welt, dass ich vor Freude hätte heulen können. Selbst besoffene Engländer und bekiffte Israelis hatte ich auf einmal lieb. »Vipassana ist vergleichbar mit einer Operation am Unterbewusstsein«, erklärte Go. »Es geschieht eine Art Reinigung auf einer tiefen Ebene, die wir kaum bewusst wahrnehmen.« Er riet mir, mich wie nach einer echten OP erst mal zu erholen, bevor ich mich wieder in die Welt stürzte. Also verbrachte ich noch eine Woche im Dschungel hinter der Furt. Aber irgendwann musste ich gehen. Der Ashram wartete. Mich zog es mit aller Kraft zum Guru aus Blaufingen. Go schaute mich lange an: »Immerhin hast du Vipassana gemacht. Besser wird’s nicht. Aber das verstehst du erst in vielen Monaten.« Er umarmte mich kurz und fest. Dann ging er ins Meer, schwimmen.
Ich kaufte mir für dreißig Euro ein Flugticket ans andere Ende des Subkontinents, nach Chennai. Früher hieß die Stadt Madras. Aber seit der Unabhängigkeit Indiens 1947 haben die Politiker nach und nach wieder die Namen eingeführt, die ihre Städte vor der britischen Besetzung trugen. Leider weiß in dieser bereits 65 Jahre währenden Übergangsphase niemand, welcher Name gerade wo benutzt wird. Wer einen Zug nach Chennai nehmen möchte, sollte am Bahnsteig nach Madras fragen. Auf der Karte stünde allerdings Chennai, was aber den Schaffner im Zug stutzig machen würde, da er mit dem Namen Madras aufgewachsen ist. Also würde der Mann in Uniform ein gewaltiges Gewese machen, gestikulieren, schimpfen, den Kopf schütteln und den arglosen Westler als Trottel, Analphabeten und vom Teufel Besessenen darstellen. Wer dieses Land nicht kennt, würde es mit der Angst zu tun bekommen und glauben, er säße tatsächlich im falschen Zug und würde womöglich bald ins Gefängnis geworfen. Er würde sofort aussteigen und auf einem verlassenen Bahnhof am Ende der Welt nach der richtigen Verbindung suchen, nur um herauszufinden, dass er doch im richtigen Zug gesessen hatte. Er würde drei Tage auf den nächsten Zug warten, der gestern hätte ankommen müssen. So ist Indien – auf dem Boden. In der Luft ist Indien das genaue Gegenteil. Die Flugzeuge sind nagelneu, die Stewardessen höflich, das Essen europäisch, Pünktlichkeit oberstes Gesetz. Oben gelten globale Regeln, alles Indische bleibt unten. Ich schaute aus dem Fenster einer Boeing. Unter mir zogen rote Gebirgszüge vorbei. Wie viel Elend herrschte dort? Einer der vielen indischen Götter hatte wohl entschieden, dass ich in zehntausend Metern Höhe darüber hinwegrauschen sollte.
Im vergangenen Jahr war ich mit meinem jüngeren Bruder in Indien gewesen. Nach vier Wochen hatte er ein klares Fazit gezogen: »Ich werde nie wieder in dieses Scheiß-Land fliegen. Es ist der dreckigste Staat der Welt, die Menschen sind verschlagen und unfreundlich oder sie verhungern gerade. Sie haben mich verarscht, betrogen und belogen. Wieso machst du hier jeden Winter Urlaub?« Ich hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich ihm diesen Urlaub eingebrockt hatte, und brauchte schnell eine entwaffnende Antwort: »Vielleicht steckt dahinter das ganz profane Glück, hier nicht zu Hause sein zu müssen. Indien ist für mich wie ein anderer Planet. Nur seltsamer.« Mein Bruder hatte daraufhin tief durchgeatmet und meine Antwort ohne Kommentar akzeptiert. Vielleicht hatte er das in Indien gelernt.
Am Flughafen in Chennai wartete kein Fahrer auf mich, trotz Vereinbarung mit dem Ashram. Ich musste mir irgendein Taxi suchen, im Land mit den schlimmsten Verkehrsbedingungen der Welt – ein LKW, der von Kalkutta (beziehungsweise Kolkata) nach Mumbai fährt, macht im Durchschnitt elf Kilometer pro Stunde. Sieben indische Staaten, Hunderte von korrupten Zöllnern, Tausende von Schlaglöchern, Millionen von Fußgängern und Radfahrern auf den sogenannten Highways machen den Verkehr zum russischen Roulette. Der Straßenverkehr ist die größte Gefahr in Indien. Wer nicht zur Seite springt, wird übergemangelt, weil die meisten Inder immer in Hierarchien denken: Sei rücksichtslos gegen den, der dir untergeordnet ist, und wachsam gegen den, der über dir steht. Für Hunde bremst niemand. Für Fußgänger höchstens Fahrradfahrer oder Eseltreiber. Diese werden von Mopedfahrern zutiefst verachtet und regelmäßig angefahren. Mopedfahrer werden von PKW-Rowdys plattgemacht. Privatwagen stehen in der Rangfolge unter Taxen. Taxen weichen europäischen Karossen mit Geschäftsmännern aus. Über Audi, Mercedes und BMW rangieren LKW. Darüber gibt es nur Busse. Die töten alles, was ihnen in die Quere kommt. Ein Busfahrer würde niemals bremsen. Außer für Kühe – die sind schließlich heilig.
Zwei Prozent der Autobahnen sind vierspurig. Auf indischen Straßen sterben täglich tausend Menschen. Ein Land mit geschätzten 1,4 Milliarden Einwohnern erreicht allerdings schnell statistische Zahlen, die für uns unvorstellbar sind. In Indien hungern dreihundert Millionen Menschen – fast ganz Westeuropa zusammen. Mehr als eine halbe Milliarde lebt ohne vernünftige Ausbildung und weiß morgens nicht, ob abends etwas zu essen auf dem Tisch (beziehungsweise dem Boden) steht.
Vier Stunden benötigte mein Taxi für die hundertzwanzig Kilometer von Chennai nach Borus Siam, wo der Ashram liegt. Der Fahrer redete kein Wort. Vermutlich konnte er kein Englisch. Meist guckte er grimmig – es sei denn, wir fuhren an einem Tempel vorbei. Dann ließ er sein Lenkrad los, faltete die Hände, murmelte »Shiva, Shiva, Shiva«, bis er auf die andere Straßenseite geriet. Dann riss er den Wagen zurück auf die linke Spur, streifte einen Hund, rammte einen Eselkarren und verfluchte die miserablen Fahrkünste seiner Landsleute. Kurz mussten wir anhalten. Nicht etwa, um nach dem Befinden des Eselkarrenfahrers zu schauen, sondern weil sich ein Elefant mitten auf die Straße gelegt hatte. Hinter uns jaulte der angefahrene Hund lauthals vor Schmerz. Der Eselkarrenfahrer zuckelte mit seinem Wagen an uns vorbei, als wäre nichts passiert. Vor uns schlugen zwei Kinder dem Elefanten Eisenhacken in den Kopf, um ihn wegzutreiben. Langsam erhob sich der Koloss. Er sah todmüde aus.
Das Taxi roch nach Süßholz. Auf dem Armaturenbrett leuchteten kleine indische Plastikgottheiten. Ein bunter Teppich lag ihnen zu Füßen. Am Rückspiegel baumelten ausgestanzte Papptempel, klingende Glöckchen und kitschige Glaskugeln mit kalten Winterlandschaften – die Idealvorstellung hitzegeplagter Inder. Auf dem Lenkrad klebte eine elfenbeinerne Plakette. Der heilige Christophorus, religionsübergreifender Schutzpatron aller Autofahrer.
Verzweifelt suchte der Fahrer den Ashram. Er war zu stolz, um nach dem Weg zu fragen. Als ich erkannte, dass wir zum dritten Mal an derselben liegenden Krishnastatue vorbeifuhren, bestand ich darauf, anzuhalten. Das Wörtchen »Stop« ist international. Ich fragte einen Passanten nach dem Ashram. Er zeigte uns die Richtung. Einen Kilometer weiter entdeckte ich ein riesiges Schild: Sri What Ashram. Wahrscheinlich konnte der Fahrer unsere Schrift nicht lesen.
Vor einer Toreinfahrt mit gewaltigen Lettern prangten bunte Plakate des lachenden, bärtigen Meisters. Come, come!, las ich. Hier war ich richtig. Hätte dort gestanden: Guru begrüßt seine Opfer; ich hätte mich trotzdem begeistert hineingestürzt.
Mir war ein bisschen flau vor Aufregung. In einem hölzernen Kabäuschen hockte ein Wärter. Als ich durch das Tor trat, schaute er kurz auf. Da ich sofort als Westler zu erkennen war und keine Waffen trug, lehnte er sich wieder zurück in seinen Stuhl und starrte weiter ins Leere. Ich ging einfach vorbei.