
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Goyalit
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hawthorne ermittelt
- Sprache: Deutsch
Keine sechs Stunden nachdem die wohlhabende alleinstehende Diana Cowper ihre eigene Beerdigung geplant hat, wird sie in ihrem Haus erdrosselt aufgefunden. Ahnte sie etwas? Kannte sie ihren Mörder?
Daniel Hawthorne, ehemaliger Polizeioffizier und inzwischen Privatdetektiv im Dienst der Polizei, nimmt die Spur auf. Aber nicht nur den Fall will er lösen, es soll auch ein Buch daraus werden, und dafür wird Bestsellerautor Anthony Horowitz gebraucht. Der wiederum sträubt sich zunächst, ist jedoch schon bald unrettbar in den Fall verstrickt. Fasziniert von der Welt des Verbrechens ebenso wie von dem undurchsichtigen Detektiv und dessen messerscharfem Verstand.
Ganz im Stil von Holmes und Watson begeben sich Hawthorne und Horowitz auf die Suche nach dem Mörder einer scheinbar harmlosen älteren Frau, in deren Vergangenheit allerdings schon bald dunkle Geheimnisse auftauchen. Eine atemberaubende Jagd beginnt …
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cover
Titel
Anthony Horowitz
Ein perfider Plan
Hawthorne ermittelt
Roman
Aus dem Englischen von Lutz-W. Wolff
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel The Word is Murder bei Penguin Random House UK, LondonDas Zitat auf S. 158 stammt aus Sylvia Plath, Ariel, englisch und deutsch,Übertragung und Nachwort Alissa Walser © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2008
eBook Insel Verlag Berlin 2019
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2019
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
eISBN 978-3-458-76227-0
www.suhrkamp.de
Ein perfider Plan Hawthorne ermittelt
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
1 Eine gut geplante Beerdigung
2 Hawthorne
3 Das erste Kapitel
4 Der Tatort
5 Der Verletzte
6 Zeugenaussagen
7 Harrow-on-the-Hill
8 Beschädigtes Leben
9 Starglanz
10 Die Drehbuchkonferenz
11 Die Beerdigung
12 Blutgeruch
13 Die Schuhe des toten Mannes
14 Willesden Green
15 Lunch mit Hilda
16 Detective Inspector Meadows
17 Canterbury
18 Deal
19 Mr Tibbs
20 Das Leben eines Schauspielers
21
RADA
22 Hinter der Maske
23 Besuchszeiten
24 River Court
Danksagung
Informationen zum Buch
Ein perfider Plan
1 Eine gut geplante Beerdigung
An einem hellen Frühlingsmorgen, dessen blasses Sonnenlicht weit mehr Wärme versprach, als der Tag dann zu liefern vermochte, überquerte Diana Cowper kurz nach elf Uhr die Fulham Road und betrat ein Beerdigungsinstitut.
Sie war nicht besonders groß, wirkte aber sehr zielstrebig. In ihren Augen, ihrem akkurat geschnittenen Haar und ihrem Gang lag eine heftige Entschlossenheit. Wenn man sie kommen sah, hatte man sofort den Wunsch, ihr auszuweichen und sie passieren zu lassen. Dabei hatte sie gar nichts Unfreundliches an sich. Sie war in den Sechzigern und hatte ein angenehmes, rundes Gesicht. Sie war teuer gekleidet, ihr heller Regenmantel stand offen und enthüllte einen rosa Pullover mit einem grauen Rock. Sie trug ein Perlenhalsband mit Edelsteinen, das wertvoll sein mochte oder auch nicht, und eine Reihe von Diamantringen, die auf jeden Fall teuer gewesen sein mussten. Es gab viele Frauen wie sie in den Straßen von Fulham und South Kensington. Sie hätte auch auf dem Weg zu einer Lunchverabredung oder einer Kunstgalerie sein können.
Das Beerdigungsinstitut hieß Cornwallis & Söhne. Es stand am Ende einer Häuserreihe, und der Name prangte in klassischer Schrift sowohl auf der Front als auch an der Seite des Hauses, so dass man ihn nicht übersehen konnte, egal aus welcher Richtung man kam. Eine große viktorianische Uhr verhinderte, dass die beiden Inschriften über der Eingangstür aneinanderstießen. Ihre Zeiger waren passenderweise um 11 Uhr 59 zum Stillstand gekommen: eine Minute vor Mitternacht. Unter dem Firmennamen stand, erneut in doppelter Ausführung, die Legende: Unabhängige Trauerhilfe und Bestattungen. Seit 1820 im Besitz der Familie. An der Straßenfront gab es drei Schaufenster. Zwei davon zeigten geschlossene Vorhänge, im mittleren lag ein aufgeschlagenes Buch aus Marmor, dessen Seiten die Inschrift trugen: Wenn Kummer kommt, dann kommt er einzeln nicht, er kommt in Bataillonen. Alle Holzteile, die Fensterrahmen und die Fassadenverkleidung waren in einem sehr dunklen Blau gestrichen.
Als Mrs Cowper die Tür öffnete, erklang ein Glöckchen, das an einem altmodischen Federmechanismus befestigt war. Sie betrat einen kleinen Empfangsraum mit zwei Sofas, einem niedrigen Tisch und einem Regal, in dem ein paar Dutzend Bücher standen, die schon deshalb besonders traurig erschienen, weil sie ganz ungelesen waren. Eine Treppe führte ins obere Stockwerk und ein schmaler Korridor in die hinteren Räume.
Sogleich kam eine stämmige Frau mit dicken Beinen und klobigen schwarzen Lederschuhen die Treppe hinunter. Sie lächelte höflich. Ihr Lächeln gab zu verstehen, dass dies eine schmerzliche, heikle Angelegenheit war, die man aber mit größter Ruhe und Effizienz erledigen würde. Ihr Name war Irene Laws. Sie war die persönliche Assistentin von Robert Cornwallis, dem Bestattungsunternehmer, und zugleich die Empfangsdame.
»Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie.
»Ja. Ich möchte ein Begräbnis organisieren.«
»Sind Sie wegen jemandem da, der kürzlich gestorben ist?« Das Wort »gestorben« war durchaus bezeichnend. Nicht »verschieden«. Und nicht »dahingegangen«. Irene Laws hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, stets Klartext zu reden, da sie zu der Erkenntnis gekommen war, dass das am Ende weniger schmerzhaft für alle Beteiligten war.
»Nein«, erwiderte Mrs Cowper. »Es ist für mich selbst.«
»Ich verstehe.« Irene Laws zuckte nicht mit der Wimper – warum sollte sie auch? Es war durchaus nichts Ungewöhnliches, dass Leute ihre eigene Beerdigung regelten. »Haben Sie einen Termin?«, fragte sie.
»Nein. Ich wusste nicht, dass das nötig ist.«
»Nehmen Sie doch bitte Platz! Ich werde mal nachsehen, ob Mr Cornwallis Zeit hat. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Tee oder Kaffee?«
»Nein, danke.«
Diana Cowper setzte sich, und Irene Laws verschwand den Korridor hinunter. Kurz darauf erschien sie wieder: Sie ging hinter einem Mann her, der so eindeutig wie ein Beerdigungsunternehmer aussah, dass er ein Schauspieler hätte sein können. Er trug den unvermeidlichen schwarzen Anzug und eine dunkelgraue Krawatte. Sein bloßes Auftreten signalisierte, dass er sich am liebsten dafür entschuldigt hätte, dass seine Anwesenheit überhaupt nötig war. Seine Hände waren zu einer Geste des Bedauerns gefaltet. Sein Gesicht war von tiefen Furchen durchzogen, und das dünne, am Rande der Kahlköpfigkeit dahinsiechende Haupthaar verbesserte diesen Eindruck genauso wenig wie der schüttere Bart, der aussah wie ein gescheitertes Experiment. Er trug getönte Brillengläser, deren Fassung auf seine Nase drückte und die Augen nicht nur umrahmte, sondern nahezu völlig verdeckte. Er war ungefähr vierzig und versuchte, trotz allem zu lächeln.
»Guten Morgen«, sagte er. »Mein Name ist Robert Cornwallis. Sie wollen eine Bestattung veranlassen?«
»Ja.«
»Hat man Ihnen schon etwas angeboten? Wenn Sie mir bitte folgen wollen …«
Die neue Kundin wurde den Korridor hinunter zu einem Zimmer am hinteren Ende geführt. Es war genauso dezent wie der Empfangsbereich ausgestattet, allerdings mit einem wichtigen Unterschied: Statt der Bücher gab es hier Broschüren und Kataloge mit Bildern von Särgen und Leichenwagen (mit Pferden oder motorisiert) und Preislisten. Falls sich das Gespräch in Richtung einer Feuerbestattung bewegen sollte, waren auf zwei Regalen auch Urnen zur Prüfung bereitgestellt worden. Zwei Lehnsessel standen sich gegenüber. Cornwallis setzte sich auf den mit dem kleinen Schreibtisch daneben. Er zog einen Füllfederhalter heraus, einen silbernen Montblanc, und legte ihn auf seinen Notizblock.
»Es geht um Ihre eigene Beerdigung«, begann er.
»Ja.« Plötzlich wollte Mrs Cowper etwas rascher vorankommen. »Ich habe mir schon ein paar Einzelheiten überlegt, ich hoffe, das stört Sie nicht?«
»Ganz im Gegenteil. Individuelle Bedürfnisse sind uns sehr wichtig. Heutzutage sind maßgeschneiderte Konzepte für vorgeplante Beerdigungen der Hauptbestandteil unseres Geschäfts. Es ist uns eine besondere Ehre, genau das zu bieten, was unsere Kunden verlangen. Vorausgesetzt, dass unsere Angebote und Bedingungen Ihnen zusagen, werden wir Ihnen nach unserem Gespräch einen Vertragsentwurf und eine detaillierte Rechnung mit allen Einzelheiten zukommen lassen, auf die wir uns verständigt haben. Ihre Verwandten und Freunde werden nichts weiter tun müssen, als an der Veranstaltung teilzunehmen. Und aus Erfahrung kann ich Ihnen versichern, dass es ihnen ein großer Trost sein wird, wenn sie wissen, dass alles genau so vonstatten geht, wie Sie es sich gewünscht haben.«
Mrs Cowper nickte. »Ausgezeichnet. Dann können wir ja loslegen, oder?« Sie holte tief Luft und kam sofort zur Sache: »Ich will in einem Pappsarg begraben werden.«
Cornwallis war schon dabei, die erste Notiz zu machen, als die Feder kurz vor der Papieroberfläche noch einmal innehielt. »Wenn Sie an ein Öko-Begräbnis denken, würde ich vielleicht eher recyceltes Holz oder auch ein Weidengeflecht vorschlagen. Es gibt Fälle, bei denen Pappe nicht so … wirkungsvoll ist.« Er wählte seine Worte mit Sorgfalt, damit alle möglichen Untertöne darin mitschwingen konnten. »Weidensärge sind kaum teurer und sehr viel attraktiver.«
»Na schön. Ich will auf dem Brompton Cemetery begraben werden, neben meinem Mann.«
»Haben Sie ihn vor kurzem verloren?«
»Vor zwölf Jahren. Die Grabstelle haben wir schon, das ist also kein Problem. Und die Trauerfeier stelle ich mir so vor …« Sie klappte ihre Handtasche auf und nahm ein Blatt Papier heraus, das sie auf den Tisch legte.
Der Beerdigungsunternehmer warf einen Blick darauf. »Ich sehe, Sie haben über die Angelegenheit schon viel nachgedacht«, sagte er. »Und die Feier ist wohldurchdacht, wenn ich das sagen darf. Teils religiös, teils humanistisch.«
»Na ja, da ist dieser Psalm – und da sind die Beatles. Ein Gedicht, ein bisschen klassische Musik und ein paar kurze Reden. Ich will nicht, dass es zu lange dauert.«
»Wir können den Zeitplan ganz genau festlegen.«
Diana Cowper hatte ihre Beerdigung genau geplant, und das war auch gut so. Denn sie wurde noch am selben Tag, nur sechs Stunden später, ermordet.
Zum Zeitpunkt ihres Todes hatte ich noch nie von ihr gehört, und ich wusste so gut wie nichts darüber, wie sie gestorben war. Vielleicht hatte ich eine Überschrift in der Zeitung gelesen: MUTTER VON HOLLYWOODSCHAUSPIELER ERMORDET, aber die Fotos und Berichte konzentrierten sich alle mehr auf den weitaus berühmteren Sohn, der gerade als Hauptfigur einer neuen amerikanischen Fernsehserie besetzt worden war. Das oben dargestellte Gespräch ist daher nur eine grobe Annäherung, denn ich bin natürlich nicht dabei gewesen. Ich habe das Beerdigungsinstitut aber später besucht und lange mit Robert Cornwallis und seiner Assistentin Irene Laws gesprochen (die übrigens auch seine Cousine war). Wenn Sie die Fulham Road hinuntergehen, hätten Sie kein Problem, das Bestattungsunternehmen zu finden. Die Räumlichkeiten sind genauso, wie ich sie beschrieben habe. Viele andere Einzelheiten stammen aus Zeugenaussagen und Polizeiberichten.
Wann genau Mrs Cowper das Bestattungsunternehmen betrat, wissen wir deshalb, weil ihre Bewegungen sowohl auf der Straße als auch in dem Bus, den sie von zu Hause aus genommen hatte, von Überwachungskameras aufgezeichnet worden waren. Es gehörte zu ihren absonderlichen Verhaltensweisen, dass sie stets öffentliche Verkehrsmittel benutzte. Sie hätte sich ohne weiteres einen Chauffeur leisten können.
Sie verließ das Bestattungsunternehmen um Viertel vor zwölf, ging zur U-Bahnstation South Kensington und nahm die Piccadilly Line zum Green Park. Dort traf sie sich zu einem frühen Lunch mit einem Bekannten im Café Murano in der St James's Street, in der Nähe von Fortnum & Mason. Von da aus nahm sie ein Taxi zum Globe Theatre auf der South Bank. Sie sah sich aber kein Stück an, sondern nahm an einer Vorstandssitzung im ersten Stock des Gebäudes teil, die von zwei Uhr bis kurz vor fünf dauerte. Fünf Minuten nach sechs war sie wieder zu Hause. Es hatte gerade angefangen zu regnen, aber sie hatte einen Schirm dabei, den sie in einem pseudoviktorianischen Ständer neben der Tür ihres Hauses zurückließ.
Dreißig Minuten später hat sie jemand erwürgt.
Diana Cowper wohnte in einem schicken Reihenhaus in der Britannia Road etwas außerhalb der Gegend von Chelsea, die – in ihrem Falle ganz angemessen – als »World's End« bekannt ist. Es gab keine Überwachungskameras in dieser Straße, so dass man nicht feststellen konnte, wer in der fraglichen Zeit sonst noch da war. Die Nachbarhäuser standen leer. Das eine gehörte einem Konsortium in Dubai und war nicht vermietet, das andere gehörte einem Rechtsanwalt und seiner Gemahlin, aber die hielten sich in Südfrankreich auf. Es hatte also niemand etwas gehört.
Die Leiche wurde erst nach zwei Tagen gefunden. Andrea Kluvánek, die slowakische Putzfrau, kam nur zweimal die Woche und entdeckte sie am Mittwochmorgen. Mrs Cowper lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden im Wohnzimmer. Eine rote Kordel, die normalerweise zum Zurückbinden der Vorhänge benutzt wurde, war um ihren Hals geschlungen. Der Bericht des Gerichtsmediziners, der in der üblichen sachlichen, ja beinahe desinteressierten Weise verfasst war wie alle solche Berichte, beschrieb in allen Einzelheiten die Einwirkung stumpfer Gewalt auf den Hals, das gebrochene Zungenbein und die Blutungen der Bindehaut. Die slowakische Putzfrau sah etwas viel Schlimmeres. Sie arbeitete seit zwei Jahren in Mrs Cowpers Haushalt und mochte ihre Arbeitgeberin, die sie stets gut behandelt und immer mal einen Kaffee mit ihr getrunken hatte. Als sie am Mittwoch die Tür öffnete, war sie dagegen mit einer Leiche konfrontiert, und noch dazu mit einer, die schon eine Weile dalag. Das Gesicht, soweit sie es sehen konnte, war blauviolett angelaufen. Die Augen starrten ins Leere, die Zunge hing grotesk heraus und war zweimal so lang wie normal. Ein Arm war ausgestreckt, ein Finger mit einem Diamantring zeigte anklagend auf sie. Da die Heizung lief, hatte die Leiche bereits zu stinken begonnen.
Nach eigener Aussage hatte die Putzfrau nicht geschrien. Sie hatte sich auch nicht erbrochen. Sie war leise aus dem Haus gegangen, hatte ihr Handy aus der Tasche gezogen und die Polizei angerufen. Sie war nicht ins Haus zurückgegangen, bevor die Beamten eintrafen.
Anfangs nahmen die Ermittler an, dass Diana Cowper das Opfer eines Einbruchs geworden war. Es waren verschiedene Gegenstände, darunter Schmuck und ein Laptop, entwendet worden. Mehrere Räume waren durchsucht und Dinge verstreut worden. Es gab aber keine Einbruchsspuren. Mrs Cowper hatte dem Angreifer offenbar selbst die Tür geöffnet, auch wenn nicht ganz klar war, ob sie ihn gekannt hatte oder nicht. Sie war überrascht und von hinten erwürgt worden. Sie hatte sich kaum gewehrt. Es gab keine Fingerabdrücke, keine DNA, keine Hinweise sonstiger Art, was den Eindruck erweckte, dass der Täter alles mit großer Sorgfalt geplant hatte. Er hatte sie abgelenkt, die rote Kordel vom Haken neben dem Vorhang genommen und sich von hinten angeschlichen. Er hatte ihr die Vorhangschnur um den Hals gelegt und gezogen. Es hatte wohl nur eine Minute gedauert, bis sie tot war.
Aber dann erfuhr die Polizei von ihrem Besuch bei Cornwallis & Söhne und merkte, dass sie es mit einem richtigen Rätsel zu tun hatte. Man muss sich das mal vor Augen halten: Niemand organisiert seine eigene Beerdigung und wird am selben Tag noch ermordet. So etwas ist kein Zufall. Die beiden Ereignisse mussten irgendwie miteinander verknüpft sein. Hatte sie gewusst, dass sie sterben würde? Hatte sie jemand in das Bestattungsunternehmen hineingehen sehen und sich bemüßigt gefühlt, etwas zu unternehmen? Wer wusste überhaupt, dass sie dort gewesen war?
Es war tatsächlich ein Rätsel und bedurfte eines besonderen Ansatzes. Gleichzeitig hatte es überhaupt nichts mit mir zu tun.
Aber das sollte sich ändern.
2 Hawthorne
Mich an den Abend zu erinnern, an dem Diana Cowper getötet wurde, fällt mir nicht schwer. Ich habe mit meiner Frau im Moro am Exmouth Market zu Abend gegessen und eine Menge getrunken. Denn wir hatten etwas zu feiern: Am Nachmittag hatte ich meinem Verleger das Manuskript meines neuen Romans geschickt, an dem ich acht Monate lang gearbeitet hatte.
Das Geheimnis des weißen Bandes war eine Sherlock-Holmes-Geschichte, mit der ich nie gerechnet hatte. Aus heiterem Himmel hatten die Nachlassverwalter von Conan Doyle bei mir angefragt, ob ich daran interessiert sei, mit ihrer Genehmigung und Unterstützung ein neues Sherlock-Holmes-Abenteuer zu schreiben. Ich hatte sofort ja gesagt. Die ersten Sherlock-Holmes-Geschichten hatte ich mit siebzehn gelesen, und sie hatten mich mein Leben lang begleitet. Das lag nicht nur daran, dass ich die Hauptfigur so liebte, weil Sherlock Holmes der Vater aller modernen Detektive ist. Es waren auch nicht die Rätsel, so bemerkenswert sie auch sind. Es war vor allem die Welt, die Holmes und Watson bewohnten: die Themse, die Kutschen, die durch die Straßen ratterten, die Gaslaternen, der wirbelnde Londoner Nebel. Es war, als hätte man mich eingeladen, in der Baker Street 221b einzuziehen und ein stiller Zeuge der größten Freundschaft in der Literatur zu werden. Wie hätte ich ablehnen können?
Von Anfang an war mir klar, dass meine Aufgabe darin bestand, unsichtbar zu bleiben. Ich versuchte mich im Schatten von Conan Doyle zu verstecken, seine literarischen Tricks und seinen Stil nachzuahmen, und mich dabei nicht aufzudrängen. Ich habe nichts geschrieben, was nicht auch von ihm hätte sein können. Ich erwähne das nur, weil es mich beunruhigt, dass ich in dieser Geschichte hier so im Vordergrund stehe. Aber diesmal bleibt mir nichts anderes übrig. Ich schreibe einfach nur, was passiert ist.
Ausnahmsweise hatte ich gerade keine Fernsehserie in Arbeit. Die Detektivserie Foyle's War hatte man vorläufig eingestellt, und es war fraglich, ob sie fortgesetzt werden würde. In den letzten sechzehn Jahren hatte ich über zwanzig zweistündige Episoden geschrieben; das heißt, ich hatte fast dreimal länger daran gearbeitet, als der ganze Krieg gedauert hatte. Ich war müde. Und was noch schlimmer war: Als ich am 15. August 1945 angekommen war, am VJ Day, gab's keinen Stoff mehr. Ich wusste nicht, was ich als Nächstes tun sollte. Einer der Schauspieler hatte vorgeschlagen, wir könnten ja »Foyle's Peace« drehen. Aber ich war nicht so ganz sicher, ob das funktionieren würde.
Beim Publikum war ich vor allem als Jugendbuchautor bekannt. Im Jahr 2000 hatte ich eine Serie über einen jugendlichen Spion namens Alex Rider herausgebracht, die auf der ganzen Welt verkauft worden war. Ich liebte es, Jugendbücher zu schreiben, aber es störte mich, dass ich mich mit jedem neuen Lebensjahr weiter von meinem jungen Publikum entfernte. Ich war gerade fünfundfünfzig geworden. Es war an der Zeit, etwas Neues zu machen. Auf jeden Fall war ich gerade auf dem Weg zum Hay-on-Wye-Literaturfestival, um das neueste Buch in der Alex-Rider-Serie vorzustellen.
Das spannendste Projekt auf meinem Schreibtisch war wohl das Drehbuch mit dem Arbeitstitel »Tintin 2«. Zu meiner Überraschung hatte Steven Spielberg mich damit beauftragt und las jetzt den ersten Entwurf. Peter Jackson sollte der Regisseur sein. Ich konnte es noch gar nicht fassen, dass ich plötzlich mit den beiden größten Regisseuren der Filmwelt arbeiten sollte. Und ich muss zugeben, dass ich nervös war. Ich hatte das Drehbuch vielleicht ein Dutzend Mal gelesen und versuchte, mich davon zu überzeugen, dass ich mich in der richtigen Richtung bewegte. Funktionierten die Charaktere? Waren die Action-Szenen stark genug? In einer Woche wollten Jackson und Spielberg in London sein. Ich sollte mich mit ihnen treffen, um zu erfahren, was sie davon hielten.
Als mein Handy klingelte und ich die Nummer nicht gleich erkannte, fragte ich mich sofort, ob es vielleicht einer von ihnen war – obwohl sie natürlich nicht persönlich bei mir angerufen hätten. Ein Assistent wäre am Apparat gewesen und hätte mich dann weitergereicht. Es war ungefähr zehn Uhr morgens. Ich saß in meinem Arbeitszimmer, ganz oben in meiner Wohnung, und las The Meaning of Treason von Rebecca West, eine Untersuchung über das Leben in England nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich überlegte, ob das vielleicht den richtigen Hintergrund für die Fortsetzung der Foyle-Serie abgeben könnte: der Kalte Krieg. Ich konnte ihn ja in die Welt der Spione, Atomwissenschaftler, Verräter und Kommunisten eintauchen lassen. Ich legte das Buch weg und griff nach dem Handy.
»Tony?«, fragte mich eine Stimme.
Also, Spielberg war das bestimmt nicht. Sehr wenige Leute nennen mich Tony. Um ganz ehrlich zu sein: Ich mag es nicht sehr. Ich bin immer Anthony gewesen, für manche Freunde auch Ant.
»Ja?«, sagte ich.
»Wie geht's, Sportsfreund? Hier ist Hawthorne.«
Wer dran war, hatte ich schon gewusst, noch ehe er seinen Namen gesagt hatte. Die flachen Vokale und schiefen Betonungen, diese Mischung aus Cockney und dem Norden von England konnte man gar nicht verwechseln. Und das Wort »Sportsfreund« erst recht nicht.
»Mr Hawthorne«, sagte ich. Er war mir als »Daniel« vorgestellt worden, aber diesen Vornamen zu benutzen wäre mir merkwürdig vorgekommen. Er benutzte ihn selbst kaum … und genau genommen habe ich ihn auch von anderen nie gehört. »Schön, von Ihnen zu hören.«
»Ja, ja.« Er klang ungeduldig. »Hören Sie – haben Sie eine Minute Zeit?«
»Wie bitte? Worum geht's denn?«
»Ich habe gedacht, wir könnten uns vielleicht treffen. Was machen Sie heute Nachmittag?«
Das war typisch für ihn. Er litt unter einer Art Kurzsichtigkeit, die ihn davon ausgehen ließ, dass sich alles nach ihm richtete. Er fragte nicht etwa, ob ich morgen oder nächste Woche Zeit für ihn hätte. Es musste gleich sein, weil er sich das so vorstellte. Wie ich schon gesagt habe, hatte ich an diesem Nachmittag tatsächlich nichts weiter vor, aber das gedachte ich ihm nicht auf die Nase zu binden. »Also, ich weiß nicht, ob …«, fing ich an.
»Wie wäre es um drei in diesem Café, wo wir immer waren?«
»J + A?«
»Ja, genau. Ich muss Sie etwas fragen. Ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar.«
J + A war in Clerkenwell, ein Zehn-Minuten-Spaziergang von meiner Wohnung. Wenn er von mir verlangt hätte, auf die andere Seite von London zu kommen, hätte ich vielleicht gezögert, aber jetzt war ich neugierig. »Okay«, sagte ich. »Drei Uhr.«
»Großartig, Sportsfreund. Bis dann.«
Damit legte er auf. Das Tintin-Manuskript war immer noch auf meinem Bildschirm. Ich klappte den Laptop zu und dachte an Hawthorne.
Kennengelernt hatte ich ihn vor einem Jahr, als ich an einer fünfteiligen Fernsehserie arbeitete, die in einigen Monaten ausgestrahlt werden sollte. Sie hieß Unrecht! und der Hauptdarsteller war James Purefoy.
Unrecht! beruhte auf einer jener ewigen Fragen, die Drehbuchschreiber sich stellen, wenn sie nach einer neuen Idee suchen: Wie kann ein Strafverteidiger jemand verteidigen, von dem er weiß, dass er schuldig ist? Also entwickelte ich eine Geschichte über einen Tierschutz-Aktivisten, der hochvergnügt zugibt, ein Kind ermordet zu haben, nachdem sein Verteidiger William Travers (Purefoy) einen Freispruch für ihn erwirkt hat. Daraufhin erleidet Travers einen Nervenzusammenbruch und zieht nach Suffolk um. Dann trifft er den Kerl zufällig wieder, als er in Ipswich auf seinen Zug wartet. Ein paar Tage später wird der ehemalige Mandant von irgendjemandem getötet, und die Frage erhebt sich: Hat Travers etwas damit zu tun?
Die Handlung wird schließlich zu einem Duell zwischen dem Rechtsanwalt und dem Detective Inspector, der gegen ihn ermittelt. Travers war ein düsterer Charakter, gestört und wahrscheinlich auch gefährlich, aber er war auch der Held der Geschichte und das Publikum musste auf seiner Seite sein. Deshalb konzipierte ich bewusst einen Detektiv, der so unangenehm wie möglich sein sollte. Das Publikum sollte ihn bedrohlich, borderline rassistisch, übellaunig und aggressiv finden. Mein Vorbild war Hawthorne.
Der Fairness halber muss man erwähnen, dass Hawthorne ganz anders war. Also zumindest war er nicht rassistisch. Er war nur außerordentlich nervig, so dass ich meine Gespräche mit ihm zu fürchten begann. Er und ich waren komplette Gegensätze. Ich begriff einfach nicht, wo seine Ansichten herkamen.
Gefunden hatte ihn der Produktionsleiter der Serie. Man sagte mir, dass er Detective Inspector bei der Metropolitan Police in London gewesen sei. Sein Arbeitsplatz war das Polizeirevier Putney gewesen. Seine Spezialität waren Mordfälle. Er hatte zehn Jahre Dienst auf dem Buckel, die jäh zu Ende gegangen waren, als er aus nicht ganz erkennbaren Gründen gefeuert wurde. Es gibt überraschend viele Ex-Polizisten, die als Berater für Produktionsfirmen arbeiten, in denen Fernsehkrimis gedreht werden. Sie sind verantwortlich für die kleinen Details, die man braucht, damit die Filme realistisch und glaubwürdig wirken, und in dieser Hinsicht war Hawthorne hervorragend. Er hatte einen Instinkt dafür, was ich brauchte und was auf dem Bildschirm funktionieren würde. Nur ein Beispiel: In einer Szene ganz am Anfang, als der Detektiv eine wochenalte Leiche untersuchen muss, gibt ihm ein Mann von der Spurensicherung eine Dose Wick Vaporub, das er sich unter die Nase schmieren kann. Das Menthol überdeckt den Geruch. Das war ein Trick, den mir Hawthorne beschrieben hatte, und wenn Sie die Szene sehen, merken Sie, dass diese kleine Geste sie lebendig macht.
Kennengelernt haben wir uns im Büro der Produktionsfirma. Nachdem wir mit der Arbeit begonnen hatten, konnte ich ihn jederzeit anrufen und irgendwas fragen. Die Antworten konnte ich dann ins Drehbuch einarbeiten. Das ging alles über das Telefon. Die erste Begegnung war eigentlich nur eine Höflichkeit, damit wir uns miteinander bekanntmachen konnten. Als ich eintraf, saß er bereits im Foyer. Er hatte die Beine übereinandergeschlagen. Sein Mantel lag zusammengefaltet auf seinem Schoß. Ich wusste sofort, dass er der Mann war, den ich kennenlernen sollte.
Er war nicht besonders groß. Er sah nicht furchterregend oder brutal aus. Aber schon die Art und Weise, wie er von seinem Stuhl aufstand, diese einzige Bewegung, gab mir zu denken. Er hatte die Geschmeidigkeit einer Raubkatze, eines Panthers oder Leoparden, und in seinen weichen, braunen Augen lag eine Boshaftigkeit, die mich herauszufordern und zu bedrohen schien. Er war ungefähr vierzig, und sein Haar war sehr kurz geschnitten. Es war von unbestimmter Farbe und zeigte erste Spuren von Grau. Er war glattrasiert, und seine Haut war blass. Ich hatte den Eindruck, dass er als Kind womöglich sehr hübsch gewesen war, im Lauf seines Lebens aber etwas geschehen war, das ihn zwar nicht direkt hässlich, aber doch irgendwie unschön gemacht hatte. Es schien, als wäre er zu einem schlechten Foto seiner selbst geworden. Mit Anzug, weißem Hemd und Krawatte war er sehr korrekt gekleidet; den Regenmantel trug er jetzt über dem Arm. Er betrachtete mich mit fast übertriebener Aufmerksamkeit, als hätte ich ihn irgendwie überrascht.
»Hallo, Anthony«, sagte er. »Schön, Sie kennenzulernen.«
Woher wusste er überhaupt, wer ich war? Es gingen jede Menge Leute hinein und hinaus, niemand hatte mich angekündigt, und ich hatte ihm auch nicht meinen Namen genannt.
»Ich bin ein großer Bewunderer Ihrer Arbeit«, sagte er auf eine Art und Weise, die ich als Beweis nahm, dass er noch keine Zeile von mir gelesen hatte und dass es ihm völlig egal war, ob ich das merkte.
»Danke«, sagte ich.
»Ich hab von dieser Serie gehört, die Sie schreiben wollen. Klingt wirklich sehr interessant.« Machte er sich über mich lustig? Er sah unglaublich gelangweilt aus, als er das sagte.
Ich lächelte. »Ich freue mich darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten«, sagte ich.
»Wir werden viel Spaß haben«, sagte er.
Aber den hatten wir nicht.
Wir haben viel telefoniert, hatten aber auch ein halbes Dutzend Besprechungen, meist im Büro oder im Hof vor dem Café J + A (er rauchte praktisch die ganze Zeit, meist Selbstgedrehte oder billige Marken wie Lambert & Butler oder Richmond). Ich hatte gehört, dass Hawthorne in Essex wohnte, aber ich hatte keine Vorstellung, wo. Er sprach nie über sich selbst oder seine Zeit bei der Polizei – schon gar nicht darüber, wie sie geendet hatte. Der Produktionsleiter, der ihn angeheuert hatte, sagte mir, er hätte bei einigen aufsehenerregenden Mordfällen an den Ermittlungen mitgewirkt und habe einen ausgezeichneten Ruf, aber ich konnte auf Google nichts über ihn finden. Er hatte ganz offensichtlich einen sehr scharfen Verstand. Obwohl er keinen Zweifel daran ließ, dass er kein Schriftsteller war, und sich kein bisschen für die Serie interessierte, die ich schreiben wollte, machte er immer genau die richtigen Vorschläge, noch ehe ich danach fragte. Gleich in den Eingangsszenen des Films gibt es ein Beispiel dafür: William Travers verteidigt einen jungen Schwarzen, der von der Polizei fälschlich beschuldigt wird, eine Medaille gestohlen zu haben, die angeblich in der Jacke des Jungen gefunden wurde. Aber die Medaille war kürzlich geputzt worden, und als die Taschen des Jungen untersucht werden, finden sich keinerlei Spuren von Amidosulfonsäure oder Ammoniak, wie man sie in Silberputzmitteln verwendet. Das war der Beweis, dass die Medaille dort nicht gewesen sein konnte. Und das war Hawthornes Idee.
Ich kann nicht bestreiten, dass er mir geholfen hat, aber ich kann auch nicht leugnen, dass ich mich vor jeder unserer Begegnungen fürchtete. Er kam immer gleich zur Sache, Smalltalk gab es so gut wie gar nicht. Man hätte annehmen können, dass er über dies oder jenes eine Meinung hatte – das Wetter, die Regierung, das Erdbeben in Fukushima oder die Hochzeit von Prince William. Aber er redete nie über irgendetwas, außer über das, worum es gerade ging. Er trank Kaffee (schwarz, mit zwei Stück Zucker) und rauchte, aß aber nie etwas, wenn er mit mir zusammen war, nicht mal einen Keks. Und er war immer auf die gleiche Weise gekleidet. Ich hätte mir genauso gut ein Foto von ihm ansehen können, wenn er hereinkam: Er schien völlig unwandelbar.
Aber das war das Merkwürdige: Er schien sehr viel über mich zu wissen. Ich hatte mich gestern Abend betrunken. Meine Assistentin war krank. Ich hatte das ganze Wochenende mit Schreiben verbracht. Ich brauchte ihm diese Dinge nicht zu erzählen. Ganz im Gegenteil: Er erzählte sie mir! Am Anfang habe ich mich gefragt, ob er vielleicht mit jemandem im Büro geredet hatte, aber seine Beobachtungen waren immer rein zufällig und schienen gänzlich spontan. Ich bin nie richtig schlau aus ihm geworden.
Der größte Fehler, den ich gemacht habe, war der, ihm den zweiten Entwurf meines Drehbuchs zu zeigen. Ich schreibe normalerweise ein Dutzend Entwürfe, ehe eine Episode gedreht wird. Sowohl der Produzent als auch der Sender und meine Agentin schicken mir Kommentare – und später auch der Regisseur und der Hauptdarsteller. Es ist ein – wenn auch für mich oft sehr strapaziöser – Prozess kollektiver Zusammenarbeit. Man fragt sich, ob man je fertig wird. Aber solange ich das Gefühl habe, dass wir vorankommen und jeder Entwurf besser ist als der vorhergehende, funktioniert das Prinzip. Es ist ein wechselseitiges Geben und Nehmen, und am Ende ist es ganz tröstlich, dass irgendwie jeder dazu beigetragen hat, das Drehbuch noch besser zu machen.
Hawthorne hatte dafür kein Verständnis. Er war wie eine Betonmauer, und wenn er einmal beschlossen hatte, dass etwas falsch war, dann ließ er es einfach nicht durchgehen. Es gab eine Szene, in der mein Detektiv mit einem Vorgesetzten zusammentrifft, einem Chief Superintendent. Der Superintendent bittet ihn, Platz zu nehmen, und der Detektiv antwortet: »Ich stehe lieber, wenn's Ihnen nichts ausmacht, Sir.« Es war nur eine Kleinigkeit. Ich wollte damit zeigen, dass meine Hauptfigur Probleme mit der Autorität hatte, aber Hawthorne wollte davon nichts hören.
»So etwas kommt nicht vor«, sagte er trocken. Wir saßen irgendwo vor einem Starbucks, ich weiß nicht mehr, welchem. Das Drehbuch lag zwischen uns auf dem Tisch. Wie immer trug Hawthorne Anzug und Krawatte. Er rauchte die letzte Zigarette und benutzte die leere Packung als Aschenbecher.
»Warum nicht?«
»Wenn dein Chef dir sagt, dass du dich setzen sollst, dann setzt du dich hin.«
»Er setzt sich ja.«
»Ja. Aber vorher streitet er rum. Was soll das? Er macht sich doch bloß zum Deppen.«
Hawthorne fluchte übrigens die ganze Zeit. Wenn ich seine Äußerungen wörtlich wiedergeben würde, müsste ich in jeder zweiten Zeile das F-Wort benutzen.
Ich versuchte es zu erklären. »Die Schauspieler verstehen genau, was ich meine«, sagte ich. »Es ist nur eine Kleinigkeit. Es leitet die Szene ein, zeigt aber sofort, wie die beiden Männer miteinander umgehen.«
»Kann sein, Tony. Aber es stimmt nicht. Es ist bloß ein Haufen Scheiß.«
Ich versuchte ihm zu erklären, dass es viele verschiedene Wahrheiten gibt und dass die Fernseh-Wahrheit vielleicht nur sehr bedingt etwas mit der wirklichen Wahrheit zu tun hat. Ich sagte, dass unsere Vorstellungen von Polizisten, Ärzten, Krankenschwestern, ja sogar von Verbrechern im Wesentlichen dem entspricht, was wir auf dem Bildschirm sehen, und nicht umgekehrt. Aber Hawthorne war von seiner Meinung nicht abzubringen. Er hatte mir beim Drehbuch geholfen, aber jetzt fand er es nicht mehr glaubwürdig, und deshalb gefiel es ihm nicht. Wir stritten über alles, über jede Szene, die mit der Polizei zu tun hatte. Er sah nur noch die Formulare, die Uniformen, die Schreibtischlampen. Zur Geschichte fand er überhaupt keinen Zugang.
Ich war sehr erleichtert, als alle fünf Drehbücher fertig waren und ich mich nicht mehr mit ihm auseinandersetzen musste. Als noch ein paar Fragen geklärt werden mussten, überließ ich es dem Büro, ihm die nötigen E-Mails zu schreiben. Wir drehten die Serie in Suffolk und in London. Die Rolle des Detektivs spielte ein brillanter Schauspieler, Charlie Creed-Miles, und witzigerweise sah er Hawthorne äußerlich ziemlich ähnlich. Aber das war noch nicht alles. Hawthorne beschäftigte mich, und ich hatte nicht ganz unabsichtlich einen Teil seiner dunklen Seite in den Detektiv hineingelegt. Er hieß allerdings nicht »Daniel«, sondern »Mark« und nicht »Hawthorne«, sondern »Wenborn«, aber einen biblischen Vornamen hatten sie beide. So etwas mache ich öfter. Als ich ihn am Ende der fünften Episode sterben ließ, musste ich lächeln.
Ich war neugierig, was er jetzt wollte. Aber trotzdem empfand ich ein Unbehagen, als ich an jenem Nachmittag zum J + A-Café hinunterschlenderte. Hawthorne gehörte nicht zu meiner Welt, und ehrlich gesagt, hatte ich auch nicht das Gefühl, ihn zu brauchen. Andererseits hatte ich nichts zu Mittag gegessen, und J + A serviert den besten Kuchen in London. Das Café liegt in einer kleinen Seitengasse der Clerkenwell Road, und wegen dieser versteckten Lage findet man meist einen Platz. Hawthorne wartete draußen auf mich. Er saß an einem der Tische bei einem Kaffee und rauchte eine Zigarette. Er trug genau dieselben Sachen wie beim letzten Mal, als ich ihn gesehen hatte. Derselbe Anzug, dieselbe Krawatte, derselbe Mantel. Er hob den Blick, als ich eintraf, und nickte. Das war auch schon die ganze Begrüßung.
»Was macht die Serie?«, fragte er.
»Sie hätten zur Voraufführung kommen sollen«, sagte ich. Wir hatten ein Hotel in London gemietet und die ersten beiden Episoden gezeigt. Hawthorne war eingeladen gewesen.
»Ich hatte zu tun.«
Eine Kellnerin kam heraus, und ich bestellte einen Tee und eine Victoriatorte. Ich weiß, dass ich kein solches Süßzeug essen sollte, aber versuchen Sie mal, jeden Tag acht Stunden allein zu verbringen. Früher habe ich zwischen den Kapiteln geraucht, aber das habe ich vor dreißig Jahren aufgegeben. Aber Kuchen ist wahrscheinlich genauso schlimm.
»Wie geht's?«, fragte ich.
Er zuckte die Achseln. »Kann nicht klagen.« Er warf mir einen prüfenden Blick zu. »Sind Sie auf dem Land gewesen?«
Tatsächlich war ich erst am Morgen aus Suffolk zurückgekommen. Meine Frau und ich waren ein paar Tage auf dem Land gewesen. »Ja«, sagte ich vorsichtig.
»Und Sie haben einen neuen Hund. So einen ganz jungen.«
Ich sah ihn misstrauisch an. Das war so typisch für ihn. Ich hatte niemandem gesagt, dass ich nicht in London sein würde. Und ich hatte es auch nicht herumgetweetet. Außerdem gehörte der Hund unseren Nachbarn. Wir hatten bloß auf ihn aufgepasst, während sie verreist waren. »Woher wissen Sie das?«, fragte ich.
»Das war nur eine Vermutung. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir vielleicht helfen.«
»Wobei denn?«
»Ich möchte, dass Sie über mich schreiben.«
Hawthorne hat mich noch jedes Mal überrascht, wenn ich ihn getroffen habe. Bei den meisten Leuten weiß man ja, woran man ist. Man stellt eine Beziehung her, man lernt sie kennen, und danach stehen die Regeln mehr oder weniger fest. Aber bei ihm war das nie so. Er hatte diese eigenartig wechselhafte Natur, er war wie Quecksilber und ließ sich nicht festlegen. Jedes Mal wenn ich dachte, ich wüsste, wo's hingeht, bewies er mir das Gegenteil.
»Wie meinen Sie das?«, fragte ich.
»Ich möchte, dass Sie ein Buch über mich schreiben.«
»Warum sollte ich das tun?«
»Wegen dem Geld.«
»Sie wollen mich dafür bezahlen?«
»Nein. Ich dachte, wir machen fifty-fifty.«
Neue Gäste näherten sich und setzten sich an den Tisch neben uns. Während sie an uns vorbeigingen, überlegte ich, was ich sagen könnte. Ich wusste sofort, dass ich ablehnen musste, aber ich hatte Angst, einfach nein zu sagen.
»Ich verstehe nicht ganz«, sagte ich. »Was für eine Art Buch meinen Sie?«
Hawthorne sah mich mit seinen Kinderaugen an. »Lassen Sie es mich erklären«, sagte er, als ob es längst klar wäre. »Sie wissen ja, dass ich gelegentlich fürs Fernsehen arbeite. Und Sie haben wahrscheinlich gehört, dass ich von der Met gefeuert wurde. Na ja, das war deren Problem. Darum geht es mir gar nicht. Die Sache ist die: Ich arbeite auch als Berater. Für die Polizei. Natürlich ganz inoffiziell. Sie setzen mich ein, wenn etwas Ungewöhnliches vorkommt. Die meisten Fälle sind ja sehr einfach, aber manche sind etwas raffinierter. Und wenn etwas außerhalb der alltäglichen Routine liegt, dann wenden sie sich an mich.«
»Wirklich?« Ich fand es nicht leicht, das zu glauben.
»So ist das bei der Polizei heute. Die ganzen Einsparungen, sie haben niemand mehr, der die Arbeit macht. Haben Sie von der Group 4 gehört und von Serco? Das sind alles nur Nieten, aber sie sind richtig gut im Geschäft. Sie haben denen Ermittler geschickt, die nicht mal den Ausgang aus einer Papiertüte finden würden, aber das war denen egal. Und das ist noch nicht alles. Früher hatten wir große Labore in Lambeth, denen wir Blutproben und solche Sachen geschickt haben, aber die haben das alles verkauft und lassen es von Privatfirmen machen. Das dauert zweimal so lange und kostet das Doppelte, aber das scheint die nicht weiter zu stören. Und ich bin so was Ähnliches. Ich bin auch so eine externe Ressource.«
Er machte eine Pause, um sicherzugehen, dass ich ihm folgen konnte. Ich nickte. Er zündete sich eine neue Zigarette an und fuhr fort.
»Ich verdiene recht gut dabei. Ich kriege einen Tagessatz und Spesen. Allerdings – und ich erwähne das ungern – bin ich im Augenblick etwas knapp. Es werden einfach nicht genug Leute ermordet. Und als ich Sie bei dieser Fernsehproduktion kennengelernt und gehört habe, dass Sie Bücher schreiben, bin ich auf die Idee gekommen, dass wir uns vielleicht helfen könnten. Fifty-fifty. Ich kriege einen interessanten Auftrag. Und Sie schreiben dann über mich.«
»Aber ich kenne Sie doch kaum«, sagte ich.
»Sie werden mich schon kennenlernen. Ich habe jetzt gerade so einen Fall. Ich stehe noch ganz am Anfang, aber ich glaube, das wäre genau das Richtige für Sie.«
Die Kellnerin kam mit meinem Tee und dem Kuchen, aber ich wünschte mir dringend, ich hätte ihn nicht bestellt. Ich wollte nur noch nach Hause.
»Wie kommen Sie auf die Idee, dass irgendjemand etwas über Sie lesen will?«, fragte ich.
»Ich bin Detektiv. Die Leute lesen gern Detektivgeschichten.«
»Aber Sie sind kein richtiger Detektiv. Sie sind doch entlassen worden. Warum eigentlich?«
»Darüber will ich nicht reden.«
»Na ja, wenn ich über Sie schreiben soll, müssten Sie's mir schon erzählen. Ich müsste wissen, wo Sie wohnen, ob Sie verheiratet sind oder nicht, was Sie zum Frühstück essen und was Sie in Ihrer freien Zeit machen. Das sind die Gründe, weshalb die Leute so etwas lesen. Deshalb lesen sie Detektivgeschichten.«
»Glauben Sie wirklich?«
»Ja!«
Er schüttelte den Kopf. »Da bin ich anderer Ansicht. Das Wort ist Mord. Das ist es, worauf es ankommt.«
»Hören Sie – es tut mir echt leid.« Ich versuchte, es ihm so behutsam wie möglich zu sagen. »Es ist eine prima Idee, und ich bin sicher, Sie arbeiten an einem sehr interessanten Fall, aber ich hab viel zu viel zu tun. Außerdem mache ich so etwas nicht. Ich schreibe über fiktive Ermittler. Ich habe gerade einen Roman über Sherlock Holmes geschrieben. Ich habe über Poirot und Inspector Barnaby geschrieben. Ich bin Romanautor. Sie brauchen jemanden, der über wahre Verbrechen schreibt, das nennt sich True Crime.«
»Was ist denn der Unterschied?«
»Das ist ein Riesenunterschied. Ich habe die volle Kontrolle über meine Geschichten. Ich weiß gern vorher, worüber ich schreibe. Ich erfinde das Verbrechen, die Spuren und alles Übrige. Das ist der halbe Spaß. Wenn ich Ihnen hinterherlaufen und alles aufschreiben müsste, was Sie entdecken und was Sie sagen – was hätte ich davon? Tut mir leid. Das interessiert mich nicht.«
Er betrachtete mich über die Zigarette hinweg. Er sah weder überrascht noch beleidigt aus, so als hätte er gewusst, was ich sagen würde. »Ich könnte wetten, dass sich das prima verkauft«, sagte er. »Und es wäre ganz leicht für Sie. Ich würde Ihnen alles sagen, was Sie wissen müssen. Wollen Sie gar nicht wissen, woran ich arbeite?«
Das wollte ich tatsächlich nicht. Aber er redete einfach weiter, ehe ich es verhindern konnte. »Eine Frau betritt ein Bestattungsunternehmen in South Kensington. Sie organisiert ihre eigene Beerdigung bis ins kleinste Detail. Und noch am selben Tag, sechs Stunden später, ermordet sie jemand … marschiert in ihr Haus und erwürgt sie. Das ist doch ziemlich ungewöhnlich, finden Sie nicht?«
»Wer war denn die Dame?«, fragte ich.
»Ihr Name tut nichts zur Sache. Aber sie war reich und hatte einen berühmten Sohn. Und dann ist da noch etwas: Soweit wir wissen, hatte sie keinen einzigen Feind. Alle Welt mochte sie. Deshalb hat man mich hinzugezogen: Es erscheint vollkommen sinnlos.«
Einen kurzen Moment lang geriet ich in Versuchung.
Das Schwierigste bei Mordgeschichten ist immer die Handlung, und zu diesem Zeitpunkt hatte ich einfach keine Ideen mehr. Es gibt nun mal nur eine bestimmte Anzahl von Gründen, warum man Leute umbringt. Man tut es, weil man etwas von ihnen will: ihr Geld, ihre Frau, ihren Job. Man tut es, weil man vor ihnen Angst hat. Sie wissen etwas über dich und sie bedrohen dich. Oder man bringt sie aus Rache um, weil sie dir bewusst oder unbewusst etwas angetan haben. Vielleicht bringt man sie auch nur aus Versehen um. Nach zweiundzwanzig Episoden von Foyle's War hatte ich so ziemlich jede Variante einmal durchexerziert.
Das nächste Problem sind die Recherchen. Wenn ich beschließe, dass der Täter – sagen wir – ein Chefkoch in einem Hotel ist, dann muss ich seine Welt erschaffen. Ich muss das Hotel besuchen. Ich muss wissen, wie ein Restaurant funktioniert. Um die Figur glaubwürdig zu machen, muss ich hart arbeiten. Dabei ist das vielleicht nur die erste von zwanzig oder gar dreißig Figuren, die mir im Kopf herumspuken und die ich erfinden muss. Ich muss die Vorgehensweise der Polizei kennen: Fingerabdrücke, Gerichtsmedizin, DNA und alles Übrige. Es kann Monate dauern, bevor ich das erste Wort schreibe. Ich war müde. Ich wusste nicht, ob ich die Energie hatte, schon wieder ein neues Buch anzufangen.
De facto bot mir Hawthorne allerdings eine Abkürzung an. Er servierte mir alles auf einem Silbertablett. Und er hatte natürlich recht. Der Fall klang interessant. Eine Frau betritt ein Bestattungsinstitut. Das war schon mal eine gute Eröffnung. Ich konnte mir das erste Kapitel schon vorstellen. Ein sonniger Frühlingsmorgen. Eine schicke Gegend. Eine Frau überquert die Straße …
Trotzdem war es undenkbar.
»Woher wussten Sie das?«, fragte ich plötzlich.
»Was?«
»Gerade eben. Sie haben mir gesagt, ich wäre auf dem Land gewesen und wir hätten jetzt einen Hund. Wer hat Ihnen das erzählt?«
»Niemand hat mir das erzählt.«
»Und woher haben Sie's dann gewusst?«
Er verzog das Gesicht, als hätte er keine Lust, mir das zu sagen. Aber er wollte ja etwas von mir, und deshalb hatte ich für den Augenblick mal die Oberhand. »Im Profil Ihrer Schuhsohlen klebt Sand«, sagte er. »Das hab ich gesehen, als Sie das eine Bein über das andere geschlagen haben. Also sind Sie entweder über eine Baustelle gewandert oder Sie waren irgendwo an der Küste. Ich habe gehört, dass Sie eine Wohnung in Orford haben, deshalb bin ich davon ausgegangen, dass Sie dort gewesen sind.«
»Und der Hund?«
»Da ist ein Pfotenabdruck auf Ihren Jeans. Direkt unter dem Knie.«
Ich untersuchte den Stoff. Tatsache: Da war ein Fleck, so schwach, dass ich ihn nicht bemerkt hätte. Aber er schon.
»Warten Sie mal«, sagte ich »Woher wussten Sie, dass es ein junger Hund war? Es hätte ja auch ein kleiner Hund gewesen sein können. Und woher wussten Sie, dass ich ihm nicht einfach auf der Straße begegnet bin?«
Er sah mich traurig an. »Irgendjemand hat Ihren linken Schnürsenkel gründlich zerkaut«, sagte er. »Ich glaube nicht, dass Sie das selbst waren.«
Ich schaute gar nicht erst nach. Ich war beeindruckt, das muss ich zugeben. Und ich ärgerte mich, dass ich nicht selbst darauf gekommen war. »Es tut mir leid«, sagte ich. »Nach dem, was Sie sagen, ist es bestimmt ein interessanter Fall, und ich bin sicher, Sie finden einen Autor, der das für Sie schreibt. Aber wie ich gesagt habe: Sie brauchen einen Journalisten oder so etwas. Selbst wenn ich wollte, ich könnte das gar nicht. Ich mache andere Dinge.«
Ich fürchtete, seine Reaktion könnte heftig ausfallen. Aber wieder erwischte er mich auf dem falschen Fuß. Er zuckte bloß mit den Schultern. »Ja. Okay. War nur ein Gedanke.« Er stand auf, und seine Hand fuhr in die Hosentasche. »Soll ich das bezahlen?«
Er meinte den Tee und den Kuchen. »Nein. Ist schon gut. Ich zahl das dann«, sagte ich.
»Ich hab einen Kaffee gehabt.«
»Den zahl ich gleich mit.«
»Gut. Wenn Sie sich's noch anders überlegen, wissen Sie ja, wie Sie mich erreichen.«
»Ja, natürlich. Ich kann ja mal mit meiner Agentin reden, wenn Sie wollen. Vielleicht kennt die jemanden.«
»Nein. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich finde schon jemand.« Er wandte sich ab und ging davon.
Ich aß meinen Kuchen. Es wäre eine Schande gewesen, ihn stehenzulassen. Dann ging ich wieder nach Hause und verbrachte den Rest des Nachmittags mit Lesen. Ich versuchte, nicht weiter an Hawthorne zu denken, aber ich vermochte ihn nicht aus meinem Kopf zu verbannen.
Wenn man Schriftsteller ist, hauptberuflich, dann gehört es zu den schwierigsten Dingen, Arbeit abzulehnen. Man schlägt eine Tür zu, die sich womöglich nie wieder öffnet, und ständig fragt man sich, was man auf der anderen Seite verpasst hat. Vor Jahren fragte mich eine Produzentin, ob ich Lust hätte, an einem Musical mit den Songs einer schwedischen Popgruppe mitzuarbeiten. Ich lehnte ab – und deshalb stehe ich nicht auf den Plakaten von Mamma Mia! (und bin auch nicht in den Genuss der Tantiemen gekommen). Nicht, dass es mir leidtut. Vielleicht wäre die Show ja gar kein solcher Erfolg geworden, wenn ich sie geschrieben hätte. Aber die Sache zeigt doch, mit welchen Unsicherheiten Autoren jeden Tag leben. Ein bizarres Verbrechen, das zufällig wahr ist. Eine Frau geht in ein Bestattungsinstitut. Hawthorne, ein merkwürdiger, komplizierter, aber wirklich brillanter Detektiv wird als eine Art Berater herangezogen. Hatte ich wieder einen Fehler gemacht, als ich sein Angebot ablehnte? Ich nahm mein Buch und las weiter.
Zwei Tage später war ich in Hay-on-Wye.
Es ist erstaunlich, wie viele literarische Festivals es überall auf der Welt gibt. Ich kenne Autoren, die gar nicht mehr schreiben, sondern ihre Zeit damit verbringen, von einem Festival zum nächsten zu reisen. Ich frage mich manchmal, was ich wohl gemacht hätte, wenn ich Stotterer wäre oder unter chronischer Schüchternheit litte. Der moderne Autor muss öffentlich auftreten können, oft auch vor großem Publikum. Es ist fast so, als wäre man ein Comedian. Bloß dass sich die Fragen nie ändern und dass man am Ende immer dieselben Witze erzählt.
In Harrogate geht es um Krimis, um Kinderbücher in Bath, um Sciencefiction in Glasgow und um Lyrik in Aldeburgh. Man hat das Gefühl, in jeder Stadt im Vereinigten Königreich gibt es ein Literaturfestival, aber das Festival in Hay-on-Wye, das auf einer ziemlich matschigen Wiese am Rand eines Marktfleckens in Wales stattfindet, ist eins der berühmtesten. Die Leute kommen von weit her, um daran teilzunehmen, und über die Jahre haben zwei US-Präsidenten, mehrere große Eisenbahnräuber und J. K. Rowling dort gesprochen. Ich durfte in einem Zelt reden, in dem fünfhundert junge Leute saßen. Wie üblich waren auch ein paar Erwachsene da. Oft kommen Leute zu meinen Veranstaltungen und hören sich vierzig Minuten Alex Rider an, um dann noch ein bisschen über Foyle's War reden zu können.
Die Veranstaltung war gut gelaufen. Die Kinder waren munter gewesen und hatten ein paar gute Fragen gestellt. Ich hatte ein paar Dinge über Foyle sagen können. Sechzig Minuten waren vorbei, und ich hatte gerade ein Zeichen erhalten, ich solle allmählich zum Schluss kommen, als etwas Eigenartiges passierte.
In der ersten Reihe saß eine Frau, die ich für eine Lehrerin oder Bibliothekarin gehalten hatte. Sie war ungefähr vierzig und sah ziemlich normal aus. Sie hatte ein rundes Gesicht und helles Haar und trug ihre Brille an einer Kette um den Hals. Aufgefallen war sie mir, weil sie offenbar allein gekommen war und sich für nichts von dem, was ich sagte, besonders zu interessieren schien. Sie hatte über keinen meiner Scherze gelacht. Ich begann zu fürchten, dass sie eine Journalistin sein könnte. Die Zeitungen schicken heutzutage oft Journalisten, wenn man irgendwo auftritt, und dann wird jeder Scherz oder unbedachte Kommentar aus dem Zusammenhang gerissen und gegen einen verwendet. Ich war also sehr auf der Hut, als sie die Hand hob und eine der Assistentinnen ihr das Saalmikrofon in die Hand drückte.
»Ich habe mich gefragt«, sagte sie, »warum Sie immer ausgedachte Sachen schreiben? Warum schreiben Sie nicht mal was Reales?«
Die meisten Dinge, die ich bei solchen Gelegenheiten gefragt werde, bin ich schon oft gefragt worden. Wo nehme ich meine Ideen her? Welches sind meine Lieblingsfiguren? Wie lange dauert es, ein Buch zu schreiben? Aber das, was diese Frau gefragt hatte, war mir neu. Das hatte mich noch nie jemand gefragt, und ich war ein bisschen pikiert. Ihr Tonfall war nicht besonders aggressiv, aber die Tendenz irritierte mich trotzdem.
»Foyle's War ist durchaus real«, erwiderte ich. »Jede Episode beruht auf wahren Ereignissen.«
Ich wollte erklären, wie viel ich jedes Mal recherchiere, dass ich mich die ganze letzte Woche mit dem Atomspion Alan Nunn May beschäftigt hatte, dessen Verrat womöglich den Hintergrund für die nächste Folge von Foyle abgeben würde. Aber die Frau unterbrach mich.
»Ich glaube Ihnen gern, dass Sie sich auf historische Dinge beziehen, aber was ich sagen will: Die Verbrechen sind nicht echt. Und Ihre anderen Fernsehserien, Poirot und Inspector Barnaby, die sind von vornherein bloß Erfindung. Sie schreiben Geschichten über einen vierzehnjährigen Spion. Ich weiß, dass viele Kinder das mögen, aber es ist reine Fantasie. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich wundere mich schon ein bisschen, dass Sie sich für die reale Welt so gar nicht zu interessieren scheinen.«
»Was ist denn die reale Welt?«, konterte ich.
»Ich meine halt richtige Menschen …«
Die Kinder wurden allmählich unruhig. Es wurde Zeit, der Sache ein Ende zu machen. »Ich schreibe nun mal Geschichten«, sagte ich. »Das ist mein Beruf.«
»Haben Sie nicht die Befürchtung, dass man Ihre Geschichten für irrelevant halten könnte?«
»Ich glaube nicht, dass sie aus der Wirklichkeit kommen müssen, um relevant zu sein.«
»Tut mir leid. Ich mag Ihre Bücher. Aber da bin ich anderer Ansicht.«
Angesichts dessen, was mir Hawthorne ein paar Tage vorher angeboten hatte, war das ein eigenartiger Zufall. Ich sah mich noch nach der Frau um, ehe ich das Zelt verließ, aber sie kam nicht, um sich ein Buch signieren zu lassen, und als ich mit dem Signieren fertig war, war sie verschwunden. Im Zug auf dem Weg zurück nach London musste ich ständig daran denken, was sie gesagt hatte. Hatte sie womöglich recht? Enthielten meine Bücher tatsächlich zu viel Fantastisches? Ich bemühte mich gerade um Anerkennung als Autor für Erwachsene, aber mein erster Roman in dieser Richtung Das Geheimnis des Weißen Bandes war von der Gegenwart weit entfernt. Einige meiner Drehbücher wie Unrecht! spielten zwar im London des 21. Jahrhunderts, aber es stimmte schon: Ich hatte viel Zeit mit meinen Fantasien verbracht, und wenn ich nicht aufpasste, würde ich womöglich den Kontakt zur Realität verlieren. Vielleicht war das sogar schon geschehen? Vielleicht würde mir ein harter Zusammenprall mit der Wirklichkeit richtig guttun?
Der Weg von Hay-on-Wye nach Paddington ist sehr weit. Und als ich in London angekommen war, hatte ich mich entschlossen. Sobald ich in meiner Wohnung war, griff ich zum Telefonhörer.
»Hawthorne?«
»Tony!«
»Okay. Fifty-fifty. Ich mache mit.«
3 Das erste Kapitel
Mein erstes Kapitel gefiel Hawthorne nicht.
Ich sage das schon an dieser Stelle, obwohl ich es ihm erst viel später und auch dann nur sehr widerstrebend gezeigt habe. Ich erinnerte mich nur allzu gut an seine Reaktion auf das Drehbuch zu Unrecht! und hätte das erste Kapitel gern noch etwas länger geheim gehalten. Aber er bestand darauf, es zu lesen, und da wir gleichberechtigte Partner sein sollten, konnte ich ihm das nicht abschlagen. Auf der anderen Seite möchte ich gern erklären, wie dieses Buch zustande gekommen ist, welches die Regeln waren, gewissermaßen. Es sind meine Worte, aber es waren seine Handlungen, Maßnahmen und Erkenntnisse. Und die Wahrheit ist, dass sie am Anfang nicht richtig zusammenpassten.
Wir saßen in einem der vielen Cafés, die sich durch unsere Ermittlungen zogen wie Satzzeichen. Ich hatte ihm die ersten Seiten geschickt, und ich wusste gleich, dass ich ein Problem hatte, als ich den über und über mit roten Kreuzen und Kringeln bedeckten Ausdruck sah, den er aus der Tasche zog. Ich verteidige meine Texte mit Klauen und Zähnen. Man kann durchaus sagen, dass ich über jedes einzelne Wort lange nachdenke. (Ist »einzelne« wirklich nötig? Wäre »wirklich« nicht besser als »durchaus«? Ist »lange« nicht doch übertrieben?) Als ich mich bereit erklärt hatte, mit Hawthorne zu arbeiten, war ich davon ausgegangen, dass er zwar die Verantwortung für die Ermittlungen trug, sich beim eigentlichen Erzählen aber zurückhalten würde. In diesem Punkt wurde ich rasch eines Besseren belehrt.
»Es stimmt alles nicht, Tony«, erklärte Hawthorne sofort. »Sie führen die Leute total in die Irre.«
»Wie meinen Sie das?«, fragte ich.
»Gleich der erste Satz. Völlig falsch.«
Ich las noch einmal, was ich geschrieben hatte: An einem hellen Frühlingsmorgen, dessen blasses Sonnenlicht weit mehr Wärme versprach, als der Tag dann zu liefern vermochte, überquerte Diana Cowper kurz nach elf Uhr die Fulham Road und betrat ein Beerdigungsinstitut.
»Ich weiß nicht, was falsch daran sein soll«, sagte ich. »Es war doch ungefähr elf. Und sie ist in ein Beerdigungsinstitut gegangen.«
»Aber nicht so, wie Sie es beschreiben.«
»Sie hat den Bus genommen!«
»Richtig. Sie ist an ihrem Ende der Fulham Road eingestiegen. Das wissen wir dank der Überwachungskamera im Bus. Der Fahrer hat sich ebenfalls an sie erinnert und eine entsprechende Aussage bei der Polizei gemacht. Trotzdem gibt's ein Problem, Sportsfreund. Warum behaupten Sie, sie wäre nach dem Aussteigen über die Straße gegangen?«
»Warum nicht?«
»Weil sie es nicht getan hat. Wir reden von der Buslinie 14. Sie ist in Chelsea Village eingestiegen. Das ist die mit ›U‹ bezeichnete Haltestelle direkt gegenüber von der Britannia Road. Sie ist über Chelsea Football Club, Hortensia Road, Edith Grove, Chelsea & Westminster Hospital und Beaufort Street zur Haltestelle ›HJ‹ Old Church Street gefahren, und dort ist sie ausgestiegen.«
»Sie haben eine fabelhafte Kenntnis der Londoner Busrouten«, sagte ich. »Aber ich weiß nicht recht, worauf das hinauslaufen soll.«
»Sie brauchte die Straße nicht zu überqueren. Als sie aus dem Bus ausstieg, war sie bereits auf der richtigen Straßenseite.«
»Ist das denn so wichtig?«
»Ja, das könnte durchaus wichtig sein. Wenn man sagt, sie hat die Straße überquert, dann bedeutet das, dass sie zuvor woanders gewesen sein muss. Vielleicht war sie ja bei einer Bank und hat einen Haufen Geld abgehoben. Sie könnte sich mit jemandem gestritten haben, was dann später der Grund dafür war, dass sie ermordet wurde. Die betreffende Person könnte ihr gefolgt sein und gesehen haben, wo sie hinging. Sie hätte jemandem den Weg versperrt haben können, was dann zu einem Streit führte. Schauen Sie mich nicht so an! Wutanfälle im Straßenverkehr führen zu viel mehr Gewaltverbrechen, als Sie vielleicht annehmen. Aber die Tatsachen waren ganz andere: Sie ist allein in ihrem Haus aufgestanden, sie hat gefrühstückt und ist in einen Bus gestiegen. Das war das Erste, was sie an diesem Tag getan hat.«
»Und was soll ich jetzt Ihrer Meinung nach schreiben?«
Er hatte bereits etwas aufgeschrieben. Er gab mir das Blatt und ich las: Um elf Uhr siebzehn stieg Diana Jane Cowper an der Haltestelle HJ (Old Church Street) aus dem Bus Nr. 14. Sie ging auf dem Bürgersteig fünfundzwanzig Meter weit zurück und betrat das Bestattungsinstitut Cornwallis & Söhne.
»Das schreibe ich nicht«, sagte ich. »Das liest sich ja wie ein Polizeibericht.«
»Zumindest ist es genau«, sagte Hawthorne. »Und was hat das Glöckchen in Ihrer Geschichte zu suchen?«
»Welches Glöckchen?«
»Im vierten Absatz. Hier! Sie schreiben, es hätte geklingelt, als Mrs Cowper das Bestattungsinstitut betrat. Aber ich habe kein Glöckchen bemerkt. Und der Grund dafür ist, dass es kein Glöckchen gibt.«
Ich versuchte, ruhig zu bleiben. Ich hatte es ja schon früher bemerkt: Wenn Hawthorne es darauf anlegte, konnte er mich schneller auf die Palme bringen als jeder andere Mensch, den ich kannte.
»Das Glöckchen habe ich da reingehängt, um Atmosphäre zu schaffen«, erklärte ich. »Sie müssen mir schon eine gewisse erzählerische Freiheit lassen. Ich wollte zeigen, wie traditionell und altmodisch das Unternehmen Cornwallis & Söhne ist – und das war der einfachste Weg.«
»Vielleicht. Aber es verfälscht die Geschichte. Was ist, wenn ihr jemand gefolgt ist und dann gehört hat, was sie gesagt hat?«
»Sie meinen diesen Verkehrsteilnehmer, dem sie den Weg versperrt hat?«, fragte ich sarkastisch. »Oder jemand, den sie in der Bank getroffen hat? Meinen Sie wirklich?«
Hawthorne zuckte die Achseln. »Sie sind derjenige, der behauptet, dass zwischen Mrs Cowpers Besuch im Bestattungsunternehmen und ihrer Ermordung ein Zusammenhang bestünde. Zumindest suggerieren Sie das Ihren Lesern.« Er betonte das Wort »Lesern« auf der ersten Silbe, als ob es ein Schimpfwort wäre. »Aber man muss auch die Alternativen ins Auge fassen. Vielleicht waren der Besuch und die Ermordung auch nur ein Zufall. Obwohl ich ehrlich sein will – ich mag keine Zufälle. Ich habe zwanzig Jahre lang in der Verbrechensbekämpfung gearbeitet, und ich habe immer wieder festgestellt, dass alles seinen Platz hat. Vielleicht wusste Mrs Cowper ja auch, dass sie sterben würde. Vielleicht war sie bedroht worden und arrangierte ihre Beerdigung, weil sie wusste, dass es keinen Ausweg gab. Das ist eine Möglichkeit, aber warum ist sie dann nicht zur Polizei gegangen? Und die dritte Möglichkeit: Jemand hat mitgekriegt, was sie vorhatte. Und das hätte jeder sein können. Der Betreffende hätte ihr von der Straße in das Institut folgen und alles mithören können, weil es eben kein Glöckchen an der Ladentür gibt. Jeder konnte kommen und gehen, ohne dass es jemand gehört hätte. In Ihrer Fassung der Geschichte ist das allerdings nicht so.«
»Okay«, sagte ich. »Das Glöckchen werde ich rausnehmen.«
»Und den Montblanc-Füller auch.«
»Warum?« Ich stoppte ihn, ehe er antworten konnte. »In Ordnung. Ist egal. Den streiche ich auch.«
Er zupfte und zerrte an den Blättern des Manuskripts, als ob es ihm schwerfiele, auch nur einen einzigen Satz zu finden, der ihm gefiel. »Mit Ihren Informationen«, sagte er schließlich, »sind Sie sehr selektiv.«
»Was meinen Sie damit?«
»Na ja, Sie schreiben, dass Mrs Cowper nur öffentliche Verkehrsmittel benutzt hat. Aber Sie erklären nicht, warum.«
»Ich sage doch, dass sie exzentrisch war.«


![Der Tote aus Zimmer 12. Susan Ryeland ermittelt [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/f29b5c5fba27049bb29f9e3f1876fde2/w200_u90.jpg)


![Mord in Highgate. Hawthorne ermittelt [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/089fc19c4ec8b4ecb2d6573d5df1cc74/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Stormbreaker [Band 1] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a50942d1747f6f8e55b49793c0526659/w200_u90.jpg)

![Alex Rider. Gemini-Project [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5c4cca9cd875693fa38bd1fe5643672c/w200_u90.jpg)
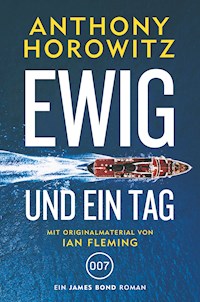

![Wenn Worte töten. Hawthorne ermittelt [Band 3] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/fd859681bbb599e306846498660819cf/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Skeleton Key [Band 3] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/320ebe043418750c249478304f43c699/w200_u90.jpg)

![Alex Rider. Ark Angel [Band 6] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0edb9586d5f912fe388eb13780edd96f/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Scorpia [Band 5] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8818b99503b4fee6aa78484cc0275aa9/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Eagle Strike [Band 4] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/e46a21054c8da2b3c0d46afe9bc7c865/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Scorpia Rising [Band 9] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3c94c2aaec60d2997fb8da5488146852/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Crocodile Tears [Band 8] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3d4c3c2ca6b7c5bf541a32fa57f1bbf3/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Snakehead [Band 7] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/18daaba796e373f6fd5944e2f667ed7b/w200_u90.jpg)









