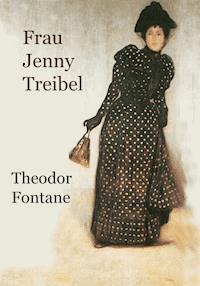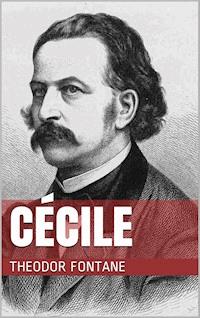Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In 35 Essays, zumeist verfasst für die preußischen Zeitungen die seine Auftraggeber waren, berichtet Fontane hier von seinem fünfmonatigen Aufenthalt in der englischen Haupstadt. Muntere Beobachtungen aus der lebhaften Großstadt reihen sich ein neben kulturellen Exkursen, während ein unermüdlich prüfendes Auge Vergleiche zur deutschen Heimat zieht. Ein faszinierendes Stadtporträt, das oft mehr über den Autor als über die Metropole London offenbart.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Theodor Fontane
Ein Sommer in London
Saga
Ein Sommer in London
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1854, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726997415
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Von Gravesend bis London
Das ist die englische Küste! Durch den Morgennebel schimmern die Türme von Yarmouth. Ein gut Stück Weges noch in der Richtung nach Süden, und die Themsemündung liegt vor uns. Da ist sie: Sheerneß mit seinen Baken und Tonnen taucht auf. Nun aber ist es, als wüchsen dem Dampfer die Flügel, immer rascher schlägt er mit seinen Schaufeln die hochaufspritzende Flut, und die prächtige Bucht durchfliegend, von der man nicht weiß, ob sie ein breiter Strom oder ein schmales Meer ist, trägt er uns jetzt, an Gravesend vorbei, in den eigentlichen Themsestrom hinein.
Alles Große wirkt in die Ferne: wir fühlen ein Gewitter lange bevor es über uns ist; große Männer haben ihre Vorläufer, so auch große Städte. Gravesend ist ein solcher Herold, es ruft uns zu: »London kommt!« und unruhig, erwartungsvoll schweifen unsere Blicke die Themse hinauf. Des Dampfers Kiel durchschneidet pfeilschnell die Flut, aber wir verwünschen den saumseligen Kapitän: unsere Sehnsucht fliegt schneller, als sein Schiff – das ist sein Verbrechen. Und doch lebt London schon rings um uns her. Gravesend liegt nicht im Bann von London, aber doch in seinem Zauberbann. Noch fünf Meilen haben wir bis zur alten City, noch an großen volkreichen Städten müssen wir vorbei, und doch sind wir bereits mitten im Getriebe der Riesenstadt; Greenwich, Woolwich und Gravesend gelten noch als besondere Städte und doch sind sie's nicht mehr; die Äcker und Wiesen, die zwischen ihnen und London liegen, sind nur erweiterte Hyde-Parks; von Smithfield nach Paddington, quer durch die Stadt hindurch, ist eine schlimmere Reise wie von London-Bridge bis Gravesend; nicht mehr Miles-end ist die längste Straße Londons, sondern der prächtige Themsestrom selbst: statt der Cabs und Omnibusse befahren ihn Hunderte von Booten und Dampfern, Greenwich und Woolwich sind Anhaltepunkte, und Gravesend ist letzte Station.
Der Zauber Londons ist – seine Massenhaftigkeit. Wenn Neapel durch seinen Golf und Himmel, Moskau durch seine funkelnden Kuppeln, Rom durch seine Erinnerungen, Venedig durch den Zauber seiner meerentstiegenen Schönheit wirkt, so ist es beim Anblick Londons das Gefühl des Unendlichen, was uns überwältigt - dasselbe Gefühl, was uns beim ersten Anschauen des Meeres durchschauert. Die überschwengliche Fülle, die unerschöpfliche Masse – das ist die eigentliche Wesenheit, der Charakter Londons. Dieser tritt einem überall entgegen. Ob man von der Paulskirche, oder der Greenwicher Sternwarte herab seinen Blick auf dies Häusermeer richtet – ob man die Citystraßen durchwandert und von der Menschenwoge halb mit fortgerissen, den Gedanken nicht unterdrücken kann, jedes Haus sei wohl ein Theater, das eben jetzt seine Zuhörerschwärme wieder ins Freie strömt –, überall ist es die Zahl, die Menge, die uns Staunen abzwingt.
Überall! aber nirgends so wie auf der großen Fahrstraße Londons – der Themse. Versuche ich ein Bild dieses Treibens zu geben. Gravesend liegt hinter uns, noch sehen wir das Schimmern seiner hellen Häuser und schon taucht Woolwich, die Arsenalstadt, vor unsern Blicken auf. Rechts und links liegen die Wachtschiffe; drohend weisen sie die Zähne, hell im Sonnenschimmer blitzen die Geschütze aus ihren Luken hervor. Vorbei! Wir haben nichts zu fürchten: Alt-Englands Flagge weht von unserm Mast; friedlich nur dröhnt ein Kanonenschuß über die Themse hin und verhallt jetzt in den stillen Lüften der Grafschaft Kent. – Weiter schaufelt sich der Dampfer, an Ostindienfahrern vorbei, die jetzt eben mit vollen Segeln und voller Hoffnung in Meer und Welt hinausziehen; seht, die Matrosen drüben und schwenken ihre Hüte! Wenn wieder Land unter ihren Pulsen ist, so ist es des Indus oder des Ganges Ufer. Glückliche Fahrt! Und jetzt, ein Invalidenschiff sperrt uns fast den Weg. Alles daran ist zerschossen – es selbst und seine Einwohner. Ein Dreidecker ist's; seine Kanonenluken sind friedliche Fenster geworden, hinter denen die Sieger von Abukir und Trafalgar, die alte Garde Nelsons, ihre traulichen Kojen haben. –
Aber lassen wir die Alten! Das junge, frische Leben jubelt eben jetzt an uns vorüber. Eine wahre Flottille von Dampfbooten, eine friedliche Schärenflotte, nur heimisch im Themsefahrwasser, kommt unter Sang und Klang den Fluß herunter. In Gravesend ist Jahrmarkt oder ein Schifferfest, da darf der Londoner Junggesell, der Kommis und Handwerker nicht fehlen; die halbe City, scheint es, ist flügge geworden und will in Gravesend tanzen und springen und sich einmal gütlich tun nach der Melodie des Dudelsacks. Kein Ende nimmt der Festzug: bis hundert hab' ich die vorbeifliegenden Dampfer (die keine Masten und nur einen hohen eisernen Schornstein in der Mitte tragen) gezählt, aber ich geb' es auf: sie sind eben zahllos. Und welche Jagd! wie beim Wettrennen suchen sich die einzelnen zu überholen; eine nordische Regatta ist es; welch' prächtige Lagune, diese Themse – welch' flüchtige Gondel jedes keuchende Boot! Greenwich taucht auf vor uns, immer reger wird das Leben, immer bunter der Strom; – wie wenn Ameisen arbeiten, hier hin – dort hin, rechts und links, vor und zurück, aber immer rastlos, so lebt und webt es zwischen den Ufern. Noch haben wir kein Wort Englisch gehört und schon haben die Spiegel und Flaggen der vorbeisausenden Schiffe einen ganzen Sprachschatz vor uns aufgeschlagen; wie in Blättern eines Riesenlexikons hätten wir darin lesen können. Noch hat unser Fuß London nicht betreten, noch liegt es vor uns, und schon haben wir ein Stück von ihm im Rücken – auf hundert Dampfbooten eilte es an uns vorbei. Die Bevölkerung ganzer Städte ist ausgeflogen aus der einen Stadt, und doch die Tausende, die ihr fehlen – sie fehlen ihr nicht. – Was ein Stück Infusorienerde unter dem Ehrenbergschen Mikroskop, das ist London vor dem menschlichen Auge. Zahllos wimmelt es; man gibt uns Zahlen, aber die Ziffern übersteigen unsere Vorstellungskraft. Der Rest ist – Staunen.
Ein Gang durch den leeren Glaspalast
Es ist ein Etwas im Menschen, was ihn den Herbst und das fallende Laub mehr lieben läßt als den Frühling und seine Blütenpracht, was ihn hinauszwingt aus dem Geräusch der Städte in die Stille der Friedhöfe und unter Efeu und Trümmerwerk ihn wonniger durchschauert als angesichts aller Herrlichkeit der Welt. Ein ähnliches Gefühl mocht' es sein, was mich zum Glaspalast zog. Kaum zwei Stunden in London– und schon saß ich wieder auf meinem alten Lieblingsplatz, hoch oben neben dem Omnibuskutscher und das vor mir ausgeschüttete Füllhorn englischen Lebens wie einen langentbehrten Freund nach rechts und links hin grüßend, rollt' ich Regent-Street und Piccadilly hinab bis zu seinem Schlußstein, Apsley-House.
Ich trat in den Hyde-Park; die Sonne stand in Mittag und unter ihrem Strahlenstrom glühte die noch ferne Kuppel des Kristallhauses auf wie ein »Berg des Lichts«, wie der echte und einzige Kohinur. Es brauchte kein Fragen und Suchen nach ihm: er war sein eigener Stern. Aber welche Stille um ihn her! verlaufen der bunte Strom der Gäste, kein Fahren und Rennen, kein Drängen am Eingang; gähnend vor Langerweile hält ein einziger Konstabel die nutzlose Wache und zerlumpte Kinder lagern am Gitter und bieten Medaillen feil oder betteln. Keiner künstlichen Vorrichtung bedarf es mehr, um die Eintretenden zu zählen; die Augen und das Gedächtnis einer alten Frau würden ausreichen, die Kontrolle zu führen, aber niemand kümmert sich um die Handvoll Nachzügler, die wie letzte Funken eines niedergebrannten Feuers, hier und dorthin den weiten Raum durchhuschen.
Wir treten ein. Wie eine Riesenleiche streckt sich dieser Glasleib aus, dessen Seele mit jenen farbenreichen Shawls und Teppichen entflohn, die einst wie Phantasien ihn durchglühten und dessen geistiges Leben mit jenen tausend Meß- und Rechenkräften dahin ist, die eisern und unbeirrt ihr Urteil fällten.
Es ist etwas Eigentümliches um die bloße Macht des Raums! Das Meer und die Wüste – sie haben diesen Zauber, und leise fühlt' ich mich von ihm berührt, als mein Auge die ungeheueren Dimensionen dieses Palastes durchmaß. Der Eindruck mag schöner, erquicklicher gewesen sein, als eine ganze Welt ihr Bestes hier ausgebreitet hatte – imposanter war er nicht. Und als ich nun von Säule zu Säule diesen Raum durchschritt, und fast ermüdet durch die völlige Gleichheit und stete Wiederkehr aller einzelnen Teile, doch nicht aufhören konnte, das riesenhafte Ganze zu bewundern, da erschien mir dies Glashaus wie das Abbild Londons selbst: abschreckende Monotonie im einzelnen, aber vollste Harmonie des Ganzen.
Nur weniges erinnert noch an die Bestimmung des Gebäudes; die Tafeln und Inschriften sind abgebrochen, und nur in der Nähe der Kuppel – wie um dem späteren Beschauer als Fingerzeig zu dienen – lesen wir in großen Lettern »Van Diemensland«. Aber, daß dem Ernsten der Humor nicht fehle: eben hier wo der rote Federmantel eines neuseeländischen Häuptlings, oder wohl gar ein ausgestopfter Kasuar die Blicke Neugieriger auf sich gezogen haben mochte, hier saß im Schmucke lang herabhängender Locken, den unvermeidlichen meergrünen Schleier halb zur Seite geschlagen, eine blasse Tochter Albions und war eifrig bemüht, die Welt mit der tausendundeinten Abbildung des »Exhibition-Houses« zu beglücken, noch dazu in Öl.
Ich nannte das Glashaus einen Leib, dessen Seele entflohn. Aber es ist nicht der Leib der schönen Fasterade, der Geliebten Kaiser Karls, die einen Zauberring trug und im Tode blühte wie im Leben. Unsere Zeit eilt schnell: sie ist rasch im Schaffen wie im Zerstören; noch ein Winter und – das Glashaus ist eine Ruine. Schon dringen Wind und Staub durch hundert zerbrochene Scheiben, schon ist das rote Tuch der Bänke verblaßt und zerrissen, und schon findet die Spinne sich ein und webt ihre grauen Schleier, die alten Fahnen der Zerstörung. Sei's! auch die Bäume grünen schon wieder, die Paxtons kühne Hand mit in seinen Glasbau hineinzog und sprechen von Verjüngung; und möge Wind und Sand durch die Fensterlücken wehn, auch die Schwalben flattern mit herein und erzählen sich unter Trümmern von dem Leben und der Liebe, die nicht stirbt.
Long Acre 27
Von welcher Stelle Londons aus glaubst Du diese Zeilen zu erhalten? Gib es auf, die Antwort darauf zu finden. Und riefest Du von der Kuppel St. Pauls an bis in den letzten Winkel des Themsetunnels hinein, just an der Stelle würdest Du vorübergehn, von der aus ich mich anschicke, Dir diese Zeilen zu schreiben. Vernimm denn, ein Zufall hat sich meiner Neugier erbarmt und mich ohne Wissen und Wollen zu einem Mitbewohner der Flüchtlings-Herberge gemacht. Gestern z. B. bin ich ein Tischgenosse Willichs gewesen und schon mehrfach hatt' ich die Ehre mit dem Grenadier Zinn eine längere Unterredung zu führen. Laß Dir erzählen, wie ich in die Höhle des Löwen gekommen bin.
Auf dem Steamer, kurze Zeit nachdem wir in die Themse eingefahren waren, trat ein blonder und rotbackiger junger Mann mit entschieden gutmütigem Gesicht an mich heran und äußerte den Wunsch, da ich des Englischen mächtiger zu sein schiene als er, mich seiner anzunehmen. Ich verbeugte mich und versprach zu tun, was in meinen Kräften stehe. So kamen wir einander näher, und noch eh' der Steamer Londonbridge erreicht hatte, wußt' ich aus dem überreichen Fluß seiner Rede, daß er ein Landwirt aus Hessen-Kassel sei und vor Übernahme eines väterlichen Gutes sich entschlossen habe, noch einen Ausflug nach London und Paris zu machen. Auf dem Zollamt (custom house), während unsere Koffer durchsucht wurden, richtete er die Frage an mich, ob ich bereits ein bestimmtes Unterkommen in der Stadt habe, und als ich wahrheitsgemäß diese Frage verneinte, empfahl er mir das german coffee house Long Acre 27, an das er brieflich empfohlen sei und das sich, wie er schon in Kassel gehört habe, durch Billigkeit und freundliches Entgegenkommen auszeichnen solle. Ich hatte keinen Grund, in die Stichhaltigkeit seiner Empfehlung den geringsten Zweifel zu setzen und da es begreiflicherweise was Verlockendes hat, seinen Einzug in das London-Labyrinth an der Seite eines Landsmanns zu halten, so schlug ich mit tausend Freuden ein, und vor Ablauf einer Viertelstunde rollte bereits unser gemeinschaftlicher Cab, an St. Paul vorbei, Ludgate-Hill und Fleet-Street hinunter.
Du magst Dir meinen Schreck denken, als endlich der Wagen hielt und gleich der erste Blick auf das german coffee house mich leise ahnen ließ, wohin das Schicksal in Gestalt meines hessenkasselschen Landwirts mich geführt hatte. Unsre Koffer wurden abgeladen und zwei Treppen hoch in das Fremdenzimmer gebracht. Zögernd folgt' ich. Mit unverkennbaren Zeichen der Ungeduld durchschritt ich das Zimmer und endlich vor meinem Reisegefährten stehen bleibend, fragte ich mit einem Tone, der wenig Zweifel über meine äußerste Enttäuschung ließ: Sagen Sie, Bester, wo sind wir eigentlich? Der Angeredete geriet in sichtliche Verlegenheit und antwortete beinah stotternd: »Sie befinden sich im Flüchtlings-Hotel; wenn Ihnen der Aufenthalt darin, wie ich fast glauben muß, mißhagt, so bitt' ich um Entschuldigung Sie hierher geführt zu haben.« Diese Worte entwaffneten mich; als er aber schließlich gar versicherte, daß er selber ein andres Unterkommen gewählt haben würde, wenn ihm die leiseste Ahnung davon gekommen wäre, daß die Gastzimmer seines Freundes Schärtner im Stil einer pennsylvanischen Zelle hergerichtet seien, schwand auch die letzte Falte des Unmuts von meiner Stirn und ich beschloß so lange zu bleiben, bis es mir geglückt sein würde, in einem eleganteren Stadtteil eine paßliche Wohnung ausfindig zu machen. Das ist nun geschehn. Morgen zieh' ich nach Burton-Street, in die unmittelbare Nähe von Eaton-Square; bevor ich aber dahin abgehe und dem deutschen Flüchtlings-Hôtel ein für allemal den Rücken kehre, kann ich nicht umhin, Dich mit der Festung und ihrer üblichen Besatzung bekannt zu machen.
Long Acre an und für sich ist eine der rußigsten Straßen in London, und Long Acre Numero siebenundzwanzig vermeidet es durch unzeitige Schönheit und Sauberkeit die Schornsteinfegerphysiognomie der ganzen Straße zu unterbrechen. Das Haus hat zwei Fenster Front und drei Stockwerke. Parterre befindet sich ein Ale- und Porter-Laden, wo eine Art Eckensteher-Publikum seine Pinte Bier trinkt, auch gelegentlich wohl sich bis zu Gin und Whisky versteigt. Die ganze erste Etage besteht aus einem einzigen, saalartigen, aber finstren Zimmer. Dem Fenster zunächst steht ein schwerer runder Tisch, darauf demokratische Zeitungen aus allen Weltgegenden– meist alte Exemplare – aufgespeichert liegen. An den Wänden entlang, in Form eines rechten Winkels, laufen zusammengerückte Tische, darauf in den Vormittagsstunden einige stehengebliebene Bierkrüge sich langweilig angucken, während hier am Abend die künftigen Präsidenten der einigen und unteilbaren deutschen Republik sich lagern und ihre Regierungsansichten zum besten geben. Ich führe Dich später in ihre Gesellschaft.
Zwei Treppen hoch teilen sich die Schlafgemächer des Hôtelwirts und das mehrerwähnte Fremdenzimmer in den vorhandenen Raum und von hier aus ist es, daß ich die Freude habe, Dir ein Bild der vielgefürchteten Flüchtlingswirtschaft zu entwerfen. Es gewährt mir eine gewisse Befriedigung, daß dieselbe Tischplatte, von der aus so manche Verwünschung dessen, was uns heilig gilt, in die Welt gegangen ist, nun meiner altpreußischen Loyalität als Unterlage dienen muß und es macht mich wenig irre, daß der Wind beständig an den alten klapprigen Fenstern rüttelt, als wollt' er mir drohen oder mich mahnen: laß ab!
Ich habe nie ein ungemütlicheres Zimmer bewohnt; nur wer eben die Kasematten Magdeburgs hinter sich hat, mag sich hier verhältnismäßig wohl und heimisch fühlen. Der vielgerühmte englische Komfort ist durch einen Fetzen Teppich vertreten, der den Boden notdürftig bedeckt; kein Kamin, kein Fenstervorhang, kein Bild an den Wänden, mit Ausnahme einer grasgrünen, hier und da gelbdurchkreuzten Pinselei, dran die Inschrift prangt: »Plan des neuen Victoria-Parks«. Von Möbeln nur das notdürftigste: ein paar Wandschränke rechts und links, ein Klapptisch, drei Binsenstühle, und zwischen den Fenstern ein bleifarbner Spiegel, drin man noch trauriger aussieht, als diese Umgehung einen ohnehin schon macht. Vielleicht tu' ich Unrecht, meinen Groll in dieser Weise auszulassen, da das german coffee house schwerlich beabsichtigt, unter den Hotels der Stadt genannt zu werden, aber das Unbehagen wägt nun mal die Worte nicht ab und ich friere so jämmerlich, wie man selbst in einer Ausspannung, und daß ich's rund heraus sage, selbst in Long Acre 27 nicht frieren sollte.
Die Bewirtung ist erträglich genug; nur der Kellner, ein desertierter Soldat, der bei Iserlohn zu den Aufständischen überging, verdirbt einem durch seine Süffisance den Appetit. Sein Benehmen gegen die renommiertesten Gäste dieses Zirkels ist das eines Spital-Beamten, der armen Leuten einen Teller Suppe reicht. Nur wenige verstehn es, sich in Respekt zu setzen; der Rest wird tyrannisiert, im günstigsten Falle protegiert.
Gestern mittag aß ich in Gesellschaft von Schärtner, Heise, Willich, Zinn und einigen Diis minorum gentium. Ich hielt es für überflüssig oder gar unwürdig, aus dem bloßen Zufall, der mich in ihre Mitte geführt hatte, irgendein Hehl zu machen und bekannte mich freimütig zu Ansichten, die den ihrigen schnurstracks entgegen seien. Man respektierte diese Erklärung nicht nur, sondern zeigte auch, im Gespräch mit mir, eine Ruhe und Gemessenheit, die mich um so mehr frappierte, als sie den Streitenden, bei ihren Streitigkeiten unter einander, durchaus nicht eigen war. »Komm ich heran, der erste, den ich erschießen lasse bist Du« zählte zu den oft und gern ausgespielten Bekräftigungs-Trümpfen.
Der gemütlichste Paladin der ganzen Tafelrunde ist unbedingt der Wirt selbst. Schärtner, dieser vor Zeiten vielbesprochne Führer des Hanauer Turner-Korps, hat längst den klugen Einfall gehabt, seinen unbrauchbar im Stall stehenden Republikanismus zur milchenden Kuh zu machen und lebt jetzt in vollster Behaglichkeit von dem unverwüstlichen Renommee eines längst aufgegebenen Prinzips. Er hat sich zum Eheherrn einer blassen Engländerin gemacht und unter reichlichem Verbrauch seines eignen Ales und Porters arrondiert er sich immer mehr und mehr zum vollen Gegensatz jener Cassius-Naturen, deren Magerkeit dem Caesar so bedenklich war.
Schärtners ganzer Radikalismus ist ein bloßer Zufall; in Stettin oder Danzig statt in Hanau geboren, wäre er der loyalste Weinhändler von der Welt geworden, und hätte am 15. Oktober die Toaste auf den König ausgebracht.
Anders verhält es sich mit Dr. Heise, einem ehemaligen Mitredakteur der »Hornisse«, der mein Tischnachbar war. Das stechende Auge, die etwas spitze Nase, dazu seine Redeweise, gleich scharf an Inhalt wie Ton der Stimme, sagen einem auf der Stelle, daß man es hier mit keinem Revolutionär aus Zufall, sondern mit einer jener negativen Naturen zu tun hat, deren Lust, wenn nicht gar deren Bestimmung das Zerstören ist. Ohne besonders viel zu sprechen, war er doch die Seele der Unterhaltung und gab das entscheidende Wort. – Neben ihm saß Willich, beredt sonst wie ich vernehme, aber schweigsam an diesem Abend. Man schätzt ihn allgemein, und doch zählt Achtung nicht eben zu den Dingen, mit denen die Bewohner von Long Acre 27 besonders verschwenderisch umgehn. Das Urteil über ihn lautet: verrannt, aber ehrlich.
War Willich schweigsam, so war Grenadier Zinn (jetzt Setzer in einer Buchdruckerei) desto muntrer. Als ich vor kaum einem halben Jahre von ihm las, hatt' ich mir stets einen alten zopfigen Gefreiten, ich weiß nicht aus welchem Grunde vorgestellt. Wie war ich erstaunt, jetzt einen rotbackigen, kaum 24jährigen Springinsfeld vor mir zu sehn, der lachend von einem zum andern ging und das verzogne Kind der ganzen Versammlung zu sein schien. Keine Spur von Ernst in seinem ganzen Wesen, und wie sein Auftreten, so auch seine politische Tat. Sie besticht durch ihre Kühnheit, und bei dem Haß, den alle Welt gegen die Kasselsche Wirtschaft hegt, auch durch ihren Erfolg; in ihren Motiven aber ist sie klein. Mein Reisegefährte erzählte mir beim Zubettgehn, wie das blonde Grenadierchen es selber kaum leugne, daß die Lorbeeren des Carl Schurz ihn nicht hätten schlafen lassen und daß er den Dr. Kellner überwiegend nur deshalb befreit habe, um ein Seitenstück zu der Befreiung Kinkels zu liefern. Das ist ihm gelungen. Man darf Heldentaten nicht in der Nähe betrachten.
Das wäre das Offiziers-Korps der Besatzung von Long Acre 27; von den Gemeinen laß mich schweigen. In der Nacht vom Sonnabend auf Sonntag ist hier allwöchentlich ein großes Meeting. Dann gesellen sich die französischen Flüchtlinge zu den unsren, und bei Bier und Brandy wird die Brüderlichkeit beider Völker proklamiert und beschworen. Vorgestern nacht hörte ich den Jubel bis zum Morgen hin. Es war ein Lärmen ohnegleichen: deutsche und französische Lieder bunt durcheinander, dazwischen Gekreisch und Gefluch; mitunter flog eine Tür und man hörte Gepolter treppab; – ein wahres Höllentreiben!
Fragst Du mich noch, was ich von dieser Wirtschaft halte? Meine Darstellung des Erlebten ist zugleich eine Kritik. Das Ganze (eine einzelne Tüchtigkeit gern zugegeben) ist widerlich und lächerlich zugleich; bliebe noch Raum für ein drittes Gefühl, so wär' es das des Mitleids. Da sitzen alltäglich diese blassen verkommenen Gestalten, abhängig von der Laune eines groben Kellners und der Stimmung ihrer englischen Wirtsleute daheim, da sitzen sie, sag' ich, mit von Unglück und Leidenschaft gezeichneten Gesichtern und träumen von ihrer Zeit und haben für jeden Neueintretenden nur die eine Frage: regt sich's? Geht es los? Dabei leuchtet ihr Auge momentan auf, und erlischt dann wieder wie ein Licht ohne Nahrung. – Ihr Regierungen aber, zum mindesten ihr deutschen Regierungen, tut ab die kindische Furcht vor einem hohlen Gespenst und besoldet nicht eine Armee von Augen, die dies Jammertreiben verfolgen und von jedem hingesprochnen Wort Bericht erstatten soll. Ihr verdientet zu fallen, wenn dieser Abhub euch je gefährlich werden könnte.
Die öffentlichen Denkmäler
Es ist mit der englischen Kunst wie mit dem englischen Leben überhaupt: die Straße, die Öffentlichkeit bietet wenig von beiden. Man könnte sagen, das sei das Wesen des Nordens; indes man braucht nicht nach dem Süden zu gehen, um es anders zu finden. In München, Berlin und Brüssel trifft das Auge angenehm überrascht, an Giebeln hier und unter Arkaden dort, auf die Vorläufer des Freskobildes, das Miene macht, über die Alpen bei uns einzuwandern, und beschränken wir uns gar auf das Monumentale und eine Vergleichung dessen, was die Straße hier dem Beschauer bietet und was bei uns, wie reich sind wir Armen da. Jeder Fremde, der Berlin besucht und überhaupt ein Auge mitbringt für die Werke der Skulptur, wird auf einem einzigen raschen Gange durch die Stadt, vom »Kurfürsten« ab bis zur Quadriga des Brandenburger Tores hin, mehr Anregungen und Eindrücke mit nach Hause nehmen, als nach der Seite hin ganz London ihm zu bieten vermag. Wer die englische Bildhauerkunst bewundern, oder wenn ihm Zweifel an ihrer Existenz gekommen sein sollten, sich wenigstens von ihrem Dasein überzeugen will, der suche Zutritt zu den Galerien der Großen und Reichen zu erlangen, oder gehe, wenn er das Bequemere vorzieht, nach St. Paul und Westminster: der erste Schritt in die Kirche, der flüchtigste Umblick darin, wird ihm Gewißheit geben, daß es eine englische Meißelkunst gibt.
Richten wir für heute unser Augenmerk lediglich auf die öffentlichen Denkmäler und beginnen wir mit der City. Wir kommen von der Londonbrücke und haben zur Rechten das »Monument«, die berühmte Denksäule, die im Jahre 1677 zur Erinnerung an das große City-Feuer (dem Londonbrücke und Paulskirche zum Opfer fielen) errichtet wurde. Ich habe nichts gegen diese Säule – wiewohl ich nicht recht fasse, was man mit ihrer Aufstellung und der steten Vergegenwärtigung eines großen Unglücks bezweckte – muß aber feierlichst protestieren gegen die 42 Fuß hohe Flammenurne, womit eine konfuse Pietät und der barste Ungeschmack den Knauf jener Säule geschmückt haben. Die vorgeblichen Flammenbüschel dieser Urne sind alles Mögliche, nur eben keine Flammen, und da es dieser goldenen Kuriosität gegenüber, ähnlich wie beim Bleigießen in der Neujahrsnacht, der Phantasie jedes einzelnen überlassen bleiben muß, was sie aus diesen Ecken und Spitzen herauszulesen für gut befindet, so mach' ich kein Hehl daraus, daß ich die Flammenurne für ein riesiges Kissen mit hundert goldnen Nadeln und in Folge davon die berühmte Säule selbst für ein Wahrzeichen der ehrsamen Schneiderzunft gehalten habe, dessen historische Begründung mir leider nicht gegenwärtig sei. Das Piedestal trägt neben Basreliefs, die sich's angelegen sein lassen den komischen Eindruck des Ganzen nicht zu stören, die Anzeige: daß es erlaubt sei, gegen Zahlung eines Sixpence, die Säule zu besteigen. Hat diese Erlaubnis den Zweck, die wunderliche Flammenurne auch in der Nähe bewundern zu können, so wird man durch solch humane Fürsorge in seiner guten Laune nicht wenig bestärkt; indes es handelt sich wohl um die Aussicht, um das London-Panorama, dessen man von oben genießen soll, und hier wolle mir der Leser erlauben abzuschweifen und ihn vor dem Erklettern von Türmen und Säulen ein für allemal zu warnen. Während meines Aufenthalts in Belgien hab' ich mir diese Erfahrung mit manchem Frankenstück, mit Beulen an Kopf und Hut und schließlich mit dem jedesmaligen äußersten Getäuschtsein erkaufen müssen. Woran liegt das? Der Turm führt uns nur dem Himmel näher, und diesem denn doch nicht nah genug, um eine Reiseausbeute davon zu haben; von allem andern entfernt er uns, die Ferne bleibt Ferne, und die Nähe wird zur Ferne. In Brüssel bestieg ich den Rathausturm: der Führer streckte seinen dicken Finger aus, wies auf einen schwarzen Punkt am Horizont und sagte ernsthaft: voilà le Lion de Waterloo! In Antwerpen mußt' ich einen blinkenden Streifen bona fide als das Meer hinnehmen, so daß man, zur Besinnung gekommen, sich eigentlich schämt, Punkte und Striche als Sehenswürdigkeiten ernsthaft beobachtet zu haben. Und blickt man nun in die Nähe, was hat man? Dächer! wenn's hoch kommt, flache und schräge, schwarze und rote, aber doch immer nur Dächer. Unsere Bauten nehmen, wie billig, noch Rücksicht auf den Menschen, der geht. Wenn wir erst fliegen werden, dann wird das Zeitalter der Dächer gekommen sein; aller Schmuck der Fassaden: Reliefs und Bildsäulen (natürlich alle liegend, wie auf Grabmälern) werden ihren Platz dann auf dem Dach, der neuen Front des Hauses, einnehmen, und der Reisende mag dann Türme erklettern oder wenigstens auf ihnen– rasten.
Doch kehren wir zurück in die City. Wenig hundert Schritte von der Säule entfernt, wo sich die King-Williamsstraße zu einem kleinen Platze erweitert, finden wir das neueste öffentliche Denkmal Londons: die Statue König Wilhelms IV., das neueste und zugleich beste. Aber das beste ist kein gutes oder gar ein bedeutendes; seine relativen Vorzüge bestehn in dem Fehlen alles Störenden und Geschmacklosen. Ruhig blickt der König zur französischen Küste hinüber, als wollte er mit unterdrücktem Gähnen sagen: »kommt ihr – gut! kommt ihr nicht – noch besser!« und mit ähnlicher Gleichgültigkeit geht der Beschauer an dem Denkmal selbst vorbei, das allenfalls befriedigen, aber nicht anregen und entzünden kann. Das Interessanteste der Statue ist ihre Ausführung in Granit. Das englische Klima, dem Marmor wie dem Erz in gleichem Maße ungünstig, wies darauf hin, ein Auskunftsmittel zu suchen. Man wählte den Granit, und das Geschick, mit dem sich die englische Skulptur diesen spröden Stoff dienstbar zu machen verstand, hat um so mehr Anspruch auf Dank, als bei der vollständigen Unleidlichkeit jener Patina, womit Luft und Rauch alles Erz hier, und zwar in kürzester Zeit, umkleiden, erst von jetzt ab an öffentliche Denkmäler, die sich des Anblicks verlohnen, zu denken sein wird.
Wir schreiten weiter, lassen vorläufig eine Wellington-Statue zur Rechten unbemerkt, und gelangen an St. Paul vorbei, durch Fleet-Street und Strand auf den Trafalgar-Square. Hier blickt es uns an, rechts und links, von Kapitälern und Piedestalen herab, und wir machen halt. In der Mitte des Platzes erhebt sich die 170 Fuß hohe Nelson-Säule; auf ihr der Sieger von Abukir selbst. Ob die Statue gut ist oder schlecht, mag ein anderer entscheiden als ich; auf eine Entfernung von 170 Fuß bescheidet sich mein Auge jeder Kritik und überläßt es den Teleskopen, Nachforschungen anzustellen. Nur so viel: Nelson trägt Frack und Hut, aller Gegnerschaft zum Trotz, auf gut napoleonisch, und die Statue, wie sie da ist, auf den Vendome-Platz zu Paris statt auf den Trafalgar-Square in London gestellt, sollt' es ihr nicht schwer fallen, vielen tausend Beschauern gegenüber, den englischen Admiral zum französischen Kaiser avancieren zu lassen. Man hat keine andren Anhaltepunkte, als den schlaff herabhängenden Rockärmel, drin der Arm fehlt, und das Gewinde von Schiffstau, dran der Rücken sich lehnt; das einzige, was jeden Zweifel lösen könnte, entzieht sich der Beobachtung– das Gesicht. Ich möchte hieran ketzerischerweise überhaupt die Frage nach dem Recht der künstlerischen Zuverlässigkeit dieser Säulen knüpfen. Sie geben nicht, was sie geben wollen, und deshalb hab' ich Bedenken gegen die ganze Gattung. Eine Nelsonsäule z. B., die sich faktisch, wie die vor uns befindliche, nicht mit dem Namen des Mannes begnügt, den sie verherrlichen will, sondern dadurch, daß sie ihn in effigie auf ihren Knauf stellt, auch die Absicht ausspricht, mir sein Bild einprägen zu wollen, bleibt hinter einem bloßen Gedenkstein in so weit zurück, als sie das Plus ihrer Aufgabe nicht erreicht und bei 170 Fuß Höhe nie erreichen kann. Die Skulptur tut ihr Werk dabei sozusagen umsonst und wird selbst da zum »Jüngern Sohn«, wo sich, dem Prinzip nach, die künstlerische Ruhmeserbschaft wenigstens teilen sollte.
Vor der Nelsonsäule, das Antlitz nach Whitehall gewandt, steht die Reiterstatue Karl Stuarts. Wohl ist er's: der feine Kopf, in dem sich Majestät mit jenem wunderbaren Zuge mischt, der auf ein tragisches Schicksal deutet. Er ist es, aber so klein wie möglich. Er reitet nach Whitehall hinab, als drücke ihn immer noch die Schmach, die seiner dort harrte, und als fühl' er, daß das Schwert ihm fehle, das – o bittres Spiel des Zufalls! – die Hände eines Straßenbuben vor Jahr und Tag ihm raubten: Wie wenig ist diese Statue und wie viel hätte sie sein können, wie viel hätte sie sein müssen in dem loyalen, königlichen England. Es war ein poetischer, glücklicher Gedanke, den Platz der Schmach nicht zu scheuen und das Haupt des Königs gerade dorthin blicken zu lassen, wo es fiel, aber dann müßte dieses Haupt ein andres sein und der ganze Reiter dazu, dann müßte Sieg und Hoheit von dieser Stirne leuchten und jede Fiber nach Whitehall hinunterrufen: »ich bin doch König!« Ein Rauchsches Denkmal an dieser Stelle wäre eine Verherrlichung des Königtums gewesen; was der Platz jetzt bietet, ist eine Fortsetzung der alten Demütigung.
Nach dieser Seite hin leisten die öffentlichen Denkmäler Londons überhaupt das Mögliche. Was ist die Reiterstatue Georgs III. (in unmittelbarer Nähe des Trafalgar-Square), was ist sie anders, als eine öffentliche Bloßstellung, eine Verhöhnung. Ein wohlbeleibter Mann mit einer schrägen, höchstens zwei Zoll hohen Stirn, krausem, fast negerhaftem Haar, einem wohlangebrachten Zopf im Rücken und dem Ausdruck der Gedankenlosigkeit im Gesicht, sitzt, den Hut in der Hand, nicht nur nicht als König, sondern geradezu als Karikatur zu Pferde, und das mitten im Trab zurückprallende Tier legt einem die Vorstellung nahe, daß es in einer Wasserlache am Wege plötzlich seines eignen Reiters ansichtig und vor solchem Bilde scheu geworden sei. Wenn ein König für die Kunst nichts bietet, so ehre man ihn, so lang er lebt und begrabe ihn, wenn er tot ist; die erzne Verewigung einer königlichen Unbedeutendheit kann niemandem ungelegener sein, als dem Königtum selbst.
Soll ich noch von der Yorksäule sprechen, deren erznes Herzogsbild, zu äußerster Lächerlichkeit, die goldne Spitze eines Blitzableiters wie einen bankrotten Glorienschein trägt, dessen anderweitige Strahlen nach rechts und links hin fortgefallen sind? Nein! überlassen wir es einer Feuer-Versicherungs-Gesellschaft, an dieser Vorsichtsmaßregel Gefallen zu finden und wenden wir uns lieber zum Herzog Wellington, dem Manne der ausschließlichen Denkmalberechtigung. Jede Malerakademie hat ihr Modell und die Londoner Bildhauerkunst – ihren Herzog. Wir begegnen ihm auf unsrer Wanderung dreimal: in der City als »jungen Feldherrn«, als »älteren Herrn« vor Apsley-House und als »Achill« im Hyde-Park. Dieser »Achill«, laut Inschrift eine Frauenhuldigung in Kanonenmetall, ist eine längst verurteilte Geschmacklosigkeit und steht auf der Höhe jener lyrischen Liebesgedichte, die schamhaft ihren rechten Namen verleugnen und sub rosa von Damon und Phyllis sprechen. Was die Ausführung angeht, so erinnert sie an den Apoll von Belvedere unseres Tiergartens. – »Der junge Feldherr« in der City ist ein anständiges Mittelgut, zu gut für den Spott und zu schlecht für die Bewunderung; was bleibt da anders als – schweigen. – Der »ältliche Herr« bietet schon mehr: es ist ganz ersichtlich, daß er die Gicht hat, daß es ihm die größte Anstrengung kostete, in den Sattel zu kommen und daß er ohne seinen weiten Regenmantel so früh in der Morgenluft unrettbar verloren wäre. Sein Federhut und der Marschallsstab in der Hand machen eine verzweifelte Anstrengung, ihm ein Feldherrn-Ansehen zu geben, allein vergeblich, es ist und bleibt das langweilige Bild eines Mannes, der doppelte Flanelljacken trägt. Nur eines übertrifft ihn an Steifheit, das ist das Pferd, welches er reitet. – Die Mitwelt hat ihre großen Männer durch undankbare Unterschätzung nur allzu oft verbittert; in Herzog Wellington haben wir ein Beispiel vom Gegenteil: die Liebe der Zeitgenossen mochte der Nachwelt nichts zu tun übriglassen. Wenn nichtsdestoweniger dem Gefeierten Zweifel kommen sollten an dem unbedingten Glück solcher Verewigung, so haben wir als Trost für ihn das Horazische Wort, daß Lied und Geschichte, drinnen er fortlebt, »dauernder sind als Erz«.
Die Musikmacher
Die Musik, wie jedermann weiß, ist die Achillesferse Englands. Wenn man sich vergegenwärtigt, welche musikalischen Unbilden das englische Ohr sich von früh bis spät gefallen läßt, so könnte man in der Tat geneigt werden, dem Engländer jeden Sinn für Wohlklang abzusprechen und auf die Seite Johanna Wagners oder besser ihres Vaters zu treten, der mit mehr Wahrheit als Klugheit die ihm nicht verziehenen Worte sprach, »daß hier viel Gold, aber wenig Ruhm zu holen sei«. Man wolle indes aus dem Umstand, daß England des musikalischen Gehörs entbehrt, nicht voreilig schließen, es entbehre auch der musikalischen Lust; gegenteils, die alte Wahrheit bewährt sich wieder, daß der Mensch am liebsten das treibt, was ihm die Götter am kärgsten gereicht. Die große Forte-piano-Krankheit hat längst auch diese friedliche Insel ergriffen, und da bekanntlich starke Organismen von jeder Krankheit doppelt heftig befallen werden, so herrscht denn auch das Klavierfieber hier in einem unerhörten Maße. Aber dies ist es nicht, was einen Veteranen, der viele Jahre lang die Nachbarschaften einer Berliner Chambre-garnie getragen und vom rasenden Lisztianer an bis zur Skala-spielenden Wirtstochter herunter alles durchgemacht hat, was bei ihm zu Lande einem menschlichen Ohre begegnen kann– dies ist es nicht, was einen bewährten Mut bricht; das eigentliche Schrecknis Londons sind die Straßenvirtuosen.