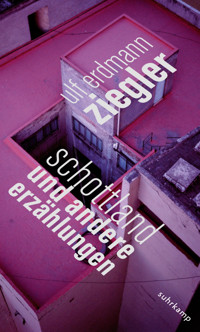19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Berlin, Bundestag, Herbst 2011. Die SPD schlummert in der Opposition, als an einem Novembertag in Eisenach ein ausgebranntes Wohnmobil gefunden wird: Das Ende einer rechtsextremen Terrorzelle stellt die noch junge Berliner Republik vor nahezu unlösbare Fragen. Plötzlich zur moralischen Instanz erhoben, brilliert der Abgeordnete Andi Nair als Vorsitzender des eingesetzten Untersuchungsausschusses. Protokolliert wird das Geschehen von seinem Büroleiter Wegman Frost, der die Verkommenheit der Verhältnisse, das Versagen der Behörden kaum fassen kann und in einen Strudel von Selbstzweifeln gerissen wird. Als Pflegekind mit ungewisser Herkunft hatte ihn sein Einsatz gegen Fremdenhass in die Politik geführt. Damit ist er nicht allein: Sein Freund aus Jugendtagen, Flo Janssen – einst als namenloses Baby aus dem brennenden Saigon ausgeflogen –, steht jetzt am Rednerpult des Reichstags und verkündet neoliberale Ideen. Der ist nicht irgendjemand, er ist der Vizekanzler.
Der neue Roman Ulf Erdmann Zieglers nimmt in den Blick, wie dieses Land zu dem wurde, was es heute ist. Eine andere Epoche erzählt von rechtem Terror, einer Krise der Verfassung, der Wiedervereinigung und der Suche nach Identität. Leidenschaftliche Demokraten geraten an die Grenzen ihrer Erklärungsmuster. Sie ahnen das Ende einer Zeit, auf der ihre eigene Lebensgeschichte gegründet ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Ulf Erdmann Ziegler
Eine andere Epoche
Roman
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Eine andere Epoche
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
»Den Tüchtigen bieten wir immer eine Chance!«, kräht Florian Janssen, und seine Stimme ist in jedem Büro zu hören, sofern der Hausruf eingeschaltet ist, ein Lautsprecher aus weißem Plastik. Wegman Frost hat den Ton aufgedreht, aber nur bis zur unteren Grenze der Hörbarkeit, während er ein Thesenpapier in volkstümliche Rede umschreibt. Er könnte die laufende Debatte auch auf einem Bildschirm verfolgen, aber muss den Sprecher nicht sehen, er kann ihn sich vorstellen. Der lässt seine Augen etwas starr werden hinter der randlosen Brille. Sein Mund ist zu einem Dauerlächeln gefroren, das auch die Vorstufe des Beißens darstellen könnte. Und mit dem rechten Zeigefinger fuchtelt er über dem Rednerpult, um anzuzeigen, dass er im Besitz der Wahrheit sei.
Gerade kommt der Abgeordnete ins Zimmer, um ein weiteres Papier auf seinem Tisch abzulegen. »Dieses neoliberale Gekeife ist wirklich unerträglich«, spricht er, stehend, in Wegmans Nacken. »Völlig abgehoben«, antwortet Wegman ruhig. »Aber du kennst doch Flo.« Er schaltet den Hausruf ab, um sich mit Andi Nair zu beraten, und als er ihn Minuten später wieder anknipst, hört er den Applaus der Konservativen und der Liberalen. Er könnte schwören, dass man den vom Applaus der Opposition unterscheiden kann, obwohl der Hausruf keinen Stereoton hergibt. Einfach durch den Klang. Aber das ist etwas jenseits der Politik, das behält Wegman Frost für sich.
Zwei Jahre nach der Wahl und zwei Jahre vor der nächsten fühlt sich fast an wie Stillstand. Die Sozialdemokraten sind nicht an der Regierung. Sie verfassen Entwürfe, die nicht weit kommen, bereiten Anfragen vor, über die sich Minister lauthals amüsieren, sie halten Würde-hätte-sollte-Reden im Bundestag. Analysten sagen, dass die Sozialdemokratie nie mehr das sein wird, was sie einmal war. Aber das haben sie vor Gerhard Schröder auch schon gesagt. Vielleicht wäre Warten-auf-ein-Wunder die angemessene Beschreibung für den mentalen Zustand der Fraktion zur Mitte der Legislaturperiode. Der schlierig graue Himmel an einem irgendwie windigen, aber auch nicht wirklich kalten Novembertag in Berlin befördert das Gefühl der angehaltenen Zeit. Aber nur, wenn man nicht regiert. Für die, die regieren, gelten andere Regeln. Die merken das gar nicht.
Andi Nair schnappt sich die überarbeiteten Papiere und verlässt das Büro im Eilschritt. Wegman klickt sich über den Fernsehsender Phoenix in den Plenarsaal und schaut zu, wie Andi unterhalb der Regierungsbank vorbeihastet und gerade dabei ist, seinen Platz einzunehmen, bevor umgeschnitten wird auf den Redner, einen Hinterbänkler aus Bayern. Wieso sind die Sitze im Bundestag noch einmal blau? Wegman macht sich eine Notiz auf einem dottergelben Post-it. Das sind die Sachen, die Schüler aus dem Wahlkreis einen fragen, wenn sie zu Besuch kommen. Und die aus Schaumburg-Lippe sind keineswegs auf den Mund gefallen.
In die Politik gerät man nicht, man will das. Zuerst möchte man etwas ändern oder ist wütend über einen Vorfall, und kaum ist man bemerkt worden, denkt man, das kann nur ich; ganz viel Vorhaben und ein kleines Amt, dann die höheren Ziele und ein mittleres Amt; danach wird es schwieriger zu beschreiben. Leute mit schwerem Dialekt haben es schwerer; krumme Geschäfte rächen sich; wer seine Freunde verrät, wird verraten; sich auf Quote wählen zu lassen, heißt Sackgasse. Ein Rätsel bleibt, warum sich manche zu idealen Kandidaten auswachsen und andere als Pappfiguren vergessen werden. Wer zögert, wenn es darum geht, »Ich-hier!« zu rufen, wird bei einer ähnlichen Gelegenheit in der Zukunft übersehen. Wer nicht glaubt, berufen zu sein, wird auch nicht berufen. Wenn der sichere Wahlkreis frei wird, muss man ihn sich schnappen, denn danach passiert für ein Vierteljahrhundert nichts. Andi Nair ist ein gutes Beispiel, mit vierzig Jahren zum vierten Mal in den Bundestag gewählt, und zwar jedes Mal direkt. Er weiß, wann welche Gelegenheit kommt, für sich und sogar für andere. Andi war es, der Wegman damals zugeflüstert hat: »Jetzt musst du sagen, dass du es willst.« Immerhin Landesvorstand der Jungsozialisten. Wegman hatte sich überwinden müssen, und das dralle Bauernmädchen aus Maschen hat ihm furchtbar leidgetan, als es mit zwei Stimmen Differenz gegen ihn verlor. So fängt es eben an, dachte er damals, gewählt ist gewählt. Soll heißen: legitimiert. Ab dem Moment sprichst du mit den Stimmen der anderen. Und trotzdem hat es später nicht geklappt, nicht wirklich.
Falls ihn jemals jemand fragen würde, wäre seine Theorie die der zwei Wahlen. Man muss gewinnen, beim ersten und beim zweiten Mal. Dann darf man einmal verlieren. Eine Variante ist, beim zweiten Mal stoisch zu verlieren und beim dritten Mal zurückzukehren. Zweimal in dieselbe Position gewählt, dann geht es fast immer weiter. Wegman wurde beim zweiten Mal niedergestimmt und hat sich dann aufs Studium konzentriert. So hat er das den Genossen verklickert, nicht dass die denken, er wäre raus. Immer ein bekennender Sozialdemokrat geblieben. Deshalb sitzt er jetzt hier, als Büroleiter, wie seine Visitenkarte behauptet, obwohl es diese Position im Bundestag gar nicht gibt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, eine Bezeichnung, die Wegman vorzieht, aber nie benutzt, weil die Menschen da draußen sich darunter nichts vorstellen können. Und das sind ja die, auf die es ankommt.
Der Bildschirm ist stumm, während er mit dem Wahlkreisbüro telefoniert. Nach der Abstimmung schaltet er den Ton wieder zu, während Andi Nair unterwegs ist zum Rednerpult. Er ist schon lange kein Hinterbänkler mehr. »Es wird immer wieder suggeriert«, sagt er, und tatsächlich hören alle zu, »die Vorstellung der Sozialdemokratie von sozialer Gerechtigkeit meine Staatsgeschenke für alle. Das ist nicht der Fall. Wir bleiben aber dabei, dass im Wettbewerb nicht alle in der gleichen Startposition sind: Arbeitslose über fünfzig, alleinerziehende Mütter, Schüler und Schülerinnen aus Familien mit Migrationshintergrund. Soziale Gerechtigkeit bedeutet, dort zu helfen, wo es notwendig ist.« Applaus. Blick in den Saal. Fasziniert beobachtet Wegman, wie ein Abgeordneter der CSU mitklatscht, zwei- oder dreimal, bis er merkt, dass er in seiner Fraktion der Einzige ist, und es dann lässt.
Wegman Frost überfällt das warme Gefühl von Sinnstiftung und Zielerfüllung. Die Sätze, die Andi Nair gerade gesprochen hat, stammen von ihm, Wegman, wörtlich.
Für Berliner Verhältnisse ist die Stadt östlich des Brandenburger Tors hell erleuchtet, eine urbane Travestie, man spürt noch, dass es einmal anders war, nur keiner weiß mehr, wie. Es will scheinen, als wäre die Stadt schwarzweiß und farbig zugleich, das kippt mit einer Drehung des Kopfes. Ist das mondäne Berlin der zwanziger Jahre noch oder wieder da? Die Nordsüdachsen haben sich schneller erholt als jene, die ostwestlich verlaufen, die Friedrichstraße schon nahezu prächtig, hier, wo es Wegman hinzieht, ohne Fahrbahnmarkierungen, ein Hauch von Main Street. Passanten überqueren die Straße an beliebigen Stellen, auch diagonal, als könnten sie es einfach nicht abwarten, auf der anderen Seite noch einmal hundert Euro auszugeben, aber es darf auch etwas mehr sein.
Wie oft ist er in der Mitte des neuen Kaufhauses stehen geblieben, um den gläsernen Trichter zu bewundern, der sich – aber das kann man wegen der vielen Spiegelungen kaum erkennen – als Kelch zum Himmel hin öffnet; jetzt aber lässt Wegman seinen Blick flüchtig über die lackierten Damenhandtaschen gleiten, bevor er über die Rolltreppe in die Gourmetabteilung abtaucht. Fast der ganze Bundestag hat Dienstschluss. Er nickt dieser und jenem in der Kassenschlange zu, eilt unten durch eine Passage mit schönen Geschäften und wenig Publikum, erscheint südlich vom Kaufhaus wieder auf der Friedrichstraße und biegt bei nächster Gelegenheit ein zum Spittelmarkt. So sieht er aus, so sehen sie alle aus, vor zehn Stunden rasiert, Bügelfalte, gesteppte Jacke und die rote Tüte mit dem weißen Schriftzug. Das ist kein Berliner, der ist zugezogen, der hat sich über einen Makler eine frisch renovierte Wohnung angemietet … Merkwürdig, denkt Wegman, der sich bisweilen mit dem Fahrrad hochkämpft auf den Berg, man müsste doch auch in der U-Bahn spüren, dass es hügelan geht, dass sie eine Steigung nimmt, aber es kommt einem vor, als wenn sie eben dahinfährt. Nicht aber ruhig fährt, nein, sie ruckelt, faucht und quietscht und vollzieht aberwitzige Bremsmanöver. Tatsächlich fahren noch die klapprigen ostdeutschen Bahnen, wenn auch seltener als vor zehn Jahren. Da mietet also einer eine Wohnung, das doppelte Fenster jetzt doppelt verglast, Induktionsherd, Überwachungskamera neben der Klingelanlage, eine Wohnung, wie Wegman nun hört, in der Arndt dreißig Jahre glücklich gewesen war, mit Familie, die Kinder inzwischen aus dem Haus, die Frau gestorben, und er hatte gedacht, da könne er gut seinen Lebensabend verbringen unter den alten Hausgenossen. Für die Miete hätte es immer gereicht, der Altbaubestand war ja eigentlich unbeliebt, wegen der Kohleöfen, das Klo auf halber Treppe und so weiter. Das sagt oder verkündet vielmehr Ilona, von der Wegman nur weiß, wie sie heißt, weil ein Mann, der ihr gegenübersitzt, sie einmal so anspricht, während er selbst namenlos bleibt. Wegman steigt nicht am Senefelderplatz aus, sondern bleibt bis zur Eberswalder Straße sitzen, um sich das anzuhören. Denn er hat keinen Zweifel, dass sie ihn meint oder eigentlich alle anderen auch, nicht nur den Kumpel, der im hinteren Segment des Wagens nicht zufällig nicht neben ihr sitzt, obwohl Wegman durchaus für ihn rüberrutschen würde. Die Fahrt mit der U-Bahn ist ihre Wandzeitung, und alle sollen es wissen, was Arndt widerfahren ist.
Das ist der Vorteil an der U-Bahn in den Osten, die sprengt die Pforten auf, Schluss mit Fraktion und Ausschuss, SPD und CDU, Rede und Protokoll. Mädchen mit lila Augenlidern und Hunde mit blinkendem Halsband, junge Männer mit kahlgeschorenen Schädeln und ältere Damen mit wie in Stein gehauenen Mienen. Ilona vertritt hier das alte Modell, weil sie sich für ihre Philippika einen leibhaftigen Adressaten sucht, einen Zufallsbekannten, einen Ex-Kollegen, jemanden, der modellhaft zuhört und laut genug zustimmt, stellvertretend für alle anderen, die so tun, als wenn sie überhaupt nichts hören. Die neue Plattform ist das Handy, das allerdings die Wandzeitung entpolitisiert hat: Egomanie und Betrug, Groll und Rache, mangelnde Einsicht und dürftige Ausreden, und dann diese Pausen, in denen jemand – hoffentlich! – am anderen Ende spricht, Pausen, in denen das Gesagte in den Köpfen der Mithörenden nachhallt, lauter wird, schmerzhaft gegenwärtig. »Siehst du, das ist eben Gesellschaft«, hat Bibi Burose kommentiert, und Wegman zu ihr: »Mensch Bibi, was du nicht sagst!«
Beide, Ilona und ihr Gegenüber, fahren weiter nach Pankow, wohin sie entweder freiwillig gegangen sind, schon als Kinder mit den Eltern, endlich eine richtige Wohnung, gut geheizt, Einbauküche mit Durchreiche ins Wohnzimmer, Müllschlucker oben auf dem Balkonumlauf, oder wohin sie, wie Arndt (der abwesend ist, weil er die U-Bahn nicht mehr braucht), verdrängt worden sind.
Dann gefiel Wegman Bibis Deutung, und er schmückte sie aus: »Ist nicht die U-Bahn die beste Darstellung von Gesellschaft überhaupt, eine Zwangsgemeinschaft von Leuten, die das gleiche Ziel haben, aber immer nur bis zur nächsten Station? Das Gegenmodell ist die Straße, da ist alles immer im Fluss, völlig undurchschaubar. Ja, fast unmöglich, jemanden anzuhalten, wenn man den Weg nicht weiß, in Berlin jedenfalls, sie gehen einfach weiter, ob mit Kopfhörern oder ohne.« Wegman selbst, übrigens, wird oft gefragt, schaut sogar Suchenden ins Gesicht, damit sie ihn ansprechen, und gibt gern Auskunft, auch auf Englisch. So kann er sich das Gefühl verschaffen, er lebe in einer offenen und freundlichen Stadt, oder jedenfalls bald, vorausgesetzt, es würden alle seinem Beispiel folgen. Es müsste sich eine Methode finden lassen, den Nachhauseweg zu verlängern. Am besten wäre, einen Besen dabeizuhaben, einen aus Weidenzweigen gebundenen, lang und elastisch. Damit würde er, hin- und herschwingend, den Bordstein reinigen, die ganze Knaackstraße hinunter bis zum Kollwitzplatz, den Bordstein und die Gosse, entlang der Kühler der Autos, die hier quer geparkt sind, graue Haufen hinterlassend für die Berliner Stadtreinigung, die diese später abholen würde. Die private Reinigung der Gosse ist ja schließlich nicht verboten. Andererseits: Ungünstig, wenn sich herumsprechen würde, Wegman Frost wäre verrückt geworden.
Meistens jedoch fährt er nur bis zum Senefelderplatz und geht die Kollwitzstraße hoch, die viel sauberer aussieht. Vielleicht ist sie einfach so breit, dass sich der Dreck besser verteilt. Vorbei am Abenteuerspielplatz ist es noch ziemlich dunkel, dann nimmt die Straße richtig Form an, mit Geschäften und Restaurants auf beiden Seiten, Kopfsteinpflaster, Gaslicht. Zuhause überfällt einen dann die Müdigkeit, vielleicht, weil man sie zeigen darf. Tatsächlich schläft Wegman in der Badewanne mehrmals ein, unter ihm ein uralter gemusterter Boden in Grau und Weiß mit einigen dünnen, kaum sichtbaren roten Rändern. Das Bad, hat Marion gesagt, ist zurückversetzt worden in das Original. Es hat ein Fenster zum Hinterhof, der gar nicht so groß und zudem fast quadratisch ist, eher wie Atriumshöfe in Basel oder Paris, und im vierten Stockwerk ist es so leise, als wäre man gar nicht in der Stadt. Marions einzige Ergänzung war die Wanne auf ihren schweren Füßen gewesen, massives Kupfer, so ziemlich das Teuerste, was man in Berlin bekommen kann. Das hat sie sich geleistet, aus eigener Tasche. So ein Einrichtungsstück habe in etwa die Funktion der Schuhe beim Städter, die sollten auch nie billig sein. Alles andere sei relativ.
Ein Banküberfall kurz nach neun Uhr. »Wo?«, fragte Wegman, und Andi zischelte fast unhörbar: »In Eisenach.« »Typisch«, antwortete Wegman, »im Osten steht man eben ein bisschen früher auf«, aber damit konnte er seinen Chef nicht erheitern, ja, der schien es nicht einmal gehört zu haben. Sie saßen im hellsten Selbstbedienungsrestaurant des Bundestags, das Wegman, weil es namenlos war, Aquarium nannte. Andi Nair hatte, was seine Gewohnheit war, die gläserne Oberfläche seines I-Pads berührt, um es wiederzubeleben, und vergaß in diesem Moment zu kauen, was nicht sehr schön aussah. »Die Bankräuber«, referierte er kurz darauf direkt von Reuters, »liegen jetzt beide tot in einem Wohnmobil, das sie zudem in Brand gesteckt haben.« »Das ist ungewöhnlich«, sagte Wegman. »Mehr als das, ganz unwahrscheinlich.« »Ich habe so eine Ahnung«, raunte der Abgeordnete, »wer die sind.« Er hatte ganz zu essen aufgehört, und Wegman, der die Gabe besaß, immer eine Minute vorauszuschauen, ordnete bereits die Tabletts übereinander.
An diesem Tag, einem Freitag, veränderte sich die Bundesrepublik Deutschland. Sie wusste es noch nicht, aber Wegman, der von seinem Schreibtisch aus durch zwei offene Türen Andi Nair in seinem Zimmer beobachten konnte, sah diesem dabei zu, wie er mit glasigen Augen in eine ungewisse Zukunft starrte. Manchmal schienen sich ihre Blicke über die Distanz von zehn Metern zu begegnen. Wegman aber reiste fünfundzwanzig Jahre zurück und sah ihn, Andi, als den etwas älteren Jungen vor sich, den bronzen getönten Katzenkopf, die blitzenden braunen Augen – den Zorn, schon damals. Dann wandte sich Wegman wieder seinem Bildschirm zu, auf dem die sechste Mail innerhalb einer halben Stunde erschien, sämtlich grußlose Links, die Andi ihm schickte, viele Jahre alte Zeitungsberichte über abgetauchte Rechtsradikale, und Wegman zögerte nicht, kürzte eingehende Telefongespräche ab und las alles sofort. Er konnte sich nicht daran erinnern, von diesen Gruseltypen jemals gehört zu haben.
Bis zum Nachmittag hatte man das halb ausgeräucherte Wohnmobil abgeschleppt. Nicht wirklich abgeschleppt, sondern an Gurten aufgehängt und verladen, komplett mit den Leichen da drin, und hinter den Polizeiabsperrungen in einem Wohngebiet zeigte das lokale Fernsehen eine Lücke. Dann versiegten die Nachrichten.
Der Polizeichef von Gotha nämlich hatte sich entschlossen, die Sache selbst aufzuklären. Er ließ das Wrack in einer Halle unterbringen, wo sich Forensiker über Restleichen, Handys und Geldtaschen beugten, und nein, sie warteten nicht auf Experten aus Wiesbaden und versuchten auch nicht, Karlsruhe für die thüringische Angelegenheit zu interessieren. Sie machten sich Gedanken, wer die unglücklichen Bankräuber sein könnten, und kamen in aller Schlichtheit zu dem Schluss, dass sich jeder selbst erschossen haben müsste. Sie bargen eine Waffe, von der sich noch am selben Nachmittag herausstellte, dass sie einer Polizistin gehört hatte, die ermordet worden war. Das aber war ihnen keine Meldung wert. Schon brannte ein Wohnhaus in Zwickau aus, in dem sich alle Informationen finden würden, die man brauchte, aber Zwickau liegt in Sachsen, und solange man die Zuständigkeit im eigenen Land belässt, weiß die Polizei hundert Kilometer weiter nicht, mit wem sie es zu tun hat.
Der Abgeordnete Nair hatte in seinem Zimmer kein Licht gemacht. Der Schimmer des Bildschirms tönte den weißen Kragen seines Hemdes blau. Es musste eine Stunde her sein, dass man die automatisch schließende Tür am Ende des Flurs zuletzt gehört hatte, ein Fauchen, und jetzt waren Wegman Frost und Andi Nair im Bundestag allein. Wahrscheinlich nicht wirklich allein, aber es fühlte sich so an. Der Trakt mit den Büros, der Wegmans Fenster gegenüberlag, war komplett dunkel, und die Telefone hatten aufgehört zu läuten. Was gewiss an einem Freitagabend, in einer sitzungsfreien Woche des Parlaments, nicht wunderlich war, aber noch nie hatte Wegman diese Stille wahrgenommen, dieses Brüten. Er hätte jedes Recht gehabt, sich ins Wochenende zu verabschieden, aber er ahnte oder wusste, dass es seine Aufgabe sein würde, einfach da zu sein oder jedenfalls nicht davonzulaufen. Er hätte sich in Andis Türrahmen stellen können und mal ganz nett fragen, ob es nicht Zeit wäre, eine gute Pizza zu suchen, und so hätte es jeder andere wissenschaftliche Mitarbeiter in der gleichen Lage auch getan. Der Abgeordnete jedoch hatte sich in den vielen Jahren, die Wegman für ihn arbeitete, nie spontan – außerhalb von terminierten Abendessen – zu irgendetwas verabredet. Nie war Wegman bei ihm zuhaus gewesen oder ihm auch nur auf einer Party begegnet. Andi Nair bestand ganz aus Politik, widerstandslos im Räderwerk, aber entschlossen in der Sache; nicht bitter, nein, aber gelegentlich düster, und an diesem Abend schien er sich verwandelt zu haben, im blauen Licht, nahezu unbeweglich, übergewechselt in die mineralische Welt.
Es wackelte im Gebälk dieses Staates, und Erschütterungen erreichten das Fundament. Der Umzug des Bundestags und der Regierung von Bonn nach Berlin, die Überführung der ostdeutschen Staatssicherheit in geordnete und zugängliche Archive, der späte Wiederaufbau der prächtigsten Kirche Dresdens: All das wurde immer wieder benannt und gelobt und gepriesen in feierlichen Reden zum Jahrestag, den irgendjemand auf den dritten Oktober gelegt hatte. Die Erhebung der Menschen gegen ihren eingemauerten Staat wurde verklärt zur unblutigen Revolution, Länderparlamente in ihre Rechte eingesetzt, die feindlichen Sportteams zu bundesdeutschen Mannschaften fusioniert, die giftigen Industrien Bitterfelds ersetzt durch solare Musterbetriebe, Hochschulen und Gerichte in die Unabhängigkeit zurückversetzt. Der Reichstag wurde wie ein Geschenk verpackt und als Prachtbau einer transparenten Demokratie wieder enthüllt. Die deutsche Einstaatlichkeit, den einstigen Siegermächten abgerungen, hatte sich ausgewachsen zu einer Geschichte des Erfolgs, an der man nicht zweifeln durfte, ohne den Erfolg zu gefährden. Schon fast ein Tabu. Und doch, hatten sich nicht die Unschlüssigen und die Zurückgebliebenen in den ostdeutschen Provinzen zusammengerottet, verschworen gegen die Fremden, die als sozialistische Brüder zu ihnen gekommen waren, verhärtet im Hass, in den Hinterstuben ausgestattet mit staatsfeindlichen Symbolen? Gewiss, aber das wurde alles ausbalanciert von der großen west-ostdeutschen Waage. Und neonazistische Brandstifter hatte es nicht nur in Rostock gegeben – in Solingen auch.
Überhaupt, war nicht der linke Terrorismus bei weitem langlebiger gewesen als geglaubt? Ein entflammtes Hamburger Bürgermädchen seit dreißig Jahren aus dem Jemen nicht zurückgekehrt; eine brutale Flugzeugentführerin bürgerlich verheiratet in Norwegen; ein Killer namens Klar reuelos, nicht geeignet, um begnadigt zu werden; gar nicht zu reden von den in der DDR Abgetauchten, ideologische Bombenbastler, gedeckt durch die mausgraue Staatssicherheit; und wer hatte, durch das große Fenster seines Arbeitszimmers, Detlev Rohwedder erschossen, den Mann, der die Staatswirtschaft der DDR abwickeln sollte? Ja, was waren denn dagegen grölende Neonazis in Nordhessen oder die Glatzen an den Tankstellen Nordbrandenburgs? Schließlich hatte es, anders als im restlichen Europa, keine braune Partei ins Parlament geschafft, während die Salonkommunisten im Bundestag darauf beharrten, man dürfe die untergegangene DDR nicht einen Unrechtsstaat nennen.
Und bevor sie zusammensinken würden, die rhetorischen Kartenhäuser, bevor man die Sonntagsreden ablegen würde im Register des Wohlgemeinten, hätte das Glück über das Ende der Teilung sich als stärker erwiesen als das Bauchgrimmen der Vereinigungsverlierer. Außerdem gab es ja auch wichtige Dinge: Europa, Israel, Afghanistan; Klimawandel, Gedenken an den Holocaust, das Versagen von Banken. Die Furcht der Nachbarn vor einem zu starken Deutschland war aufgegangen im Reichstagtourismus. Reisende aus aller Welt hatten ihren Spaß daran, dem nationalen Parlament von oben bei der Arbeit zuzusehen. Und sich dann noch auf den Rücken legen und in den Himmel gucken dürfen!
An diesem vierten November 2011 aber sah Andi Nair die Risse im Gebälk, und Wegman Frost lief es kalt den Rücken runter. In den folgenden Tagen wurden die verkohlten Leichen der jungen Männer aus dem Wohnmobil identifiziert und die geflüchtete Brandstifterin aus Zwickau zur Fahndung ausgeschrieben. Mehr als zehn Jahre zuvor waren diese Leute einer Verhaftung nur knapp entkommen und seitdem unsichtbar gewesen, Kumpel unter anderen Namen auf einem holsteinischen Campingplatz, Banküberfälle mit Masken, falsche Papiere – keine Bekennerbriefe, keine Fahndungsplakate. Erst jetzt fiel der Polizei in Thüringen auf, dass die Gesuchten auch in Sachsen hatten residieren können, und dem Generalbundesanwalt schwante, dass der Grenzübertritt aus den sogenannten Neuen Bundesländern in die sogenannte alte Bundesrepublik unter terroristischem Vorzeichen nicht völlig undenkbar sei. Oder undenkbar gewesen sei. Denn alles, was nun kam, kam ohnehin zu spät.
Geschützt durch Desinteresse an neonazistischen Umtrieben im Osten, hatten sich die Thüringer Männer, beide namens Uwe, in die Städte des Westens begeben, nach Hamburg, Dortmund, Köln, Kassel und Nürnberg, wo sie explosive Attrappen in kleinen Innenstadtläden hinterlegten. Manchmal machten sie sich weniger Mühe und schossen gleich. Immer und überall, wenn gemordet wird, muss die Polizei eine Verbindung von Opfer und Täter konstruieren, die in der Motivation besteht. Dass man Türken angreifen könnte, weil sie Türken waren, galt bei der westdeutschen Polizei als abwegig. Also mussten die Türken Konflikte untereinander haben, oder mit Kurden, was die Befragten überall konsequent verneinten und nirgendwo zu einer Festnahme führte. Die systematische Beleidigung der Hinterbliebenen war also die Folge, der größtmögliche Erfolg der Täter, die sich in ihrem Zwickauer Versteck, zwischen Waffen und Katzen, hämisch darüber freuten.
»Und es ist ja nicht so, dass in dieser Szene nicht auch einige Leute unterwegs sind, die sich der Verfassungsschutz an der Leine hält«, sagte Andi am Sonntag zu Wegman, der in der kupfernen Badewanne lag, sein flaches Telefon in der Linken. »Wir schlittern in eine Art Staatskrise«, vermutete dieser. »Wir schlittern nicht«, verkündete Andi, »wir sind schon mittendrin.«
Es stimmt: Parteien, ihre Listen, die Ausschüsse, die Seilschaften und die Freundschaften, das sind die Schmieden des politischen Willens, die Orte der Handlung. Der Ort der Herkunft aber ist unveränderlich. Im Bauausschuss meldet sich ein Konservativer zu Wort. Er sagt: »Wie Sie wissen, komme ich aus einer Holzregion.« Deshalb zählt, was er zum Baustoff Holz zu sagen hat, doppelt. Andere haben das Meer, die Viehzucht, die großen Industrien hinter sich. Mit Berlin kann nur argumentieren, wer in Berlin gewählt wurde.
Und doch, es gibt Wahlkreise, die weniger geläufig sind: Neckar-Zaber, St. Wendel, Nienburg II – Schaumburg. Das ist doch westfälisch, oder? Oh nein. Man muss ja nur an den Vizekanzler Janssen denken, zuvor Minister in Hannover, das zweite Kabinett Wulff. Ach, der Janssen – ist der nicht aus Goslar? Unsinn, das ist Sigmar Gabriel. Aus Lüneburg? Nein, nicht aus Lüneburg, aus Bückeburg. Da gibt es sogar ein ganz merkwürdiges, aber wichtiges Gericht, das selten tagt. Ja richtig, warte: der Niedersächsische Staatsgerichtshof.
Es ist Winter. Die Stadt, von oben gesehen, wurde um einen Schlosspark gebaut, an den sich die Altstadt anschmiegt. Wie ungelenke Arme schießen die Vorstädte in alle Himmelsrichtungen. Da draußen dieses weite Feld, das ist der Fliegerhorst Achum. Die ganz kleine Figur, mit bloßem Auge nicht zu erkennen, auf dem Fahrrad, das ist ein Unterstufenschüler am Gymnasium Adolfinum. Er biegt nicht zum Flugplatz ein, da würde er nicht hineingelassen, sondern zu dem Gebäuderiegel gegenüber, ein Offizierskasino. Dort isst er mit seinem Vater zu Mittag. Später sehen wir ihn auf dem Rückweg, und dann, mit einem anderen Knaben, auf der Schlossgraft, einem bleifarbenen Ring in der weiß gepuderten Stadtlandschaft. Sie fahren Schlittschuh.
Die beiden haben sich im Herbst kennengelernt, eine unwahrscheinliche Begebenheit. Während des Unterrichts geht die Tür des Klassenzimmers auf und die Kandidaten für das Amt des Unterstufensprechers kommen herein: Udo Stefano aus der 7c, rundes Gesicht, gerahmt von schwarzen Locken, bei Mädchen sehr beliebt. Hinter ihm ein spitteldürrer Quintaner, von dem Wegman nur weiß, dass er auf dem Schulhof Kung Fu genannt wird.
Eine Stunde bevor die Frist ablief, war der Junge aus der Sechsten im Sekretariat aufgetaucht und hatte sich selbst nominiert. Blitzartig machte das die Runde, und Udo Stefanos Helfer wussten auch, um wen es sich handelte: ein Einzelkind, Sohn eines Bundeswehroffiziers, der Vater stramm CDU. Der Junge halte in seiner Klasse flammende Reden für die Aufrüstung der Bundesrepublik, ein Einheizer und Aufwiegler, Pfadfinder und Nachwuchssänger bei den Bückeburger Jägern, den sollte man sich mal genau anschauen. Wenn so einer zwei Stimmen bekäme, wäre das schon zu viel.
Der schmale Junge mit den asiatischen Augen stellt sich neben Udo Stefano, nimmt Witterung auf, vergrößert seinen Abstand um zwei Schritte, und während Udo seine kleine Programmrede hält, sieht er sie alle an, dreißig Mädchen und Jungen, wer es eben zulässt; ein Blick in die Augen und ein fast unmerkliches Nicken. Er lächelt völlig unbefangen. Und als er dran ist, sagt er: Ich bin Florian Janssen aus der 6b. Natürlich stellen Udos Freunde ihre Fragen, aber Florians Antworten gehen weit über das Gefragte hinaus. Er kann wohl Gedanken lesen.
»Ist dein Vater bei der Bundeswehr?«
»Ja, das stimmt. Mein Vater ist Berufssoldat und bildet in Achum Flieger aus.«
»Stimmt es, dass dein Vater für die Nachrüstung getrommelt hat?«
»Mein Vater, Olaf Janssen, ist ein gemäßigter Sozialdemokrat und war mit der Friedenspolitik von Helmut Schmidt völlig einverstanden, soweit ich weiß. Aber getrommelt hat er nie. Ich übrigens auch nicht.«
»Warum singst du denn bei den Bückeburger Jägern?«
»Bei den Bückeburger Jägern singt überhaupt niemand. Das ist ein berühmtes Blasorchester. Kennt ihr James Last? Der hat da gelernt. Ich selbst bin leider nicht besonders musikalisch. Aber ich muss als Unterstufensprecher ja auch nicht zur Pause blasen, nich'?«
»Udo hat ein Programm, wie er die Bedingungen für die Unterstufenschüler verbessern will. Warum hast du keins?«
»Weil wir keine Politiker sind, sondern nur Sprecher. Dazu gehört zweierlei, glaube ich. Zum einen muss man rausfinden, was nicht in Ordnung ist. Das tut man am besten im Gespräch. Ich bin immer bereit zuzuhören. Dann muss man überlegen, wie man das Problem benennt und an wen man sich wendet. Das muss nicht der Direktor, das kann ja auch der Vertrauenslehrer sein.«
»Hast du einen Spitznamen?«
»Ich weiß, dass ich einen Spitznamen habe, aber nur hinter meinem Rücken. Das ist mir nicht ganz egal, und schön ist es auch nicht. Jedenfalls werde ich mich bei niemandem dafür entschuldigen, dass ich ein paar tausend Kilometer von hier zur Welt gekommen bin. Ich bin Bückeburger, Schüler des Adolfinums, genau wie ihr auch.«
Am nächsten Tag zur großen Pause gibt es einen Aushang auf rotem Karton. Udo Stefano hat die Wahl gewonnen; mit einem Vorsprung von sieben Stimmen auf Florian Janssen. Mittags am Fahrradstand will ihm Wegman tröstende Worte sagen, aber der Jüngere ist bester Dinge: »Ach was, das war doch nur der Probelauf für nächstes Jahr!« Danach sieht er ihn einige Male auf dem Fahrrad in der Stadt, aber er scheint immer ein Ziel zu haben, er hält nicht an. Es ist eiskalt unter stahlblauem Himmel, als er Florian auf dem Schulhof entdeckt, diesmal mit Udo Stefano und dem Mittelstufensprecher, der Jörn oder Jörg heißt. Florian hat eine Pelzmütze auf, die ihm über beide Ohren reicht.
Wegman, eher schüchtern, überwindet sich und schiebt sich in den Kreis.
»Aber wie kriegen wir das raus?«
»Keine Frage, das stimmt!«
»Und wenn es doch nicht stimmt? Wenn es ein anderer Rudolf Zocher ist? Dann holst du dir aber den Schulverweis.«
Sie sprechen über den Vertrauenslehrer.
»Was wäre, wenn wir ihn fragen?«
»Was machen wir, wenn er es leugnet?«
»Kann man denn Mitglied einer Partei sein – also heimlich?«
»Nicht heimlich, sondern einfach nicht öffentlich. Solange man keine Ämter hat. Keine Partei veröffentlicht die Listen ihrer Mitglieder – wieso ausgerechnet die?«
Alles ist gefroren, die Karpfenteiche, die Baggerseen draußen beim Forst und auch die Schlossgraft, die zum ersten Mal zum Eislauf freigegeben wird, oder jedenfalls im Gedächtnis derer, die am Leben sind. Man kann dort komplette Runden drehen, und weil es zwischendurch nicht getaut hat, ist die Fläche spiegelglatt. »Authentisch russisch« nennt Florian seine Mütze, Wegman hat nur eine blasse Ahnung, was das Fremdwort meinen könnte. Florian will Flo genannt werden, weil er zuhause auch so heißt. Wegman muss die Obhut der Zwillingsschwestern älteren Mädchen anvertrauen, dann ist er frei, mit Flo Kreise zu ziehen. Nach der dritten Runde macht der plötzlich eine Kehrtwendung und besteht darauf, in die andere Richtung zu laufen: »Sonst bekommt man einen Krampf in dem Bein, das immer belastet ist.« Aber das ist nur der Anfang. Flo neigt zu höheren Einsichten, oder jedenfalls kommt es Wegman bald so vor, als sei in der Gestalt dieses unscheinbaren Jungen ein ganzer Erwachsener verborgen.
Die Mädchen bringen bei einsetzender Dämmerung die Zwillingsschwestern nach Haus, während Wegman mit Florian weiterläuft, schneller jetzt, leicht vorgebeugt, versetzt hintereinander, weil der Graben doch nicht so weit ist, bis sie herausfinden, wie man sich tatsächlich parallel bewegt, »synchron« nennt Florian das. Jetzt fahren sie enger beieinander auf gleicher Höhe; nun versteht man auch, was der andere sagt. Flo ist so flott im Antworten, dass Wegman glaubt, die Glocke vom Schloss her läute alle zehn Minuten.
Es ist lange schon dunkel, als er, zu nahe an den Grabenrand geraten, an einem im Eis steckenden Ast hängenbleibt, fällt und in die Uferböschung rutscht. »Bleib sitzen!«, ruft Flo, der sich neben ihn hockt und seinen Kopf in den Händen hält. Auf Wegmans Stirn bildet sich rasch eine Beule. Flo bricht sich aus der Böschung einen Eiszapfen und kühlt, entschlossen drückend, die Schwellung.
Er begleitet Wegman auch nach Hause, weit ist es nicht, denn er wohnt über der Apotheke in der Innenstadt. Von den Zwillingen als Held des Eissports bewundert, liegt Wegman auf dem Sofa, als der Apotheker selbst zu Hilfe kommt, mit Salbe und Bandagen – »Danke, Eike«, sagt Wegman; Eike mit weißem Kittel und silbern gerahmter Brille entschieden Autorität im Fach ausstrahlend. Dann bleiben die Jungen allein, schweigend zunächst, bis Flo plötzlich zu seiner tadellosen Laune zurückfindet, die sein Markenzeichen ist:
»Wieso nennst du denn deinen Vater beim Vornamen?«
»Das ist ja nicht mein Vater. Das ist mein Onkel.«
»Dein Onkel?«
»Ja, der Bruder von meiner Mutter.«
»Der Bruder deiner Mutter«, berichtigt Flo.
»Ja.«
»Dann sind Bella und Lisa – deine Cousinen?«
»Sie waren meine Cousinen. Jetzt sind sie meine Schwestern.«
Flo grinst, und seine weißen Zähne, die etwas wild beieinanderstehen, leuchten. Er lacht über seine Idee, während er fragt: »Dann haben dich deine Cousinen adoptiert?«
Wegman hat seine Beule vergessen.
»Quatsch, Eike hat mich adoptiert. Na ja, nicht wirklich adoptiert, aber angenommen.«
»Mein Vater hat mich auch adoptiert. Aber trotzdem nenne ich ihn Papa.«
»Aber er ist vielleicht auch nicht dein Onkel.«
»Nee, natürlich nicht.«
Das ist es also, was sie verbindet, aber sie sind noch lange nicht so weit, sich ihre Geschichten zu erzählen oder das, was ihnen als solche erzählt worden ist. Unter dem Wunder der Rettung ist ein Schmerz geblieben. Später einmal werden sie beschließen, dass dies ihr Geheimnis sei. Dafür ist es an diesem Winterabend in Bückeburg noch zu früh. Außerdem liegt hinter dem, was einen verbindet, gewiss auch etwas, was einen unterscheidet. Beide, jetzt wieder schweigend, wissen, dass Vorsicht angebracht ist, sogar im Umgang mit sich selbst.
Wegman Frost hatte zu seinem vierzehnten Geburtstag acht Freunde eingeladen, aber es kam nur einer. Das war Flo Janssen. Alle anderen blieben, nachdem die Nachricht aus der Ukraine eingetroffen war, zuhaus.
Der erste Regen nach Tschernobyl ging über Schweden nieder, aber die Angst hatte Europa im Griff. Es hieß, man werde in den nächsten zwanzig Jahren keine Pilze verzehren können. Manche aßen nur noch Konserven. Die Bückeburger Apotheke wurde bestürmt von Leuten, die Jod kaufen wollten, weil sie glaubten, sich mit der Einnahme vor Strahlung schützen zu können. Wegman besorgte sich eine Rolle Aluminiumfolie und wickelte heimlich seinen Hodensack damit ein, Tag und Nacht, um seine Erbsubstanz zu schützen. Das führte zu einem rosa Ekzem, da ließ er es wieder. In der Schule fehlten die Söhne des Arztes Stübing. Ihr Vater hatte sie nach Teneriffa fliegen lassen, wo er ein Haus besaß. Als sie in die Schule zurückkehrten, wollten sie das nicht zugeben.
Es war Mai, und mit Verwunderung registrierten Wegman und Flo, dass ihr großes Thema eines von gestern war. Udo Stefano, eine Eins in Physik, hatte sich in ein Informationsbüro für Strahlenkunde verwandelt. Der Lehrer Zocher, nun ja – »Versteht ihr nicht? Es geht jetzt um den größeren Zusammenhang«.
Florians Vater wollte von Wegman Olaf genannt werden, buk für die Jungen Pizza und hatte überhaupt nichts Schneidiges an sich, von wegen Oberstleutnant der Bundeswehr. Er stellte eine Menge Fragen, die die Jungen kaum beantworten konnten. Dass Rudolf Zocher rechtsradikal sein könnte, so viel mussten sie zugeben, war noch immer nicht mehr als ein Gerücht, und Zocher hatte sich im Schulalltag als umgänglich und verlässlich erwiesen. Wie, fragten die Jungen, könnte man ihn dazu bringen, sich zu bekennen, bevor er im Herbst als Vertrauenslehrer wiedergewählt würde? Papa Olaf warnte die beiden, Emil und die Detektive zu spielen, und schlug ihnen stattdessen vor, einen Brief an den Landesverband der Jungsozialisten zu schreiben, die Sache »präzise und ohne Übertreibung« darzustellen und um Rat zu fragen. Es sei aber auf keinen Fall ein Fehler zu erwähnen, dass Florian die Wahl zum Unterstufensprecher mit zwölf Jahren nur um sieben Stimmen verpasst habe. Inzwischen war er dreizehn geworden, durch die Zählung eines Geburtstags, der, wie Flo grinsend zugegeben hatte, »willkürlich festgesetzt« worden sei, einem Findelkind ohne Namen angehängt in einer brennenden Stadt. Während Wegman noch nicht die Worte gefunden hatte, von seiner vagen Herkunft zu berichten. Er wollte, wenn es so weit war, auch unbedingt nicht weinen.
Zur Verblüffung der beiden Schüler kam nach einer Woche die Antwort, aber nicht aus Hannover, sondern von einem Juso aus Rehburg-Loccum. Er hatte dies in seine Maschine getippt und mit einem fast leeren Kuli krakelig unterschrieben:
»Lieber Florian, lieber Wegman, ich freue mich außerordentlich, dass Ihr uns in der Frage des Vertrauenslehrers geschrieben habt. Einfach wird das nicht, das steht fest. Erst einmal aber wollte ich Euch fragen, ob Ihr Lust hättet, zu Pfingsten an einer Schülertagung teilzunehmen, deren Thema ›Fremde und Heimat‹ sein wird. Es soll dabei vor allem um den Umgang mit Fremdenfeindlichkeit gehen, diese überhaupt bewusst zu machen. Ich wohne eher zufällig in der Nähe der Evangelischen Akademie, aber seit einem Jahr arbeite ich dort im Jugendausschuss mit, und die Tagung war unter anderem meine Idee, obwohl ich das mit der Heimat nicht so gut finde. Aber nicht so wichtig. Jedenfalls wollten die Jusos fünfzehn niedersächsische Schüler entsenden. Jetzt aber scheint es nur noch um die Kernkraftfrage zu gehen. Wir haben einige Absagen. Vielleicht kommt Ihr einfach zur Tagung nach Loccum? Die Jusos übernehmen die Tagungskosten, aber auch die volle Bahnfahrt. Mit freundlichen Grüßen – Euer Andreas Nair«
Für die dreißig Kilometer brauchten sie anderthalb Stunden. Die Akademie war ein moderner Bau mit riesigen Fenstern, die Ausblick auf eine Klosteranlage boten, und es wimmelte vor Leuten, die alle irgendetwas Wichtiges zu tun hatten, Infoplakate malen, Tische rücken, Brote belegen. Das Zuschauen allein war eine volle Beschäftigung. Flo und Wegman bekamen ein Zimmer für sich, legten dort ihre albernen Köfferchen ab, und schon waren sie wieder unten, wo sie gleich als die Bückeburger ausgemacht wurden, denn sie waren die Jüngsten. Andreas war älter, vielleicht sechzehn, ein Junge mit dunklen Augen und einem Teint wie jemand aus Rom oder aus Konstantinopel, wie Flo in Wegmans Ohr flüsterte, und weil der sich darunter nichts vorstellen konnte, nachsetzte: »Also Antike.« Sie hätten fragen können, aber was genau: Wo kommst du eigentlich her? Möglicherweise war es die unausgesprochene Regel der Tagung, dass sich das nicht gehörte. Niemand fragte das zum Beispiel Flo, das ganze lange Pfingstwochenende nicht.
So ging der erste Nachmittag vorbei: Referat mit Koreferat, Referat mit Diskussion, Referat ohne Diskussion, spontane Aufteilung in Arbeitsgruppen nach Themen. Die sich wiederum im Nu Sprecher wählten, um eine halbe Stunde später im Plenum, wie es hieß, zu berichten. Was waren die Jungen froh, gegen acht im hohen Saal sitzen zu dürfen bei Graubrot mit Aufschnitt und Hagebuttentee, die Gesichter erhitzt, und später, es war lange hell, gingen sie hinaus und um das Kloster herum, das, darin waren sie sich einig, viel schöner war als das Bückeburger Schloss. Sie hatten das Gefühl, weit gereist in einem anderen Land angekommen zu sein. Bevor es richtig dunkel war, lagen sie schon in ihren Betten.
Andreas Nair stand für den Samstag vor dem Mittagessen allein auf dem Programm. Er wurde mit dem Hinweis eingeführt, er habe diese Tagung angeregt. Sogleich verschwand das nachsichtige Lächeln aus den Gesichtern der zahlreich anwesenden Vikare und Pastoren.
Ganz ungewöhnlich für einen Schüler, trug er ein gebügeltes, weißes Hemd über einer Bundfaltenhose, die ihm Gewicht zu verleihen schien. Er schwitzte nicht. Mit dem ersten Satz hob er beide Arme, ließ sie für einen Augenblick mit den Handflächen nach oben stehen und dann wieder sinken. Andere Gesten, die folgten, waren ebenfalls symmetrisch. Es schien, als habe er die Unterschiede, die durch zweierlei Herkunft bedingt sind, in sich bereits ausgeglichen. Seine Rede allerdings zielte aufs Gegenteil.
Er zeichnete das düstere Bild einer aufs Materielle versessenen Gesellschaft, die Menschen aus anderen Ländern in Gettos hielte. Er erwähnte die wenig begehrenswerte Position von Frauen »aus Anatolien, die weniger Freiheiten haben als ihre eigenen Kinder«; »Afrikaner, die sich anhören müssen, sie stammten von den Affen ab – man ist so dumm zu unterstellen, wer schwarz sei, verstünde kein Deutsch.« Jeder Flüchtling aus der DDR, jeder Aussiedler aus Siebenbürgen werde als Held der Freiheit gefeiert und bekäme sogleich einen bundesdeutschen Pass. Aber wehe, es wolle jemand zuwandern, zum Beispiel der Bürger einer ehemaligen deutschen Kolonie.
Die Fremdenfeindlichkeit sei im Wesentlichen nicht organisiert, der Einfluss der NPD überschätzt und die Rolle der neuen Partei der »Republikaner« – »in Wirklichkeit Antirepublikaner« – noch nicht klar. Die westdeutsche Angst vor dem Fremden sei so unsichtbar wie allgegenwärtig, von den höchsten Ämtern in Bonn bis zu den Stammtischen von Schaumburg und Nienburg. Das spiegele sich im Einwanderungsrecht, das ein Blutrecht sei. Dies gelte es so bald wie möglich zu verändern, ins Gegenteil zu verkehren: Erst wenn Deutschland begreife, winziger Teil einer großen Welt zu sein, wäre die Gesellschaft vorbereitet für die Zukunft. Es gebe für Westdeutschland kein Vorbild, nicht Schweden, nicht Großbritannien, nicht die USA – es gelte nicht, Formeln zu übernehmen, und schon gar nicht, die eigene Geschichte zu fälschen. »Die Frage ist: Was ist jetzt? Wir werden in den Spiegel schauen müssen, und wir werden erkennen, dass wir nicht die sind, die wir denken, dass wir sind.«
Beim Mittagessen standen Sonnenstrahlen diagonal im Raum; man sah Tausende von Partikeln darin schweben wie Stellvertreter noch nicht ausgebrüteter Gedanken. Trotz der Düsterkeit des Resümees hatte Nairs Rede den Hörern einen Schub gegeben – eine Wirkung, die niemand zuvor und auch niemand danach erreichen konnte. Es waren einige illustre, fortschrittliche Theologen zu Gast, geschliffene Sprecher. Und dennoch schienen deren Deutungen christlicher Nächstenliebe das, was in Loccum stattfinden konnte oder sollte, eher aufzuhalten. Nair hatte abstrakte Gegner benannt, Gesetz einerseits und andererseits die Stimmung im Lande. Das war groß genug. Man musste etwas tun.
Flo und Wegman waren ziemlich geschmeichelt, als sich dieser große Junge in der Kaffeepause zu ihnen setzte. Andi sollten sie ihn nennen. Er fragte noch einmal nach, wer wer sei – »ach, du bist der, der fast Unterstufensprecher geworden ist« –, und Florian grinste selbstzufrieden. Wegman maß er intensiv mit den Augen, und dieser glaubte, dass Andi sehr wohl den Grad seiner Fremdheit abzuschätzen versuchte; sie bildeten also ein exotisches Trio, wobei keinem der drei in der deutschen Diktion auch nur ein Fitzelchen fehlte. Mit geschlossenen Augen hätte man nichts anderes gehört als die niedersächsische Kleinstadt protestantischer Prägung, Gymnasiasten unter sich.
Andi wollte wissen, wie die Bückeburger auf die Spur des möglicherweise rechtsradikalen Lehrers gekommen waren, und auch, wie er hieß. Das war ein eigentümlicher Moment, denn nun mussten sie den Namen nennen, was ihnen klarmachte, wie ernst es werden würde. Üble Nachrede stand durchaus im Raum. Sie sollten, riet Andi, dort nach der Quelle suchen, wo der Verdacht zuerst aufgekommen war; sie aber hielten dagegen, dass es ein Schulhofgespräch gewesen sei und die Mitschüler davon jetzt nichts mehr wissen wollten. Eine andere Möglichkeit wäre, schob er nach, sich als angeblich Interessierter an die »Republikaner« zu wenden, auf die nächste lokale Versammlung zu gehen und zu prüfen, ob Rudolf Zocher dort erscheine. Dafür bräuchten sie allerdings einen Strohmann, einen Erwachsenen, am besten sogar jemanden, der nicht Elternteil am Adolfinum sei. Er machte auch einen Witz über den Namen der Schule.
Eine dritte Möglichkeit wäre, das Thema allgemein aufzubringen: Ein Artikel über Fremdenfeindlichkeit, über die Propaganda der »Republikaner«, über die Geschichte der Stadt – das wüssten sie hoffentlich, dass Bückeburg ein ganz übles Nazinest gewesen sei –, ein Artikel, in dem es nonchalant (Wegman sah Flo an, und der übersetzte: »lässig«) heißen würde … »Ja, ganz harmlos, ungefähr so: Wir würden als Gymnasiasten natürlich gern glauben, dass solche Umtriebe in unserer Lehrerschaft niemals eine Stimme finden würden, aber so ganz eindeutig ist die