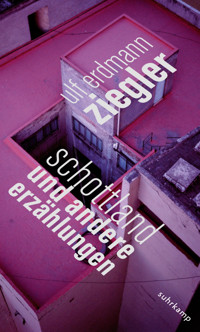16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch erzählt vom deutschen Abenteuer eines amerikanischen Puritaners, der »die Anfänge liebte«. Will McBride kam 1953 mit der US-Armee nach Deutschland und blieb. In West-Berlin erfand er die »Clique«, die melancholisch gestimmt ihr Vergnügen suchte. Mit diesem Motiv wurde er Fotograf der neuen Zeitschrift twen und bald ein Star seines Fachs. Die Aufnahme seiner Frau Barbara als Schwangerer gereichte zum Skandal. In den sechziger Jahren betrieb er in München ein riesiges Studio, in dem die Bilder für Zeig Mal! entstanden, das paradigmatische Aufklärungsbuch der sozialliberal verjüngten Republik.
Von Worpswede bis in die Toskana suchte McBride nach einer frischen Form für einen überzeugenden Lebensstil. Die biographischen Recherchen des Autors summieren sich zu einer alternativen Kulturgeschichte der Bundesrepublik. Gastauftritte haben Willy Fleckhaus, Donna Summer, Hans Filbinger, Willy Brandt, Norman Rockwell und Wolfram Siebeck. Eine Auswahl von McBrides besten schwarzweißen Fotografien begleitet die ungewöhnliche Erzählung von der »Erfindung des Westens«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Ulf Erdmann Ziegler
Die Erfindung des Westens
Eine deutsche Geschichte mit Will McBride
Suhrkamp
Inhalt
Nach Deutschland
Worpswede
Adenauer
Willy Fleckhaus
twen
West-Berlin
Die Clique
Strandbad Wannsee
Chlodwig Poths Satiren
Ein Bauernhaus in der Toskana
HfG Ulm
Die Leica
Illustrierte versus Fotobuch
David und Hair
Donna Gaines, Donna Summer
Amerika
Von Grosse Pointe zu Norman Rockwell
Whitmans Knabe
David Heinemann und Julius Leber
Die HfG und »Die Weiße Rose«
Willy Brandt
Hermann Hesses Siddhartha
Studio Maximilianstraße
Pleite und Erfolg
Kartonhaus
Von Salem zu Uli
Toskana-Fraktion
David Heinemann, Hans Filbinger, die HfG
Zeig Mal!
Die Siebecks
Einsamkeit und Freiheit
Tafelteil
Bildtitel und -nachweise
Anmerkungen
Nach Deutschland
Die Bundesrepublik war vier Jahre alt, als Will McBride mit der amerikanischen Armee nach Deutschland kam. Der zweiundzwanzigjährige Soldat dachte nicht, dass Fotografie seine Berufung wäre, aber fing sogleich an, schwarzweiße Bilder zu machen, zunächst von anderen GIs in Würzburg, wo er stationiert war. Soeben entlassen, zog er 1955 nach Berlin. Nach Stationen in München und Frankfurt kehrte er in die wieder offene Stadt Berlin, kurz vor der Jahrtausendwende, zurück. Sein Hauptwerk aber entstand in seiner Münchner Zeit im Umfeld der Zeitschrift twen.
McBrides fotografisches Œuvre hatte eine autobiographische Wurzel und wuchs in eine soziale Gestalt. Seine Bilder waren lebendig und leicht verständlich, obwohl sie oft eher aus Andeutungen bestanden, also überhaupt nicht dem geltenden Dogma folgten, dass Fotografie »das Typische« abbilden solle. So ist seine Beobachtung des Jungen in Berlin-Schöneberg, der nur mit der Unterhose bekleidet auf dem warmen Straßenpflaster liegt, ein phantastisches Foto über kleine Freuden der Nachkriegszeit. Es ist aber auch ein archaisches Bild über Empfindungen der Kindheit. McBrides Figuren stellen dar, wie sich das Leben in einem bestimmten Moment anfühlt, anreichert mit Sinn, auf anrührende Weise stillsteht.
Man sagt der Fotografie nach – im Gegensatz zur Malerei –, sie könne nur abbilden, was bereits geschieht oder soeben geschehen ist. Das ist aber nicht richtig. McBride sah die hedonistische Öffnung der Bundesrepublik voraus und wendete sie affirmativ ins Humane. Nichts spricht dagegen, seine Fotografien als Dokumente zu dechiffrieren. Dabei aber entdeckt man: Will McBride war ein Visionär.
Fotografie wurde bis hundert Jahre nach ihrer Erfindung als Technik verstanden. Später wurde es üblich, sie ein Medium zu nennen. Zuletzt ist sie als Sonderfall von Kunst wahrgenommen worden. McBrides Erfolge fallen in die Zeit der Fotografie als Medium. Im Zenit seiner Karriere gelang dabei etwas, was selbst unter den größten Fotografen der Welt selten geblieben ist: ein Buch, das eine tiefe Wirkung auf die Gesellschaft ausübte. Es hieß Zeig Mal! und nannte sich auf dem Cover Ein Bilderbuch für Kinder und Eltern. Es hat die gesamte verstaubte Literatur der Sexualaufklärung weggefegt. In der Geschichte der Bundesrepublik ist Zeig Mal! so wichtig wie die Studie der Mitscherlichs über Die Unfähigkeit zu trauern, wie Willy Brandts Kniefall in Warschau, das freischwebende Dach des Münchner Olympiastadions von Frei Otto oder die Honigpumpe am Arbeitsplatz von Joseph Beuys auf der sechsten documenta – ein Shifter im sozialen Code, eines der wenigen singulären, kulturellen Signale einer nicht mehr umkehrbaren Moderne.
Wahrscheinlich gibt es keinen Fortschritt ohne Rollback, aber wer aktiv und willentlich teilhat an einem Modernisierungsprozess, geht vom Gegenteil aus. In der Nachkriegsgesellschaft konnte ins Gefängnis kommen, wer junge Unverheiratete bei sich übernachten ließ; Mitte der siebziger Jahre lebten Tausende junger Leute in Wohngemeinschaften. Eine Abtreibung gab es nicht mehr beim Quacksalber. Den Wehrdienst konnte man irgendwann aus Gewissensgründen verweigern, erst durch eine »Gewissensprüfung«, dann per Postkarte. Der »zweite Bildungsweg« durchlöcherte das Klassensystem der Schulen. Man kann es damit erklären, dass sich die Mehrheit der Wähler von den Leitmotiven des Adenauerstaats abwandte und eine »sozial-liberale Koalition« die Geschicke übernehmen ließ, für immerhin dreizehn Jahre. Aber der gesellschaftliche Wandel fühlte sich an wie eine Öffnung der Schleusen. Das Gemeinwesen stieg in einen Jungbrunnen und kam jung wieder heraus. Es gibt keine Formeln für das, was neu ist; das Neue muss erfunden werden. An der Erfindung Westdeutschlands als offene, mobile und hedonistische Gesellschaft hatte Will McBride seinen Anteil.
Was Will McBride fotografierte, war eingebunden in ein Narrativ, das der Fotograf selbst lieferte und gelegentlich variierte. Demnach war er ein Sinnsucher aus einem puritanischen Milieu, der das zivile Leben als Negativ des Krieges deutete. »Ich verließ die Armee und blieb im Lager des Kalten Krieges«, schrieb er über seinen Umzug nach West-Berlin im Jahr 1955. »Ich sah mich als Pionier, dessen Seele in Leder gehüllt ist, während er das Gewehr des Friedens aus den Wäldern der Appalachen in die schreckliche Wildnis der Völker trägt.« Die Besiedlung des amerikanischen Westens wird ausgeweitet nach Europa, aber der soeben entlassene Soldat sieht sich in der Gestalt eines Indianers. Er ist zunächst absolut fremd und versteht auch »das Sprachengewirr« der Vier-Sektoren-Stadt nicht.1 Wie sollte er auch? Als er unter den Deutschen gleichaltrige Freunde findet, wird ihm klar, dass diese jungen Leute nicht nur von den Amerikanern befreit worden, sondern dass es allesamt Kriegskinder sind. Ja, sie tanzen zusammen zu altertümlichem Jazz, aber was sie versuchen zu vergessen, ist nicht für jede und jeden dasselbe. Er notiert: »Lang lebe der Ragtime! Zieh die ausgefransten engen Hosen der Cowboys an, Jan. Geh unter die Dusche, damit sie einlaufen und Farbe verlieren. Vergiß das braune Hemd und die Armbinde mit dem krummen eckigen Zeichen. Zieh das hier an. Hier, dein Pullover, ein paar Nummern zu groß, lässig und bequem. Nimm die Trompete und fang an zu spielen. Die Akkorde gehen so, blues und easy. Laß dich gehen, Jan. Der Krieg ist schon lange vorbei.«2
Die Kleiderordnung ist wörtlich zu nehmen: Die Begegnung der jungen Männer und Frauen wird eine Frage des Stils. Wer es schafft, genau so auszusehen, gehört auch schon dazu. Sie kommen zusammen bei einem Bootsausflug auf der Havel (oder der Spree), um sich selbst zu feiern, ihre Unabhängigkeit, ihre Schönheit, ihre Clownereien, ihre todschicke Melancholie. Der amerikanische Maler mit seiner Kamera ist an Bord. Er choreographiert die Natürlichkeit der Körpersprache; sorgt dafür, dass nur im Bild ist, wer richtig aussieht; schöpft aus einem Tag einen Lebensstil. McBride setzt West-Berlin auf die Landkarte existenzialistischer Hipness.
Erst in den achtziger Jahren würde dies ein fotografisches Genre werden: Lifestyle. Gemeint ist eine Nische der Publizistik, weder Mode noch Reportage. Man könnte vielleicht sagen, dass dieses Genre einen Lebensstil eher vorwegnimmt als eigentlich abbildet. Es braucht dafür auch keine Akteure, die tatsächlich so leben, aber sie sollten es wenigstens herbeisehnen. Unverzichtbar ist der Beobachter, der den Trend erspürt, lange bevor er Mainstream wird. Ganze Berufssparten können darin verwickelt werden, Art-Direktoren, Texter, Stylisten. So ist es später gekommen, aber hier, 1957, stilisiert die Gruppe sich noch selbst. Der Fotograf wächst in die Rolle eines Produzenten; er muss sehen, dass die Logistik stimmt, genügend Leute kommen, die Accessoires vorhanden sind. Dann, auf dem Boot, ist ein gewisses Maß an Darstellungskunst gefragt. Die Bilder waren gerade deshalb so wirksam, weil der Beobachter kein Fremder blieb. Der Fotograf jagte seinen Modellen die Bilder nicht ab – er bekam sie geschenkt. So jedenfalls sah das aus.
Erstaunlich bleibt, dass Will McBride ein vielbeschäftigter Fotojournalist gewesen ist. Er fotografierte Magazingeschichten für Quick, den stern, GEO, auch für Life, Look und Paris Match. Diese Aufträge jedoch spielen im Bilderfundus später keine Rolle mehr, abgesehen von den intensiven Portraits des Kanzlers Konrad Adenauer und des in Berlin Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt. Man findet sie sensationellerweise nebeneinander im Fond eines Cabrios mit John F. Kennedy als Drittem, und im Hintergrund, exakt mittig, das Brandenburger Tor – hinter einer Mauer. Auftraggeber war die Illustrierte Quick. Vom Standpunkt der Reportage aus betrachtet ist das Bild komplett geglückt, indem Aufmerksamkeit und Wichtigkeit verschmolzen sind. Es schreibt nicht Geschichte, es macht sie. Adenauer schaut gelassen in die Kamera, Brandt blickt in die Zukunft, und Kennedy liefert eine Geste mit der rechten Hand, die an Segnen erinnert.
An seine Zeit als Fotojournalist erinnert McBride sich später so: »Spät abends bekam ich Anrufe, worauf ich packen, das nächste Flugzeug oder den nächsten Zug nehmen musste, um in einem anderen Land die Themen zu fotografieren, für die ich bezahlt wurde. So gerne reiste ich nun auch wieder nicht.«3 Er sehnt sich nach dem Kokon der Familie. Aber das Entstehen der Familie beunruhigt ihn auch. Über seinen ersten Sohn notiert er nach dessen Geburt: »Ich selbst trug ihn nach Hause. Niedliche Büchse der Pandora, Unschuldslamm. Schniefender und greinender Usurpator, gieriger Plünderer, zärtlich gewaschen und gesalbt und mit duftendem Puder bestäubt.« Als Fotoreporter erfüllt er seine Rolle als Ernährer, er verdient gut Geld; als Vater hat er das Gefühl, sein Sohn »machte sich mit meiner geliebten Frau auf und davon«.4
Für Will McBride war die Welt kriegerisch und die Idylle trügerisch. Musste er sich entscheiden, blieb er zu Haus und fotografierte die Familie als Universalie.
Man könnte ihn als einen Mann beschreiben, für den es zwar die ideale Zeit gab, aber den idealen Ort nicht. Jede Suche wurde ihm zur Sinnsuche; jeder Interessenkonflikt schnitt ihm ins eigene Fleisch. Sein eigentlicher Raum künstlerischen Schaffens wurde das Atelier, und am Ende seines Lebens blieb er allein mit dem Monument eines Knaben, der als fallender Krieger eine Erektion bekommt. Davor aber entstand, im Atelier, ein bedeutendes, zutiefst humanes fotografisches Werk. Die Fotografie, glaubte McBride – wie viele bildende Künstler vor ihm5 –, sei nicht viel mehr als ein Werkzeug. Die fotografischen Bilder waren also vorläufig oder transitiv. Sie sind der lebendigste Teil seines Werks geblieben, eine deutsche Geschichte der Intimität.
Das agilste Modell der Berliner Clique war Barbara Wilke, deren Mutter in Worpswede, einer Künstlerkolonie nördlich von Bremen, eine Galerie betrieb. Hier fand der Fotograf eine intakte Kulisse, das Bild eines unversehrten Deutschlands mit einer weiten kulturellen Referenz im Hintergrund. Dort heiratete er Barbara im September 1959, verschmolz also die Clique, die Geliebte und sich selbst mit der Genealogie einer deutschen, mehr oder weniger bürgerlichen Familie. Er notierte später, er habe damals das Gefühl gehabt, mit Barbara »ganz Europa geheiratet«6 zu haben.
Bei der Hochzeitszeremonie steht er falsch, darauf weist ihn aus der ersten Reihe seine Schwiegermutter hin, er wechselt auf die linke Seite der Braut. Aber er hat nicht ins Spießermilieu geheiratet, sondern in die Kunstszene. Bald erscheint ein Bild, dass die barbusige Braut im weichgezeichneten Worpsweder Interieur zeigt, wie sie einen weißen Schleier anprobiert. Die ganze Hochzeit, von einer Kollegin namens Elisabeth Niggemeyer fotografiert, findet ein Jahr später in der neugegründeten Zeitschrift twen noch einmal statt, und einen Monat darauf gibt es ein Bild McBrides von Barbara im Profil, deren schwangerer Bauch den Bund ihrer Jeans gesprengt hat, was für einen Skandal reichte. Ein Gutachter des Bundespresseamts kam zu folgendem Schluss: »Die Photos sind bis zur Unerträglichkeit gewagt, aber sie lenken zum Text, und der ist nicht anstößig.«7
Das heißt, schon zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit waren Barbara und Will McBride bis zu einem gewissen Grad Celebrities. Was sie tun würden, würde außergewöhnlich, schön und weithin sichtbar sein. Ein amerikanischer Maler wäre in dieser Familie schon okay gewesen, aber das offensichtliche, kommerzialisierbare Talent Will McBrides lag – wenn man zu schauen verstand – in der Fotografie. Wahrscheinlich hat die Schwiegermutter Lotte Cetto ihm einen Kontakt zu Diedrich »Pitt« Kenneweg gebaut, der leitend bei Quick in München tätig war. Die hatte die Millionenauflage Mitte der fünfziger Jahre bereits überschritten. Sie brachte dem Familienvater McBride eine lukrative Festanstellung, katapultierte ihn mitten in die westdeutsche Medienlandschaft. Drei Söhne, alle geboren in der ersten Hälfte der sechziger Jahre, bekamen amerikanische Namen. 1969 kam die Ehe an ihr Ende, aber Will McBrides rebellisch-puritanischer Familienbegriff sollte wenige Jahre später aufgehen in Zeig Mal!, dem emblematischen Buch der siebziger Jahre. Mit Anfang vierzig hatte McBride schon ein ganzes Leben hinter sich und begann ein zweites.
Worpswede
In Worpswede anzudocken muss für McBride ein unwiderstehliches Angebot gewesen sein. Dort galten die Bedenken seiner Eltern, dass Kunst nicht lohne, gar nichts – im Gegenteil, beschränkte Mittel gehörten zu den Urerfahrungen der Künstlerkolonie zwanzig Kilometer nordöstlich von Bremen. Gewiss hat nicht jeder Besucher Worpswedes das Leben in Katen und Baracken in der Nähe eines Moors als ideale Bedingung eines Künstlerlebens begriffen, für manche aber waren der Ort, seine Nähe zur Natur und sein soziales Band geradezu mythisch. Rainer Maria Rilke sah dort großes künstlerisches Potential; 1902 schrieb er eine Abhandlung über die – für ihn – fünf entscheidenden Maler der Kolonie. Dabei übersah er die sechste, die später als Paula Modersohn-Becker zu einiger Berühmtheit kommen sollte, weit über Bremen hinaus. Das heißt, er übersah sie nicht wirklich, sondern wurde in ihrem Atelier zum Tee empfangen. Er heiratete aber nicht sie, sondern die Bildhauerin Clara Westhoff. Die künstlerische Nähe entflammte Leidenschaften und führte zu Entfremdungen und Zerwürfnissen. Jeder und jede war mindestens potentiell doppelt vergeben, und Otto Modersohn – »eine ernste, schwermütige Natur bei einer großen Freude an Sonnenschein und Frohsinn«8 – wurde dort zweimal Witwer, aber auch nach Paulas Tod, mit zwei Kindern, sollte er noch einmal heiraten.
In Rilkes Monographie nehmen Fritz Mackensen und Heinrich Vogeler beide prominente Plätze ein. Sie sollten sich politisch als Antipoden erweisen. Mackensen, der Sohn eines Dorfbäckers, nämlich verwandelte sich vom Naturschwärmer in einen »Maleroffizier«. Schon 1934 paktierte er mit den Nationalsozialisten. Heinrich Vogeler aber, ein Illustrator im Jugendstil, repräsentierte die offene und spirituelle Seite der Künstlerkolonie. Seit 1899 hatte er für die Münchner Zeitschrift Die Insel gezeichnet. Der Sohn eines Bremer Kaufmanns erlebte im Ersten Weltkrieg einen kompletten seelischen Zusammenbruch, kehrte als Sozialist nach Worpswede zurück und zog 1931 mit seiner Frau Sonja Marchlewska in die Sowjetunion. Als Deutscher deportiert nach Kasachstan, starb er dort 1942, sein Grab ist nicht bekannt.
Worpswede kann man also als Außenposten-im-Nebel betrachten, als zänkisch-inzestuösen Ort einer völkischen Kunst; oder als handverlesene Gemeinde mit nationalem und internationalem Netzwerk, in der sich die klügsten und empfindsamsten Künstler des Deutschen Reiches tummelten. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg behielt Worpswede dieses doppelte Gesicht, indem nämlich Leute wie Mackensen, um einige verräterische Vokabeln ärmer, auf der Heimatkunst beharrten – 1953 bekam er, in seinem letzten Lebensjahr, das Bundesverdienstkreuz. Schwerbelastete Nazis holten sich nach dem Krieg reihenweise ihre »Persilscheine« ab; ließen sich als Mitläufer oder Entlastete qualifizieren. Andere witterten die Chance eines Neubeginns, so wie Klaus Pinkus, ein remigrierter jüdischer Deutscher, der in Worpswede Lotte Cetto traf – sie trug den Namen ihres zweiten Mannes – und bald heiratete, ihre dritte Ehe. Sie betrieben eine Galerie, die sie – wie die Münchner Zeitschrift ein halbes Jahrhundert zuvor – Die Insel nannten. Dort verkauften sie moderne Kunst, und aus Hamburg kam namhafter Besuch – Zeichner und Grafiker wie Horst Janssen und Paul Wunderlich. Pinkus war mit einer dringenden Empfehlung in Worpswede angelandet: den düsteren Surrealisten Richard Oelze zu finden, einen introvertierten Künstler mit einem rätselhaften, wuchernden Bildwerk, das es noch zu entdecken galt. Tatsächlich wurde Oelze dann eingeladen zur documenta II (1959) und III (1964). Das neue, moderne Kommunikationszentrum ruhte also wiederum auf einem vom genius loci beflügelten Ehepaar, und dort, mitten unter Künstlern, wuchs Barbara Wilke auf, Lotte Cettos Tochter. Kein Wunder, dass Will McBride in diesem Dorf nicht das dunkle Deutsche sah, sondern den kosmopolitischen Funken spürte.
Gleich zu Beginn des neuen Jahrhunderts hatte sich in Worpswede ein kultureller Riss gezeigt. Das Ehepaar Modersohn nämlich zeichnete sich nackt in der Natur; die konservativen Gründer der Kolonie, Fritz Mackensen und Hans am Ende, fanden das unmoralisch und skandalisierten es zu einem Fall. Geradezu grotesk ist die Angelegenheit, wenn man weiß, dass Modersohn jahrelang neben seiner klugen Kollegin schlief, »ohne daß er mich zu seiner Frau machte«.9 Was die Frage durchaus verschiebt, nach welchem Bild Paula Modersohn suchte, indem sie Nacktheit und Weiblichkeit an den Bauernkindern erforschte und dann an sich selbst ausprobierte. An ihrem sechsten Hochzeitstag malte sie sich als Schwangere, obwohl sie nicht schwanger war. Man sieht sie im Halbprofil vor einer gepunkteten Tapete, dem Betrachter in die Augen schauend, den Unterrock (oder ein Tuch) so weit unten wie möglich, mit einer Perlenkette, die ihre Brüste trennt. Die rechte Hand liegt in der Magengegend, die linke umfasst den gerundeten Bauch und deutet zwischen Daumen und Fingern eine Aussparung an, so als habe sie die Welt – oder ihren Ehemann – auf einen bestimmten Vorzug weiblicher Anatomie erst einmal hinweisen müssen.
Merkwürdigerweise reiht sich auch die Kunstboheme-Tochter Barbara Wilke ein in die Worpsweder Skandalisierung. Als sie nämlich mit sechzehn Jahren entdeckte, dass sie »lieber mit Jungs spielte als mit Spielzeug«,10 wurde sie, um ihre Mädchenehre zu retten, zu Freunden »der Eltern« nach Schweden verschickt, von wo aus sie zwei Jahre später weiterzog nach West-Berlin. Um die Worpsweder Geschichte der Intimität fortzuschreiben: In I, Will McBride verrät der Fotograf und Autor, er und seine sehr junge Braut hätten damals beschlossen, »jene Säfte« bis zur Eheschließung aufzusparen, was der puritanischen Herkunft McBrides geschuldet war.11 Wichtig erscheint dies insofern, als die Sicht des Fotografen auf »die Clique« in Berlin also nicht implizierte, dass sämtliche Schlachten der Selbstbefreiung und Selbstbestimmung schon geschlagen waren; man gab sich unkonventionell, hielt sich aber an die Konvention. Umso erstaunlicher der Umstand, dass das Paar dann, als Barbara – verheiratet – deutlich sichtbar schwanger war, der Republik über twen jenes Bild lieferte, das zu einem Skandal taugte. Im Detail: Darauf ist Barbara im Halbprofil zu sehen, wie sie kokett – oder in falscher Bescheidenheit – in die Kamera schaut; ihr Bauch scheint den Reißverschluss der Jeans (damals in Deutschland noch bekannt unter »Nietenhosen«) aufgesprengt zu haben. Sie ist nicht einmal ein bisschen nackt, aber es liegt etwas Dreistes in diesem Bild, was mit der offenen Hose zu tun hat, der Überblendung von Sexualität und Schwangerschaft. Ganz unwahrscheinlich, dass Will McBride das Selbstportrait Paula Modersohn-Beckers nicht gekannt hat. Es hing schon damals in der Sammlung in der Bremer Böttcherstraße. Schließlich war McBride, nach eigenem Verständnis, Maler.
Adenauer
Also … es sitzen Kennedy, Brandt und Adenauer im Fond eines Cabrios …– aber dies ist nicht der Anfang eines Witzes. Gewiss, die Illustrierte Quick hatte beschlossen, zum Berlinbesuch des Präsidenten der USA keinen altgedienten Fotoreporter zu schicken – Hanns Hubmann war im Impressum gelistet –,12 sondern drei junge Männer, denen man zutraute, die Gunst der Stunde zu nutzen. Es wurde eine reine Jubel- und Gruselstrecke – Konfettiparade hier, ein Blick auf den Mauerstreifen dort. McBrides Dreierportrait vor dem Brandenburger Tor fand darin keinen Platz. Die Intimität des Bildes lebt von der tatsächlichen oder imaginierten Nähe des Fotografen zu den politischen Würdenträgern, die so eng beieinandersitzen, als wären sie Familie. Der Fotograf kannte John F. Kennedy von einem Interviewtermin im Weißen Haus (mit dem Chefredakteur der Quick Karl-Heinz Hagen); den Regierenden Bürgermeister Brandt mindestens von einer Flugreise (Köln-Bonn nach Berlin); und Konrad Adenauer hatte er wenige Wochen zuvor in Cadenabbia kennengelernt, einem kleinen Ort am Comer See, wo der Bundeskanzler regelmäßig und auch im Frühjahr 1963 seinen Urlaub verbrachte.
Über die Situation in Berlin berichtete er später: »Und als ich alle drei Staatsmänner am Brandenburger Tor wieder traf, sprang ich fast in den Wagen hinein, so begeistert war ich, sie zusammen zu sehen – bis der Ellenbogen des Leibwächters mich darauf aufmerksam machte, daß ich zu nah gekommen war.«13
Adenauer war also, als McBride ihn in Italien zum ersten Mal fotografierte, 87 Jahre alt. Der Fotoreporter – gleiches Sternzeichen – war damals 32.
In einem Fotobuch über Adenauer – McBrides erste Monographie überhaupt –, das 1965 (also zu Lebzeiten Adenauers) erschien, erlaubte sich der Fotograf im Anhang umfangreiche Erläuterungen »Zu den Bildern«: »Während der Reise« nach Italien »dachte ich über das Gesicht nach, das ich fotografieren sollte, dieses vertraute, steinerne Antlitz des unvergleichlichen alten Mannes, der im Alter das Aussehen eines amerikanischen Indianers gewonnen hatte; und ich fragte mich, was es da noch zu fotografieren geben werde, das nicht schon viele tausend Male abgebildet worden war. Aus Beschreibungen der deutschen Presse hatte ich das Bild eines verfallenen Alten vor Augen, der beinahe nicht mehr Herr seiner Sinne ist, ich erwartete, ein Gesicht fotografieren zu müssen, dessen Züge unter der Last sorgenvoller Gedanken zu einer steinernen Maske erstarrt waren.«14
Konrad Adenauer aber war, ganz im Gegenteil, physisch recht agil und geistig völlig präsent – was eben gerade das Problem darstellte. Denn die Kandidatur für eine vierte Amtszeit hatte seine eigene Partei, die CDU, ihm nur gelassen unter der Bedingung, dass er zur Hälfte der Legislaturperiode seinen Posten räumen würde. Das heißt, McBride traf ihn als eine Figur, die sich für unentbehrlich hielt und im unvermeidlichen Rücktritt ihr Scheitern voraussah. Was Quick mit Adenauer betrieb, war eine gruselige Anti-Hagiographie. Je riesiger und müder Adenauer wirkte, desto bedrohlicher war er für den politischen Apparat.
Das Porträt-Buch zeigt Adenauer als nahbar, und so hat McBride ihn auch empfunden. Adenauer gestikulierend (mit einer weißen Serviette oder einem Schnupftuch in der Linken); Adenauer beim Tee (die Tasse am Mund, einen Brief lesend); beim Boccia-Spiel; auf einer Gartenbank sitzend (mit übergeschlagenem Bein und Hut, ein Hauch von Charlie Chaplin); vor einer Pressekonferenz (jemand tupft sein Gesicht trocken); Akten studierend am Schreibtisch in Rhöndorf; als Spaziergänger im Garten, regennass; dem Fotografen aufs Charmanteste eine weiße Rose überreichend; einem schwarzen Mercedes 600 entsteigend; auf Wahlkampfreise im Saarland (warnend »vor den Gefahren des Weltkommunismus«, wie McBride im Anhang des Buchs berichtet15).
Adenauer sollte auch nach seinem Rücktritt als Kanzler seinen Sitz im Bundestag nicht aufgeben. Am 17. Februar 1966 um 17 Uhr, wie McBride notierte, kam es zu einer Begegnung mit dem Altbundeskanzler im Bundeshaus, also im Haus des Parlaments in Bonn. Es war wohl das erste Interview, das McBride für twen führte.
Zuerst beklagt Adenauer das Fehlen von Männern zwischen 45 und 65 Jahren – »infolge des Krieges«. Dann bekennt er sich, erstaunlicherweise, zum Laisser-faire: »Erziehung, ich bin ja dafür, möglichst wenig zu erziehen«, warnt allerdings: »Vor einem habe ich Angst, vor dem Fernsehen! Das bringt Kinder total durcheinander.«16 Er erwähnt seinen Rottweiler – »sehr klug« –, weil dieser den Fernseher nur einmal beschnüffelt habe; er »sieht keinen Apparat mehr an«. Darauf folgt eine Passage über Geschichtspessimismus (die weiter unten wörtlich zitiert wird). McBride versucht, Adenauer in eine Debatte über politische Mündigkeit zu ziehen, nicht sehr erfolgreich. Gegen Ende des Interviews verteidigt der Kanzler, ohne sie so zu nennen, »die skeptische Generation«, die in McBrides Augen nicht engagiert genug sei. Er gibt zu, dass ein »Sicherheitsdenken« vorherrsche, preist aber den Sozialstaat, der dieses hervorbringe, als großen Fortschritt.
McBride geht nicht so weit, Adenauer und seine CDU frontal für das Sicherheitsdenken verantwortlich zu machen. Er versucht, Adenauer von seiner sorgenvollen Seite anzurühren, ihn zu einem persönlichen Bekenntnis zu verleiten, indem er selbst bekennend auftritt:
»McBride: Die Dinge, an die ich geglaubt habe, gibt es nicht mehr, und das betrübt mich.
Adenauer: Ich will Ihnen sagen, die Welt und diese ganzen Verhältnisse in der Welt haben sich seit 1914 bis heute 1966 so kolossal geändert. Als der Krieg zu Ende ging, glaubten wir doch alle mehr oder weniger, jetzt käme eine gewisse Zeit der Pause, der Erholung, der Wiederaufbau war die Hauptsache, Neuordnung, etc. Nein, es ist viel schlimmer geworden.
McBride: Es ist so schlimm und noch schlimmer – und ich komme wieder auf meine Situation, was Sie nicht glauben wollen –, weil es eine große Anzahl von jungen Menschen gibt, die nichts wissen wollen. Sie denken an ihr Auto, an ihre Familien, an ihren wirtschaftlichen Aufstieg, denken an ihren Job, sogar an ihre Pensionierung.
Adenauer: Aber das kommt aus der Unsicherheit unserer Zeit heraus; daraus entsteht auf der anderen Seite das Bestreben nach Sicherheit.
McBride: Wie kann ein Mensch nach Sicherheit streben oder überhaupt mit dem Begriff Sicherheit umgehen, wenn man weiß, daß jeden Tag die Atombombe fallen könnte, dann sind wir alle tot. Was nutzt mir da eine Sicherheit? Ich finde eigentlich, jetzt müßte doch immer noch die Zeit sein, in der man versucht, diese neue Ordnung zu schaffen, während das so in Kleinigkeiten verläuft, in nationalen Streitigkeiten?
Adenauer: Das sind keine Kleinigkeiten. Sehen Sie mal die Zeit von 1900 an, was sich da ereignet hat. 1900 hatte Amerika keine Armee, keine Flotte, kein auswärtiges Amt, weil es keine auswärtige Politik betrieb; es war im Übergang vom Kolonialzustand. 1900 war Deutschland die stärkste Landmacht der Welt, war England die stärkste Seemacht der Welt. Das ist jetzt erst sechs Jahrzehnte her, und in der Zeit ist alles zerschlagen worden oder hat sich geändert. England ist ein armes Land geworden. Was sind wir? Wir haben keine Macht. Wir haben das Geld zusammengerafft, oft zuviel. So hat sich alles geändert, und da müssen Sie verstehen, daß die Menschen, die in einer solchen Zeit zu leben verurteilt sind, auch in ständiger Unruhe und in ständiger Rastlosigkeit leben – die verändern sich.
McBride: Das würde mir gar nichts ausmachen, rastlos leben zu müssen, wenn ich das Gefühl hätte, es ändert sich wirklich etwas. Aber Sie sagten vor zehn Minuten, die Leute ziehen sich zurück in ihre eigenen Vorstellungen …
Adenauer: Weil sie Angst haben. Der Begriff der Angst ist auch durch all die Geschehnisse ein sehr mächtiger Begriff geworden. Aber deswegen, nun kommen wir auf den Ausgang zurück, müssen Sie beim Urteil über die Kinder nachsichtig sein. Unsere Kinder sind verurteilt, in einer Welt aufzuwachsen, die sich ständig verändert, rastlos ist, ruhelos ist.
McBride: Wie soll der junge Mensch in einer so rastlosen, von Unruhe erfüllten Welt Fundament bekommen?
Adenauer: Eine sehr ernste Frage!
McBride: Es gibt so viele Leute, die keinen Glauben mehr haben, die glauben wollen, aber sie können nicht, weil sie zuviel Wissenschaft drin haben.
Adenauer: Sie wissen, daß ich Katholik bin? Meinen Sie, das gibt es bei uns nicht? Über alle Dinge, die die Wissenschaftler und die Forscher fertiggebracht haben, gibt es diese Zweifel, so daß man sich mit Gewalt zusammennehmen muß. Für mich ist das Unerklärliche und das, was auf noch eine Macht hinweist, die wir noch gar nicht kennen, die Naturgesetze, die einfache – für mich – Natur.«17
Es wirkt, als lausche man einem ökumenischen Podium auf dem Kirchentag. McBride wagt es nicht, die allgegenwärtige Verdrängung der Nazivergangenheit anzusprechen. Am Horizont steht irgendwie der Krieg in Vietnam – oder was sonst wäre »viel schlimmer geworden«? Selbstverständlich hat twen das Interview nicht gebracht – die guten Ratschläge eines uralten Mannes für die jungen Leute von heute? Völlig unmöglich.
Jedenfalls war McBride von Adenauer schwer beeindruckt, und wahrscheinlich genoss er die Wertschätzung des bedeutenden Politikers, der in ihm nicht einen nörgelnden Wahl-Deutschen, sondern schlichtweg einen Repräsentanten der Vereinigten Staaten sah. Auch war das Buch über Adenauer schon erschienen; nicht ausgeschlossen, dass der Alt-Kanzler dem Amerikaner dafür dankbar war.
Die biographische Erzählung von I, Will McBride setzt im Jahr 1877 ein, mit der braun getönten Fotografie eines Will Woodin McBride, aufgenommen in Ottawa, Illinois. Tatsächlich hieß Will nach ihm, inklusive des zweiten Vornamens, und hatte deshalb ein »II