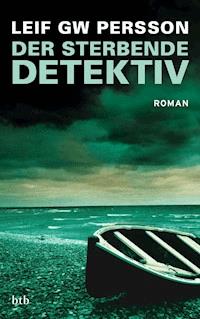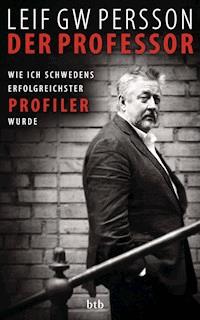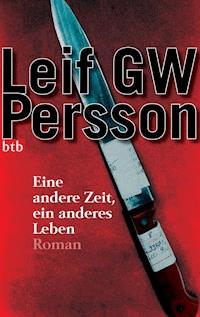
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lars M. Johansson
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Ein spannender Politkrimi über einen ungesühnten Mord und dunkle Machenschaften im heutigen Stockholm.
Stockholm 1989, an einem Novemberabend: Ein Mann wird erstochen in einem Apartment aufgefunden. Das Opfer war ein Eigenbrötler, nicht besonders beliebt, ein kleiner Beamter in einer staatlichen Behörde. Die Ermittlungen laufen zunächst ins Leere – bis Kriminaldirektor Lars M. Johansson Hinweise findet, die in eine andere Zeit und in ein anderes Leben führen …
Ausgezeichnet mit dem Schwedischen Krimipreis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 651
Ähnliche
Leif GW Persson
Eine andere Zeit, ein anderes Leben
Roman
Aus dem Schwedischenvon Gabriele Haefs
btb
Die schwedische Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel »En annan tid, ett annat liv« bei Piratförlaget, Stockholm.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2003 by Leif GW Persson
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2006 by btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Published by arrangement with Salomonsson Agency Umschlaggestaltung: Design Team MünchenUmschlagmotiv: Corbis
Satz: Uhl+Massopust, Aalen EM · Herstellung: BB
ISBN 978-3-641-10647-8V002
www.btb-verlag.de
Buch
Stockholm, Ende November: Kjell Eriksson, Mitarbeiter des Statistischen Zentralamtes der Stadt, wird in seiner Wohnung erstochen aufgefunden. Die Ermittler Bo Jarnebring und Anna Holt fahnden nach dem Täter, doch ohne Erfolg. Ihre Recherchen ergeben, dass Eriksson ein unangenehmer Zeitgenosse war, der kaum Freunde, aber umso mehr Feinde hatte. Die Polizei ist zunächst davon überzeugt, den Täter im privaten Umfeld des Opfers zu finden, und geht davon aus, dass es sich um einen Mord im Homosexuellen-Milieu handelt. Doch sämtliche Spuren verlaufen im Sand, die Ermittlungen werden schließlich eingestellt, und der Fall wird ungelöst zu den Akten gelegt. Erst als Kriminaldirektor Lars M. Johansson ins Spiel kommt, nimmt der Fall eine neue Wendung. Johansson, eigentlich mit einer ganz anderen Sache betraut, stößt beim Durchforsten der Akten auf Hinweise, die das Mordopfer Kjell Eriksson betreffen und den unscheinbaren Beamten in ein ganz anderes Licht rücken. Eriksson scheint eine bewegte politische Vergangenheit gehabt zu haben, die sich bis ins Jahr 1975 zurückverfolgen lässt: Damals wurde ein Anschlag auf die Deutsche Botschaft in Stockholm verübt. Liegt dort der Schlüssel zur Lösung des Falles?
Autor
Leif GW Persson ist Professor für Kriminologie, Medienexperte und einer der führenden Krimiautoren Schwedens. Seine Kriminalromane um Lars M. Johansson und die Stockholmer Polizeibehörden zählen zu den erfolgreichsten des Landes. Persson wurde mehrfach mit dem Schwedischen Krimipreis ausgezeichnet, seine Auflagen bewegen sich in Millionenhöhe.
Für Mikhail und den Bären
Was bringt es schon, jemanden zu warnen, der sich nicht wappnen kann?
Der Professor
Teil 1
Eine andere Zeit
I
Am Donnerstag, dem 24. April 1975, kam der Tod zur Bürozeit und hatte ungewöhnlicherweise die Gestalt von Frau und Mann gleichermaßen angenommen. Obwohl die Männer auch dieses Mal die überwiegende Mehrheit stellten. Der Tod war adrett und ordentlich gekleidet und verhielt sich zunächst höflich und zuvorkommend. Es war auch kein Zufall, dass sich der Botschafter an seinem Arbeitsplatz aufhielt, was sonst durchaus nicht immer der Fall war. Im Gegenteil, es war das Ergebnis sorgfältiger Planung und ein überaus wichtiger Teil der ganzen Unternehmung.
Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Schweden liegt in der Stockholmer Innenstadt auf Djurgården, und zwar seit Beginn der sechziger Jahre. In der Nordostecke des Gebietes, das allgemein als Diplomatenstadt bezeichnet wird, mit dem Rundfunk- und Fernsehgebäude und der norwegischen Botschaft als nächsten Nachbarn, und feiner kann es wohl kaum werden, wenn von Stockholmer Adressen die Rede ist. Das Botschaftsgebäude an sich ist nicht weiter der Rede wert. Der übliche triste Betonkasten im Stil der sechziger Jahre, drei Stockwerke und an die zweitausend Quadratmeter Bürobereich, der Eingang liegt auf der Nordseite im Erdgeschoss. Diese Botschaft gehört durchaus nicht zu den ehrenvollsten Auslandsposten, die das Bundesaußenministerium zu vergeben hat.
Auch das Wetter bot an dem Tag, an dem der Tod zu Besuch kam, keinen Grund zum Jubeln. Es war ein typisch schwedischer Frühlingstag mit scharfem Wind und rastlosen Wolken an einem zinngrauen Himmel, an dem die Verheißung besserer und wärmerer Zeiten wirklich nur zu erahnen war. Für den Tod aber waren es ideale Verhältnisse, und das Beste waren die fast nicht vorhandenen Sicherheitsvorkehrungen in der Botschaft. Das Gebäude war leicht einzunehmen und zu verteidigen, es war jedoch schwer zu stürmen, und das Wetter konnten die Widersacher jedenfalls nicht als Gegenargument anführen, als es Zeit wurde, dieses Haus zu verlassen. Noch besser aber: ein einsamer und ziemlich erschöpfter Hausmeister in einer Rezeption, in der die Glastüren der Sicherheitsschleuse notfalls auch von Hand geöffnet werden konnten.
Irgendwann zwischen Viertel nach elf und halb zwölf Uhr morgens setzten die Geschehnisse ein, und dass sich kein genauerer Zeitpunkt feststellen ließ, liegt eben an den mangelhaften Sicherheitsvorkehrungen. Egal. Innerhalb weniger Minuten betraten sechs Besucher in drei Gruppen von jeweils zwei Personen das Gebäude, junge Menschen zwischen zwanzig und dreißig, allesamt natürlich Staatsbürger der BRD, und alle brauchten in unterschiedlichen Angelegenheiten Hilfe.
In ihrem Heimatland waren sie allgemein bekannt. Ihr Steckbrief war auf tausenden von Fahndungsplakaten in der gesamten Bundesrepublik zu sehen. In Flughäfen, in Bahnhöfen und an Bushaltestellen, in Banken, Postämtern und so ungefähr an jedem öffentlichen Ort, wo an der Wand ein wenig Platz war, hingen ihre Gesichter. Sie hatten ihren Weg sogar in die Stockholmer Botschaft gefunden, unter anderem in einen Ordner, der in einer Schreibtischschublade in der Rezeption lag, was auch immer er dort zu suchen hatte, aber als sie nun auftauchten, wurden sie von niemandem erkannt, und die Namen, die zwei von ihnen nannten, waren nicht ihre eigenen.
Zuerst fanden sich zwei junge Männer ein, die Rat in einer Erbschaftsangelegenheit brauchten, bei der sowohl schwedische als auch bundesdeutsche Verhältnisse eine Rolle spielten, und dass es sich nicht um eine einfache Angelegenheit handelte, verriet ein Blick auf die voll gestopfte Aktentasche, die der eine mit sich herumschleppte. Der Pförtner teilte ihnen mit, wo der zuständige Botschaftsangestellte zu finden war, und ließ sie eintreten.
Gleich darauf erschien ein junges Paar, das seine Pässe verlängern wollte. Eine typische Routineangelegenheit, eine der allerüblichsten in der Botschaft, und die junge Frau lächelte den Pförtner freundlich an, als er für sie und ihren Begleiter die Tür öffnete.
Aber dann wurde die Sache komplizierter, denn jetzt tauchten zwei junge Männer auf, die eine Arbeitsgenehmigung für Schweden brauchten. Der Pförtner erklärte ihnen, dafür sei nicht die Botschaft zuständig, das sei eine Angelegenheit der schwedischen Behörden, doch statt auf ihn zu hören, beharrten sie auf ihrem Anliegen. Einer wurde sogar ziemlich laut, als der Pförtner die beiden nicht einlassen wollte, aber während sie noch dastanden und argumentierten, erschien ein Botschaftsangehöriger, der in der Stadt zu Mittag essen wollte, und passierte die Glastüren, und die beiden jungen Männer nutzten die Gelegenheit, um hineinzuschlüpfen und auf der Treppe zu den oberen Stockwerken zu verschwinden. Ohne darauf zu achten, dass der Pförtner hinter ihnen herrief und sie aufforderte, sofort zurückzukommen.
Jetzt ging alles sehr schnell. Die sechs Besucher sammelten sich auf dem Treppenabsatz vor der Konsulatsabteilung, vermummten sich und zogen Pistolen, Maschinenpistolen und Handgranaten hervor. Dann wurden die Räumlichkeiten von überflüssigen Besuchern und Personal befreit; einige einleitende Schusssalven an die Decke reichten aus, um diese Leute Hals über Kopf auf die Straße fliehen zu lassen, und die zwölf verbliebenen Angestellten wurden in die Bibliothek im obersten Stock getrieben. Mit militärischer Präzision und ohne irgendwelche Zeit mit Höflichkeiten zu vergeuden.
Um elf Uhr siebenundvierzig lief der erste Alarm mit der Meldung »Schusswechsel in der Botschaft der BRD« bei der Stockholmer Polizeizentrale ein und führte zu einem Großeinsatz. Ordnungspolizei, Kriminalpolizei, Streife, Gewaltsektion und Sicherheitspolizei, alle, die sich überhaupt auftreiben ließen, wurden herbeibefohlen, mit Blaulicht, Sirenen und kreischenden Reifen jagten sie zur Botschaft der BRD auf Djurgården, und der Alarm, der gegeben worden war, hatte eine klare Aussage. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland ist von Terroristen besetzt worden. Sie sind bewaffnet und gefährlich. Alle Polizisten werden zur größtmöglichen Vorsicht aufgefordert.
Eine Funkstreife aus dem Wachdistrikt Östermalm traf als Erstes vor Ort ein, und dass sie laut eingereichtem Bericht bereits um elf Uhr sechsundvierzig dort war, lag nicht daran, dass der Streifenführer Hellseher wäre, sondern einfach daran, dass seine Armbanduhr zwei Minuten nachging, als er die Zeit notierte, und wenn wir bedenken, was dann weiter geschah, ist das nun wirklich ein Irrtum, mit dem es sich leben lässt.
Schon um halb eins, nach etwa vierzig Minuten, hatte die Polizei die Botschaft umstellt, den Keller und die unteren Stockwerke gesichert, die Gegend um die Botschaft herum abgesperrt, um die rasch anwachsende Schar von Presseleuten und Gaffern zurückzudrängen, eine provisorische Einsatzzentrale eingerichtet und Ordnung in Funk- und Telefonverbindungen zu Polizeigebäude, Botschaft und Regierungskanzlei gebracht. Der Chef der Gewaltsektion, der den Einsatz leiten sollte, war eingetroffen, und er und seine Kollegen waren bereit zur Tat.
Die sechs jungen Leute in der Botschaft hatten auch nicht die Hände in den Schoß gelegt. Die zwölf Geiseln, zu denen der Botschafter gehörte, waren aus der Bibliothek in den Dienstraum des Botschafters in der Südostecke des Obergeschosses geführt worden, so weit fort vom Eingang wie überhaupt nur möglich. Einige der weiblichen Angestellten hatten helfen müssen, die Abfalleimer mit Wasser zu füllen und Waschbecken und Toiletten mit Papierhandtüchern zu verstopfen, um einen Gasangriff über das Leitungssystem zu verhindern. Zwei Terroristen brachten an strategischen Stellen im Obergeschoss Sprengladungen an, während die übrigen die Geiseln und die Tür zum Treppenhaus bewachten. Und mit all diesen Vorbereitungen waren sie ungefähr zu demselben Zeitpunkt fertig wie ihre Gegner.
Dann eröffneten die Terroristen die Partie mit einer schlichten und unmissverständlichen Forderung. Wenn die Polizei nicht sofort das Botschaftsgebäude verließe, würden sie eine Geisel erschießen. Der Chef der Gewaltsektion war keiner, der sich unnötig aufregte, und sein Selbstvertrauen war groß, um nicht zu sagen, grenzenlos. Außerdem war er anderthalb Jahre zuvor beim Norrmalmstorgdrama zugegen gewesen und hatte gelernt, dass sich, wenn der Geiselnehmer nur die Zeit hat, seine Geisel kennen zu lernen, die seltsamsten Gemeinschaftsgefühle entwickeln können, was zugleich das Risiko der Gewaltanwendung beträchtlich verringert. Diese interessante menschliche Mechanik hatte inzwischen sogar einen eigenen Namen erhalten, das »Stockholmsyndrom«, und im allgemeinen psychologischen Wirrwarr hatte niemand die Zeit gefunden, dem Umfang des empirischen Materials auch nur einen Gedanken zu widmen.
Der Chef der Gewalt glaubte deshalb, die Wissenschaft hinter sich zu haben, als er mitteilen ließ, er sei bereit, über die Angelegenheit zu reden. Nun aber zeigte sich, dass die Gegenseite mit anderer und härterer Münze zahlte, denn schon nach zwei Minuten hallten im Obergeschoss der Botschaft Schüsse wider. Dann wurde oben im Treppenhaus die Tür geöffnet, und der blutige und leblose Körper des Militärattachés wurde auf die Treppe geworfen, wo er auf dem mittleren Absatz liegen blieb. Als das geschehen war, nahmen die Terroristen abermals Kontakt auf.
Sie blieben bei ihrer Forderung. Wolle man die Leiche holen, dann sei das kein Problem, vorausgesetzt, diese Aufgabe werde höchstens zwei Polizisten übertragen, die nur mit Unterhose bekleidet waren. Was für ungewöhnlich unangenehme Menschen, dachte der Chef der Gewalt, der zugleich seinen ersten operativen Beschluss in einer Extremsituation fasste. Natürlich würden sie das Gebäude räumen. Natürlich würden sie den Leichnam bergen. Natürlich, natürlich, und alles sei bereits im Gange.
Danach hatte er über Funk den Kommissar der Zentralstreife informiert, der innerhalb des Gebäudes den Einsatz leitete, und diesen um drei Dinge gebeten. Erstens eine angemessene Anzahl von Kollegen gut sichtbar aus dem Haus zu schicken, zweitens dafür Sorge zu tragen, dass die verbliebenen sich im Keller diskret neu verteilten, und drittens und letztens zwei Freiwillige zu finden, die bereit waren, nur in kurze Beinkleider gewandet den Toten zu holen.
Kriminalassistent Bo Jarnebring von der zentralen Streife war einer der Ersten, die mit gezogener Dienstwaffe, heißem Herzen und kaltem Kopf ins Botschaftsgebäude gestürmt waren, und er war auch der Erste, der sich freiwillig meldete. Sein Chef aber schüttelte nur den Kopf. Selbst ein fast nackter Jarnebring wäre eine allzu furchterregende Gestalt, um sich in dieser brisanten und einleitenden Phase zeigen zu dürfen. Der Auftrag war deshalb an zwei ältere Kollegen von eher jovial gemütlichem Auftreten gegangen, zwei weitere Gleichgesinnte sollten den Transport der Bahre sichern und bei Bedarf ein Sperrfeuer auf das obere Treppenhaus eröffnen.
Diese Aufgabe passte Jarnebring im Grunde sehr viel besser, und rasch kroch er die Treppen hoch und bezog Stellung. Seine beiden Kollegen konnten mit einer gewissen Mühe den leblosen und blutigen Körper auf die Bahre hieven, die sie vor sich hergeschoben hatten. Das war nicht ganz einfach, so zusammengekauert auf einer Treppe, aber sie schafften es, und danach begannen sie überaus vorsichtig und indem sie die Bahre hinter sich herschleifen ließen die Treppe wieder hinunterzukriechen, während Jarnebring die ganze Zeit seine Dienstwaffe auf die Tür zum oberen Stock richtete... und ungefähr in diesem Moment legte er sich seine lebenslang unauslöschliche Erinnerung an die Besetzung der bundesdeutschen Botschaft in Stockholm durch bundesdeutsche Terroristen zu. Und zwar durch den Geruch von verbranntem Telefon.
Er ahnte plötzlich den Lauf einer automatischen Waffe im Türspalt, und während er zugleich versuchte, seine Stellung zu ändern, um diesen Lauf ins Visier zu bekommen, sah er die Flammen in der Mündung des Laufs, vernahm den Knall im engen Treppenhaus und hörte die abgeprallten Kugeln seine Ohren wie wütende Hornissen umschwirren. Aber am besten konnte sich später seine Nase erinnern, an den Geruch von verbranntem Telefon, und erst am folgenden Tag, als er und einige andere zum Ort der Zerstörung zurückkehrten, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen, ging ihm auf, was dieses Erinnerungsbild verursacht hatte. Das Treppengeländer war mit schwarzem Bakelit überzogen, und ungefähr einen halben Meter oberhalb der Stelle, wo sein Kopf gewesen war, hatte das Geschoss der automatischen Waffe einen meterlangen Spalt in das Geländer gerissen.
Bei der schwedischen Polizei verhielt es sich so, dass für diese Art von Einsatz Ausbildung und Ausrüstung fehlten, und zwar sowohl denen, die sich im Botschaftskeller versteckten, als auch besonders jenen, die draußen auf der Straße herumlungerten. Im Grunde war das nur natürlich, wenn wir bedenken, dass sich die gesammelte praktische Erfahrung der Truppe großzügig gerechnet auf drei vergleichbare Ereignisse beschränkte. Auf den Mord am jugoslawischen Botschafter in Stockholm im April 1971, auf eine Flugzeugentführung in Bulltofte bei Malmö im September 1972 und auf das so genannte Norrmalmstorgdrama in Stockholm im August 1973. Damals hatte ein schlichter schwedischer Straßendieb das Personal einer Bank als Geiseln genommen, um den von den Massenmedien des Landes meistgeschätzten Bankräuber aus dem Gefängnis zu befreien. Flugzeugentführung und Norrmalmstorgdrama hatten insofern ein gutes Ende genommen, als niemand ums Leben gekommen war, aber hier in der Botschaft galten offenbar andere Spielregeln, denn bereits eine Stunde später hatte der Chef der Gewaltsektion abermals eine Leiche am Hals, und das missfiel ihm nun wirklich.
Deshalb beschloss er, seine Taktik zu ändern und sich bedeckt zu halten, sehr bedeckt, so bedeckt, wie man sich überhaupt nur halten konnte, und sei es auch nur, um dem Stockholmsyndrom noch eine Chance zu geben. Im tiefsten Herzen, da er selbst ein guter Mensch war, konnte er sich von diesem Gedanken nur schwer freimachen. Während der Nachmittag in den Abend überging, hatte er deshalb seine Truppen die polizeiliche Variante eines Einigelungsmanövers vollziehen lassen, und er selbst hatte vor allem telefoniert. Mit seiner eigenen Polizeileitung, mit Leuten aus der Landespolizeileitung, mit Vertretern der Regierung und des Justizministeriums, also im Grunde mit allen, denen es gelungen war, Kontakt zu ihm aufzunehmen.
Am späten Nachmittag waren in seiner provisorischen Einsatzzentrale zwei Kollegen vom bundesdeutschen Sicherheitsdienst aufgetaucht. Nach einer kurzen Lagebeschreibung hatten sie ihn verlassen, um sich selbst ein Bild zu machen, und nur eine Viertelstunde darauf war ein Kommissar von der Ordnungspolizei atemlos hereingestürzt und hatte mitgeteilt, dass die »Scheißdeutschen« ihren schwedischen Kollegen nunmehr großkalibrige Armeerevolver aus den USA verehrten. Damit die etwas »Reelleres« hätten als »so eine miese Waltherpistole, wenn es hier wirklich ernst wird«. Der Chef der Gewalt hatte geseufzt und dem anderen befohlen, diese »philanthropischen Aktivitäten« so schnell wie möglich zu unterbinden und dafür zu sorgen, dass die bereits ausgeteilten Gaben wieder eingesammelt würden.
»Ansonsten drehen die Jungs von der Technik doch durch«, fügte er kollegial und pädagogisch hinzu. Denn egal, was aus den Leuten in der Botschaft auch werden würde, es würde doch nach und nach eine kriminaltechnische Untersuchung des Tatorts geben, und immer wieder wären abgegebene Geschosse mit den passenden Waffen zu vergleichen. Das wusste er besser als fast alle anderen, denn er hatte über zwanzig Jahre seines Berufslebens der Ermittlung schwerer Gewaltverbrechen gewidmet.
Die Gegenseite in der Botschaft hatte jedenfalls keinerlei Unzufriedenheit mit den neuen taktischen Verfügungen der Polizei zum Ausdruck gebracht. Man war dort vollauf damit beschäftigt, die Lage im Blick zu behalten und zugleich mit der eigenen und der schwedischen Regierung über die inzwischen gestellten Forderungen zu verhandeln. Sofortige Freilassung von sechsundzwanzig Genossen aus bundesdeutschen Gefängnissen, darunter die Anführer der Baader-Meinhof-Gruppe. Transport per Flugzeug in ein freundlich gesinntes Aufnahmeland, dazu zwanzigtausend Dollar für jeden und jede der Freigelassenen. Würden ihre Forderungen nicht erfüllt, würden sie die Geiseln erschießen, pro Stunde eine, die erste um zehn Uhr abends, mehr sei zu der Sache nicht zu sagen.
Die Stunden vergingen, ohne dass etwas Besonderes passierte, und als es auf zehn Uhr zuging, fasste man den Beschluss, in Ermangelung eines besseren, denn einen solchen konnte niemand sich vorstellen, die Vorbereitungen für den nun schon seit einigen Stunden erwogenen Tränengasangriff zu beschleunigen.
Es war bereits Viertel nach zehn, als die endgültige Verlautbarung der Bundesregierung in Bonn – über die schwedische Regierung in Stockholm – die Terroristen in der Botschaft erreichte. Wenn es bei der polizeilichen Taktik vor allem darum geht, Zeit zu schinden, ist das eine ganz normale Verspätung, und bisher war ja noch nichts passiert. Aber nur einige Minuten darauf hatte in der Botschaft offenbar jemand die Sache satt, ging hin, schnappte sich den Handelsattache, führte ihn an ein Fenster und schoss ihn von hinten nieder.
Ein polizeilicher Ermittler – gut versteckt in einem so genannten Meisenkasten in einer benachbarten Botschaft – hatte den Mord am Handelsattache beobachtet, und als er seine Beobachtungen mitteilte – »offenbar haben die ihn in den Nacken oder in den Rücken geschossen« –, übermannte den Chef der Gewaltsektion plötzlich der Trübsinn. Die Kennzeichen des Stockholmsyndroms, dieser schönen Trostzigarre, waren weiter weg denn je. Weniger als zehn Stunden, und schon waren zwei Geiseln ermordet worden.
Eine Weile darauf aber schöpfte er wieder Hoffnung. Es war nach elf, es war keine weitere Geisel erschossen worden, und nur wenige Minuten später hatten die Terroristen in der Botschaft plötzlich drei Sekretärinnen freigelassen. Ein Hoffnungsfunke in der immer dichteren Aprildunkelheit... vielleicht doch, dachte der Chef der Gewalt, denn auf den Tränengasangriff mochte er sich nun wirklich nicht freuen. Der konnte doch nur zu weiterem Elend führen. Zugleich wusste man ziemlich genau, wie viele Geiseln noch übrig waren. Es war eine rasch schrumpfende Schar, die nicht länger als bis in die frühen Morgenstunden reichen würde, wenn die Terroristen ihre Drohung von einer Hinrichtung pro Stunde wahr machten.
Die Befreiung kam eine Viertelstunde vor Mitternacht. Der Chef der Gewaltsektion hatte den Bauwagen verlassen, in dem die provisorische Einsatzzentrale untergebracht war, um sich endlich die Füße zu vertreten, ein paar Mund voll frischer Luft zu schnappen und noch eine Zigarette zu rauchen. Zuerst sah er einen grellen Blitz aus dem Botschaftsgebäude schlagen, dann spürte er, wie der Boden unter ihm bebte, erst danach hörte er eine Serie von Explosionen. Die Wolke aus Glassplittern, Rauch, Bauschutt, zuletzt das Geschrei der Menschen im Haus. Der Menschen, die aus den Fenstern stiegen, sich hinauswarfen, sprangen, die an der Fassade herabkletterten, abstürzten, fielen, sich aufrappelten oder liegen blieben. So erinnerte er sich, wenn er daran zurückdachte, genau in dieser Reihenfolge: Blitze, Beben, Knall, Rauch, Geschrei, Menschen.
Anders als der Fernsehreporter, der die Direktübertragung vom Schauplatz leitete, war er selbst nicht in die Luft gesprungen, und wenn seine Füße sich überhaupt aufwärts oder zur Seite bewegt hatten, dann lag das jedenfalls nicht an ihm. Dagegen hatte er sich so allerlei gedacht. Ja verdammt, hatte er gedacht, obwohl er sonst nie fluchte. Danach hatte er seine Zigarette ausgetreten und sich zurück auf seinen Stuhl in der provisorischen Einsatzzentrale begeben. Und es wurde hohe Zeit, denn dort drinnen ging es nun wirklich rund.
Eine halbe Stunde später war im Grunde alles vorbei, und Wunder über Wunder. Mit einer Ausnahme schienen alle, die Terroristen und ihre Geiseln und seine Kollegen unten im Botschaftskeller und in der Umgebung des Gebäudes, die Explosion überlebt zu haben. Viele waren verletzt, zwei sogar schwer, aber alle waren am Leben.
Die Terroristen waren festgenommen worden, und wenn er und seine Kollegen die Sache nicht völlig missverstanden hatten, dann hatten sie wirklich alle erwischt. Auf jeden Fall alle, die seine Ermittler und Beamten früher an diesem Tag und Abend beobachtet und gezählt hatten. Einer befand sich noch in der Botschaft, und man hatte ihn gerade gefunden, genauer gesagt seine Hälfte, und identifiziert war er schon seit mehreren Stunden. Vier waren auf dem Parkplatz hinter dem Botschaftsgebäude aufgegriffen worden. Vermutlich bei einem vergeblichen Versuch, mit dem Mietwagen zu fliehen, mit dem sie zwölf Stunden zuvor eingetroffen waren, und das hatte sich als Dummheit erwiesen, denn dieses Auto hatte die Polizei bereits nachmittags gesichert.
Der sechste und letzte Terrorist wurde gefasst, als er durch den Garten der norwegischen Botschaft irrte. Verrußt und mit rauchender Kleidung, abgesengten Haaren, verbrannt, geblendet, total verwirrt und zuerst irrtümlicherweise für eine Geisel gehalten. Aber jetzt war dieses Missverständnis geklärt. Drei der Festgenommenen waren in ein Krankenhaus geschafft worden, einer davon in lebensbedrohlichem und einer in elendem Zustand, zwei hatten sie direkt in den Arrest im Polizeigebäude bringen können. Allesamt in Handschellen, zwei sicherheitshalber auch mit Fußfesseln versehen.
Jarnebring war um kurz nach zwei Uhr morgens als einer der letzten Streifenpolizisten vom Tatort aufgebrochen. Dort waren noch die Kollegen von der Ordnung, die den Objektschutz übernehmen und die Absperrungen sichern sollten, dazu die Techniker, die versuchten, sich warm zu halten, während die Feuerwehr ihre Arbeit beendete. Es war schon drei, als er endlich nach Hause kam. Dort warteten eine besorgte Gattin, die fast die Wände hochgegangen war, und drei kleine schlafende Kinder, von denen der Älteste irgendwann vor lauter Spannung vor dem Fernseher eingeschlafen war, ohne sich auch nur die geringste Sorge zu machen.
Er selbst fühlte sich seltsam abwesend, und als seine Frau ihm erzählte, dass sein bester Freund und engster Kollege Lars Martin Johansson an diesem Nachmittag und Abend sicher zehn Mal angerufen habe, nickte er nur und zog sicherheitshalber den Telefonstecker heraus. Danach schlief er ein und wachte sechs traumlose Stunden später wieder auf. Ganz klar im Kopf war er, trotz des seltsamen Gefühls, dass das, was passiert war, nichts mit ihm zu tun hatte. Auch der Geruch von verbranntem Bakelit war noch immer bei ihm. Das geht vorbei, dachte er, das geht vorbei.
II
Das erste Regierungsmitglied, das von diesen Ereignissen erfuhr, war nicht der Justizminister – was richtig gewesen wäre –, sondern der Ministerpräsident, und dass es so kam, beruhte auf schlichten menschlichen Selbstverständlichkeiten, die ansonsten keinerlei sachliche Konsequenzen nach sich ziehen sollten.
Sowie der zuständige Wachhabende in der Zentrale der Polizeileitung begriffen hatte, dass die Lage ernst war und dass es sich nicht um den üblichen Fehlalarm handelte, hatte er aus dem Ordner auf seinem Tisch den für solche Fälle erstellten Maßnahmenkatalog gefischt. Der Rest war Routine. Zuerst rief er den Chef der Gewaltsektion an, der bei der Stockholmer Polizei der oberste Verantwortliche war. Der meldete sich beim ersten Klingeln, brummte ein wenig in die Leitung und bat den anderen, sich zu melden, wenn er mehr wüsste. Danach hatte der Wachhabende den Zuständigen bei der Sicherheitspolizei angerufen, der laut Instruktionen den für den Kontakt zwischen Ministerium, Regierung und Polizei zuständigen Staatssekretär im Justizministerium informieren sollte.
Beim Staatssekretär war besetzt, und während er auf das Freizeichen wartete – denn die Sekunden gingen verdammt langsam dahin – und um überhaupt etwas Sinnvolles zu tun, während der Arsch am anderen Ende der Leitung in alle Ewigkeit Unsinn faselte, hatte er den tutenden Hörer in die linke Hand genommen und mit der rechten auf seinem anderen Telefon die Nummer des Staatssekretärs gewählt, der direkt dem Ministerpräsidenten unterstand. Er hatte sich sofort gemeldet und war in weniger als einer Minute informiert worden. Und in dem Moment, da der Wachhabende den Hörer auflegte, hörte er den bisher besetzten Staatssekretär in sein linkes Ohr »Hallo« schreien, und was danach passierte, stimmte ganz und gar mit den schriftlichen Instruktionen überein.
Diese Abweichung von der Routine war wie gesagt nie entdeckt oder gar gemeldet worden. Sie war auch von keinerlei Bedeutung für die neuere schwedische oder deutsche Geschichte, und er selbst hatte kaum über die Sache nachgedacht. Ab und zu hatte er sie erwähnt, als kleines Detail in einer netten Geschichte, verlässlichen Kollegen gegenüber, nach einem guten Essen, beim zweiten Kognak zum Kaffee. Aber mehr war aus der Sache nie geworden.
Der Ministerpräsident und sein Staatssekretär waren von Anfang an dabei gewesen, der Justizminister sollte die Überzeugung, es als »Erster erfahren zu haben«, mit ins Grab nehmen, und als der Nachmittag in den Abend und dann langsam in die Nacht überging, hatte sich eine wachsende Schar aus Regierungsangehörigen und Beamten der Regierungskanzlei im Zimmer des Ministerpräsidenten versammelt, und keiner war besonders guter Laune gewesen. Das Leben war ihnen schwer und ungerecht vorgekommen, denn die Sache hatte doch gar nichts mit ihnen oder dem Schweden zu tun, dem sie nach demokratischer Entscheidung derzeit vorstanden.
Erst der Mord am jugoslawischen Botschafter, kroatische Extremisten und Separatisten und ein toter serbischer Botschafter, und abgesehen von allem anderen hatte Schweden gar keine Schuld daran. Dann neue kroatische Terroristen, die eine SAS-Maschine gekapert hatten, um die Botschaftermörder freizupressen, und die so ganz nebenbei das Leben von an die hundert einfachen Schweden aufs Spiel gesetzt hatten, um dann endlich in Spanien zu landen, sofort aufzugeben und sich der Polizei zu stellen. Und jetzt ein halbes Dutzend blödsinniger Studenten, die sich Sozialistisches Patientenkollektiv nannten und mit Gewalt die bundesdeutsche Gesellschaft umstürzen wollten, und das ausgerechnet von Stockholm aus. Das war ungerecht, das war durch und durch unschwedisch, und dass ein einheimisches Talent aus dem herkömmlichen kriminellen Lumpenproletariat zwischendurch das Personal einer Bank am Norrmalmstorg als Geiseln genommen hatte, war gerade noch hinnehmbar gewesen.
Zuerst saßen sie im Zimmer des Ministerpräsidenten und diskutierten, wie sie die Geiseln ohne unnötiges und weiteres Blutvergießen retten könnten. Es reichte jetzt wirklich auch so. Sie hatten nicht viele Ideen, bis endlich der Ministerpräsident, ein alter Reserveoffizier der Kavallerie, vorschlug, die Polizei das Gebäude stürmen zu lassen. Ein Vorschlag, der von der obersten Polizeileitung sofort zurückgewiesen wurde. Der schwedischen Polizei fehle es an Ausrüstung und Ausbildung für einen solchen Einsatz, wie der Landespolizeichef betonte, um den Augenblick zu nutzen, denn er hatte schon mehrfach und seit Jahren vom Ministerium Geld zu ebendiesem Zweck erbeten. Aber Geld hatte er nie bekommen, und deshalb fehlte es eben an Ausrüstung und Ausbildung. Wenn auch natürlich nicht am guten Willen.
»Das wäre das pure Himmelfahrtskommando«, erklärte der Landespolizeichef in seinem schnarrenden Schonisch, und danach senkte sich tiefe Düsterkeit über die Versammlung.
Als die Bundesregierung mitgeteilt hatte, dass man sich kategorisch weigere, auf die Forderungen der Terroristen einzugehen, war die Stimmung rasch auf den Nullpunkt gesunken, und am Ende hatten sie, mangels eines Besseren und weil sie ja nun einmal etwas unternehmen mussten, beschlossen, zumindest doch vielleicht ein wenig Tränengas in das Botschaftsgebäude zu schießen zu versuchen. Während der Einsatz noch geplant wurde, hatte sich das Problem auf natürliche Weise gelöst, indem das oberste Geschoss des Botschaftsgebäudes in die Luft gehüpft war. Aus welchen Gründen auch immer; das war eine Frage, auf die andere die Antwort finden mussten, und da offenbar so gut wie alle der im Haus befindlichen Personen überlebt hatten, gab es auf der nächtlichen Tagesordnung wichtigere Fragen.
In dieser Situation kurz vor Mitternacht waren sie in den Besprechungsraum der Regierung übergesiedelt, und dort hatte die Diskussion sehr bald eine neue Richtung eingeschlagen. Nämlich wie sie sich der fünf überlebenden Terroristen so schnell wie möglich entledigen könnten. Die bloße Vorstellung, sie könnten in schwedischen Gefängnissen sitzen und dauernd zu Freipressungsversuchen in Form von neuen Flugzeugentführungen, Personenentführungen und allem anderen Teufelszeug verleiten, war so ungefähr das Allerletzte.
»Die müssen raus. Da gibt es nichts zu diskutieren«, wie einer der älteren Minister die Sache noch vor Beginn der Überlegungen zusammenfasste.
Der Einzige, der Einwände erhob, war der beratende Staatssekretär im Justizministerium, der juristische Experte der Regierung und praktischerweise just jener, der das Gesetz ersonnen hatte, das der sofortigen Ausweisung zugrunde liegen sollte. Ihm zufolge war das Problem nicht einmal kompliziert. Wenn sie vorhatten, das Terroristengesetz anzuwenden, dann fehlte jegliche gesetzliche Grundlage für die Ausweisung der fünf Terroristen, aber da keine Zeit für juristische Spitzfindigkeiten war, hatte eine einträchtige Regierung – inklusive des juristischen Beraters – beschlossen, die fünf unter Verweis auf just jenes schwedische Terroristengesetz des Landes zu verweisen, das praktischerweise nur für Ausländer galt und deshalb nicht einmal eine Frage für das Justizministerium war.
»Man kann in solchen Situationen nicht immer das Gesetzbuch unter dem Arm haben«, wie die Ministerin, die für »Ausländerfragen« zuständig war, so elegant formulierte. Und abgesehen davon, dass sie eine Frau war, war sie das jüngste Regierungsmitglied und die jüngste Person, die jemals ein Ministeramt innegehabt hatte, und sie war mindestens so entschlussfreudig wie ihre doppelt so alten Regierungskollegen.
Für sie wurde Freitag, der 25. April, deshalb ein Tag voller praktischer Beschäftigungen, vom frühen Morgen bis lange nach Mitternacht. Zuerst musste sie versuchen, die gesetzlichen Fragen zu klären – so weit das überhaupt möglich war –, und danach tausendundein praktisches Detail im Zusammenhang mit der Ausweisung in die Wege leiten. Die Deutschen hatten zum Beispiel versprochen, ein Flugzeug zu schicken, das ihre Landsleute abholen sollte, aber als dieses Flugzeug sich einfach nicht sehen ließ, war das auch nicht so wichtig, denn in Schweden hatte man sofort und sicherheitshalber beschlossen, eins in Reserve zu halten. Aufgetankt und abflugbereit, samt motivierter und ausgeruhter Besatzung und mitfühlendem Krankenpflegepersonal, stand es in Arlanda bereit.
Der gesundheitliche Zustand der Ausgewiesenen hatte Probleme gemacht. Sie waren allesamt nicht gerade in Spitzenform, aber bei dreien von ihnen hatten die Ärzte immerhin grünes Licht gegeben, während der Fall beim vierten im Grunde noch einfacher lag. Er hatte nämlich so schlimme Verbrennungen erlitten, dass sie ihn gleich hätten totschlagen können, statt sein Bett auch nur um einen Meter zu verschieben. Man musste eine Woche Geduld haben, bis sich sein gesundheitlicher Zustand so weit stabilisiert hatte, dass er den Transport in die Bundesrepublik überleben konnte. Daran, ihn unterwegs sterben zu lassen, war nicht zu denken. Solche Geschehnisse weckten nämlich die Rachsucht der Leute. Aber nach einer Woche konnte er dann nach Hause reisen, und zu Hause angekommen zeigte er genügend Taktgefühl, um noch eine Woche in einem deutschen Krankenhaus auszuhalten und dann zu sterben.
Das große Problem bildete die fünfte Teilnehmerin der Botschaftsbesetzung, denn bei ihr waren die Meinungen der medizinischen Sachverständigen doch arg geteilt. Der zuerst befragte Arzt sah kein Problem in einer Abschiebung, aber als die zuständige Ministerin, eine größere Anzahl von Polizisten und das nötige Pflegepersonal im Krankenhaus auftauchten, um sie abzuholen, fuhr der zuständige Stationsarzt die Stacheln aus. Am Ende spielte er sein Trumpfass aus und weigerte sich einfach, die Patientin zu entlassen. Wenn sie aus seiner Obhut entfernt werden solle, dann müsse jemand anders die medizinische Verantwortung übernehmen, und außerdem verlangte er die schriftliche Bestätigung der Ministerin, dass der Transport ohne sein Einverständnis geschehe.
Wenn er dabei an das Wohl der Patientin gedacht hatte, dann hatte er sich dumm verhalten und seine Gegner um einiges unterschätzt, denn in einer solchen Situation erringt man keinen Sieg, wenn man mit dem Gesetzbuch unter dem Arm herumläuft. Ohne eine Miene zu verziehen, zückte die Ministerin ihren Kugelschreiber und unterschrieb den Ausweisungsbefehl. Danach verfasste sie eine kurze Bestätigung für den Onkel Doktor, worauf sie und ihre Begleitung die Patientin einsackten und mit ihr nach Arlanda fuhren. Und unmittelbar nach drei Uhr am Samstagmorgen startete endlich das Transportflugzeug der schwedischen Regierung mit seiner Ladung aus vier deutschen Terroristen zu seinem geheimen Zielflughafen in der Bundesrepublik.
Das alles war wirklich keine amüsante Geschichte, aber mitten im Elend konnte die Regierung sich immerhin freuen, dass sie die öffentliche Meinung auf ihrer Seite hatte. Außerdem war diese öffentliche Meinung ausnahmsweise sowohl im Volk als auch in den Medien verankert. Der Mann auf der Straße war ganz einfach stocksauer. Es war überaus unschwedisch und zugleich typisch deutsch, den friedlichen Nachbarn die eigenen Probleme an den Hals zu laden. Und das war ja leider schon viel zu lange die Gewohnheit der Deutschen. Jedes Land hatte kurz gesagt den Terrorismus, den es verdiente, und außerdem wussten doch alle, die im Winter jemals im Ausland gewesen waren, dass die Deutschen sich in den beliebten Wintersportorten am Skilift immer vordrängten, sogar wenn diese Orte in Österreich und der Schweiz lagen.
In den Medien suhlten sich allerlei Leitartikler und so genannte Experten fast schon orgiastisch in den vielen Versäumnissen der Bundesregierung. Die Bundesregierung hatte sich nicht nur vor ihrer Verantwortung gedrückt, sie hatte sich nicht einmal damit begnügt, alle Verantwortung hinzuschmeißen, sie hatte außerdem die Frechheit besessen, diese Verantwortung auf die schwedische Regierung, die schwedische Polizei und die schwedische Bevölkerung abzuwälzen. Außerdem war man dermaßen total und durch und durch inkompetent, dass die einzig logische Folgerung darin bestand, die Botschaft der BRD müsse auf geheimnisvolle Weise von selbst in Brand geraten sein und der Beitrag der Terroristen zu der ganzen Angelegenheit müsse eher als Wirkung denn als Ursache gelten.
Wenn wir bedenken, was passiert ist, dann war die Empfänglichkeit der Medien fast phänomenal, es gab nur eine Ausnahme, und die finden wir natürlich in der großen bürgerlichen Morgenzeitung. Die Leitartikler, »diese fast durchgängig schwachsinnigen und perversen Opportunisten«, wie der Ministerpräsident, wenn er in überschäumender Laune war, die Sache zusammenzufassen pflegte, hatten einen kürzeren Artikel gebracht, dessen Autor die Botschaftsbesetzung durch bundesdeutsche Terroristen überaus frech in dasselbe Licht gerückt hatte wie die Sache um Anton Nilsson und seine Genossen, die siebenundsechzig Jahre zuvor im Hafen von Malmö das englische Streikbrecherschiff Amalthea in die Luft gesprengt hatten.
III
Die polizeiliche Ermittlung war durchaus nicht schlecht. Sie war absolut erbärmlich, und wenn wir bedenken, dass es um eins der allerschwersten Vergehen ging, die sich seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Schweden abgespielt hatten, dann war das wirklich nicht leicht zu verstehen. Eine der Erklärungen, die ganz oben in der Polizeileitung diskutiert wurden, unter anderem in vertraulichen Gesprächen zwischen dem Landespolizeichef und seinen engsten jüngeren Mitarbeitern, lautete, dass die Regierung aus unerfindlichen Gründen kein Interesse an einer Klärung der Angelegenheit zu haben schien und dieses Desinteresse auf die Polizei übergegriffen hatte. Ein Verbrechen mit klaren politischen Vorzeichen und eine Regierung, die mit der Sache einwandfrei nichts zu tun haben wollte – was sollte die Polizei da noch machen?
Der Chef der Stockholmer Gewaltsektion war kein Freund politischer Kannengießerei. Damit sollten andere sich amüsieren, und wie die Regierung diese oder jene Frage beurteilte, ließ ihn kalt. Er stimmte ja nicht einmal für sie. Dagegen ärgerte es ihn, dass die Regierung sich in seine Ermittlungen eingemischt und seine Täter nach Hause geschickt hatte. Wie sollte man ein Verbrechen aufklären, wenn man nicht die Möglichkeit hatte, die Verdächtigen zu verhören?
Er hatte sich wirklich darauf gefreut, mit ihnen zu sprechen. In aller Ruhe, der Reihe nach und so oft, wie es nun einmal nötig gewesen wäre, bis sich das ganze Bild ergeben hätte. Das war ihm schon zahllose Male gelungen, und er war davon überzeugt, dass er es auch dieses Mal geschafft hätte, ohne jeden Dolmetscher sogar. Denn anders als seine Kollegen hatte er Abitur gemacht, noch dazu am Whitfeldska-Gymnasium in Göteborg, und sein altes Schuldeutsch funktionierte weiterhin tadellos. Das Vorgehen der Regierung war rein ermittlungstechnisch die pure Sabotage gewesen. Und die Sache wurde nicht besser dadurch, dass ihr das vermutlich nicht einmal bewusst war.
Er und seine Kollegen hatten sich mehr oder weniger damit begnügen müssen, unter alles andere als idealen Umständen eine technische Untersuchung durchzuführen. Gleich nach der Explosion hatte es ausgesehen, als wäre nun wirklich die Hölle los. Die Terroristen hatten bei ihren erpresserischen Telefonaten mit der Regierung behauptet, im Gebäude fünfzehn Kilo Trotyl angebracht zu haben, aber nichts vor Ort sprach für diese Behauptung.
Der Einsatz der Feuerwehr, so unerlässlich der sein mochte, hatte die Sache auch nicht besser gemacht – tonnenweise Wasser auf dem ganzen Schrott war niemals gut –, aber was den Polizeichef und seine Kollegen am meisten störte, waren die vielen mehr oder weniger Unbefugten, die sich am Tatort herumgetrieben hatten. Die deutschen Kollegen zum Beispiel hatten sich kaum nützlich gemacht, auch wenn er im Grunde jegliches Verständnis für deren Interesse hatte. Formal gesehen war der Tatort schließlich deutsches Territorium, und deshalb hatte er sie nicht einfach wegschicken können.
Genauso verhielt es sich mit den »Filzpantoffeln« von der Sicherheit und ihrer gelinde gesagt irritierenden Unsitte, Kollegen, die einfach nur ihre Arbeit machen wollten, ewig über die Schulter zu glotzen. Außerdem hatten sie die Frechheit besessen, ihre eigenen Techniker anzubieten, aber da hatte er dann doch energisch erklärt, eine solche Arbeitsteilung könne ja wohl weder Hand noch Fuß haben, und er selber habe nicht vor, herumzulaufen und Reviere zu markieren, das sollten andere machen, und wenn sie kein Vertrauen zu ihm und seinen Leuten hätten, könnten sie die Sache auch gleich übernehmen.
Aber gut war die Arbeit nicht gewesen, und als der Polizeichef nach etwas über einer Woche, an dem Tag, an dem sie die Absperrungen draußen weggenommen hatten, ihm mitteilte, dass die weiteren Ermittlungen der Sicherheitspolizei obliegen würden, war das für ihn wirklich eine Erleichterung.
Über die Ursache der Explosion jedoch hatten er und seine Kollegen sich noch eine durchaus nette Auffassung beschaffen können. Nichts sprach dafür, dass die Terroristen das Gebäude vorsätzlich in die Luft gejagt hatten. Alles wies auf einen Unglücksfall hin, auf eine Kombination von Schlamperei und Dilettantismus, und vermutlich war die Explosion vom terroristeneigenen »Sprengstoffexperten« ausgelöst worden, der wie jedes Kind die Finger gern an der falschen Stelle hatte und bei einem normalen schwedischen Sprengmeisterexamen klarerweise durchgefallen wäre. Das ergab sich mit aller wünschenswerten Klarheit aus den Kabeln und Verbindungen, welche die Explosion überlebt hatten, auch wenn die Abendzeitungen natürlich über seine diesbezüglichen Kenntnisse herzogen.
Mehr kam also bei den Ermittlungen nicht heraus, und aus seiner Sicht war das ja im Grunde egal. Was die Sicherheitspolizei noch festgestellt hatte, nachdem ihr die Untersuchungen übertragen worden waren, blieb wie gesagt im Ungewissen. Jedenfalls war nichts unternommen worden, das juristische Folgen gezeitigt hätte, man hatte wie üblich »im Verborgenen« gearbeitet, und wenn ihn jemand nach dem Fall gefragt hätte, dann hätte er die Überzeugung vertreten, dass von der Sicherheit wie so oft nicht viel gekommen war. Obwohl man kein Polizist zu sein brauchte, um sich auszurechnen, dass es bei der Sache mehr Beteiligte gegeben haben musste als die sechs Terroristen in der Botschaft.
Wer hätte denn sonst am Donnerstag, dem 24. April, gegen dreizehn Uhr in den Briefkästen von drei internationalen Nachrichtenagenturen, die alle in den Räumlichkeiten der schwedischen Nachrichtenagentur TT im ersten Wolkenkratzer am Hötorg untergebracht waren, die Mitteilungen hinterlegen sollen, drei Kilometer und mehr als fünf Autominuten von der Botschaft der BRD draußen auf Djurgården entfernt? Die sechs in der Botschaft – das »kommando holger meins«, wie sie sich in konsequenter Kleinschreibung nannten – konnten das jedenfalls nicht gewesen sein.
Der Chef der Gewaltsektion hatte viel darüber nachgedacht, was wohl passiert war, ehe die sechs die Botschaft betreten hatten. Sie mussten irgendwo gewohnt haben, sie hatten rekognoszieren müssen, sie hatten sich einen Überblick über die Botschaftsangestellten und deren Arbeitszeiten beschaffen müssen, sie hatten feststellen müssen, wie sie in die Botschaft hineingelangen und wie sie fliehen konnten, wenn etwas nicht nach Plan ging. Sie mussten ein Dach über dem Kopf gehabt haben, dazu ein Bett, Tisch, Stühle und Besteck, Fahrzeuge, um sich fortzubewegen, Speis und Trank und alles praktische Zubehör wie Waffen, Sprengstoff und gefälschte Papiere. Insgesamt mussten die Vorbereitungen für die Aktion mindestens einen Monat beansprucht haben.
Kurz gesagt, sie mussten Hilfe gehabt haben. Vermutlich von mehreren Personen. Vermutlich von Personen mit Verbindungen zu Schweden und Stockholm. Von Personen, die Schwedisch sprachen, die sich in der Gegend auskannten, die Bescheid wussten über die Szene, über Sitten und Gebräuche, über die normalen Selbstverständlichkeiten wie das Lösen eines U-Bahn-Fahrscheins oder den Einkauf größerer Mengen von Lebensmitteln in einem Supermarkt, bei dem keine Aufmerksamkeit erregt werden darf. Normale, anonyme, nicht vorbestrafte Menschen ihres eigenen Alters, die so aussahen, dachten und urteilten wie sie selbst.
Der Chef der Gewaltsektion war keiner, der unnötig Streit anfing. In seinem Beruf hatte er gelernt, dass die einfachste Erklärung oft die zutreffende ist. Eine Gruppe junger Studenten, dachte er. Radikal, motiviert, mit Selbstdisziplin und Ordnung im Denkkasten. Vielleicht lebten sie sogar zusammen in einer dieser seltsamen Wohngemeinschaften, über die er in der Zeitung gelesen hatte. Und es war kein allzu kühner Schluss, dass es sich bei diesen Leuten um Schweden handelte, dachte der Chef der Gewaltsektion der Stockholmer Polizei.
Als er den Fall dem Kollegen von der Sicherheit, der von nun an die Verantwortung für die Ermittlungen tragen sollte, übergeben hatte, hatte er ein wenig laut gedacht. Nur ein paar Worte mit auf den Weg, aber das hätte er sich natürlich sparen können. Der Kollege war kein richtiger Polizist, sondern ein Polizeiinspektor, der Jura studiert hatte und das übliche Selbstvertrauen mitbrachte, und seine Reaktion war denn auch wie erwartet ausgefallen.
Er hatte mit genau der richtigen Besserwissermiene genickt, hatte müde geseufzt und mit seinem wohl manikürten Zeigefinger über seine lange Nase gestrichen. »Dieser Gedanke ist uns auch schon vorgeschwebt«, sagte der Kollege kurz, und mehr war nicht bei der Sache herausgekommen. Ziemlich bald hatte der Kollege von der Gewalt immer weniger an die ganze Angelegenheit gedacht, und nach nur zwei Jahren gehörte sie nicht einmal mehr zu dem Repertoire an polizeilichen Heldengeschichten, die er erzählte, wenn er sich mit richtigen Kollegen traf. Es gab schließlich neuere und bessere.
Ansonsten hätte die Sicherheitspolizei Arbeit genug haben müssen. Im Jahr vor der Botschaftsbesetzung waren immer häufiger Warnungen eingelaufen, denen zufolge deutsche Terroristen irgendeine Aktion auf schwedischem Boden planten. Es war alles genauso konfus wie sonst; anonyme Tipps, Informationen diverser Gewährsleute und sogar ein Bericht, der von einem Infiltrator der Sicherheitspolizei verfasst worden war, und alle hatten eines gemeinsam. Es gab nichts Konkretes oder Handfestes, und während des Frühlings hatte man fast den Eindruck gewinnen können, die Lage habe sich wieder beruhigt. Nichts Neues an der Terrorfront. Nicht einmal die besten Gewährsleute hatten auch nur die kleinste Neuigkeit liefern können.
Einige Tipps und Beobachtungen waren auch von Kollegen von der Streife gekommen. Vor allem ging es dabei um »nicht identifizierbare Fahrzeuge« und »zweifelhafte Personen«, die kurz vor der Terroraktion in der Nähe der Bundesdeutschen Botschaft und auch darin beobachtet worden waren, aber obwohl man viel Zeit darauf verwendet hatte, diesen Hinweisen nachzugehen, hatte das nichts gebracht. Mit anderen Worten war es genau wie immer gewesen, denn Tipps dieser Art brachten fast nie etwas. Anders als die Aktionen, die man selbst in die Wege leitete, in Form von Bespitzelung, Infiltration und zielgerichteter Informationsbeschaffung durch Telefonabhöraktionen, andere Abhöraktionen und Funküberwachung.
Die wiederholten Behauptungen in den Medien, dass die Sicherheitspolizei eine konkrete Bedrohung ignoriert habe, waren in mehreren Besprechungen auf höchster Ebene der Sicherheitspolizei und sogar bei der parlamentarischen Aufsicht der Sicherheitspolizei diskutiert worden. Wie schon so oft hatte man jedoch nachweisen können, dass es sich um haltloses Gefasel und vage, grundlose Spekulationen handelte, die sicher nur zu dem Ziel in die Welt gesetzt worden waren, der Sicherheitspolizei zu schaden. Man hatte die Maßnahmen ergriffen, zu denen man sich veranlasst gesehen hatte, und einige Wochen lang, als der Gerüchtewald besonders gewuchert war, hatte man die Botschaft der BRD auf die Liste der besonders wichtigen Überwachungsobjekte gesetzt.
Diese Maßnahme hatte ein eindeutiges Resultat gezeitigt. Es hatten sich keinerlei Hinweise auf irgendeine geplante Aktion ergeben, und die zusätzliche Bewachung war zurückgezogen worden, ein Geschenk des Himmels, denn die Drogensektion hatte gerade zu diesem Zeitpunkt einen unerwartet großen Bedarf an zusätzlichen Kräften angemeldet. Die Parlamentarier in der Leitung waren mit diesen Erklärungen vollauf zufrieden gewesen. Die Besetzung der Botschaft der BRD war ein einzigartiges Ereignis gewesen, geplant und durchgeführt von einer bundesdeutschen Terrorfraktion, die sich fast als Sammelbecken verwirrter Freibeuter von der Universität Heidelberg beschreiben ließ, und allen Auskünften der Kollegen von der deutschen Sicherheitspolizei zufolge hatten sich viele von ihren etablierteren Genossen – in dem leider viel zu großen Kreis radikaler Elemente – energisch von dem Geschehenen distanziert. Die Botschaftsbesetzung hatte dem gemeinsamen Kampf nichts genützt.
IV
Übrig blieben die Erinnerungen. Die Erinnerungen der Polizisten.
Jarnebring erinnerte sich an den Geruch von verbranntem Telefon, aber da der an seinem Arbeitsplatz überaus ungewöhnlich war, ungewöhnlicher noch als der von Madeleine-Küchlein, war es nicht dieser Geruch, der Bilder in seinem Kopf hervorrief. Das geschah vielmehr durch andere Dinge und manchmal auch durch gar nichts, denn ab und zu und vor allem in seinen Träumen drängten sich die Erinnerungen an die Minuten auf der Botschaftstreppe auf, ohne dass er auch nur die geringste Ahnung hatte, warum das wohl gerade jetzt geschah. Es war keine übermäßig wichtige Angelegenheit, denn ziemlich bald hatte er aufgehört, über diese Geschehnisse zu sprechen, und nicht lange danach hatte er auch aufgehört, darüber nachzudenken. Wir Menschen sind in dieser Hinsicht ja glücklich eingerichtet, dachte er oft.
Sein bester Freund und engster Kollege Lars Martin Johansson, um die Zeit der Botschaftsbesetzung seit einem guten Monat frisch ernannter Kriminalinspektor, hatte ebenfalls seine Erinnerungen, obwohl er sich nicht einmal in der Nähe der bundesdeutschen Botschaft befunden hatte. Am Donnerstag, dem 24. April 1975, hatte er sich freigenommen, um sich um seine beiden kleinen Kinder zu kümmern, die viel zu verrotzt waren, um in der Tagesstätte abgeliefert werden zu können. Das Botschaftsdrama hatte er auf dem Sofa vor dem Fernseher in seinem Wohnzimmer in der Wollmar Yxkullsgata auf Söder verfolgt. Und er hatte nie im Leben zehn Mal bei Jarnebring angerufen, wie dessen damalige Gattin so gern behauptete. Er hatte drei Mal angerufen, nicht mehr und nicht weniger, und das nicht, um seine Neugier zu befriedigen, sondern aus Angst, wie es seinem besten Freund wohl ergangen sein mochte.
In gewisser Weise war auch er zum Opfer der Ereignisse geworden. An seinem Arbeitsplatz galt es kaum als Verdienst, zu Hause zu sitzen und sich um kranke Kinder zu kümmern, während alle Kollegen, die sich aufrecht halten konnten, mit gezogener Dienstwaffe vor der Botschaft standen. Noch eine ganze Weile hatte es an entsprechenden Kommentaren nicht gefehlt. Die erreichten etwas über einen Monat nach dem Botschaftsdrama ihren Höhepunkt, als jemand das Namensschild an seiner Tür mit einem bedruckten Zettel ergänzte. Unter seinem Namen stand jetzt sein neuer Titel: »Leiter der Tagesstätte Schnupfen«.
Die besagten Ereignisse hatten eine Zeit lang außerdem zu einigen gelassenen Reibereien mit seinem besten Freund und engsten Kollegen geführt. Wenn das Telefon in ihrem gemeinsamen Zimmer klingelte, oft weil irgendwer mit einem anderen Lars Johansson reden wollte als dem, der in diesem Zimmer in dem großen Polizeigebäude auf Kungsholmen saß, lösten sie das Problem, indem sie ganz lange warteten, ehe sie den Hörer abnahmen; in der Regel gab der Anrufer als Erster auf.
Aber nicht immer, und wenn das Geklingel dann zu hartnäckig wurde, schaute Lars Martin Johansson von den Papieren auf, über die er sich gerade gebeugt hatte, nahm Witterung auf wie ein Schweißhund und blickte seinen besten Freund und Kollegen fragend an.
»Bin ich hier der Einzige, der findet, dass es nach verbranntem Telefon riecht?«
Und danach griff Jarnebring immer zum Hörer.
Einer, der ebenfalls starke Erinnerungen an das Botschaftsdrama hatte und es vom ersten Anfang bis zum Schluss miterlebt hatte, war der damalige Polizeiassistent Stridh. Stridh fuhr eine Funkstreife auf Östermalm, und Djurgården gehörte zu seinem Revier. Stridh führte außerdem das Kommando in der Streife, die als Erstes bei der Botschaft der BRD angelangt war. Seinen eigenen Aufzeichnungen zufolge sogar noch bevor die Polizeizentrale den Alarm gegeben hatte, aber das nur, weil seine Armbanduhr zwei Minuten nachgegangen war.
Sein rasches Eingreifen hatte seine Chefs und seine Kollegen gewaltig überrascht. Stridh war nämlich vor allem bekannt wegen seiner – um es kollegial und freundlich auszudrücken – bedächtigen Art. Unter den Kollegen hieß er nur »Friede um jeden Preis«, und nicht er hatte dem raschen Eingreifen der Stockholmer Polizei draußen im Feld ein menschliches Gesicht gegeben. Dafür hatten andere gesorgt.
Der Grund, aus dem er der »erste Mann vor Ort« bei der bundesdeutschen Botschaft gewesen war, hing auch nicht damit zusammen, dass er normalerweise in dieser Gegend Streife fuhr und schon allein statistisch gesehen eine sehr gute Chance auf diesen Titel hatte. Er war nämlich Meister im Ausweichen, und vor allem im Frühling machten viele seiner fahrenden und um einiges tatkräftigeren Kollegen gern einen Abstecher nach Djurgården. Der Grund war ein anderer.
In der Woche vor dem Botschaftsdrama hatte er über Funk eine einfache und ziemlich harmlose Anfrage beantwortet. Ein Hausmeister der norwegischen Botschaft hatte einen verdächtigen Personenwagen beobachtet, der durch die Nachbarschaft fuhr, und gefragt: »Ist irgendwer in der Nähe, der sich dieses Fahrzeug mal ansehen kann?« Da sich das nicht weiter gefährlich anhörte und da besagtes Fahrzeug nur fünfzig Meter vor ihnen auf der Höhe des Schifffahrtsmuseums durch den Djurgårdsbrunnsväg fuhr, hatten Stridh und seine Kollegen den Auftrag übernommen. Sie hatten den Wagen angehalten und eine routinemäßige Verkehrskontrolle durchgeführt.
Es handelte sich um einen ziemlich neuen und alles andere als billigen Mercedes. Am Steuer saß ein junger Mann von vielleicht fünfundzwanzig, und neben ihm saß eine noch jüngere Frau. Alle Papiere waren ganz und gar in Ordnung, und die jungen Leute im Wagen waren sympathisch, sie kicherten ein wenig und waren leicht nervös, wie anständige Menschen das ja gern tun, wenn sie von der Polizei angehalten werden. Obwohl Stridh gar nicht danach gefragt hatte, erklärte die junge Frau, der Wagen gehöre ihren Eltern und sie wollten nur einen kleinen Ausflug machen. Stridh hatte keine weiteren Fragen. Er nickte freundlich und reichte dem jungen Mann seinen Führerschein zurück, und als er und der Kollege weiterfuhren, dachte er an den Frühling und die Jugend und die Liebe. Danach fuhren sie zum Kaffeetrinken auf die Wache, und wenn nicht zwei Tage später die bekannten Ereignisse stattgefunden hätten, dann hätte er dieses Intermezzo sicher vergessen.
Aber dann hatte der Kollege sich abermals per Funk gemeldet. Der Hausmeister der norwegischen Botschaft hatte dasselbe Fahrzeug wie vor zwei Tagen beobachtet, und ob denn vielleicht ein Wagen in der Nähe sei, der nach besagtem Fahrzeug Ausschau halten und auch bei der Botschaft vorbeifahren und mit dem Anrufer reden könne. Stridh hatte den Auftrag übernommen und war der Einfachheit halber gleich zur Botschaft gefahren, statt sich nach irgendeinem Mercedes umzusehen. Einer Automarke, die in diese Gegend übrigens ziemlich gut passte.
In der Botschaft hatte er mit dem Hausmeister gesprochen, der bei der Polizei angerufen hatte. Er war um die fünfunddreißig, Norweger und ein sympathischer Bursche, der ohne zu fragen schon zu Beginn des Gesprächs Kaffee und Plätzchen aufgetischt hatte. Besonders hektisch wirkte er nicht. Norwegen, die Norweger und die norwegische Botschaft lebten mit aller Welt in Frieden, aber nun hatte er dieses Fahrzeug schon mindestens vier Mal an ebenso vielen Tagen beobachtet, und im Hinblick auf die Deutschen auf der anderen Straßenseite hatte er nach der zweiten Beobachtung beschlossen, die Polizei anzurufen.
»Hast du mit den Kollegen von der deutschen Botschaft gesprochen?« , fragte Stridh.
Hatte er nicht. Wenn es sich vermeiden ließ, redete er nie mit Deutschen, und das hatte rein persönliche Gründe. Da sprach er lieber mit der schwedischen Polizei.
»Die haben meinen Vater ins KZ gesteckt«, erklärte er, und das reichte Stridh, dessen großes Interesse nicht der Polizeiarbeit, sondern der europäischen Geschichte galt, und anders als etliche seiner Kollegen hatte er nie Schwierigkeiten mit seinen historischen Sympathien gehabt.
»Ich verstehe«, sagte Stridh auf selbst erfundenem Norwegisch und lächelte. Sympathischer Bursche, dachte er.
Als er eine halbe Stunde später losfuhr, hatte er zuerst einige Zeilen über diesen Einsatz schreiben wollen, hatte sich bei genauerem Nachdenken aber dagegen entschieden. Eine einfache Aktennotiz musste reichen, denn auch wenn der Hausmeister ein sympathischer und zuverlässiger Mensch zu sein schien, so waren seine Auskünfte doch alles andere als sicher. Er konnte zum Beispiel nicht mit Bestimmtheit sagen, dass es sich alle vier Male um dasselbe Auto gehandelt hatte. Für zwei Mal konnte er garantieren, da hatte er sich nämlich die Nummer notiert. Und an den Fahrer konnte er sich leider nur sehr vage erinnern. Beim ersten Mal war ein junger Mann gefahren, und auf dem Beifahrersitz hatte jemand gesessen, da war er sich »ziemlich sicher«, aber ob es sich um Männlein oder Weiblein gehandelt hatte, war nicht zu erkennen gewesen. Beim zweiten Mal, als er die Nummer notiert hatte, war er »fast sicher« gewesen, dass der Wagen von »einem Knaben« gefahren wurde und dass dieser Knabe allein im Auto gesessen hatte, aber ob es derselbe war, der zuvor einen Beifahrer gehabt hatte, konnte er nicht sagen.
Nachdem er über die Sache noch weiter nachgedacht hatte, beschloss Stridh, dass es sicher eine banale und ganz natürliche Erklärung für alles gab und verzichtete sogar auf die Aktennotiz. Diese Auffassung legte er am Donnerstag, dem 24. April 1975, unmittelbar vor dem Mittagessen wieder ab. Schon am nächsten Morgen, obwohl er schrecklich müde war, da er ja bis spät in die Nacht Dienst gehabt hatte, fuhr er zur Wache, bat um eine Schreibmaschine und verfasste eine längere und absolut plausible Zusammenfassung seiner Beobachtungen und seines Gesprächs mit dem Hausmeister der norwegischen Botschaft. Diese Zusammenfassung übergab er seinem Chef, und der nickte und versprach, sie »an die Spione oben auf Kungsholmen« weiterzureichen.
Danach passierte nichts mehr. Alles blieb still wie im Grab. Niemand meldete sich bei Stridh, und der vergaß die ganze Angelegenheit nach und nach. Man konnte ja davon ausgehen, dass einer von den geheimen Kollegen der Sache nachgegangen und aus überzeugenden Gründen zu demselben Schluss gelangt war wie vor ihm Stridh. Nämlich dass es eine banale und überaus unschuldige Erklärung gab.
Teil 2
Ein anderes Leben
1
Donnerstag, 30. November 1989, abends
Es war ein Alarm mit mehreren Hindernissen gewesen, und wenn man bedenkt, dass es sich als ein echter Fall von Mord herausstellte, war es ein unglücklicher Zufall, dass die Polizei den Tatort erst so spät erreichte. Unter normalen Umständen hätte man vielleicht das Leben des Opfers retten oder zumindest den Täter festnehmen und sich auf diese Weise eine ungeheure Menge an Problemen ersparen können. Aber die Umstände waren eben nicht normal, und deshalb kam alles so, wie es eben kam. In der Zentrale der Stockholmer Polizei war man sich immerhin einig, dass jedenfalls nicht Karl XII. die Schuld trug.
Einige Tage zuvor hatte die juristische Abteilung derselben Polizeibehörde zwei Demonstrationen zugelassen, und beiden Entscheidungen war eine ansehnliche Menge juristischer Gedankenarbeit und umfassender strategischer und taktischer Erwägungen vorausgegangen.
Im ersten Antrag, der eingereicht worden war, erklärten »vaterländisch gesinnte Organisationen und einzelne schwedische Mitbürger« – so beschrieben die Antragsteller sich selber – »dem schwedischen Heldenkönig an seinem Todestag eine Huldigung darbringen zu wollen«. Das sollte in Form eines Fackelzugs von Humlegården bis zur Statue Karls XII. in Kungsträdgården geschehen, mit Fahnenburg, Kranzniederlegung und Huldigungsrede vor dem Standbild, es sollte um 19.00 losgehen und spätestens um 21.00 beendet sein.
Schon am nächsten Tag wurde ein weiterer Antrag eingereicht. Etliche politische Jugendorganisationen, mit einer Ausnahme waren alle im Parlament vertretenen Parteien dabei, wollten eine »breite, im Volk verankerte Kundgebung gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus« durchführen, und bis dahin war ja auch alles gut und schön. Aus Gründen, die nicht ganz klar wurden und aus dem Antrag jedenfalls nicht hervorgingen, planten sie, diese Kundgebung just am Donnerstag, dem 30. November, zwischen 19.00 und 22.00 zu veranstalten. Sie wollten sich in Humlegården versammeln, durch die Birger Jarlsgata und die Hamngata ziehen und das Ganze »mit Reden und einem gemeinsamen Aufruf« am Sergels Torg ausklingen lassen, ganze vierhundert Meter vom Standbild Karls XII. im Kungsträdgården entfernt.
Was ihre politischen Ansichten anging, so wiesen die Teilnehmer der beiden geplanten Demonstrationen gelinde gesagt keine größeren Ähnlichkeiten miteinander auf. Es war sogar so, dass sie mit ziemlich großer Sicherheit schon aufgrund ihres Äußeren in zwei verschiedene Töpfchen sortiert werden konnten. Zugleich aber sollten die nicht vorhandenen gemeinsamen Interessen zur selben Zeit am selben Ort zum Ausdruck gebracht werden. In der juristischen Abteilung, wo etliche scharfe Gehirne arbeiteten, merkte man das sofort. Man ahnte kurz gesagt ein mieses Spiel, und um sich Ärger zu ersparen, war man der guten alten polizeilichen Grundregel gefolgt, auch mutmaßliche Krachschläger zu trennen.
Das hatte zuerst den Kreis der »vaterländisch Gesinnten« getroffen. Nicht als Ausdruck polizeilicher Vorlieben, als Behörde hatte man so etwas natürlich nicht, sondern einfach aufgrund polizeilicher Berechnungen der relativen Größe beider Gruppen. Demokratische Beschlüsse waren in vieler Hinsicht ja eine Frage der Quantität, und die Vaterlandsfreunde waren zahlenmäßig um einiges geringer zu veranschlagen. Wie es der mit der Rechnerei beauftragte Kommissar so fromm zusammenfasste, ging es höchstens um etwa hundert, »ein paar alte Schwule aus dem finnischen Winterkrieg und ihre jüngeren glatzköpfigen Kameraden«, und das sei ja nicht gerade »etwas, das man sich an den Weihnachtsbaum hängt, wenn hier schon von Demokratie die Rede ist«.
Sehr wahr, sehr wahr, und in einer Zeit überaus knapp bemessener polizeilicher Mittel war deshalb gestattet worden, sich um 18.00 am Kai unterhalb des Grand Hotels zu versammeln. In geschlossenem Trupp durfte man die etwa hundert Meter zum Standbild Karls XII. spazieren, wo natürlich nichts gegen Kranzniederlegung und Reden sprach, wofern alles spätestens um 19.00 zu Ende war und sich dann »in guter Ordnung auflöste«. Man durfte sogar die Nationalhymne singen, wenn man wollte, obwohl das, vermutlich aus purer Vergesslichkeit, im Antrag nicht aufgeführt war.
Die Fackeln dagegen konnten sie vergessen – »ihr haltet uns wohl für Vollidioten«, wie besagter Kommissar das Verbot begründete, als einer der Veranstalter anrief, um ebendieses Detail zu diskutieren –, und was das Fähnchenschwenken anging, so wurde vorausgesetzt, dass sich das in einem anständigen Rahmen hielt.
Da die Teilnehmer der »breiten, im Volk verankerten Kundgebung« laut Versprechungen und übereinstimmenden polizeilichen Berechnungen auf mehrere tausend veranschlagt wurden, war man, ausgehend von denselben demokratischen Grundsätzen, um einiges großzügiger verfahren. Unter der Voraussetzung, dass sie sich wirklich um 19.00 und nicht früher versammelten, konnten sie das in Humlegården tun. Und natürlich durften sie die Demonstration am Sergels Torg abschließen, wenn sie durch Kungsgata und Sveaväg gingen statt durch Birger Jarlsgata und Hamngata.