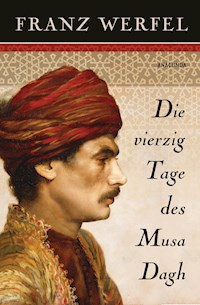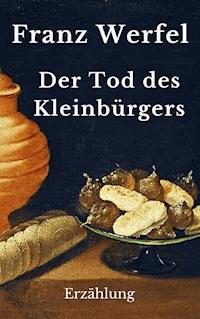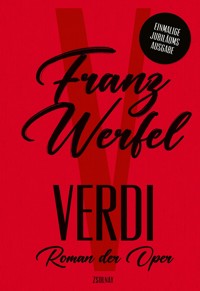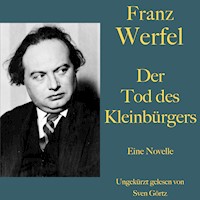Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Eine blassblaue Frauenschrift (Historischer Roman)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Eine blassblaue Frauenschrift ist eine Geschichte über den Verrat einer Liebe, ein Psychogramm eines Opportunisten und ein zeitgeschichtliches Dokument über den latenten Antisemitismus in der Ersten Republik. Im Österreich des Jahres 1936 blickt Leonidas stolz auf sein bisheriges Leben zurück. Als Sektionschef im Unterrichtsministerium gehört er zur politischen Elite des Landes. An seinem Geburtstag erhält er einen Brief, geschrieben in einer blassblauen Frauenschrift. Es ist ein Brief von der Jüdin Vera Wormser, der Liebe seines Lebens. Eine kurze, aber heftige Liebesaffäre vor 18 Jahren in Heidelberg verbindet die beiden. Nun schreibt Vera, die sich gerade in Wien aufhält, bevor sie eine Stelle in Montevideo antritt, dass ein "begabter, junger Mann von 17 Jahren", allem Anschein nach sein Sohn, in Deutschland "aus bekannten Gründen" nicht mehr das Gymnasium besuchen könne. Sie bittet "den Herrn Sektionschef" darum, ihm einen Platz in einer guten Schule in Wien zu verschaffen... Franz Werfel (1890-1945) war ein österreichischer Schriftsteller jüdischer Herkunft mit deutschböhmischen Wurzeln. Er ging aufgrund der nationalsozialistischen Herrschaft ins Exil und wurde 1941 US-amerikanischer Staatsbürger. In den 1920er und 1930er Jahren waren seine Bücher Bestseller.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine blassblaue Frauenschrift (Historischer Roman)
Geschichte über den Verrat einer Liebe
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel April im Oktober
Die Post lag auf dem Frühstückstisch. Ein beträchtlicher Stoß von Briefen, denn Leonidas hatte erst vor kurzem seinen fünfzigsten Geburtstag gefeiert und täglich trafen noch immer glückwünschende Nachzügler ein. Leonidas hieß wirklich Leonidas. Den eben so heroischen wie drückenden Vornamen verdankte er seinem Vater, der ihm als dürftiger Gymnasiallehrer außer diesem Erbteil nur noch die vollzähligen griechisch-römischen Klassiker und zehn Jahrgänge der ›Tübinger altphilologischen Studien‹ vermacht hatte. Glücklicherweise ließ sich der feierliche Leonidas leicht in einen schlicht-gebräuchlichen Leo umwandeln. Seine Freunde nannten ihn so und Amelie hatte ihn niemals anders gerufen als Leon. Sie tat es auch jetzt, indem sie mit ihrer dunklen Stimme der zweiten Silbe von León eine melodisch langgezogene und erhöhte Note gab.
»Du bist unerträglich beliebt, León«, sagte sie. »Wieder mindestens zwölf Gratulationen ...«
Leonidas lächelte seiner Frau zu, als bedürfe es einer verlegenen Entschuldigung, daß es ihm gelungen sei, zugleich mit dem Gipfel einer glänzenden Karriere sein fünfzigstes Lebensjahr zu erreichen. Seit einigen Monaten war er Sektionschef im ›Ministerium für Kultus und Unterricht‹ und gehörte somit zu den vierzig bis fünfzig Beamten, die in Wirklichkeit den Staat regierten. Seine weiße ausgeruhte Hand spielte zerstreut mit dem Briefstapel.
Amelie löffelte langsam eine Grapefruit aus. Das war alles, was sie morgens zu sich nahm. Der Umhang war ihr von den Schultern geglitten. Sie trug ein schwarzes Badetrikot, in welchem sie ihre alltägliche Gymnastik zu erledigen pflegte. Die Glastür auf die Terrasse stand halb offen. Es war ziemlich warm für die Jahreszeit. Von seinem Platz aus konnte Leonidas weit über das Gartenmeer der westlichen Vorstadt von Wien hinaussehen, bis zu den Bergen, an deren Hängen die Metropole verebbte. Er warf einen prüfenden Blick nach dem Wetter, das für sein Behagen und seine Arbeitskraft eine wesentliche Rolle spielte. Die Welt präsentierte sich heute als ein lauer Oktobertag, der in einer Art von launisch gezwungener Jugendlichkeit einem Apriltage glich. Über den Weinbergen der Bannmeile schob sich dickes hastiges Gewölk, schneeweiß und mit scharf gezeichneten Rändern. Wo der Himmel frei war, bot er ein nacktes, für diese Jahreszeit beinahe schamloses Frühlingsblau dar. Der Garten vor der Terrasse, der sich noch kaum verfärbt hatte, wahrte eine ledrig hartnäckige Sommerlichkeit. Kleine gassenbübische Winde sprangen mutwillig mit dem Laub um, das noch recht fest zu hängen schien.
Ziemlich schön, dachte Leonidas, ich werde zu Fuß ins Amt gehen. Und er lächelte wiederum. Es war dies aber ein merkwürdiges gemischtes Lächeln, begeistert und mokant zugleich. Immer, wenn Leonidas mit Bewußtsein zufrieden war, lächelte er mokant und begeistert. Wie so viele gesunde, wohlgestaltete, ja schöne Männer, die es im Leben zu einer hohen Stellung gebracht haben, neigte er dazu, sich in den ersten Morgenstunden ausnehmend zufrieden zu fühlen und dem gewundenen Laufe der Welt rückhaltlos zuzustimmen. Man trat gewissermaßen aus dem Nichts der Nacht über die Brücke eines leichten, alltäglich neugeborenen Erstaunens in das Vollbewußtsein des eigenen Lebenserfolges ein. Und dieser Lebenserfolg konnte sich wahrhaftig sehen lassen: Sohn eines armen Gymnasialprofessors achter Rangklasse. Ein Niemand, ohne Familie, ohne Namen, nein ärger, mit einem aufgeblasenen Vornamen behaftet. Welch eine triste, frostige Studienzeit! Man bringt sich mit Hilfe von Stipendien und als Hauslehrer bei reichen, dicklichen und unbegabten Knaben mühsam durch. Wie schwer ist es, das verlangende Hungerblinzeln in den eigenen Augen zu bemeistern, wenn der träge Zögling zu Tisch gerufen wird! Aber ein Frack hängt dennoch im leeren Schrank. Ein neuer tadelloser Frack, an dem nur ein paar kleine Korrekturen vorgenommen werden mußten. Dieser Frack nämlich ist ein Erbstück. Ein Studienkollege und Budennachbar hat ihn Leonidas testamentarisch hinterlassen, nachdem er sich eines Abends im Nebenzimmer eine Kugel unangekündigt durch den Kopf gejagt hatte. Es geht fast wie im Märchen zu, denn dieses Staatsgewand wird entscheidend für den Lebensweg des Studenten. Der Eigentümer des Fracks war ein »intelligenter Israelit«. (So vorsichtig bezeichnet ihn auch in seinen Gedanken der feinbesaitete Leonidas, der den allzu offenen Ausdruck peinlicher Gegebenheiten verabscheut.) Diesen Leuten ging es übrigens in damaliger Zeit so erstaunlich gut, daß sie sich dergleichen luxuriöse Selbstmordmotive wie philosophischen Weltschmerz ohne weiteres leisten konnten.
Ein Frack! Wer ihn besitzt, darf Bälle und andere gesellschaftliche Veranstaltungen besuchen. Wer in seinem Frack gut aussieht und überdies ein besonderes Tänzertalent besitzt wie Leonidas, der erweckt rasch Sympathien, schließt Freundschaften, lernt strahlende junge Damen kennen, wird in »erste Häuser« eingeladen. So war es wenigstens damals in jener staunenswerten Zauberwelt, in der es eine soziale Rangordnung und darin das Unerreichbare gab, das des auserwählten Siegers harrte, damit er es erreiche. Mit einem blanken Zufall begann die Karriere des armen Hauslehrers; mit der Eintrittskarte zu einem der großen Ballfeste, die Leonidas geschenkt erhielt. Der Frack des Selbstmörders kam somit zu providentieller Geltung. Indem der verzweifelte Erblasser ihn mit seinem Leben hingegeben hatte, half er dem glücklicheren Erben über die Schwelle einer glänzenden Zukunft. Und dieser Leonidas erlag in den Thermopylen seiner engen Jugend keineswegs der Übermacht einer hochmütigen Gesellschaft. Nicht nur Amelie, auch andere Frauen behaupten, daß es einen Tänzer seinesgleichen nie gegeben habe, noch auch je wieder geben werde. Muß erst gesagt werden, daß Leóns Domäne der Walzer war, und zwar der nach links getanzte, schwebend, zärtlich, unentrinnbar fest und locker zugleich? Im beschwingten Zweischritt-Walzer jener sonderbaren Epoche konnte sich noch ein Liebesmeister, ein Frauenführer beweisen, während (nach Leóns Überzeugung) die Tänze des modernen Massenmenschen in ihrem gleichgültigen Gedränge nur dem maschinellen Trott ziemlich unbeseelter Glieder einen knappen Raum gewähren.
Auch dann, wenn Leonidas sich seiner verrauschten Tänzertriumphe erinnert, umspielt das so charakteristisch gemischte Lächeln seinen hübschen Mund mit den blitzenden Zähnen und dem weichen Schnurrbärtchen, das noch immer blond ist. Er hält sich mehrmals am Tag für einen ausgemachten Götterliebling. Würde man ihn auf seine »Weltanschauung« prüfen, er müßte offen bekennen, daß er das Universum als eine Veranstaltung ansehe, deren einziger Sinn und Zweck darin besteht, Götterlieblinge seinesgleichen aus der Tiefe zur Höhe emporzuhätscheln und sie mit Macht, Ehre, Glanz und Luxus auszustatten. Ist nicht sein eigenes Leben der Vollbeweis für diesen freundlichen Sinn der Welt? Ein Schuß fällt in der Nachbarkammer seines schäbigen Studentenquartiers. Er erbt einen beinah noch funkelnagelneuen Frack. Und schon kommt's wie in einer Ballade. Er besucht im Fasching einige Bälle. Er tanzt glorreich, ohne es je gelernt zu haben. Es regnet Einladungen. Ein Jahr später gehört er bereits zu den jungen Leuten, um die man sich reißt. Wird sein allzu klassischer Vorname genannt, tritt lächelndes Wohlwollen auf alle Mienen. Sehr schwierig ist es, das Betriebskapital für ein derart beliebtes Doppelleben herbeizuschaffen. Seinem Fleiß, seiner Ausdauer, seiner Bedürfnislosigkeit gelingt's. Vor der Zeit besteht er alle seine Prüfungen. Glänzende Empfehlungen öffnen ihm die Pforten des Staatsdienstes. Er findet sogleich die prompte Zuneigung seiner Vorgesetzten, die seine angenehm gewandte Bescheidenheit nicht hoch genug zu rühmen wissen. Schon nach wenigen Jahren erfolgt die vielbeneidete Versetzung zur Zentralbehörde, die sonst nur den besten Namen und den ausgesuchtesten Protektionskindern vorbehalten ist. Und dann diese wilde Verliebtheit Amelie Paradinis, der Achtzehnjährigen, Bildschönen ...
Das leichte Erstaunen allmorgendlich beim Erwachen ist wahrhaftig nicht ungerechtfertigt. Paradini!? Man irrt nicht, wenn man bei diesem Namen aufhorcht. Ja, es handelt sich in der Tat um das bekannte Welthaus Paradini, das in allen Weltstädten Zweigniederlassungen besitzt. (Seither ist freilich das Aktienkapital von den großen Banken aufgesaugt worden.) Vor zwanzig Jahren aber war Amelie die reichste Erbin der Stadt. Und keiner der glänzenden Namen aus Adel und Großindustrie, keiner von diesen himmelhoch überlegenen Bewerbern hatte die blutjunge Schönheit erobert, sondern er, der Sohn des hungerleidenden Lateinlehrers, ein Jüngling mit dem geschwollenen Namen Leonidas, der nichts besaß als einen gutsitzenden, aber makabren Frack. Dabei ist das Wort »erobert« schon eine Ungenauigkeit. Denn, recht besehen, war er auch in dieser Liebesgeschichte nicht der Werbende, sondern der Umworbene. Das junge Mädchen nämlich hatte mit unnachgiebiger Energie die Ehe durchgesetzt gegen den erbitterten Widerstand der ganzen millionenschweren Verwandtschaft.
Und hier sitzt sie ihm gegenüber, heut wie allmorgendlich, Amelie, sein großer, sein größter Lebenserfolg. Merkwürdig, das Grundverhältnis zwischen ihnen hat sich nicht verwandelt. Noch immer fühlt er sich als der Umworbene, als der Gewährende, als der Gebende, trotz ihres Reichtums, der ihn auf Schritt und Tritt mit Weite, Wärme und Behagen umgibt. Im übrigen betont Leonidas nicht ohne unbestechliche Strenge, daß er Amelies Besitztümer durchaus nicht für die seinen ansehe. Von allem Anfang an habe er zwischen diesem sehr ungleichen Mein und Dein eine feste Schranke aufgerichtet. Er betrachte sich in dieser reizenden, für zwei Menschen leider viel zu geräumigen Villa gleichsam nur als Mieter, als Pensionär, als zahlenden Nutznießer, widme er doch sein ganzes Gehalt als Staatsbeamter ohne Abzug der gemeinsamen Lebensführung. Schon vom ersten Tage dieser Ehe an habe er auf dieser Unterscheidung unerbittlich bestanden. Mochten die Auguren einander auch anlächeln, Amelie war entzückt über den männlichen Stolz des Geliebten, des Erwählten. Er hat jüngst die Höhe des Lebens erreicht und geht nun die Treppe langsam abwärts. Als Fünfzigjähriger besitzt er eine acht- oder neununddreißigjährige Frau, blendend noch immer. Sein Blick prüft sie.
In dem nüchtern entlarvenden Oktoberlicht schimmern Amelies nackte Schultern und Arme makellos weiß, ohne Flecken und Härchen. Dieses duftende Marmorweiß entstammt nicht nur der Wohlgeborenheit, sondern ist ebenso die Folge einer unablässigen kosmetischen Pflege, die sie ernst nimmt wie einen Gottesdienst. Amelie will für Leonidas jung bleiben und schön und schlank. Ja, schlank vor allem. Und das fordert beständige Härte gegen sich selbst. Vom steilen Weg dieser Tugend weicht sie keinen Schritt. Ihre kleinen Brüste zeichnen sich unterm schwarzen Trikot spitz und fest ab. Es sind die Brüste einer Achtzehnjährigen. Wir bezahlen diese jungfräulichen Brüste mit Kinderlosigkeit, denkt der Mann jetzt. Und er wundert sich selbst über diesen Einfall, denn als entschlossener Verteidiger seines eigenen ungeteilten Behagens hat er niemals den Wunsch nach Kindern gehegt. Eine Sekunde lang taucht er den Blick in Amelies Augen. Sie sind heute grünlich und sehr hell. Leonidas kennt genau diese wechselnde und gefährliche Färbung. An gewissen Tagen hat seine Frau meteorologisch veränderliche Augen. »April-Augen« hat er's selbst einmal genannt. In solchen Zeiten muß man vorsichtig sein. Szenen liegen in der Luft ohne die geringste Ursache. Die Augen sind übrigens das einzige, was zu Amelies Jungmädchenhaftigkeit in sonderbarem Widerspruch steht. Sie sind älter als sie selbst. Die nachgemalten Brauen machen sie starr. Schatten und bläuliche Müdigkeiten umgeben sie mit der ersten Ahnung des Verfalls. So sammelt sich in den saubersten Räumen an gewissen Stellen ein Niederschlag von Staub und Ruß. Etwas beinah schon Verwüstetes liegt in dem Frauenblick, der ihn festhält.
Leonidas wandte sich ab. Da sagte Amelie: »Willst du nicht endlich deine Post durchschauen?« – »Höchst langweilig«, murmelte er und sah erstaunt den Briefstoß an, auf dem seine Hand noch immer zögernd und abwehrend ruhte. Dann blätterte er wie ein Kartenspieler das schiere Dutzend vor sich auf und musterte es mit der Routine des Beamten, der die Bedeutung seines »Einlaufs« mit einem halben Blick feststellt. Es waren elf Briefe, zehn davon in Maschinenschrift. Um so mahnender leuchtete die blaßblaue Handschrift des elften aus der eintönigen Reihe hervor. Eine großzügige Frauenschrift, ein wenig streng und steil. Leonidas senkte unwillkürlich den Kopf, denn er spürte, daß er aschfahl geworden war. Er brauchte einige Sekunden, um sich zu sammeln. Seine Hände erfroren vor Erwartung, Amelie werde jetzt eine Frage nach dieser blaßblauen Handschrift stellen. Doch Amelie fragte nichts. Sie sah aufmerksam in die Zeitung, die neben ihrem Gedeck lag, wie jemand, der sich nicht ohne Selbstüberwindung verpflichtet fühlt, die bedrohlichen Zeitereignisse zu verfolgen. Leonidas sagte etwas, um etwas zu sagen. Er würgte an der Unechtheit seines Tons:
»Du hast recht ... nichts als öde Gratulationen ...«
Dann schob er – es war wieder der Griff eines gewiegten Kartenspielers – die Briefe zusammen und steckte sie mit vorbildlicher Lässigkeit in die Tasche. Seine Hand hatte sich weit echter benommen als seine Stimme. Amelie sah von der Zeitung nicht auf, während sie sprach:
»Wenn's dir recht ist, könnt ich all das fade Zeug für dich beantworten, León ...«
Aber Leonidas hatte sich schon erhoben, völlig Herr seiner selbst. Er strich sein graues Sakko glatt, zupfte die Manschetten aus den Ärmeln, legte dann die Hände in die schlanke Taille und wiegte sich mehrere Male auf den Zehenspitzen, als könne er auf diese Weise die Geschmeidigkeit seines prächtigen wohlgewachsenen Körpers prüfen und genießen:
»Für eine Sekretärin bist du mir zu gut, lieber Schatz«, lächelte er begeistert und mokant. »Das erledigen meine jungen Leute im Handumdrehen. Hoffentlich hast du heute keinen leeren Tag. Und vergiß bitte nicht, daß wir abends in der Oper sind ...«
Er beugte sich zu ihr hinab und küßte sie mit ausführlicher Innigkeit aufs Haar. Sie blickte ihn voll an mit ihrem Blick, der älter war als sie selbst. Sein schmales Gesicht war rosig, frisch und wundervoll rasiert. Es strahlte von Glätte, von jener unzerstörbaren Glätte, die sie beunruhigte und gebannt hielt seit jeher.
Zweites Kapitel Die Wiederkehr des Gleichen
Nachdem Leonidas sich von Amelie verabschiedet hatte, verließ er das Haus nicht alsogleich. Allzusehr brannte in seiner Tasche der Brief mit der blaßblauen Frauenhandschrift. Auf der Straße pflegte er weder Briefe noch Zeitungen zu lesen. Das ziemte sich nicht für einen Mann seines Ranges und seiner Angesehenheit im wörtlichen Sinne. Andrerseits besaß er die unschuldige Geduld nicht, solange zu warten, bis er sich ungestört in seinem großen Arbeitszimmer im Ministerium befinden würde. So tat er das, was er öfters als Knabe getan hatte, wenn es eine Heimlichkeit zu verbergen, ein schlüpfriges Bild zu betrachten, ein verbotenes Buch zu lesen galt. Der Fünfzigjährige, dem niemand nachspionierte, blickte ängstlich nach allen Seiten und schloß sich dann, nicht anders als der Fünfzehnjährige einst, vorsichtig in den verschwiegensten Raum des Hauses ein.
Dort starrte er mit entsetzten Augen lange auf die strenge steile Frauenhandschrift und wog den leichten Brief unablässig in der Hand und wagte es nicht, ihn zu öffnen. Mit immer persönlicherer Ausdruckskraft blickten ihn die sparsamen Schriftzüge an und erfüllten nach und nach sein ganzes Wesen wie mit einem Herzgift, das den Pulsschlag lähmt. Daß er Veras Handschrift noch einmal werde begegnen müssen, das hätte er selbst in einem lastenden Angsttraum nicht mehr für möglich gehalten. Was war das für ein unbegreiflicher, was für ein unwürdiger Schreck vorhin, als ihn mitten unter seiner gleichgültigen Post plötzlich ihr Brief angestarrt hatte? Es war ein Schreck aus den Anfängen des Lebens ganz und gar. So darf ein Mann nicht erschrecken, der die Höhe erreicht und seine Bahn fast vollendet hat. Zum Glück hatte Amelie nichts davon bemerkt. Warum dieser Schreck, den er noch in allen Gliedern spürte? Es ist doch nichts als eine alte dumme Geschichte, eine platte Jugendeselei, wohl zwanzigfach verjährt. Er hat wahrhaftig mehr auf dem Gewissen als die Sache mit Vera. Als hoher Staatsbeamter ist er täglich gezwungen, Entscheidungen über Menschenschicksale zu treffen, hochnotpeinliche Entscheidungen nicht selten. In seiner Stellung ist man ja ein wenig wie Gott. Man verursacht Schicksale. Man legt sie ad acta. Sie wandern vom Schreibtisch des Lebens ins Archiv des Erledigtseins. Mit der Zeit löst sich Gott sei Dank alles klaglos in Nichts auf. Auch Vera schien sich doch schon klaglos in Nichts aufgelöst zu haben ...
Es mußte fünfzehn Jahre her sein, mindestens, daß er zum letztenmal einen Brief Veras in der Hand gehalten hatte, so wie jetzt, in einer ähnlichen Situation übrigens und an einem nicht minder kläglichen Örtchen. Damals freilich kannte Amelies Eifersucht keine Grenzen, und ihr mißtrauisches Feingefühl witterte stets eine Fährte. Es blieb ihm nichts übrig, als den Brief zu vernichten. Damals! Daß er ihn ungelesen vernichtete, das allerdings war etwas anderes. Das heißt, es war eine lumpige Feigheit, eine Schweinerei ohnegleichen. Der Götterliebling Leonidas machte sich in diesem Augenblicke nichts vor. Den damaligen Brief habe ich ungelesen zerrissen – und auch den heutigen werde ich ungelesen zerreißen –, einfach, um nichts zu wissen. Wer nichts weiß, ist nicht in Anspruch genommen. Was ich vor fünfzehn Jahren nicht in mein Bewußtsein eingelassen habe, das brauche ich heute doch noch hundertmal weniger einzulassen. Es ist erledigt, ad acta gelegt, nicht mehr da. Ich halte es für ein unbedingtes Gewohnheitsrecht, daß es nicht mehr da ist. Unerhört von dieser Frau, daß sie mir noch einmal ihre Existenz so nah vor Augen führt. Wie mag sie jetzt sein, wie mag sie jetzt aussehen?