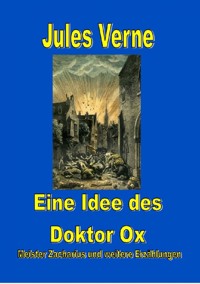
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die humorvolle Erzählung um ein verschlafenes Nest und einen ideenreichen Erfinder ist eine Ausnahme im Werk Vernes. Auch die anderen, hier enthaltenen Erzählungen sind anders - Meister Zacharius, der unheimliche Uhrmacher, die skurrile Geschichte einer Ballonfahrt oder die abenteuerliche Geschichte einer Überwinterung im Eis zeigen die Vielseitigkeit des Autors, der allgemein als 'Erfinder der Science fiction' bezeichnet wird - dabei bieten seine Werke viel mehr. Bruder Paul Verne ist mit seiner abenteuerlichen Mont-Blanc-Besteigung ebenfalls hier vertreten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jules Verne
Eine Idee des Doktor Ox
und weitere Erzählungen
Jules Verne
Eine Idee des Doktor Ox
Meister Zacharius
Ein Drama in den Lüften
Eine Überwinterung im Eis
Eine Mont-Blanc-Besteigung (Paul Verne)
Edition Corsar D. u. Th. Ostwald
Braunschweig
Texte: © 2025 Copyright by Thomas Ostwald nach der Ausgabe des Hartleben-Verlages 1875 und der von mir betreuten Taschenbuchausgabe im Pawlak-Verlag 1984 durchgesehen und korrigiert
Umschlaggestaltung: © 2025 Copyright by
Thomas Ostwald
Edition Corsar
Dagmar u. Thomas Ostwald
Am Uhlenbusch 17
38108 Braunschweig
Erstes Kapitel, dem zufolge es unmöglich ist, die kleine Stadt Quiquendone selbst auf den besten Karten zu finden.
Wenn Ihr Euch daran macht, auf einer älteren oder neueren Karte von Flandern die kleine Stadt Quiquendone aufzusuchen, wird Eure Mühe sich wahrscheinlich als vergeblich erweisen. Ist Quiquendone denn vom Erdboden verschwunden? Nein. Eine Stadt der Zukunft vielleicht? Auch das nicht. Sie existiert den Handbüchern der Geographie zum Trotz, und zwar schon seit acht- oder neunhundert Jahren; ja, sie zählt sogar 2393 Seelen, wenn man jedem ihrer Bewohner eine Seele zuerkennen will. Quiquendone erstreckt sich dreizehn und ein halb Kilometer nordwestlich von Audenarde und fünfzehn und ein Viertel Kilometer südöstlich von Bruges, mitten in Flandern. Die Stadt liegt an dem Vaar, einem kleinen Nebenfluss der Schelde, über den drei Brücken hinwegführen, die sämtlich nach altertümlicher Weise überdacht sind.
Als Merkwürdigkeiten der Stadt sind zu nennen ein altes Schloss, dessen Grundstein vom Grafen Balduin, dem zukünftigen Kaiser von Konstantinopel, gelegt wurde, und ein Rathaus mit gotischen Bogenfenstern, das von Zinnen gekrönt und von einer dreihundertsiebenundfünfzig Fuß hohen Warte mit Türmchen überragt wird. Man hört hier jede Stunde ein Glockenspiel von fünf Oktaven, ein förmliches Luftklavier, das einen noch größeren Ruf hat als das Glockenspiel in Bruges. Die Fremden – wenn nämlich überhaupt Fremde nach Quiquendone kommen – verlassen die Stadt nicht, ohne sich den Saal der Stadthouder angesehen zu haben, der mit einem Bild von Brandon geschmückt ist, das Wilhelm von Nassau in Lebensgröße darstellt; ferner besuchen sie das Empor der Kirche Saint-Magloire, ein Meisterwerk der Baukunst aus dem sechzehnten Jahrhundert, den schmiedeeisernen Brunnen, der mitten auf dem großen Platze Saint-Ernuph ausgegraben ist, und dessen wundervolle Verzierung man dem Maler und Grobschmied Quentin Metsys verdankt, und endlich ein Grabmal der Maria von Burgund (Tochter Karls des Kühnen), das ihr hier errichtet ist, obgleich sie jetzt in der Notre-Dame-Kirche zu Bruges ruht. Als Hauptindustriezweig betreibt Quiquendone die Fabrikation von Schlagsahne und Gerstenzucker auf großer Scala, und wird diese Fabrik seit Jahrhunderten in der Familie Tricasse verwaltet und vom Vater auf den Sohn vererbt. Aber trotz alledem ist Quiquendone nicht auf der Karte von Flandern zu finden; ob aus Vergesslichkeit der Geographen oder aus böslicher Absicht, ist mir unerforscht geblieben. So viel jedoch steht fest: Quiquendone existiert, und seine engen Straßen, seine befestigte Umfassungsmauer, seine Markthalle und endlich sein Bürgermeister legen beredtes Zeugnis dafür ab; ja der Letztere würde Euch auf das Klarste dartun können, dass Quiquendone in jüngster Zeit der Schauplatz eines ebenso außerordentlichen und unwahrscheinlichen, als wahrhaftigen Natur-Phänomens gewesen ist, und hierüber wollen wir in vorliegender Erzählung getreulich berichten.
Von den Flamändern des westlichen Flanderns lässt sich gewiss weder Böses sagen noch denken; sie zeigen sich als rechtschaffene, sparsame, gesellige, gleichmütige und gastliche Leute, die, was ihre Sprache und geistigen Fähigkeiten anbetrifft, vielleicht ein wenig schwerfällig sind, aber das erklärt noch immer nicht, wie es kommt, dass eine der interessantesten Städte des Landes sich ihren Platz in der neueren Kartographie erst noch erobern soll.
Ja, diese Unterlassungssünde der Geographen ist gewiss zu bedauern. Wenn nun wenigstens die Geschichte, oder statt ihrer die Chroniken, oder doch wenigstens die Überlieferung des Landes die Stadt Quiquendone erwähnten! Aber nein; weder die Atlanten noch die Reisehandbücher sprechen von diesem vergessenen Ort, und selbst Herr Joanne, den man sonst wohl als einen Jäger auf kleine Nester bezeichnen kann, sagt kein Wort darüber. Dass solch ein Schweigen dem Handel und der Industrie von Quiquendone schaden muss, liegt auf der Hand; wir wollen diesem Ausspruch aber eiligst hinzufügen, dass die Stadt weder auf Handel noch Industrie Anspruch macht und ganz vorzüglich ohnedem fertig wird. Ihr Gerstenzucker und ihre Schlagsahne wird am Ort selbst verzehrt und nicht weiter ausgeführt. Kurz, die Quiquendonianer brauchen niemanden; ihr Wünschen ist beschränkt und ihre Existenz eine durchaus bescheidene; sie verhalten sich ruhig, gemäßigt, kalt, phlegmatisch, mit einem Wort, als richtige »Flamänder«, wie sie ab und zu noch zwischen Schelde und Nordsee angetroffen werden.
Zweites Kapitel, in dem sich der Bürgermeister van Tricasse und Rat Niklausse über städtische Angelegenheiten unterhalten.
»Sie glauben wirklich?«, fragte der Bürgermeister.
»Ja, ich glaube es«, antwortete der Rat nach einem minutenlangen Schweigen.
»Wir müssen uns hüten, in dieser Sache leichthin zu verfahren«, versetzte der Bürgermeister.
»Wir sprechen nun bereits seit zehn Jahren von der betreffenden, wichtigen Angelegenheit, würdiger van Tricasse, und ich muss gestehen, dass ich noch immer zu keinem Entschluss kommen kann.«
»Ich begreife Ihr Zögern sehr wohl«, hub der Bürgermeister nach einer viertelstündigen Überlegungspause wieder an, »ich begreife Ihr Zögern sehr wohl und billige es; wir dürfen vor eingehender Prüfung der Frage keinen bestimmten Entschluss fassen.«
»So viel ist gewiss, einen Zivilkommissar haben wir in einer so friedlichen Stadt, wie Quiquendone, nicht nötig«, bemerkte Rat Niklausse.
»Unser Vorgänger«, sagte der Bürgermeister in ernstem Ton, »unser Vorgänger würde nie gewagt haben zu behaupten, dass irgendetwas gewiss sei. Jede solche Versicherung ist unangenehmen Rückschlägen unterworfen.«
Der Rat verneigte sich zum Zeichen seiner Zustimmung; dann hüllte er sich etwa eine halbe Stunde lang in tiefes Schweigen; während dieser Zeit waren Bürgermeister und Rat vollkommen ruhig gewesen, sie hatten auch nicht einen Finger gerührt. Endlich richtete Niklausse die Frage an Tricasse, ob sein Vorgänger – vor etlichen zwanzig Jahren – nicht auch den Gedanken gehabt habe, die Stelle eines Zivilkommissar eingehen zu lassen und so der Stadt Quiquendone die Ausgabe einer Summe von jährlich 1375 Franken und so und so viel Centimes zu ersparen.
»Allerdings«, antwortete der Bürgermeister, indem er mit majestätischer Grandezza die klare Stirn berührte, »allerdings; aber der würdige Mann ward uns entrissen, ehe er in Bezug auf diese wie auch manche andere Verwaltungsmaßregel einen Entschluss zu fassen gewagt hätte. Es war ein weiser Mann! Warum sollte ich ihn nicht nachahmen?«
Rat Niklausse wäre außerstande gewesen, Gründe anzugeben, die diesen Ausspruch des Bürgermeisters entkräftet hätten.
»Wenn ein Mensch stirbt, ohne in seinem Leben irgendeine Entscheidung getroffen zu haben«, fügte Tricasse mit nachdrücklichem Ernst hinzu, »so ist er nahe daran gewesen, die Vollkommenheit auf dieser Welt zu erreichen!«
Nach diesen Worten drückte der Bürgermeister mit der Spitze seines kleinen Fingers auf ein Glöckchen, das hierauf einen Ton hören ließ, der mehr ein Seufzer als ein eigentlicher Klang zu nennen war, und fast unmittelbar darauf vernahm man leichte Schritte, die über die Fliesen des Hausflurs herannahten. Eine Maus hätte nicht weniger Geräusch machen können, wenn sie über eine dichte Mokette trippelte. Die Zimmertür ging auf, indem sie sich auf ihren geölten Angeln drehte, und ein junges Mädchen mit langen blonden Flechten trat ein. Es war Suzel van Tricasse, die einzige Tochter des Bürgermeisters. Sie überreichte ihrem Vater seine kunstgerecht gestopfte Pfeife und ein kupfernes Kohlenbecken und verschwand alsbald ebenso geräuschlos, wie sie gekommen war, ohne ein einziges Wort gesprochen zu haben.
Der Bürgermeister zündete nun den ungeheuren Feuerraum seines Rauchinstruments an und verschwand bald in einer dichten Wolke bläulichen Dampfes, während sich Rat Niklausse von Neuem den allertiefsten Überlegungen hingab.
Das Zimmer, in dem diese beiden mit der Verwaltung von Quiquendone betrauten, angesehenen Persönlichkeiten also berieten, war ein reich mit Skulpturen aus dunklem Holz geschmückter Saal. Ein hoher Kamin, ein so enormer Herd, dass man in ihm hätte einen Eichenstamm verbrennen oder einen Ochsen braten können, nahm ein ganzes Fach der getäfelten Wand ein, und ihm gegenüber lag ein Gitterfenster mit geblendeten Scheiben, durch das die Sonnenstrahlen mit sanftem, gedämpftem Licht hereindrangen. Über dem Kamin hing in einem antiken Rahmen ein altertümliches Portrait irgendeines Pfahlbürgers, das einen Ahnherrn derer van Tricasse darstellen sollte und Hämling zugeschrieben wurde. Der Stammbaum der Familie van Tricasse reichte authentisch bis ins vierzehnte Jahrhundert zurück, einer Zeit, in der die Flamänder und Gui von Dampierre gegen den Kaiser Rudolf von Habsburg kämpften.
Der beschriebene Saal bildete einen Teil des bürgermeisterlichen Hauses, eines der reizendsten Gebäude von Quiquendone; es war in echt flämischem Geschmack errichtet und mit all den malerischen und phantastischen Grillen und Überraschungen ausgestattet, welche die Spitzbogen-Architektur mit sich bringt. Wäre dies Haus ein Karthäuser-Kloster oder eine Taubstummenanstalt gewesen, so hätte es darin nicht ruhiger und stiller zugehen können; man wagte kaum aufzutreten und bewegte sich nur gleitend vorwärts; es wurde nicht laut gesprochen, sondern leise geflüstert, und doch fehlten dem Bürgermeisterhaus nicht weibliche Bewohner, denn es beherbergte außer Frau Brigitte van Tricasse, der Frau des Herrn van Tricasse, die Tochter des würdigen Paares Suzel und ihre Magd Lotchè Janshéu. Auch müssen wir die Schwester des Bürgermeisters, Tante Hermance, eine alte Jungfer, anführen, die auf den Namen Tatanémance hörte, den ihr ihre Nichte Suzel, als diese noch ein kleines Mädchen war, beigelegt hatte. Trotz all dieser Elemente der Zwietracht, des Lärms und der Schwatzhaftigkeit war das Bürgermeisterhaus, wie schon erwähnt, so still und ruhig wie eine Wüste.
Herr van Tricasse, ein Mann von fünfzig Jahren, war weder besonders stark noch mager, weder groß noch klein, weder alt noch jung, weder lebhaft gerötet noch auch blass, weder fröhlich noch traurig, weder besonders zufrieden noch verdrießlich, weder sehr energisch noch weichherzig, weder stolz noch demütig, weder gut noch böse, weder freigebig noch geizig, weder tapfer noch feige, weder zu viel noch zu wenig – ne quid nimis1, – gemäßigt und Maß haltend in allem; aber jeder Physiognom hätte wohl sofort an der unveränderten Langsamkeit seiner Bewegungen, an der herabhängenden Unterlippe, den stets gleichmäßig gehobenen Augenlidern und an seiner Stirn, die ohne jede Runzel einer Metallplatte glich, erkannt, dass er in Herrn Tricasse das personifizierte Phlegma vor sich sah. Nie hatte weder Zorn noch eine sonstige Bewegung seinen Herzschlag beschleunigt oder seine Wangen höher gefärbt; und nie zogen sich seine Pupillen unter dem Eindruck irgendeiner noch so vorübergehenden Gereiztheit zusammen. Er war einmal wie immer in einen guten, weder zu weiten noch zu engen Rock gekleidet, und nie gelang es ihm, die Röcke abzutragen. Seine starken viereckigen Schuhe mit dreidoppelter Sohle und silbernen Schnallen brachten durch ihre Dauer die Schuhmacher zur Verzweiflung, und sein großer Hut datierte noch aus der Zeit, als Flandern sich entschieden von Holland absonderte, und bekundete somit das ehrwürdige Alter von vierzig Jahren. Doch das alles war wohl erklärlich; die Leidenschaften nutzen ebenso die Seele wie den Körper und mit ihm natürlich die Kleider ab, und unser würdiger Bürgermeister war nicht leidenschaftlich und ruinierte infolgedessen weder sich noch seine Sachen. Aller dieser Eigenschaften wegen eignete aber auch gerade er sich dazu, Quiquendone und seine ruheliebenden Einwohner zu regieren.
Wirklich war die Stadt fast ebenso still wie das Haus, in welchem der Bürgermeister das weitmöglichste Lebensziel menschlichen Daseins zu erreichen hoffte; musste er doch noch erleben, dass die gute Frau Brigitte van Tricasse, seine Gemahlin, ihm in das Grab voranging, wo sie doch kaum eine tiefere Ruhe finden konnte, als die sie seit sechzig Jahren hier auf Erden genoss.
Vorstehendes verlangt eine Erklärung.
Die Familie van Tricasse hätte sich mit Fug und Recht »Familie Jeannot« nennen können, und das hing so zusammen.
Bekanntlich ist das Messer dieser typischen Persönlichkeit ebenso wenig abzunutzen wie sein Eigentümer, was darin seinen Grund hat, dass einmal der Stiel und dann wieder die Klinge erneuert wird. Eine ähnliche Operation vollzog sich seit undenklicher Zeit, ja, schon seit dem vierzehnten Jahrhundert in der Familie Tricasse, und was noch wunderbarer war, Mutter Natur gab sich mit ungewöhnlicher Gefälligkeit immer wieder dazu her, die Sache zu begünstigen. Wenn ein Tricasse Witwer wurde, heiratete er eine van Tricasse, die jünger war als er; und wenn diese dann verwitwet war, verband sie sich mit einem van Tricasse, welcher abermals jünger war als sie, und der wiederum, wenn seine Frau starb . . . u.s.w. mit Grazie in infinitum; jeder starb mit fast mechanischer Regelmäßigkeit, sowie er an der Reihe war. Die würdige Frau Brigitte hatte nun bereits ihren zweiten Mann und musste, wenn sie ihre Pflicht und Schuldigkeit erfüllen wollte, wie es einer Tricasse zukam, ihrem zehn Jahre jüngeren Gemahl vorangehen, um einer neuen Tricasse Platz zu machen. Darauf hatte der ehrenwerte Bürgermeister von jeher mit absoluter Sicherheit gerechnet, denn wer konnte ihm zumuten, dass er der Erste sein solle, der sich gegen die Familiensatzungen von alters her auflehnte!
So sah es in diesem stillfriedlichen Hause aus, in dem keine Türen knarrten, keine Fensterscheiben klirrten, keine Dielen ächzten, kein Kaminfeuer brummte, keine Wetterfahnen schrillten, keine Möbel knackten, keine Schlösser rasselten, und dessen Gäste nicht mehr Lärm machten als ihr Schatten. Der göttliche Harpokrates hätte das Bürgermeisterhaus in Quiquendone zum Tempel des Schweigens geweiht.
Drittes Kapitel, in dem der Kommissar Passauf einen ebenso unerwarteten als geräuschvollen Einzug hält.
Als die interessante Unterhaltung zwischen Bürgermeister und Rat begann, war es drei Viertel auf drei Uhr nachmittags gewesen. Um drei Uhr fünfundvierzig Minuten hatte Tricasse seine Pfeife, die ein volles Viertelpfund Tabak schluckte, angezündet, und um fünf Uhr fünfunddreißig Minuten hörte er auf zu rauchen.
Während dieser ganzen Zeit wurde zwischen den beiden Ratsherren kein Wort gewechselt.
Gegen sechs Uhr hub Herr Niklausse, der immer mittelst Figur der Prätermission oder Aposiopese vorzugehen pflegte, folgendermaßen an:
»So entschließen wir uns also? . . .«
»Nichts zu beschließen«, fügte der Bürgermeister hinzu.
»Ich glaube in Summa, dass Sie recht daran tun, van Tricasse.«
»Ich glaube das auch, Niklausse. Wir wollen in Bezug auf den Zivilkommissar Beschluss fassen, wenn wir einmal besonders inspiriert sind . . . später . . . Wir haben noch über einen Monat Zeit.«
»Auch wohl noch ein Jahr«, meinte Niklausse, indem er sein Taschentuch entfaltete und sich desselben mit alleräußerster Diskretion bediente.
Wiederum breitete sich, etwa eine Stunde lang, neues Schweigen über die Beratenden, und nichts unterbrach diese neue Pause, nicht einmal das Erscheinen des ehrlichen Lento, des Haushundes, der nicht weniger phlegmatisch wie sein Herr, fein säuberlich und sittig durch den Saal schritt. Ein tugendhafter Hund, ein Muster für alle seines Geschlechts. Wäre er aus Pappe verfertigt und mit Gummiröllchen an den Füßen versehen gewesen, er hätte während seines Besuchs nicht weniger Geräusch verursachen können.
Gegen acht Uhr, als Lotchè die antike Lampe mit geschliffener Kuppel herein gebracht hatte, wandte sich der Bürgermeister von Neuem an den Rat.
»Wir haben heute kein anderes, dringendes Geschäft zu erledigen, Niklausse?«
»Nein, van Tricasse, nicht dass ich wüsste.«
»Hat man mir nicht letzthin gesagt, dass der Turm des Audenarder-Tors einzustürzen droht?« - »Allerdings«, bestätigte der Rat; »es dürfte uns nicht in Erstaunen setzen, wenn er eines schönen Tages den Vorübergehenden auf den Kopf fiele und sie zerschmetterte.« - »O!«, versetzte der Bürgermeister; »Ich hoffe doch, dass wir eine Entscheidung in Betreff des Turmes getroffen haben, bis sich ein solches oder ähnliches Unglück ereignet.«
»Wir wollen es hoffen, van Tricasse.«
»Es sind jetzt noch dringendere Fragen zu lösen.«
»Allerdings«, erwiderte der Rat; »z. B. was die Lederhalle anbetrifft.«
»Brennt sie immer noch?«, fragte der Bürgermeister.
»Ja, bereits seit drei Wochen.«
»Haben wir nicht im Rat beschlossen, sie brennen zu lassen?«
»Ja, van Tricasse, und zwar auf Ihren Vorschlag.«
»War das nicht das sicherste und einfachste Mittel, der Feuersbrunst Herr zu werden?«
»Ohne alle Widerrede.«
»Warten wir das Weitere also ab. Das wäre alles?«
»Ja«, antwortete der Rat und kraute an der Stirn, als wolle er sich vergewissern, dass er keine wichtige Angelegenheit vergessen habe. - »Ah!«, meinte der Bürgermeister, »haben Sie nicht auch von einer Wasserströmung reden hören, die das untere Viertel von Saint-Jacques zu überschwemmen droht?«
»O ja«, erwiderte Rat Niklausse; »es ist nur ärgerlich, dass sie sich nicht oberhalb der Lederhalle hinzieht; sie hätte dann auf natürliche Weise die Flammen gelöscht, und wir würden uns die bedeutenden Umstände und Kosten verschiedener Diskussion haben sparen können.«
»Das ist nun einmal nicht anders, Niklausse«, tröstete der würdige Bürgermeister; »es gibt nichts so Unlogisches als widrige Naturereignisse. Sie stehen in keiner Beziehung zueinander, und man kann nicht das eine benutzen, um den Schaden, den das andere anrichtet, zu verringern, wenn man das auch möchte.«
Es erforderte einige Zeit, bis Rat Niklausse diese seine Beobachtung seines Freundes gehörig verstanden und gewürdigt hatte.
»Nun?«, begann er kurze Zeit darauf, »Wir haben noch nicht unsere wichtigste Tagesfrage abgehandelt!«
»Was für eine wichtige Tagesfrage? Haben wir denn eine wichtige Tagesfrage?«
»Allerdings, Tricasse, es handelt sich um die Beleuchtung der Stadt.«
»Ach richtig, nun fällt's mir ein, Sie meinen das Beleuchtungswerk des Doktor Ox.«
»Gewiss.« - »Nun, die Sache geht ihren Gang, Niklausse«, erklärte der Bürgermeister. »Man macht sich schon an die Röhrenlegung, und die Anstalt ist vollständig fertig.«
»Wir haben uns doch vielleicht bei dieser Geschichte etwas übereilt«, meinte der Rat kopfschüttelnd.
»Vielleicht,« gab der Bürgermeister zu; »aber zu unserer Entschuldigung sei es gesagt, der Doktor Ox bestreitet den ganzen Kostenaufwand seines Versuchs. Die Sache wird uns keinen Heller kosten.«
»Das ist freilich eine sehr triftige Entschuldigung; auch muss man doch mit seiner Zeit fortschreiten, und wenn der Versuch gelingt, ist Quiquendone die erste Stadt in ganz Flandern, die mit diesem Gas erleuchtet wird. Wie nennt er es doch? Oxy . . .«
»Oxyhydrogengas.«
»Also Oxyhydrogengas.«
In diesem Augenblick wurde die Türe geöffnet, und Lotchè verkündete dem Bürgermeister, dass das Abendessen aufgetragen sei. Rat Niklausse stand auf, um sich von Tricasse zu verabschieden, denn er setzte voraus, dass so viele wichtige Entschließungen ihm Appetit gemacht hätten. Man kam überein, dass der Rat der Notabeln zu einem ziemlich entfernten Zeitpunkt versammelt werden sollte, um zu entscheiden, ob in Bezug auf die ziemlich dringliche Turmfrage eine Entscheidung zu treffen sei.
Die beiden würdigen Ratsherren steuerten nun auf die Haustüre zu, indem der eine den anderen geleitete. Als Niklausse an die letzte Treppenstufe gekommen war, zündete er eine kleine Laterne an, die ihm durch die dunkeln Gassen Quiquendone's leuchten sollte, denn noch waren sie ja nicht durch die Beleuchtung des Doktor Ox erhellt. Die Nacht war tiefdunkel, man befand sich im Monat Oktober, und ein leichter Nebel breitete sich über die Stadt.
Die Zurüstungen zum Fortgange des Rats Niklausse nahmen eine gute Viertelstunde Zeit für sich in Anspruch, denn nachdem er die erwähnte Laterne angezündet hatte, musste er seine großen ledernen Galoschen und die Fausthandschuhe aus Schafsfell anziehen. Demnächst klappte er den Pelzkragen seines Überziehers in die Höhe, drückte seinen Filzhut über die Augen, bewaffnete sich mit dem schweren Regenschirm, den eine schnabelförmige Krücke zierte, und war jetzt bereit, das Haus zu verlassen.
In demselben Augenblick aber, als Lotchè, die den beiden Herren geleuchtet hatte, den Riegel an der Haustür zurückschieben wollte, ließ sich von außen ein heftiger Lärm vernehmen. So unglaublich dies scheinen mag, es war Lärm, wirklicher Lärm, wie ihn die Stadt wohl seit der Eroberung des Schlossturms durch die Spanier im Jahre 1513 nicht gehört hatte. Ein furchtbares Geräusch weckte das in tiefen Schlummer versunkene Echo des alten Bürgermeisterhauses. Diese Türe, die seit undenklichen Zeiten durch kein lautes Klopfen entweiht war, erdröhnte unter den brutalen Schlägen eines von kräftiger Hand geführten Knotenstocks, und Geschrei und Rufen ließ sich unmittelbar vor dem Hause hören.
»Herr van Tricasse! Herr Bürgermeister! Öffnen Sie, öffnen Sie schnell!«, tönte es verworren herein.
Bürgermeister und Rat sahen einander konsterniert an, ohne vor Bestürzung ein Wort hervorbringen zu können; das ging über ihre Fassungskraft. Wäre die alte Feldschlange des Schlosses, die seit 1385 nicht mehr in Tätigkeit gewesen war, plötzlich im Saale abgefeuert worden, die Bewohner des Hauses van Tricasse hätten nicht mehr »wie auf den Mund geschlagen« dastehen können als in diesem Augenblick. Möge man die Trivialität dieses Ausdrucks entschuldigen, aber das Bezeichnende des Worts brachte mich über die Skrupel der Wahl hinaus. Inzwischen verdoppelten sich die Schläge, das Schreien und Rufen nahm an Heftigkeit zu. Lotchè, die zuerst ihre Kaltblütigkeit wieder gewann, fasste sich ein Herz und fragte:
»Wer ist da?«
»Ich bin's! Ich! Ich!«
»Wer ist ich?«
»Kommissar Passauf!«
Kommissar Passauf! Über dessen Amt seit vollen zehn Jahren die Frage schwebte, ob es eingehen solle. Was in aller Welt musste passiert sein? Hatten die Burgunder Quiquendone überfallen, wie schon einmal im vierzehnten Jahrhundert? Nur ein Ereignis von dieser Tragweite konnte den Kommissar Passauf, der für gewöhnlich Herrn van Tricasse an Ruhe und Phlegma nichts nachgab, bis zu diesem Grade erschüttern.
Auf ein Zeichen des Bürgermeisters – der würdige Mann hätte in diesem Augenblick kein Wort über seine Lippen bringen können – wurde der Riegel zurückgeschoben, die Türe öffnete sich, und wie ein wilder Orkan fegte Kommissar Passauf in das Vorzimmer.
»Was gibt, Herr Kommissar?«, fragte Lotchè, ein braves Mädchen, das auch in den schwierigsten Zeitläufen den Kopf oben behielt.
»Was es gibt?«, rief Passauf, und seine Augen drückten eine wirkliche, wahrhaftige Aufregung aus, »Nun, ich komme soeben vom Doktor Ox, der heute Gesellschaft hatte, und dort . . .«
»Und dort?«, inquirierte der Rat.
»Dort bin ich Zeuge eines Wortstreits gewesen, eines Wortstreits, der . . . Herr Bürgermeister, man hat von Politik gesprochen!«
»Von Politik!«, wiederholte entsetzt der Bürgermeister, und die Haare seiner Perücke sträubten sich empor.
»Von Politik!«, bestätigte Passauf; »Seit vielleicht hundert Jahren ist das in Quiquendone nicht vorgekommen! Die Diskussion ist schärfer und schärfer geworden, und zuletzt sind der Advokat André Schut und Doktor Dominique Custos so heftig aneinander geraten, dass ein Duell wohl unvermeidlich sein wird.«
»Ein Duell!«, rief der Rat; »Ein Duell in Quiquendone! Beleuchten Sie die Sache näher, was für Reden haben Advokat Schut und Doktor Custos gegeneinander geführt?«
»Ich will es wörtlich wiederholen: ›Herr Advokat‹, sagte der Arzt, ›Sie gehen, wie mir scheint, etwas zu weit und denken nicht genug daran, Ihre Worte abzuwägen!‹«
Der Bürgermeister van Tricasse faltete entsetzt die Hände; der Rat war erblasst und hatte vor Schreck seine Laterne fallen lassen. Der Kommissar schüttelte das Haupt. Eine so offenbar herausfordernde Redensart zwischen zwei Notabeln des Landes!
»Ich habe es lange gewusst,« sagte der Bürgermeister in gedämpftem Ton, »dieser Arzt ist ein gefährlicher Mensch, ein ganz entschiedener Hitzkopf. Treten Sie näher, meine Herren!«
Und Rat Niklausse, der Kommissar und
Herr van Tricasse begaben sich in den Saal zurück.
Viertes Kapitel, in dem sich Doktor Ox als Physiolog ersten Ranges und als kühner Experimentator erweist.
Wer war der Doktor Ox, diese Persönlichkeit, die unter so sonderbarem Namen schon mehrmals in unserer Erzählung erwähnt wurde? Jedenfalls ein Original; zugleich aber ein genialer Gelehrter, ein Physiolog, dessen Arbeiten in der ganzen Gelehrtenwelt Europas hoch angesehen waren; der glückliche
Nebenbuhler eines Davy, Dalton, Bostock, Menzies, Godwin, Vierordt und all der geistvollen Männer, welche die Physiologie in der neuern Zeit zu einer Wissenschaft ersten Ranges erhoben hatten.
Doktor Ox war von mittlerer Größe, mittlerer Stärke, im Alter von . . . aber nein, wir können seine Jahre ebenso wenig wie seine Nationalität genau bestimmen. Auch tut das nichts zur Sache; es ist genug, wenn wir wissen, dass Doktor Ox ein eigentümlich heißblütiger, exzentrischer Mensch war, den man in Verdacht haben konnte, dass er einem Bande Hoffmann's entsprungen sei. Dass dieser Mann mit den Bewohnern von Quiquendone einen eigentümlichen Kontrast bildete, bedarf nach dieser Beschreibung keines besonderen Wortes.
Auf sich und seine Lehren setzte Doktor Ox ein unerschütterliches Vertrauen, und wenn er mit erhobenem Haupt und lächelndem Blick, den hübschen, schlanken Schultern und weitgeöffneten Nüstern einherging und in mächtigen Zügen mit seinem großen Mund die Luft einsog, machte er einen gefälligen Eindruck. Er war lebhaft, sehr lebhaft sogar, durchaus proportioniert, munter und hatte Quecksilber in den Adern und hundert Nadeln in den Füßen. Es war ihm unmöglich, längere Zeit ruhig an einer Stelle zu bleiben, und leidenschaftliche Gebärden wie übereilte Worte entfuhren ihm in Menge. War dieser Doktor Ox denn reich, dass er auf eigene Kosten die Beleuchtung der ganzen Stadt bestreiten wollte?
Doch wohl, da er sich solche Ausgaben gestatten konnte. Aber dies ist auch die einzige Antwort, die wir auf solche indiskrete Frage geben können.
Doktor Ox hatte sich seit fünf Monaten in Quiquendone niedergelassen, und zwar in Gesellschaft seines Famulus Gédéon Ygen, der nicht weniger lebhaft als sein Herr, aber ein großer, schmaler, hagerer Mann war.
Weshalb nun hatte dieser Doktor Ox, und noch dazu auf seine eigene Kosten, die Beleuchtung der Stadt in Submission genommen, und warum gerade die Quiquendonianer, diese Flamänder aller Flamänder, auserwählt, um sie mit den Wohltaten seiner alles übertreffenden Beleuchtung zu beglücken? Wollte er unter diesem Vorwande ein großes physiologisches Experiment erproben und so in anima vili arbeiten? Auf all diese Fragen müssen wir die Erwiderung schuldig bleiben, denn Doktor Ox hatte keinen anderen Vertrauten als seinen Famulus Ygen, und dieser gehorchte ihm blindlings.
Allem Anschein nach war aber Doktor Ox die Verpflichtung eingegangen, der Stadt eine Beleuchtung zu verschaffen, und diese war einer solchen bedürftig; »besonders in der Nacht«, bemerkte fein der Kommissar Passauf. So war eine Anstalt für die Erzeugung des Leuchtgases hergestellt worden, die Gasometer standen bereit zum Arbeiten, und die Leitungsröhren, die unter dem Straßenpflaster zirkulierten, sollten binnen kurzem in Gestalt von Brennern in öffentliche Gebäude und sogar einige Privathäuser von Freunden des Fortschritts auslaufen.
Van Tricasse in seiner Eigenschaft als Bürgermeister, und Niklausse als Rat, wie auch einige andere Notabeln der Stadt, hatten geglaubt, die Einführung dieser modernen Beleuchtung in ihren Wohnungen autorisieren zu müssen.
Wenn der Leser es während der langen Unterhaltung von Bürgermeister und Rat nicht vergessen hat, wird er sich der Bemerkung erinnern, dass die Stadt nicht durch die Verbrennung des gewöhnlichen Kohlenwasserstoffs beleuchtet werden sollte, den die Destillation der Steinkohle liefert, sondern durch Anwendung eines neueren, zwanzig Mal intensiveren Gases, des Oxyhydrogengases, das durch Mischung von Hydrogen und Oxygen hervorgebracht wird. Nun wusste aber der Doktor als geschickter Chemiker und geistreicher Physiker dies Gas in großer Masse und zu sehr wohlfeilem Preis zu erzeugen; nicht etwa durch Anwendung des mangansauren Natrons nach dem Verfahren des Herrn Tessié du Motay, sondern einfach durch Zerlegung des leicht gesäuerten Wassers vermittelst einer aus neuen Elementen zusammengesetzten und von ihm erfundenen Säule. Also keine kostspieligen Substanzen; kein Platina, keine Retorten, kein Brennstoff, kein empfindlicher Apparat, um die beiden Gase isoliert zu erzeugen. Ein elektrischer Strom durchfuhr ungeheure, mit Wasser angefüllte Kübel, und das flüssige Element wurde in seine beiden wesentlichen Teile, Sauerstoff und Wasserstoff, zerlegt. Der Sauerstoff ging auf die eine, der Wasserstoff, in doppeltem Volumen wie sein ehemaliger Begleiter, auf die andere Seite. Beide wurden in getrennten Behältern gesammelt – eine sehr wesentliche Vorsichtsmaßregel, denn ihre Mischung hätte eine furchtbare Explosion hervorgerufen, so wie sie entzündet worden wäre. Dann sollten sie in gesonderten Röhren zu den verschiedenen Brennern geleitet werden, und diese waren in einer Weise konstruiert, die jede Explosion verhinderte. So musste ein ganz außerordentlich glänzendes Licht entstehen, eine Flamme, die mit dem elektrischen Licht rivalisiert, das (wie wohl allgemein bekannt) nach den Versuchen Casselmanns dem Licht von genau 1171 Kerzen gleichkommt.
Durch diese freigebige Kombination sollte die Stadt Quiquendone eine wahrhaft großartige Beleuchtung bekommen; darüber aber machten sich, wie wir alsbald sehen werden, Doktor Ox und sein Famulus die allergeringste Sorge.
Am folgenden Morgen, nachdem der Kommissar Passauf in so ungeheuerlicher Weise im Bürgermeisterhaus erschienen war, plauderten Gédéon Ygen und Doktor Ox miteinander in dem Arbeitszimmer, das beide parterre im Hauptgebäude der Anstalt innehatten.
»Nun, Ygen!«, rief Doktor Ox und rieb sich vergnügt die Hände; »Sie haben gestern bei unserm Empfangsabend die guten Quiquendonianer kennengelernt, diese kaltblütigen Leute, die an Lebhaftigkeit zwischen Schwämmen und Korallengewächsen die Mitte halten. Sie haben gesehen, wie sie sich mit Wort und Gebärde herausforderten und schon anfangen, sich moralisch und physisch zu metamorphosieren. Und doch war das nur eben ein Anfang! Geben Sie Acht, was aus der Gesellschaft wird, wenn wir anfangen, sie mit starken Dosen zu behandeln.«
»Allerdings, mein Herr und Meister«, erwiderte Gédéon Ygen und rieb seine spitze Nase mit dem Zeigefinger; »der Versuch fängt gut an. Wenn ich nicht selbst vorsichtig den Hahn zugedreht hätte, weiß ich nicht, was passiert wäre.«
»Sie haben gehört, wie dieser Advokat Schut und der Doktor Custos mit Redensarten aufeinander losgingen«, hub Doktor Ox wieder an, »und wenn ihre Worte auch an und für sich nicht so schlimm waren, wie die Helden Homers sie einander an die Köpfe zu werfen pflegten, ehe sie das Schwert aus der Scheide zogen, für Quiquendonianer waren sie doch schon recht nett. Ach, diese Flamänder! Nun, Sie werden sehen, Ygen, was wir noch an ihnen erleben werden.«
»Undankbarkeit werden wir an ihnen erleben«, sagte Gédéon Ygen im Ton eines Menschen, der das Geschlecht der Erdenbürger nach seinem richtigen Wert zu schätzen weiß. - »Bah!«, rief der Doktor. »Ob sie uns Dank wissen oder nicht, wenn nur unser Versuch gelingt.«
»Ist übrigens nicht für die Lungen der guten Leute in Quiquendone zu fürchten, wenn wir in ihren Respirationsapparaten solche Aufregung hervorrufen?«
»Schlimm für sie«, meinte Doktor Ox; »es geschieht eben im Interesse der Wissenschaft. Was würden Sie, Ygen, dazu sagen, wenn es Hunden oder Fröschen auf einmal einfallen wollte, sich unseren Vivisektionsversuchen zu widersetzen?«
Wenn man Frösche und Hunde um ihre Meinung in dieser Angelegenheit fragen wollte, würden sie aller Wahrscheinlichkeit nach gegen die Künste der Vivisektoren Einsprache erheben; aber Doktor Ox glaubte ein unwiderlegliches Argument ausgesprochen zu haben, denn er ließ einen gewaltigen Seufzer der Befriedigung hören.
»Sie haben eigentlich recht, Meister«, erwiderte Gédéon Ygen überzeugt. »Wir hätten nichts Besseres zu unserem Experiment finden können, als dies Quiquendone.«
»Absolut nicht«, bestätigte der Doktor mit nachdrücklicher Betonung.
»Haben Sie den Kreaturen ihren Puls gefühlt?«
»Wohl hundert Mal.« - »Und die Durchschnittszahl der beobachteten Pulsschläge?«
»Nicht fünfzig in der Minute. Verstehen Sie mich recht, Ygen, eine Stadt, in der seit einem Jahrhundert nicht der Schatten einer Diskussion vorgekommen ist, in der die Fuhrleute nicht fluchen, die Kutscher sich nicht schimpfen, die Pferde nicht durchgehen, die Hunde nicht beißen, und die Katzen nicht kratzen! Eine Stadt, in der das einfache Polizeigericht von einem Ende des Jahres bis zum anderen feiert! Eine Stadt, in der man sich weder für Industrie noch Kunst interessiert! Eine Stadt, in der die Gendarmen in die Zeit der grauen Mythe gehören, und in der seit einem Jahrhundert kein Protokoll aufgenommen ist! Eine Stadt endlich, in der seit dreihundert Jahren kein Faustschlag und keine Ohrfeige ausgeteilt wurde! Sie werden sich selber sagen können, Meister Ygen, dass dieser Zustand nicht länger fortdauern kann, und wir das Alles umgestalten müssen.«
»Vorzüglich! Ganz vorzüglich!«, rief der Famulus begeistert. »Haben Sie auch schon die Luft hier in der Stadt analysiert, Meister?« - »Ist bereits geschehen«, versetzte Doktor Ox; »neun-undsiebenzig Teile Stickstoff und einundzwanzig Teile Sauerstoff, Kohlensäure und Wasserdampf in veränderlicher Menge. Das sind die gewöhnlichen Verhältnisse.« - »Gut, Doktor, gut; der Versuch wird im Großen angestellt werden und jedenfalls entscheidend sein«, meinte schließlich Ygen. - »Und wenn er entscheidend ist«, rief Doktor Ox triumphierend, »werden wir die Welt reformieren.«
Fünftes Kapitel, in welchem Bürgermeister und Rat dem Doktor Ox einen Besuch abstatten, und was sich darauf zuträgt.
Rat Niklausse und der Bürgermeister van Tricasse erfuhren endlich einmal, was eine aufgeregte Nacht bedeutet; der bedenkliche Vorgang im Hause des Doktor Ox verursachte Beiden wirkliche Schlaflosigkeit. Was würde diese Angelegenheit für Folgen haben? Man konnte bis jetzt noch nichts Bestimmtes darüber ins Auge fassen. Wäre vielleicht eine Entscheidung zu treffen? Würden sie, als Vertretung der Municipalgewalt, genötigt sein, sich ins Mittel zu schlagen? Sollten Edikte erlassen werden, damit ein derartiges Ereignis nicht wieder vorkäme?
All diese Zweifel beunruhigten die weichen Naturen der beiden Räte nur noch mehr. Übrigens hatten sie an dem denkwürdigen Abend, bevor sie sich trennten, noch »entschieden«, dass sie sich am anderen Morgen wieder zusammenfinden wollten.
Am folgenden Morgen begab sich also der Bürgermeister schon vor dem Mittagessen in Person zu dem Rat Niklausse. Er hatte die Genugtuung, seinen Freund ruhiger zu finden, und auch er selbst gewann nach und nach seine Fassung wieder.
»Nichts Neues?«, fragte Tricasse. - »Seit gestern nichts Neues.« - »Und der Arzt Dominique Custos?«
»Ich habe ebenso wenig von ihm wie von dem Advokaten André Schut etwas gehört.«
Nach einer Unterhaltung, die etwa eine Stunde währte, sich aber ohne Mühe in drei Zeilen zusammenfassen ließe, wurde von Bürgermeister und Rat beschlossen, dass sie dem Doktor Ox einen Besuch abstatten und ihn hierbei auf delikate Weise über die Vorgänge am verflossenen Abend ausholen wollten; natürlich ohne ihre Absicht merken zu lassen.
Als die beiden Herren, ganz ihrer sonstigen Gewohnheit zuwider, diese Entscheidung getroffen hatten, schritten sie sofort zur Ausführung des Plans. Sie verließen das Haus und steuerten auf die Anstalt des Doktor Ox zu, die vor dem Audenarder Tor gelegen war.
Bürgermeister und Rat gaben sich zwar nicht den Arm, gingen aber passibus aequis in langsamem, feierlichem Schritt einher, so dass sie nur etwa dreizehn Zoll in der Sekunde vorwärts kamen. Es war dies, nebenbei bemerkt, der gewöhnliche Amtsschritt ihrer Verwaltungsuntergebenen, die seit Menschengedenken nicht in eiligem Tempo durch die Straßen von Quiquendone gegangen waren. Von Zeit zu Zeit, wenn die beiden Notabeln an einem Kreuzweg der ruhigen, stillen Straßen ankamen, blieben sie stehen, um die Leute zu begrüßen.
»Guten Morgen, Herr Bürgermeister«, sagte hier jemand.
»Guten Morgen, lieber Freund«, erwiderte leutselig Tricasse.
»Nichts Neues, Herr Rat?«, fragte ein anderer.
»Durchaus gar nichts«, versetzte Niklausse.
Aber trotzdem sah man an einem gewissen fragenden Blick der Vorübergehenden, dass der skandalöse Auftritt vom vergangenen Abend bereits stadtbekannt geworden war, und auch der Stumpfsinnigste aller Quiquendonianer hätte durch die von den Herren eingeschlagene Richtung sofort erraten, dass ihr Gang mit dem betreffenden Ereignis zusammenhing. Es hatten sich übrigens, trotzdem die Sache allgemein besprochen wurde, noch keine Parteien gebildet, denn sowohl Arzt wie Advokat waren in Quiquendone sehr geachtete Persönlichkeiten. Und wie sollten sie auch nicht? Hatte doch der Advokat Schut in dieser Stadt, wo Anwälte und Gerichtsdiener nur pro forma existierten, nie Gelegenheit gehabt, einen Prozess zu führen und demzufolge nie einen verloren; und was den Arzt Custos anlangte, so war er ein sehr ehrenwerter Praktikus, der die Patienten von allen Krankheiten heilte – natürlich ausgenommen von derjenigen, an der sie starben. Es ist das eine leidige Gewohnheit, die von den Mitgliedern aller Fakultäten, in welchem Lande sie ihre Kunst auch betreiben mögen, angenommen worden ist.
Als Herr van Tricasse und Rat Niklausse am Audenarder Tor ankamen, hielten sie es für angemessen, einen kleinen Bogen um den baufälligen Turm zu machen. Man war doch nicht darüber sicher, was passieren konnte.
»Ich glaube wirklich, dass er einstürzen wird«, bemerkte Tricasse.
»Ich glaube es auch«, gestand Niklausse.
»Wenn man ihn nämlich nicht stützt«, fügte Tricasse hinzu, »aber ob man ihn stützen soll, das ist eben die Frage.«
»Und diese Frage müssen wir erörtern«, schloss der Rat.
Einige Augenblicke später langten die beiden Herren an der Türe der Anstalt an.
»Ist Doktor Ox zu sprechen?«, fragten sie.
Natürlich war Doktor Ox für die ersten Behörden der Stadt immer zu sprechen, sie wurden gebeten, näher zu treten, und befanden sich bald in dem Zimmer des berühmten Physiologen.
Die beiden Notabeln hatten hier eine gute Zeit – es mochte eine Stunde sein – zu warten; zum ersten Mal in seinem Leben gab der Bürgermeister Zeichen von Ungeduld, und auch sein Begleiter fühlte sich nicht ganz frei von solchen Anwandlungen.
Endlich trat Doktor Ox ein und entschuldigte sich, dass er die Herren so lange habe warten lassen; es sei ihm soeben der Plan zu einem Gasometer vorgelegt worden, an dem eine Verzweigung zu rektifizieren gewesen wäre u.s.w. Übrigens ginge alles rüstig vorwärts, die für das Oxygen bestimmten Leitungen seien bereits gelegt, und binnen wenigen Monaten würde die Stadt mit brillanter Beleuchtung ausgestattet sein. Die beiden Notabeln hatten schon mit Genugtuung die Röhrenmündungen bemerkt, die in das Arbeitszimmer des Doktors ausliefen.
Sodann erkundigte sich der Doktor nach dem Motiv, das ihm die Ehre verschaffe, den Herrn Bürgermeister und Rat Niklausse bei sich zu sehen.
»Nun, wir wollten einmal bei Ihnen vorsprechen, um Sie zu sehen, Herr Doktor«, begann Tricasse; »es ist geraume Zeit her, dass wir das Vergnügen hatten. In unserer guten Stadt Quiquendone kommen wir wenig aus dem Haus, und unsere Schritte sind genau abgemessen. Wir finden es eben am besten, wenn das Gleichgewicht durch nichts gestört wird.«
Niklausse sah seinen Freund erstaunt an; niemals, so lange er ihn kannte, hatte der Bürgermeister so lange hintereinander gesprochen, so viel gesagt, ohne seine Sätze durch breite Pausen zu trennen. Es schien beinahe, als drückte sich Tricasse mit einer gewissen Zungengeläufigkeit aus, die bei ihm vollständig abnorm war. Niklausse selber verspürte, ob von solchem Beispiel angestachelt oder durch irgendeinen andern Beweggrund veranlasst, eine unwiderstehliche Lust, sich ins Gespräch zu mischen.
Doktor Ox schaute den Bürgermeister mit einem eigentümlich boshaften Zug um den Mund aufmerksam an. Tricasse, der sonst immer erst auf eine Diskussion einging, wenn er sich bequem in einem Lehnsessel eingeschachtelt hatte, führte heute seine Unterredung stehend. Eine sonderbare, nervöse Überreiztheit, die bis jetzt seiner Gemütsstimmung ganz fern gelegen hatte, erfasste ihn von Minute zu Minute mehr. Noch gestikulierte er zwar nicht, aber auch das konnte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Was Rat Niklausse anlangt, so rieb er sich mit steigender Vehemenz die Schenkel und holte tief und schwer Atem, wie jemand, der nur auf die Gelegenheit wartet, dem Freunde und Vertrauten beizuspringen. Van Tricasse war, wie bereits erwähnt, aufgestanden, hatte einige Schritte getan und sich schließlich dem Doktor gerade gegenüber gestellt.
»Und in wieviel Monaten gedenken Sie mit Ihren Arbeiten fertig zu werden, Herr Doktor?«, fragte er jetzt mit leichter Betonung.
»In einem Vierteljahr oder etwas darüber«, antwortete Doktor Ox.
»Also in drei bis vier Monaten«, meinte der Bürgermeister; »das ist noch lange hin, Herr Doktor.«
»Ja, gewiss, viel zu lange!«, fügte Niklausse hinzu, der sich nicht länger auf seinem Platz halten konnte und gleichfalls aufgesprungen war.
»Wir brauchen diese Zeit notwendig für unsere Zurüstungen«, entgegnete der Doktor; »die Arbeiter – wir haben sie hier aus der Bevölkerung von Quiquendone wählen müssen – sind eben nicht sehr rasch und gewandt.«
»Wie, die hiesigen Arbeiter wären Ihnen nicht rasch und gewandt genug?«, rief der Bürgermeister, der diese Äußerung als eine persönliche Beleidigung aufzufassen schien.
»Nein, Herr Bürgermeister, das kann man wohl nicht behaupten«, erwiderte der Doktor nicht ohne Absicht. »Ein französischer Arbeiter würde an einem Tag mehr leisten, als zehn von Ihren Leuten in derselben Zeit. Sie wissen, es sind echte Flamänder!«
»Wie, Flamänder!«, rief Rat Niklausse, und seine Fäuste ballten sich; »Was für eine Bedeutung verbinden Sie mit diesem Wort, wenn man fragen darf, Herr?«
»Nun, die – liebenswürdige Bedeutung, die ihm von jedermann beigelegt wird«, begütigte lächelnd der Doktor.
»Aber, Herr Doktor«, begann von Neuem der Bürgermeister, indem er das Zimmer von einem Ende bis zum andern durchmaß, »ich muss mir die Bemerkung erlauben, dass ich dergleichen Insinuationen durchaus nicht liebe. Die Handwerker Quiquendones können es mit den Arbeitern jeder anderen Stadt aufnehmen, und wir gedenken, weder in Paris noch London in dieser Beziehung unsere Vorbilder zu suchen. Was Ihre Zurüstungen betrifft, so muss ich dringend bitten, sie so sehr wie irgend möglich zu beschleunigen. Das Straßenpflaster ist, wie Sie wissen, zur Legung der Röhren aufgerissen, und das ist ein sehr unangenehmes Hindernis für den Verkehr. Der Handel könnte sich schließlich beklagen, und ich, als erster Verwaltungsbeamter der Stadt, möchte mir nicht so gerechtfertigte Vorwürfe zuziehen.«
Der wackere Mann! Er hatte von Handel und Verkehr gesprochen, und die so ungewohnten Worte waren ihm nicht in der Kehle stecken geblieben? Aber was in aller Welt war denn plötzlich mit ihm vorgegangen?
»Übrigens kann die Stadt nicht länger die Beleuchtung entbehren«, fügte Rat Niklausse hinzu.
»Eine Stadt, die seit acht- bis neunhundert Jahren ohne dieselbe fertig geworden ist . . .«, meinte der Doktor in zweifelndem Ton.
»Nur noch ein Grund mehr für unsere Behauptung«, nahm der Bürgermeister wieder das Wort, indem er jede Silbe nachdrücklich betonte; »andere Zeiten, andere Sitten! Der Fortschritt macht sich überall geltend, und wir gedenken nicht hinter unserer Zeit zurückzubleiben. Wir erwarten bestimmt, dass unsere Stadt in einem Monat Beleuchtung hat, oder Sie werden für jeden Tag der Verzögerung eine bedeutende Geldbuße erlegen. Was für unberechenbare Folgen könnte es z. B. haben, wenn sich in den finsteren Gassen ein Streit entspänne!«
»Gewiss!«, rief Niklausse, »und es bedarf nur eines Funkens, um den Flamänder in Feuer zu bringen. Flamander, flamm an!« - »Apropos«, fiel ihm der Bürgermeister ins Wort, »der Kommissar Passauf, das Oberhaupt der städtischen Polizei, hat uns von einem Streit Mitteilung gemacht, der gestern Abend in Ihren Salons, Herr Doktor, stattgefunden haben soll. Wenn mir recht berichtet ist, so hat es sich um eine politische Diskussion gehandelt?«
»Das kann ich allerdings nicht in Abrede stellen, Herr Bürgermeister«, erwiderte Doktor Ox, der nur mit Mühe ein Lächeln der Befriedigung unterdrücken konnte.
»So beruht also diese unangenehme Differenz zwischen dem Arzt Dominique Custos und dem Advokaten André Schut wirklich auf Wahrheit?«
»Ja, Herr Rat, aber die Ausdrücke, deren sich die Herren bedienten, hatten durchaus nichts Bedenkliches.«
»Wie, nichts Bedenkliches?«, rief der Bürgermeister; »Sie halten es nicht für bedenklich, wenn ein Mann dem anderen ins Gesicht sagt, er messe die Tragweite seiner Worte nicht ab? Aus was für einem Teig sind Sie denn gebacken, Herr, wenn Sie nicht wissen, dass es in Quiquendone keines weiteren Anlasses bedarf, um die bedauerlichsten Folgen herbeizuführen? Ich kann Sie versichern, Herr, wenn Sie oder sonst jemand sich erlaubte, so mit mir zu sprechen . . .« - »Oder mit mir . . .«, fügte Rat Niklausse hinzu. Als die beiden Notabeln ihrem Groll in diesen Worten Luft gemacht hatten, sahen sie dem Doktor Ox mit so drohender Miene und emporsträubendem Haar ins Gesicht, als seien sie bereit, bei dem geringsten Widerspruch in Wort, Gebärde oder Blick, ihm übel mitzuspielen.
Aber der Doktor verzog keine Miene.
»Jedenfalls gedenke ich Sie für das, was in Ihrem Haus vorgeht, verantwortlich zu machen«, nahm der Bürgermeister wieder das Wort. »Ich bürge für die Ruhe der Stadt Quiquendone und werde die ernstesten Maßregeln ergreifen, damit dieselbe nicht wieder gestört wird. Dinge, wie sie gestern Abend in diesem Haus geschehen sind, werden in Zukunft nicht wieder vorkommen, ohne dass von meiner Seite strenges Einschreiten erfolgt. Haben Sie mich verstanden? Aber so antworten Sie doch, Herr!«
Als der Bürgermeister so sprach, schwoll seine Stimme in zornigem Tonfall so an, dass man ihn vor dem Haus hätte vernehmen können. Als er sah, dass Doktor Ox nicht das Geringste auf seine Herausforderung erwiderte, geriet er vollends außer sich:
»Kommen Sie, Niklausse«, rief er wütend, warf die Tür mit einer Heftigkeit ins Schloss, dass das ganze Haus erdröhnte, und zog den Rat mit sich fort.
Als die Herren einige zwanzig Schritt auf freiem Feld gemacht hatten, beruhigten sich allmählig ihre Nerven, ihr Schritt mäßigte sich mehr und mehr, und die dunkle Zornesröte auf ihren Wangen verwandelte sich wieder in das frühere matte Rosa.
Eine Viertelstunde, nachdem sie die Anstalt verlassen hatten, wandte sich Tricasse zu seinem Rat und sagte mit sanfter, quiquendonianischer Stimme:
»Wirklich ein liebenswürdiger Mensch, dieser Doktor Ox; ich muss gestehen, dass ich ihn immer mit dem größten Vergnügen besuche.«





























