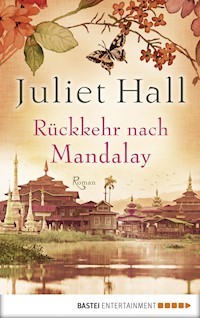5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die schönsten Sehnsuchtsromane von Juliet Hall
- Sprache: Deutsch
Plötzlich ist Rupert wie vom Erdboden verschluckt. Marianne ist verstört. Gerade noch zeichnete ihr Mann den Trevi-Brunnen, und nun bleibt er unauffindbar. Ist ihm etwas zugestoßen? Oder hat er seine schwangere Frau verlassen?
Auch sieben Jahre später kennt Marianne die Antwort nicht. Aber sie will sich von den Erinnerungen an Rupert befreien, denn ihr Herz gehört längst einem anderen. Deshalb reist die junge Engländerin noch einmal von Dorset nach Rom. Bald stößt sie auf eine heiße Spur. Diese Spur führt in die grünen Hügel von Umbrien, in ein abgelegenes Dorf - mitten hinein in einen Kunstskandal und die Abgründe des Herzens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 604
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhalt
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der englischen Originalausgabe: »The Disappearance«
Für die Originalausgabe: Copyright © 2007 by Juliet Hall
Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2009 by Bastei Lübbe AG, Köln Lektorat: Regina Maria Hartig E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-8387-1412-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Ana,die hübscheste Tochterund witzigste Person,die ich kenne
Prolog
Irgendetwas stimmte nicht. Marianne strich sich eine Haarsträhne hinters Ohr und ließ den Fotoapparat sinken. Sie war zu dicht dran. Sie wollte die gesamte Szenerie einfangen.
Rupert nahm nichts in seiner Umgebung wahr. Marianne beobachtete ihn. Er wirkte in sich gekehrt, konzentriert, bemerkte weder den Blick seiner Frau noch die Menschentrauben um ihn herum, noch den makellos blauen Frühlingshimmel. Selbst das ohrenbetäubende Rauschen der Kaskaden der Fontana di Trevi beeinträchtigte ihn nicht in seiner Konzentration. Er skizzierte den Brunnen. Geradezu fieberhaft führte er den Kohlestift über das Papier, ohne das Publikum zu bemerken, das ihm interessiert über die Schulter schaute. Ebenso wenig spürte er, dass sich sein Rücken zunehmend verspannte. Marianne würde ihn später in dem rot-weiß gehaltenen Hotelzimmer im dritten Stock des Bella Roma – gleich um die Ecke – so lange massieren, bis sich die Verspannung gelöst hatte. Wie immer galt seine ganze Aufmerksamkeit seinem Motiv, während Marianne sich allein ihm zugewandt hatte.
Das heißt, nicht ganz … Ihr Blick war auf einen Touristen um die vierzig gefallen, der seine Kamera auf sie gerichtet hatte und nicht in diese Umgebung zu passen schien. Es war, als beobachte er sie, was aber eher unwahrscheinlich war. Dennoch … Marianne runzelte die Stirn.
Sie waren tatsächlich in Rom, auf der Piazza Trevi, über der sich ein klarer Himmel spannte. Rings um den Platz fügten sich steinalte Gemäuer und Ruinen aneinander, und der plätschernde Brunnen ragte vor den Augen zahlloser begeisterter Menschen auf. Doch der elegante, selbstsicher wirkende Mann, dessen kleine silberfarbene Kamera zeitweilig sein Gesicht verdeckte, wirkte vertraut. Woran mochte das liegen? Er beobachtete Marianne; Marianne beobachtete Rupert; Rupert hingegen sah nur den Brunnen. Diese tiefe Versunkenheit war etwas, was sie so sehr an ihm liebte. Rupert vermittelte ihr manchmal das Gefühl, als existiere nur sie – in einem Raum, an einem Ort, auf der ganzen Welt –, aber eben nur manchmal.
Mariannes Hand mit dem Fotoapparat zitterte leicht, und ihr schmaler goldener Ehering funkelte in der Sonne. Der Mann wandte sich ab, warf gleichmütig eine Münze in den Brunnen und zog etwas aus der Jackentasche. Einen Stadtplan? Wohl kaum. Sie konnte nicht genau sagen, was ihr an dem Mann so merkwürdig vorkam.
Erneut blickte sie durch den Sucher und nahm Rupert ins Visier, ihren Ehemann, den Künstler. Aber was davon stand an erster Stelle? Marianne entschied sich für eine andere Perspektive. Erbarmungslos und geradezu verschwenderisch ergoss sich das Sonnenlicht über den Brunnen, wurde von dem Gestein reflektiert, bahnte sich den Weg durch die Wassertropfen und tauchte den Stein in Silber. Doch trotz seiner Erhabenheit wirkte der Trevi-Brunnen unecht, ja beinahe unwirklich. Eine kalte, spröde Herrlichkeit. Hoffentlich gelingt es Rupert, diese Atmosphäre einzufangen, dachte sie.
Wie sehr wünschte sie ihm Erfolg! Er hatte ihn verdient. Seine Werke sollten nicht länger in dieser armseligen Galerie in Bridport oder auf dem Dachboden der Kunsthandlung Hammersmith ausgestellt werden, die auch schon bessere Tage gesehen hatte. Rupert verdiente mehr Beachtung.
Nun unterbrach er seine Arbeit, um sich das Haar aus der Stirn zu streichen. Marianne betätigte den Auslöser. Sie liebte diese Geste.
Eigentlich war sie hier, um ihn zu einer Pause zu überreden. Er könnte sich mit ihr beispielsweise das Kolosseum ansehen. Schließlich musste man in Rom einmal an dem Ort gestanden haben, wo einst die Gladiatoren gekämpft hatten. Aber da Rupert so tief in seine Arbeit versunken war, wollte sie ihn lieber nicht ablenken. Sie beschloss, die Umgebung allein zu erkunden, zum nahe gelegenen Pantheon zu schlendern, sich einen Kaffee zu gönnen und den Anblick der Menschen und der Umgebung in sich aufzunehmen. Rom war ein internationales Pflaster. In den Straßen und Bussen drängten sich Amerikaner, Japaner, Deutsche und Besucher aus anderen Ländern. Die geschichtsträchtige Stadt mit den kopfsteingepflasterten Gassen, den eleganten Plätzen, Marmorpalästen, Standbildern und nicht zu vergessen den imposanten Brunnen zog die Touristen an.
Ich geh einen Kaffee trinken. Bis später. Sie kritzelte diese Worte auf einen Handzettel, der für eine Ausstellung in einer Galerie warb und den man ihr zugesteckt hatte. Sie hatten nicht die Absicht hinzugehen. Wenn Rupert gerade an einem Projekt arbeitete, mied er Ausstellungen anderer Künstler. Er erklärte stets, das würde seinen Stil verderben.
Marianne runzelte die Stirn. Das ungute Gefühl, das sie vorhin davon abgehalten hatte, ihn zu fotografieren, schlich sich erneut in ihr Bewusstsein, um sich beinahe im selben Augenblick wieder zu verflüchtigen. Plötzlich sah sie Großmutter Iris vor sich, wie sie die steifen Seiten ihrer alten Fotoalben umblätterte und auf den Bildern mit unscharfen Gesichtern jemanden zu erkennen versuchte. »Margate!«, rief sie aus und klatschte in die Hände. »Oder war es Bognor?« Die Falten auf ihrer Stirn vertieften sich. Bevor er fortgegangen war? Oder danach? Wie schwer diese Welt doch zu fassen war! Die Welt, in der Erinnerungen schwanden und der scheinbar feste Boden unter den Füßen ohne jede Vorwarnung ins Wanken geraten konnte. Erst allmählich hatte Marianne das begriffen.
Na ja, was immer sie irritiert hatte, es würde ihr schon noch einfallen. Erneut schob sie den Riemen des Fotoapparats über die Schulter und verschränkte die Hände auf dem Bauch. Schwangerschaft. Das Wort hatte sie aus dem Gleichgewicht gebracht, nachdem sie sich zunächst so gefreut hatte. Sie war wachsamer geworden, als sei sie die Hüterin einer fremden Welt, in der nur Mutter und Kind existierten, eingesponnen in einen Kokon, in ihr kleines Nest. Marianne ging auf Rupert zu. Bei jedem Schritt ihrer nackten Beine, die endlich die italienische Sonne genießen durften, raschelte ihr Umstandskleid. Ein wundervolles Gefühl. Die Wärme des Frühlings erfasste ihren Körper, als nähre sie nicht nur das Baby, sondern auch sie selbst. Sie sah auf die Uhr. Halb zwölf. Erst vor einer Stunde hatte sie gemütlich gefrühstückt, und schon bereiteten sich Bars und Restaurants auf die Mittagsgäste vor. Der Duft von warmem Brot, süßem Gebäck, reifen Tomaten und gerösteten Paprika durchzog die Straßen und lockte die Gäste in die Gaststuben oder an die Tische im Freien.
Sie näherte sich Rupert, der neben den Steinstufen hockte, blieb aber schon nach einigen Schritten stehen, wohl wissend, dass er nicht mit ihr rechnete. Er nahm sie niemals wahr, im Gegensatz zu ihr, die eine zarte Gänsehaut spürte, sobald er in der Nähe war.
Er skizzierte immer noch den Neptun und die Pferde. Marianne zögerte nicht lange, sondern schob ihre Notiz unter die Wasserflasche auf der Bank neben ihm, wo sowohl seine Tasche, die Stifte als auch ein altes Leinenjackett und die Reste eines Käse-Tomaten-Panino lagen. Außerdem sein Notizbuch mit einer Aufschrift. Marianne schob sich das Haar aus dem Gesicht und beugte sich hinunter. Der Künstler und der Brunnen. Sie schüttelte den Kopf. Alles andere interessierte ihn nicht. Nun ja, er hatte sie schließlich gewarnt. Er hatte ganz bestimmte Vorstellungen von dieser Reise und seine Frau eigentlich gar nicht mitnehmen wollen.
Nein, darüber mochte sie sich nicht den Kopf zerbrechen. Doch nachdem sie den Stadtplan studiert hatte und in die schmale Via delle Muratte eingebogen war, die sie zur Piazza della Rotonda und dem Pantheon führte, empfand sie erneut so etwas wie Furcht; eine vage, düstere Vorahnung. Rupert?
Blitzschnell wandte sie sich um, sodass ihr Rock wie elektrisch aufgeladen an ihren Beinen haften blieb. Doch er kniete immer noch dort, inmitten der Menschenmenge, tief in seine Arbeit versunken. Marianne strich sich erneut über den Bauch, ehe sie sich langsam entfernte.
Kapitel 1
Sieben Jahre später
Sie hatte schon beinahe vergessen, dass es dort so viel Wasser gab. Marianne und Amy Brooking flüchteten vor dem tosenden Geräusch auf den kleinen, belebten Platz. Marianne roch den herben, metallenen Geruch. Sie blinzelte in die grelle Sonne und suchte instinktiv den Schatten auf. Amy riss sich von ihr los. Ihre Handflächen waren feucht. Vielleicht hatte Marianne die Hand ihrer Tochter zu fest gehalten. Sie trocknete sie an der Jeans, ohne das Mädchen aus den Augen zu lassen – ebenso wenig wie den Brunnen …
La Fontana di Trevi! Sieben Jahre schwirrten Marianne innerhalb einer Sekunde durch den Kopf. Gleichzeitig fragte sie sich, ob es die richtige Entscheidung gewesen war, noch einmal an diesen Ort zurückzukehren.
Der Brunnen war so imposant, wie Marianne ihn in Erinnerung hatte, und brachte selbst Amy zum Schweigen, die sich, von dem Anblick überwältigt, durch die Touristengruppen drängte und wieselflink die Stufen erklomm.
»Lauf nicht zu weit weg!«
Der Brunnen – die Attraktion schlechthin – nahm beinahe eine Seite des Platzes ein. Die strukturierten Gesteinsbrocken wuchsen aus der prachtvollen Fassade des dahinter aufragenden Palazzo; silbrig blau schäumte das Wasser in Kaskaden über die Steinbecken und blendete geradezu.
Nachdem sie die Münzen in den Brunnen geworfen hatte – Drei Münzen, hatte er gesagt, rückwärts über die Schulter –, hätte Marianne nie gedacht, dass sie jemals ohne Rupert wieder nach Rom fahren würde. Sie hatten sich damals an den Händen gehalten. Bedeutete das nicht eigentlich, dass man gemeinsam zurückkommen würde – als Liebespaar?
Sie hatte geahnt, dass all die Erinnerungen wieder auftauchen würden. Warum also war sie hier? Sie klemmte sich die Tasche fest unter den Arm – »Rom ist berüchtigt für Taschendiebe«, hatte Daniela sie gewarnt. Daniela lebte in Rom. Sie hatten sich im Gymnasium miteinander angefreundet und den Kontakt aufrechterhalten – wenngleich in unregelmäßigen Abständen. Diesmal hatte Marianne das Angebot der Freundin angenommen, in deren Wohnung nicht weit vom Pincio-Park zu übernachten. Wenngleich sie die Anonymität eines Hotels genoss – und in einer Stadt wie Rom umso mehr –, war sie für die Gastfreundschaft dankbar, zumal es für Amy bei Daniela bestimmt netter war als in einem Hotel. Daniela war mit Federico verheiratet, einem vielbeschäftigten Mann. Sie hatten ein drei Monate altes Baby, und Amy war in ihrem Element. Nach der überstürzten Abreise nach Rom fand auch Marianne in Danielas Wohnung etwas Ruhe. Sie wollte endlich herausfinden, was sich vor sieben Jahren hier abgespielt hatte – als läge die Wahrheit vielleicht in einer dunklen Ecke verborgen, ohne dass die wärmende Frühlingssonne sie jemals ans Licht gebracht hatte …
Ja, es war wirklich lange her: sieben volle Jahre. Und Sam fand, dass es nun Zeit sei. Nach sieben Jahren könne man eine Ehe auflösen; sich verabschieden; sich trennen; einen Schlussstrich ziehen. War sie im Begriff, genau das zu tun?
Marianne trat einen Schritt vor und legte schützend die Hand über die Augen. Ein Sonnenstrahl traf genau auf Neptun. Der Trevi-Brunnen sollte die Gewalt des Meeres verdeutlichen, Marianne jedoch verband damit andere, schicksalhafte Erinnerungen.
»Mami, Mami, ich habe Durst. Darf ich …?«
»Nein.« Marianne reagierte besonders heftig, als sie aus ihren Gedanken gerissen wurde. Sie setzte sich so abrupt auf, dass ihr dunkles Haar wippte und Mutter und Tochter einander in die Augen sehen konnten. »Das Wasser ist schmutzig.«
»Es sieht aber sauber aus.« Amy trug ihren kurzen Jeansrock und ein rotes T-Shirt mit dem Bild einer großen Ziege.
»Es sieht viel zu sauber aus.« Ja, es glitzerte geradezu – keimfrei, hygienisch, silbrig blau. Aber es gab Dinge, die mehr versprachen, als sie halten konnten. Das hatte Marianne nur zu gut gelernt.
»Oooh.« Amy arbeitete sich erneut durch die Menschenmenge zu dem Brunnen vor, stieg die Stufen hinauf und ging über das Kopfsteinpflaster bis zum Brunnenrand, ganz nahe an das aufragende Gestein bis hin zu den Tauben, die respektlos auf dem weißen Neptun und dessen Pferden hockten. Amy stellte sich auf die Zehenspitzen und reckte sich dem Wasser entgegen.
»Beug dich nicht zu weit vor!« Mariannes Blick wanderte über die schattige Piazza und die engen Nebenstraßen. Als ob …
Vor sieben Jahre hatte sie genau dort drüben gestanden, am Beginn der Steigung, in der Via della Stamperia, die an dieser Stelle die Richtung änderte. Marianne hatte vor dem schäbigen Souvenirladen gestanden, der mit Artikeln für »religiöse Zwecke« warb, und Rupert beim Zeichnen des Brunnens fotografiert. Danach hatte sie sich die Umgebung angeschaut. Und genau in jenem Augenblick hatte sie es gespürt. Sie erinnerte sich geradezu bildhaft an diese dunkle Ahnung, als sei all dies erst gestern gewesen. Ihre Vermutung lag tief in ihrer Erinnerung verankert. Eine unbestimmte Frage, die sie niemals hatte beantworten können. Hatte er jemals die Notiz gefunden, die sie ihm dagelassen hatte? Spielte das überhaupt noch eine Rolle? Hatte sie jetzt nicht Sam? Doch vielleicht war sie gerade deshalb wieder an diesen Ort zurückgekehrt.
Vor sieben Jahren war sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite entlangspaziert, in der Via delle Muratte. Das Kopfsteinpflaster und die senf- und ockerfarbenen Gebäude sahen genauso aus wie heute. Selbst die runden Marmortische und die Korbsessel standen noch vor dem Caffè neben der Gelateria. Doch wieso hatte sich hier nichts verändert, während ihre eigene Welt auf dem Kopf gestanden und sich mittlerweile vollkommen gewandelt hatte? Wie war es möglich, dass die Straße, ja, überhaupt alles, so unschuldig dalag?
Instinktiv glitt Mariannes Blick zurück zu Amy, die nach wie vor wie hypnotisiert in das Wasser starrte. Die Fontana di Trevi besaß diese Wirkung, sofern man sich darauf einließ.
Sie hatte sich in ein Caffè auf der Piazza della Rotunda gesetzt und vor sich hingeträumt. Dann hatte sie mit Daniela telefoniert und ihre Abendeinladung angenommen. Rupert hatte sich zwar drücken wollen, aber sie hatte darauf bestanden, die Freundin zu besuchen. Und als sie zum Trevi-Brunnen zurückgegangen war – war er fort gewesen.
Danach war die schlimmste Zeit gekommen – allerdings erst später.
Zunächst hatte sie geglaubt, er habe nur den Ort gewechselt, um eine andere Perspektive zu bekommen.
Du musst die Sache als Ganzes betrachten … Diesen Satz hatte sie noch im Ohr. Wenn er aufstand und das arrangierte Stillleben oder sein Modell behutsam in die Mitte des Studios schob, führte er eher ein Selbstgespräch, als dass er seine Frau einbezog. Weil er als Künstler unsicher war, obwohl er in allen anderen Lebensbereichen Selbstsicherheit zeigte. Du musst das Bild schon vorher in dir tragen, vor deinem geistigen Auge sehen, hier drinnen – er tippte sich an den Kopf –, bevor du es malen kannst.
Der Künstler und der Brunnen … Also war Marianne ziellos über die schattige Piazza spaziert, die Hände über dem Bauch verschränkt, und hatte sich zunächst durch die Menschentraube vor dem Brunnen geschoben, vorbei an der Kirche und den hohen Gebäuden mit dem pfirsich- und ingwerfarbenen Anstrich, zwei Eissalons, einer Bar, Benetton-Läden und dem Hotel Fontana mit seinem dunklen Terrakottaton, die den Platz säumten und die Sonne verdeckten. Sie stieg die Treppe hinab und die Stamperia hinauf, ließ den Blick über die zahllosen Menschen mit kleinen Fotoapparaten schweifen, die mit durchdringenden Stimmen riefen: »Wow, ist der groß!« oder »Himmel, ist das hier laut!« Sie suchte in allen Richtungen nach Rupert, der womöglich erschöpft, abgemagert und tief gebräunt in einer Ecke hockte und blindwütig Skizzen anfertigte.
Ohne Erfolg. Nirgendwo ein Zeichen von ihm. Auf dem hohen Balkon eines Gebäudes an der Piazza nahm eine Frau die Wäsche von der Leine. Vollkommen unbeeindruckt plätscherte der Brunnen. Die Fontäne schwoll noch stärker an und übertönte alle anderen Geräusche. Marianne wandte sich ab.
Amy bat um Geld. Sie streckte Marianne die geöffnete Hand entgegen. Ihr honigblondes Haar glänzte in der Sonne, die blauen Augen waren so dunkel wie Ruperts Augen. »Das macht doch jeder hier«, erklärte sie.
Das stimmte. Alle machten es. Dicht gedrängt standen die Menschen auf dem Platz, um ihre Münzen dem Brunnen anzuvertrauen. Ein Stimmengewirr in verschiedenen Sprachen bot die Hintergrundmusik für das herabstürzende Wasser. So viel Wasser …
Marianne gab ihr drei Fünfzigcentstücke. »Wirf sie über deine Schulter! Rückwärts«, erklärte Marianne und machte die entsprechende Bewegung dazu.
»Cool«, antwortete Amy und lief bereits davon.
Doch Marianne erwischte sie noch am Arm. Sie durfte ihre Tochter keinesfalls aus den Augen verlieren. »Bleib in der Nähe!«, wiederholte sie.
Alles an dem Brunnen wirkte kühl. Er erinnert nicht an das Meer, sondern eher an einen reißenden Bergstrom, dachte Marianne. Als würde sich ein Gletscher durch den Fels bahnen und das Herzstück einer Landschaft durchschneiden. Sie ging auf Amy zu, trat in die wärmende Sonne, setzte sich auf eine Stufe und beobachtete ihre Tochter. Tief sog sie dieses ganz besondere Aroma ein – dieses reine Aroma. Den Geruch, wenn Wasser und Sonne sich auf trockenes Gestein ergießen …
Sie fand Rupert nicht, blieb aber nach wie vor gelassen, obwohl sie zweimal über den Platz gewandert war, bis sie unverhofft auf ein Zeichen von ihm gestoßen war: seine Wasserflasche, die nach wie vor auf der Bank stand, neben der er seine Skizzen angefertigt hatte. Wie hatte sie die Flasche übersehen können? Das zur Hälfte gegessene Panino – Mozzarella und Tomate –, überlegte sie. Und auch ihre Notiz lag noch dort. Typisch Rupert! Er hat nur Augen für sein Motiv. Vermutlich hatte er ihre Zeilen gar nicht gelesen. Seine Jacke lag allerdings nicht mehr da. Er hatte sie wohl mitgenommen.
Tja … Gewiss hat er sich einen Kaffee geholt oder ist zum Hotel zurückgegangen, überlegte Marianne, weil er mich dort anzutreffen glaubt. Ja, so muss es sein. Sie legte einen Schritt zu. Das Tosen des Brunnens klang nun spöttisch. Sie blendete es aus. Die Straßenhändler mit ihrem Angebot billiger Sonnenbrillen und Schmuckstücke zogen den Kreis enger, und sie bekam kaum noch Luft. Sie nahm die Straßenbahn Richtung Stamperia und hastete zur Piazza Barberini, zurück zum Hotel. Nein, sie würde sich nicht aufregen. Seit der Schwangerschaft war sie ängstlich, aber sie schob die düsteren Ahnungen beiseite.
Irgendwo ertönte ein zarter Glockenklang. In Rom gab es nicht nur viele Kirchen, sondern auch viele Glocken. Marianne sah auf ihre Uhr. »Wir müssen gehen«, rief sie Amy über das Wasser hinweg zu. Es war höchste Zeit.
Sie stand auf, strich sich das Haar aus der Stirn und hängte sich die Handtasche über die Schulter. War es richtig gewesen, noch einmal hierherzufahren? Sie hatte Sam erklärt, dass sie diese Reise machen müsse. Doch jetzt schnürte die Stadt ihr die Luft ab. Die Erinnerungen erschütterten ihr mühsam errungenes Gleichgewicht. Was erhoffte sie sich bloß von diesem Besuch in Rom?
»Sofort?« Amy zog die Stirn kraus.
Marianne griff nach der Hand ihre Tochter. Amy hatte sich dem Rhythmus Roms bereits angepasst, hatte die Stadt in Besitz genommen, sich unter die Leute gemischt, hatte die Caffè, die Plätze mit ihren Brunnen erobert. Hinter jeder Ecke wartete eine neue Überraschung, eine weitere Kostbarkeit.
»Wir haben mit Daniela ausgemacht, dass wir das Baby ausführen«, erinnerte Marianne sie sanft, obwohl sie heute schon viel umhergelaufen waren und viel von der Stadt gesehen hatten. Am Vormittag war sie sofort zur Galleria d’Arte Bianca aufgebrochen, in der die Ausstellung zu sehen war, von der Daniela ihr am Vorabend erzählt hatte. Der Künstler und der Brunnen – war das eine Fügung? Der Katalog, den sie gestern studiert hatte, hatte allerdings keinen Aufschluss gebracht.
Doch die Galerie war geschlossen gewesen, und Marianne wäre beinahe in Tränen ausgebrochen. Hätte sie sich doch vorher über die Öffnungszeiten informiert! Sie hätte nicht herkommen sollen. Ja, ja, hätte, hätte …
Da in der Galerie Licht gebrannt hatte, hatte sie einen Blick durch das Fenster gewagt, aber nur eine undeutliche Gestalt wahrgenommen, die in dem Raum umherwanderte. Nicht einmal ein Bild war zu erkennen gewesen.
Schließlich hatte sie das Schild mit den Öffnungszeiten entdeckt. Donnerstag bis Sonntag. Super! Heute war Montag. Sie würde sich bis zu ihrem letzten Tag in Rom gedulden müssen.
Hand in Hand schlenderten sie zu Danielas Wohnung, die stark befahrene Via del Tritone entlang, vorbei an den Palmen und den Straßenverkäufern der Piazza di Spagna, wo die von karmesinroten Azaleen eingerahmte Spanische Treppe anmutig hinauf zur Kirche führt. Amy hüpfte auf jeder dritten Stufe und summte eine geheimnisvolle Melodie dazu, während Marianne ihren Gedanken nachhing.
Warum sie einen Blick ins Caffè Greco warf, wusste sie selbst nicht und genauso wenig, weshalb sie das Gesicht zur Kenntnis nahm, das ihren Blick erwiderte. Doch als sich eine Art Wiedererkennen in ihr regte, spürte sie einen schmerzhaften, beinahe lähmenden Stich in der Magengrube.
»Mama, Mama …« Amy war bereits weitergelaufen und fasste jetzt nach ihrer Hand.
»Ich komme schon.«
Der Mann hatte sich abgewandt. Er rauchte eine Zigarette. Locker, ungezwungen. Vielleicht hatte sie es sich ja nur eingebildet.
Aber nein, kein Zweifel, dieses Gesicht hatte sie schon einmal gesehen. Fragte sich nur, wann und wo.
Kapitel 2
Was genau soll ich denn tun, Stella?« Penelope Redwood presste das Telefon fester ans Ohr und zog sich ihre beigefarbene Lieblingsjacke enger um die Schultern. Sie mochte Stella Shaw sehr. Seit ihrer gemeinsamen Studienzeit in Exeter vor dreißig Jahren hatte die Kollegin ihr stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden – natürlich nur, was die Archäologie betraf. Stella wahrte gern Abstand, und sie rief nur dann an, wenn sie ein Anliegen hatte. Penelope ahnte bereits, um was es sich handelte.
»Ich möchte, dass du die Leitung einer Forschungsgrabung übernimmst«, erklärte Stella.
»Verstehe.« Penelope lehnte sich an den Kühlschrank und schob eine vorwitzige Strähne aus dem Gesicht. Es wäre nicht verkehrt, sich demnächst mal die Haare schneiden zu lassen. »Eine Forschungsgrabung?«
Penelope war Archäologin. Da sie erst vor einer Woche ihr letztes Projekt abgeschlossen hatte, war sie ziemlich erschöpft. Daran änderten auch die ungewöhnlich interessanten mittelalterlichen Funde nichts. Aber Stella bot ihr die Mitarbeit an einem Projekt an, das sowohl Neugier als auch Vorfreude in ihr weckte, obwohl die Geophysiker und die Geldgeber erst noch grünes Licht geben mussten, damit die endgültigen Grabungen beginnen konnten. Für sie war der Einstieg in das Projekt am spannendsten – die Überlegungen zu den ersten Gräben sowie die Freilegung der obersten Schicht. Es war vermutlich das Gefühl von Hoffnung. Also sollte sie sich eigentlich freuen.
Dennoch … Penelope nahm das Telefon mit ins Wohnzimmer und ließ sich auf das Sofa vor dem großen Erkerfenster fallen. Sie hatte sich in dieses Appartement verliebt, das sich im obersten Stock eines großzügig geschnittenen Hauses im viktorianischen Stil befand. Schon damals, kurz nach ihrer Hochzeit, vor Mariannes Geburt. Und sie liebte diese Wohnung noch immer, obwohl Notting Hill hektisch, trendig und teurer geworden war und die wenigen Besonderheiten, die es noch gab – beispielsweise den Antiquitätenmarkt in Portobello –, ihren ursprünglichen Charme verloren hatten und zu einer reinen Touristenfalle verkommen waren.
Wie zur Begrüßung gab der bunte Überwurf nach, als Penelope auf das Sofa sank. Sie schob einen Becher, einen Teller und mehrere auf dem Tisch liegende archäologische Zeitschriften beiseite, zog die Schuhe aus und legte die Füße hoch. Das Gespräch könnte länger dauern.
»Wo?«, fragte sie. Penelope arbeitete freiberuflich, während Stella Shaw als Archäologin bei der Grafschaft von West Dorset angestellt war. Und West Dorset war für Penelope tabu.
Was nicht gerade einfach war, da die eigene Tochter dort lebte … Marianne war nach Dorset gezogen und hatte Rupert Brooking, einen Künstler, geheiratet – doch je seltener man dieses Thema berührte, desto besser. Marianne war auch nach Ruperts Verschwinden aus unbegreiflichen Gründen in Dorset geblieben. Penelope seufzte. Zum Glück kam ihre Tochter gern nach London, und wenn sie, Penelope, gelegentlich Besuche in Lyme Regis machte, hielt sie den Blick gesenkt und konzentrierte sich auf die Straße, bemüht, nicht über diesen Ort nachzudenken. Außerdem lag Lyme ja eigentlich in einer anderen Grafschaft und war damit eindeutig zu weit entfernt von dem gefährlichen Pflaster.
Vom Sofa aus blickte Penelope auf die oberste Etage des gegenüberliegenden Hauses. Außerdem sah sie von ihrem Fenster aus die Buche vor dem Haus und den grauen Himmel eines typisch englischen Frühlingsnachmittags. Sie machte es sich bequem, hörte Stella mit halbem Ohr zu, während sie gleichzeitig ein großformatiges Foto von ihrer Tochter und Amy an der Wand betrachtete.
Was mochte sich damals in Rom abgespielt haben? Und was um alles in der Welt hatte Marianne dazu getrieben, ohne Sam dort hinzufahren? Diesmal würde bestimmt alles gut gehen – immerhin war Daniela in der Nähe. Aber trotzdem … Warum die Geister der Vergangenheit heraufbeschwören? Warum machte Marianne es nicht so wie ihre Mutter und mied gefährliches Terrain einfach?
Stella redete immer noch, ohne auf Penelopes Frage einzugehen. »Du kennst ja die Supermärkte heutzutage. Die Sava-Kette erfüllt sozusagen sämtliche Kriterien und hatte bereits eine Baugenehmigung. Und, was meinst du, wer kreuzt da plötzlich auf?«
»Wahrscheinlich irgendein Hobbyarchäologe, der den Rasen hinter seinem Haus umgepflügt hat«, vermutete Penelope. Archäologie konnte einen wahrlich fesseln und tief in die Vergangenheit hineinziehen. Doch die Arbeit eines Archäologen war mühsam und keineswegs so romantisch, wie einem gewisse Fernsehsender vorgaukeln wollten. Aber vor dem ersten Spatenstich gab es die Hoffnung, eine Scherbe aus der Vorzeit zu finden und Licht in das Dunkel der Geschichte zu bringen. Mit jedem Spatenstich entdeckte man eine andere Phase der menschlichen Entwicklung. Man stieß womöglich auf Spuren einer Behausung oder auf Keramikgegenstände und Schmuck oder sogar auf Grabstätten einer alten Kultur, mit denen sich die Geschichte dokumentieren ließ. Ja, es ging darum, das historische Wissen zu erweitern.
»Genau!« Stella verfiel in dröhnendes Gelächter. »Du kannst offenbar hellsehen. Außerdem klingt es vielversprechend …«
»Was hat er denn gefunden?« Penelope legte den Hörer an das andere Ohr und schmiegte sich noch tiefer in die Polster. Unwillkürlich stieg Neugier in ihr auf. Vielleicht hatte sie es so lange in diesem Beruf ausgehalten, weil sie dadurch weniger befriedigende Bereiche ihres Lebens ausblenden konnte: die Geister der Vergangenheit ebenso wie das Gefühl von Verlust. Sie konnte sich – und das tat sie oft – immer wieder darauf berufen, mit neunundvierzig Jahren eine anspruchsvolle, erfüllende Tätigkeit auszuüben. Darüber hinaus hatte sie eine Tochter, die sie liebte, und eine Enkeltochter, die sie schlichtweg vergötterte. Und das trotz all der Verluste, die Teil ihres Daseins waren. Sie hatte gelernt damit zu leben, ja, sogar damit gerechnet. Aber sie war auch bereit gewesen, mit dem Verlust zu leben, mochte der eine oder andere behaupten. Aber damals hatte sie auch keine andere Wahl gehabt.
»Einige interessante Mosaiksteinchen. Sie könnten von einem römischen Mosaik stammen«, erklärte Stella. »Außerdem gibt es Hinweise auf eine römische Mauer.«
Penelope blickte zur Zimmerdecke hinauf. Dort befand sich tatsächlich eine original viktorianische Deckenleiste.
»Eine römische Mauer?«, wiederholte sie. Sie ließ sich von dem Unterton in Stellas Stimme nicht beeindrucken. Römische Mauern waren mit einem Mosaik nicht zu vergleichen. In Großbritannien wurde durchschnittlich nur ein einziges römisches Bodenmosaik jährlich entdeckt. Sie verstand sich auf ihren Job. Deshalb wollte Stella sie für das Projekt gewinnen. »Warum machst du es nicht selbst?«, fragte Penelope.
Eigentlich brauchte Stella ihr das nicht zu erklären. Die Kollegin war fest in ihr Lieblingsprojekt in Dorchester eingebunden: die Ausgrabung einer römischen Siedlung mitsamt großem öffentlichem Badehaus sowie den Überresten mehrerer Stadtvillen.
»Mir fehlt die Zeit dazu. Deshalb habe ich an dich gedacht.« Stellas Stimme suggerierte, dass Penelope dankbar dafür sein sollte. Was sie ja auch war. Gewissermaßen.
»Die Supermarktkette hat also der Kostenübernahme für die Grabungen zugestimmt?«, hakte sie noch einmal nach. Sie bewegte die Zehen. Es war herrlich, nach Tagen in einer Frühstückspension wieder in ihrem lichten, luftigen Appartement zu sein und nicht mehr in einem zugigen Verschlag zu arbeiten. Sie wäre geradezu verrückt, direkt die nächste Kampagne zu planen.
Dabei gab es kaum etwas Schöneres als eine erfolgreiche Grabung, die mühevollen Tage, ja Wochen des Schabens sowie die Reinigung der Gräben – denn auch wenn sie die Aufsicht führte, packte sie doch stets überall selbst mit an. Der Zustand ihrer Hände, die trockene, schwielige Haut, zeigte das nur zu deutlich. Graben, freilegen, reinigen und erfassen, die verflixten Einzelteile zusammenfügen, um das Bild von der Vergangenheit zu vervollständigen – eine harte Arbeit, die sich jedoch lohnte. Der Hunger nach Wissen war wie eine Sucht. Sie hatte das Marianne nie verschwiegen, die sich immer brennend für die Arbeit ihrer Mutter interessiert hatte. Allerdings konnten die Geister der Vergangenheit auch gefährlich werden.
»Selbstverständlich kommen sie dafür auf. Da die Baugenehmigung gegebenenfalls zurückgezogen werden kann, war es für die Bosse ein Leichtes, diese Entscheidung zu treffen.«
»Und wo genau ist das?«, insistierte Penelope. Die entscheidende Frage!
»Hmm.« Stella äußerte sich für gewöhnlich präziser. Penelope kannte nicht nur sie seit Jahren, sondern auch das Projekt in West Dorset. Und Stella wusste nur zu gut, dass West Dorset für Penelope einen ganz besonderen Schrecken besaß.
»Wo liegt der Grabungsort, Stella?« Penelope war bereits aufgestanden und steuerte auf den Bücherschrank in der Ecke zu, in dem sie ihre Generalstabskarten aufbewahrte. Dorset war eine große Grafschaft. Dort gab es Platz für sie beide – und man musste schon in einer schlechten Verfassung sein, um tatsächlich ein Gespenst zu sehen. Wie viel Macht man den Geistern der Vergangenheit zubilligte, hing immer von einem selbst ab. Penelopes Finger glitt über die gesammelten Karten.
»Nördlich von Bridport«, erklärte Stella.
Verflixt! Penelope brauchte eigentlich nicht einmal die passende Karte hervorzuziehen, tat es aber doch und strich das zerknitterte Papier glatt. »Kannst du dich vielleicht etwas präziser ausdrücken?« Stella schien vergessen zu haben, dass sie Wissenschaftlerin war. Etwas, was überhaupt nicht zu ihr passte.
Aber Stella schoss umgehend zurück. »Ich meinte ›OS‹ und nicht den Pathfinder«, erklärte sie. »Ich weiß, welche Karte du benutzt.«
Demnach war er nicht einmal fünf Meilen entfernt. Penelope starrte wie gebannt auf die Karte, doch der Punkt bewegte sich keinen Millimeter. Das heißt, es war tatsächlich nur um die Ecke. Schweigen. Langes Schweigen.
»Und? Wirst du es dir ansehen?«, drängte Stella. »Ich habe dich bereits empfohlen.«
»Gibt es denn keine Ausschreibung?« Stella hielt sich offenbar nie an Vorschriften. Sie entschied allein, ließ sich niemals dreinreden. Kein Mann, keine Bindungen, keinerlei Verpflichtungen. Penelope schauderte es. Nur dieser verrückte Hund.
»Nicht nötig.« Stella reagierte sofort. »Du hast den Job, wenn du ihn möchtest. Wie wäre es mit Montag, acht Uhr?«
»Zehn«, erwiderte Penelope. »Vergiss nicht, ich muss aus London anreisen!«
»Ja, ja!« Pure Skepsis sprach aus ihrer knappen Antwort. Eine Archäologin, die in Notting Hill lebt. Was würde noch kommen?
»Und ich verspreche überhaupt nichts«, fügte Penelope hinzu. Lächerlich.
Doch Stella, die keine Frau langer Abschiede war, hatte bereits aufgelegt.
Fünf Meilen …
Na ja, es war nur ein Erkundungsausflug. Und fünf Meilen waren immerhin weit genug weg. Er musste ihr ja nicht unbedingt über den Weg laufen, oder?
Penelope ging in ihre ziemlich altmodische Küche und setzte Teewasser auf. Der Job mochte ja ganz interessant sein, aber er war garantiert unterbezahlt, sodass sie sich keine neue Küche würde leisten können …
Sie sah hinaus in den Garten hinter dem Haus, der zur Erdgeschosswohnung gehörte. Mrs Timkins, Vorname unbekannt, die Fuchsien und Dahlien pflanzte, lebte vermutlich schon seit ewigen Zeiten hier und richtete sich nicht nach Trends, es sei denn, Dahlien wären wieder in, ohne dass sie es bemerkt hatte. Obwohl das Fleckchen Grün kaum als Rasen bezeichnet werden konnte, beschäftigte Mrs Timkins nach wie vor einen Gärtner. Manchmal sehnte sich Penelope nach echtem Grün, jenem Grün, das auf dem Land noch zu finden war.
Sie holte sich einen Becher für ihren Tee. Im Spiegel neben der Kommode zwinkerte ihr eine Frau mit zerzaustem Haar überrascht zu, und sie zuckte zusammen. Nun gut. Der Geist hatte keine Zeit und musste sich um sein Café kümmern, während sie sich mit der Vergangenheit auseinandersetzte – nur hoffentlich nicht mit ihrer eigenen. Mit Enttäuschungen konnte sie leben, aber nicht mit diesem Gefühl der Trostlosigkeit.
Kapitel 3
Marianne und Amy saßen in Danielas und Federicos großem Wintergarten und frühstückten. Inmitten von Palmen und Zitronenbäumen hatten sie es sich in den Korbstühlen bequem gemacht und genossen die warme Morgensonne. Amy ließ die Beine baumeln. Noch erreichten ihre Füße nicht den Boden. Sie trug ein fluoreszierendes grünes Stirnband und ein Kleid in einem süßlichen Rosa. Marianne – ungeschminkt und bereits bei der zweiten Tasse Cappuccino – wirkte entspannt. Ihr Zuhause, Sam, ihre Mutter – alles schien sehr weit weg zu sein.
Daniela hatte sich hingegen von oben bis unten herausgeputzt. Makellos geschminkt und todschick gekleidet, war sie bereits auf dem Markt gewesen, um die Zutaten für das Abendessen zu besorgen. Typisch Italiener – alles musste frisch sein! »Ihr solltet euch einen Tag gönnen und die Stadt ansehen«, empfahl sie ihren Gästen und legte Croissants und Schokoladenhörnchen auf die weißen Porzellanteller, die auf dem Glastisch standen. »Ich würde euch wirklich gern begleiten, aber …« Sie wiegte das unruhige Baby in den Armen.
»Hmm.« Marianne wirkte zerstreut. »Wir könnten zum Kolosseum spazieren, was haltet ihr davon?« Sie war noch nie dort gewesen … »Hättest du dazu Lust, Amy?« Doch eigentlich fragte sie sich, ob sie es selbst verkraften würde. Sightseeing war ja schön und gut, doch sie wurde dabei mit zu vielen Erinnerungen konfrontiert, um sich nur als Touristin fühlen zu können.
»Die Galerie hat erst Donnerstag wieder geöffnet«, sagte Daniela leise.
»Ich weiß.« Marianne warf einen Blick auf ihre linke Hand, an der sie einst den Ring getragen hatte. Niemand brauchte sie daran zu erinnern. Sie bemühte sich, ihre Nervosität zu überspielen – falls »Nervosität« überhaupt das richtige Wort war, um ihre Panik zu beschreiben. Wahrscheinlich hatte es gar nichts mit Rupert zu tun. Aber sie würde nie vergessen, was er an jenem Tag auf den Umschlag seines Notizbuchs geschrieben hatte: und der Brunnen. Wie sollte sie das jemals vergessen können?
»Was für ein Colly?« Amy war immer noch mit ihrem Frühstück beschäftigt. Überall klebten Krümel: auf ihrem Teller, auf der beigefarbenen Serviette und rund um den Mund; der Marmeladenlöffel schwebte unsicher über der Untertasse ihrer heißen Schokolade.
»Kolosseum. Wo früher die Gladiatoren gegen wilde Tiere gekämpft haben.« Marianne bemühte sich, enthusiastisch zu klingen. Wie alle Kinder war auch Amy von grausamen Geschichten fasziniert. Und nun waren sie also tatsächlich hier – in einer der ältesten und attraktivsten Städte der Welt. Sollten sie das nicht ausnutzen? Sie winkte Daniela zu, schlug die Beine übereinander, lehnte sich zurück und atmete den betäubenden Duft der Limonen ein.
»Was für Tiere?«
»Vermutlich Löwen.« Marianne bemühte sich konzentriert zu bleiben. »Tiger. Vielleicht Elefanten … Es war aufregend. Wie in einem Zirkus.« Wenngleich ein äußerst blutiger Zirkus. »Der Kaiser hat sich diese Vorführungen angesehen.«
Um ein Haar hätte Marianne mit den Vestalinnen hinzugefügt. Aber sie kannte ihre Tochter. Sie hätte Erklärungen verlangt. »Und? Was meinst du?« Sie bemühte sich sichtlich. Trotz all ihrer Hoffnungen, der Lösung des Rätsels wenigstens etwas näher zu kommen, brach doch die innere Leere erneut auf. Das Zuhause war einfach in zu weiter Ferne. Sie hätte nicht ohne Sam hierherkommen sollen.
»Cool.«
Marianne beobachtete Amy dabei, wie sie Teigbällchen knetete, sie hastig in den Becher mit dem restlichen Kakao tunkte und in den Mund schob. Amy wusste, dass sie sich in der Stadt befanden, in der ihr Vater verschwunden war. Aber was mochte das für eine Siebenjährige bedeuten, die den Vater niemals zu Gesicht bekommen hatte? Für Amy war Sam der Vater.
Marianne und Rupert waren nur ein Jahr verheiratet gewesen. Sie spürte Bitterkeit – ein Gefühl, das sie schon lange nicht mehr erlebt hatte. Vermutlich weckte die Rückkehr nach Rom doch zu viele Erinnerungen in ihr. Wahrscheinlich war es eine dumme Idee gewesen …
»Ich mache hier nicht etwa Ferien«, hatte Rupert sie gewarnt. »Ich muss arbeiten. Ich werde die ganze Zeit über arbeiten müssen.« Bleib daheim, hatten seine dunklen Augen geradezu gefleht.
»Ich möchte dich begleiten. Ich möchte bei dir sein.« Während der Schwangerschaft war Marianne nur noch eigensinniger geworden – schließlich redete sie nun für zwei. »Ich mache Ferien, und du kannst den Brunnen malen.«
Marianne schob die Tasse zur Seite. Hatte sie sich damals nie gefragt, weshalb? Weshalb möchte er mich nicht dabei haben?
Nein. Das wäre ihr gar nicht eingefallen. Sie hatte nicht an ihm gezweifelt, sich nicht einmal darüber gewundert. Sie waren glücklich miteinander. Er war nun einmal ein Mann, ein Künstler, der mit seinem Objekt verschmelzen musste, der absolut keine Ablenkung von seiner Aufgabe vertrug – nicht einmal durch seine Frau. So war er nun einmal.
Nach und nach hatten sich Zweifel eingeschlichen. Unmerklich drängten sie sich in ihre Gedanken. Sie ging zurück ins Hotel. Kein Rupert. Zurück zum Brunnen. Kein Rupert. Weder in den Straßen noch in den Cafés, an denen sie zunehmend verzweifelter vorüberging. Nirgendwo. Außer sich vor Angst, beschleunigte sie den Schritt, als wollte sie ihn erwischen, seinen Schatten einfangen. Wo bist du gewesen? Ich habe dir doch gesagt, dass ich arbeiten und keine Zeit für dich haben würde. Ich habe dich gewarnt. Hatte es etwas in den Monaten danach gegeben, was sie nicht in Betracht gezogen hatte? Welche Möglichkeiten hatte sie nicht erwogen?
Er tauchte nicht wieder auf. Weder in jener noch in der folgenden Nacht. Marianne verständigte die Polizei, die Britische Botschaft und rief sowohl Daniela als auch beim Flughafen an. Ja, sie erkundigte sich sogar bei ihrer Mutter und Sam, Ruperts bestem Freund, der in Brighton lebte. Irgendjemand musste doch wissen, wo er steckte. Verdammt noch mal! Ein Mann verschwindet doch nicht mitten in Rom, während er den Trevi-Brunnen zeichnet. Ein Mann lässt nicht einfach seine Wasserflasche und all seine Habseligkeiten, geschweige denn seine schwangere Frau zurück. Es war kaum zu glauben, dass er sich einfach aus dem Staub gemacht haben könnte. Doch nicht in Rom, und schon gar nicht, wenn sie schwanger ist, Himmel noch mal.
Amy schlenkerte mit den Beinen. »Kommt Sam mit uns zu dem Colly-Dingsbums?«, fragte sie.
Marianne zuckte zusammen. Wenn er doch bloß … »Er ist doch gar nicht hier, Amy, oder? Außerdem dachte ich …«, sie nahm ihre Tochter bei der Hand, »… dass wir zwei uns einfach ein paar schöne Tage machen.« Wenn es nur um sie und Amy ging, weshalb hatte sie dann nach Rom reisen wollen, wo an jeder Straßenecke Ruperts Geist lauerte? Hier haben wir Pizza gegessen, dort dem verrückten Polizisten zugesehen, der auf jene unvergleichliche, typisch italienische Art gestikulierte, wütend in Ruperts Auto brüllte und … Die Piazza, auf der er sich ihr zugewandt und sie geküsst hatte, als würde … Nein, nicht als würde etwas … Er hatte sie einfach geküsst. Und keinesfalls so, als wolle er sich auf diese Weise von ihr verabschieden.
Waren sie und Amy deshalb hier? Waren sie hier, um sich von Rupert zu verabschieden? War es das?
»Okay.« Amy zuckte die Achseln. »Gibt es da auch noch große Katzen?«
»Wie?« Große Katzen? Ach, so. In der Stadt wimmelte es nur so von streunenden Katzen. Aber »große Katzen«, das klang eher nach einer Schulstunde. »Nein, heutzutage nicht mehr.« Sie lächelte. »Aber wir schließen jetzt einfach die Augen und sehen sie, einverstanden?« Und auch die Gladiatoren. Und natürlich Rupert. Deshalb war sie doch nach Rom gefahren: weil all das sieben Jahre zurücklag und er sie immer noch nicht freigegeben hatte.
Vor zwei Wochen hatte Sam ihr die entscheidende Frage gestellt. An sich hätte sie darauf gefasst sein müssen. Aber sie war immer davon ausgegangen, dass er es verstand. Doch da hatte sie sich offenbar getäuscht. Und nun war sie sich selbst gar nicht mehr so sicher, auch wenn seine Frage alles ins Rollen gebracht hatte. Ehrlich gesagt, waren sie aus diesem Grund hier. Und außerdem, um sich von Daniela alles über die Ausstellung erzählen zu lassen.
»Warum?«, wollte er wissen, als sie erklärte, sie würde noch einmal nach Rom zurückkehren. »Warum, Marianne?«
»Weil ich es herausfinden muss!« Begriff er es denn nicht? Sie tat das nicht nur für sich selbst, sondern auch wegen Sam. »Ich muss wissen, was damals vorgefallen ist.« Sollte ihr das nicht gelingen, würde sie sich auf immer und ewig wie eine angeknackste Schallplatte vorkommen, wie einer dieser alten Songs, die ihre Mutter, als Marianne klein war, unentwegt abgespielt hatte. Pink Floyd oder Frank Sinatra; ihre Mutter hatte schon immer einen vielseitigen Geschmack gehabt. Immer derselbe Refrain. »Where are you now? Are you dead or alive? What was it that made you go?«
Sie spazierten rechter Hand am Forum Romanum vorbei. Die Arena wirkt wie eine Bühne vergangener Zeiten, dachte Marianne. Holpriges Pflaster, bröckelndes Mauerwerk, eine uralte Ruine, streunende Katzen, die sich ihre Wege durch Schutt bahnten, sich auf verfallenem Gemäuer räkelten oder in der Sonne schliefen. Marianne betrachtete das verfallene Kolosseum auf dem Hügel. Was für ein unglaublicher Anblick! Ebenso wie die Menschenmenge, die sich um das runde Bauwerk schob, vorbei an den Säulen, erneut hinaus ins Freie und in die zunehmend wärmende Sonne.
»Sie möchten sicherlich ein Foto machen, nicht wahr?« Ein römischer Zenturio stand vor ihnen – mit einem prächtigen Goldhelm auf dem Kopf, gekleidet in eine Tunika, einen roten Mantel und – Leggings? Marianne sah zweimal hin, um sich zu vergewissern. Nun ja, für sie war es ein warmer Frühlingstag, aber für einen Römer?
»Nein, danke.«
Im selben Augenblick sagte Amy: »Ja, bitte.«
Aus dieser widersprüchlichen Situation heraus witterte ein zweiter Zenturio seine Chance und kam seinem Kameraden zu Hilfe. »Okay«, sagte er und nahm seine modische Sonnenbrille von der Nase. »Ich mache ein Foto von euch beiden mit ihm, in Ordnung?«
Ehe Marianne etwas einwenden konnte, trat ein jüngerer Mann aus der sich nach und nach auflösenden Menge und redete in affenartiger Geschwindigkeit auf die Zenturionen ein. Alle drei gestikulierten mit Händen und Füßen. Was, im Himmel, war denn los?
Amy zog Mariannes Kamera aus ihrer Handtasche. »Mach von mir und dem Soldaten ein Foto, Mama!«, forderte sie gebieterisch.
»Zenturio«, korrigierte Marianne, um ihre Autorität zu unterstreichen. Ha!
Der junge Italiener drehte sich um und bemerkte Amys wissbegieriges Gesicht. Marianne erkannte an seinem Namensschild, dass es sich um einen der Führer handelte. »Okay.« Er trat ein paar Schritte zurück. »So ist es gut.« Die Zenturionen blickten finster. Marianne war sich nicht so sicher, ob sie tatsächlich ein Foto machen sollte, aber Amy fuhr, einen Arm der Kamera entgegengestreckt, wie ein leuchtend rosa-grüner Blitz in ihrer typischen »Mach schon«-Pose zwischen die Männer, und so schoss Marianne das Foto.
»Für dieses Foto müssen Sie normalerweise zahlen«, sagte der italienische Fremdenführer, nachdem die Zenturionen sich davongemacht hatten, um sich einen anderen Touristen vorzuknöpfen.
»Wie viel?«, fragte Marianne.
Er zuckte die Schultern. »Zwanzig, vielleicht dreißig Euro.«
Marianne zuckte zusammen. »Und wenn ich mich geweigert hätte?«
»Hätten Sie Ihre Kamera nicht zurückbekommen.«
»Verstehe.« Marianne betrachtete ihn genauer. »Vielen Dank, dass sie dazwischengegangen sind.« Offenbar passierte das allen arglosen Touristen. Weshalb hatte er sich überhaupt die Mühe gemacht?
»Gern geschehen.« Er grinste entwaffnend und zeigte dabei strahlend weiße Zähne. »Wie wäre es mit einer Führung? In zehn Minuten geht es los.«
Marianne musste lachen. Ein Hai neben dem anderen. Dieser hier war allerdings nicht unattraktiv. »Wie viel?«
Er nannte den Preis. »Noch dazu brauchen Sie sich nicht in der Schlange anzustellen.«
Marianne zögerte keine Minute. »Einverstanden.« Sie hatte bereits gehört, dass die Fremdenführer den Touristen sehr interessante Geschichten über das Kolosseum zu erzählen wussten. Amy würde das sicherlich gefallen.
Und ob! Paolo, so war auf dem Anstecker zu lesen, erzählte diese aufregenden Episoden hauptsächlich für Amy – das einzige Kind unter ungefähr zwanzig Erwachsenen, die ihm interessiert zuhörten und das gesamte Amphitheater treppauf, treppab durchkämmten. Vermutlich war es nur das unglaubliche Ausmaß dieses Theaters, das höchste Begeisterung auslöste mit all dem Marmor und den abertausend Backsteinen sowie den Steinsäulen, Gewölben, Bögen und dem Labyrinth der darunter liegenden Gänge, die von einer höheren Warte aus eingesehen werden konnten. Laut Paolo besaß das Kolosseum achtzig Eingänge und Ränge, auf denen fünfzigtausend blutrünstige Zuschauer Platz fanden. Die mit Quadraten und Bögen durchbrochene Fassade war symmetrisch angelegt und gab eine gute Vorstellung von dem historischen Gebäude. Vierundzwanzig Jahre lang hatten vierzigtausend Sklaven daran gebaut. Es war kaum zu glauben …
»Die Löwen und Tiger wurden in den dunklen Räumen unter der Arena in Käfige gesperrt«, erklärte Paolo und wies in die Richtung.
Diese Käfige waren wirklich klein. Marianne lächelte, als sie eine streunende Katze sah – ein winziges Tier verglichen mit denen, die Paolo schilderte. Überall traf man diese halb verhungerten Tiere mit den großen Augen; sie dösten in sonnigen Nischen antiker Gemäuer und suchten auf den Straßen nach Abfällen.
»Die wilden Tiere bekamen oft tagelang nichts zu fressen …« Paolo schien Mitleid mit ihnen zu haben, ließ die Schultern hängen und seufzte – einigermaßen überzeugend. »Bis sie ausgehungert und deshalb unberechenbar waren.« Er verlieh jedem Wort ein Maximum an Gewicht und Inbrunst. »Sie wurden durch die Gänge getrieben und über die Hebevorrichtungen nach oben befördert …« – er ahmte einen Glockenklang nach –, »… und schon waren die Falltüren geöffnet.« Eine theatralische Geste. »Und die Tiere jagten in die Arena.«
Amy war gespannt. Und ebenso weitere Besucher, die erst später dazugestoßen waren. Marianne schloss die Augen und hörte beinahe das Gebrüll, das die Luft zerriss, ebenso wie den Lärm der Hufe und Pranken, den Gesang und den Applaus; sie roch beinahe den ekligen Geruch von Blut – sowohl den der Tiere als auch der Menschen –, heißes, pulsierendes Fleisch, Schweiß, verschwitztes Haar … Eine Gänsehaut lief ihr über den Rücken.
»Die Gladiatoren und Sklaven sehen, wie die Tiere sich anschleichen. Langsam, vorsichtig. Psst … Den Finger auf den Mund gelegt, schlich Paolo vor den Zuschauern hin und her.
Marianne beobachtete, dass vorübergehende Touristen sie mit seltsamen Blicken beobachteten. Mittlerweile war die Gruppe auf das Dreifache angewachsen.
»Die Augen der Raubtiere funkeln wie Edelsteine.« Er starrte jeden Einzelnen mit dunklem Blick an. Paolo verstand sich blendend auf seinen Job. Die Spannung wuchs zunehmend.
»Sie kommen immer näher. Das Opfer ist an einer Stange festgebunden. Ungeschützt, wartend auf den Tod ad bestias.« Er spreizte die Arme in der Haltung eines Gekreuzigten. »Oder durch die Hand des Gladiators – er kämpft.« Gleich darauf zog er ein imaginäres Schwert, ließ es durch die Luft sausen und zerstückelte einige bedauernswerte Phatasiegestalten. »Das machte die Biester noch wilder …« Stille. »Gieriger …« Wieder Stille. »Sie brüllen!« Er hebt die Stimme, gefolgt einer wirkungsvollen Pause. »Sie stürzen hervor!«
Den Besuchern lief ein Schauder über den Rücken.
Paolo grinste. »Und zerreißen den Gladiator mit ihren monströsen Raubzähnen.«
Marianne fröstelte es. Sie warf einen Blick auf Amy, doch ihre Tochter genoss den bestialischen Augenblick sichtlich.
Paolo zuckte die Schultern. »Das war damals ein ganz normaler Zeitvertreib«, erklärte er. »In der Arena war sandiger Boden, der das Blut gut aufsaugte. Die Menschen wollten Blut sehen. Sie beklagten sich, wenn die Gladiatoren überlebten.«
Marianne warf erneut einen skeptischen Blick auf Amy. Hatte sie vielleicht zu großen Spaß an diesem Zeitvertreib?
Die Besichtigung der berühmten todbringenden Arena ging zu Ende, als Marianne in ihrem Rücken spürte, dass sie angestarrt wurde. Sie fühlte eine nahezu physische Beklemmung, wandte sich um und erhaschte noch den Schatten eines Mannes, der soeben um eine Mauerecke bog und in die schmale Passage Richtung Ausgang hastete. Eigentlich nichts Besonderes. Immerhin waren hier viele Menschen versammelt. Und weshalb sollte nicht einer von ihnen sie ansehen?
Aber ihr schien doch mehr dahinter zu sein. Sie verließ die Gruppe kurz, um einen Blick auf den Ausgang zu werfen. Doch der Mann war in der Menge untergetaucht. Marianne zog die Stirn kraus. Da sah sie ihn, konnte ihn sogar erkennen. Er war soeben im Begriff, die Arena durch den als uscita gekennzeichneten Durchgang zu verlassen. Ein großer Mann mit schütterem Haar und hängenden Schultern. Obwohl sie ihn nur von hinten sah, wusste sie, dass er es war. Der Mann, der ihr gestern im Caffè Greco aufgefallen war; der Mann, der ihr bekannt vorgekommen war.
Was sollte sie nun tun? Sie warf einen Blick zurück auf Amy. Sich Amy schnappen und ihm folgen? Den Bruchteil einer Sekunde kam ihr das wie ein guter Einfall vor. Sie könnte herausfinden, um wen es sich zum Teufel handelte und weshalb er offenbar jedes Mal auftauchte, sobald sie in Rom war. Doch ihr gesunder Menschenverstand siegte. Sie durfte Amy keinesfalls da hineinziehen. Hielt sie sich etwa für eine junge Miss Marple? Außerdem war es vermutlich keineswegs rätselhaft, sondern purer Zufall, dass sie diesen Mann schon zweimal gesehen hatte. Weshalb bereitete ihr das so viel Angst?
Nun rannte Amy auf sie zu. »Ich finde, wir sollten uns jetzt ein Eis kaufen, Mummy«, schlug sie vor.
»Gute Idee, mein Schatz.« Sie musste dringend zurück in die Realität. Marianne winkte ihrem Führer.
»Solange das Kolosseum steht, wird Rom auch stehen; wenn das Kolosseum fällt, fällt auch Rom; wenn Rom fällt, wird die ganze Welt fallen.«
»Julius Caesar?«, wollte jemand wissen.
»Beda der Ehrwürdige. Eine Prophezeiung aus dem achten Jahrhundert.« Er grinste Marianne an.
»Mille grazie, Paolo. Es war ein fabelhaftes Schauspiel!«
»Non c’è di che.« Er verbeugte sich. »War mir ein Vergnügen.«
Keineswegs rätselhaft. Und dennoch … Marianne kniff die Augen zusammen, als sie aus dem düsteren Gang ins Sonnenlicht traten. Und dennoch …
Kapitel 4
Penelope genoss die letzten Sonnenstrahlen, die ihr Gesicht angenehm wärmten, während sie mit ihrer Mutter durch die Broken Wharf in Richtung Themse schlenderte. Wenn Penelope nicht auf Reisen war, gönnten sie sich diesen Ausflug oft. An der Themse entlangzuspazieren war für ihre Mutter ein ganz besonderes Vergnügen, da sie diese Strecke recht gut bewältigen konnte. Jahrelang hatte Iris Mortimer seinen Namen so gut wie nie erwähnt, doch plötzlich erinnerte sie sich an Penelopes Vater ebenso wie an die einstigen Spaziergänge an der Themse – noch lange bevor das Ufer sein heutiges Gesicht erhalten hatte. Hier vibrierte geradezu alles vor Kunst und Kultur. Nachdem Penelope die Sonntagszeitungen gelesen und so viel Kaffee getrunken hatte, dass sie glaubte, Iris den ganzen Tag ertragen zu können, setzte sie sich in die U-Bahn Central Line, Richtung Bethnal Green, spazierte zum Appartement ihrer Mutter in der Bonner Street, führte sie zum Mittagessen aus und stieg anschließend in die U-Bahn Richtung Mansion House/Embankment. Wieder und wieder erklärte Iris, es gebe nichts Schöneres als die Themse am Sonntagnachmittag.
Wie soll ich auf Bridport zu sprechen kommen?, fragte Penelope sich und nahm den Arm ihrer Mutter, die in eine flauschige weiße Jacke gehüllt war – als sei sie eine Taube. Aber Iris Mortimer war beileibe nicht friedfertig. Ihr Arm wirkte zwar zerbrechlich, doch ihre knochigen Finger konnten erstaunlich fest zupacken.
Penelope musterte Iris verstohlen. War sie guter Laune? Schwer zu sagen. Ihre Mutter lächelte nicht, was aber nicht außergewöhnlich war. Ihr schmales, runzliges Gesicht wirkte freudlos und war Penelope sehr vertraut. Seit kurzem strich Iris sich – warum auch immer – hin und wieder über ihr gelocktes weißes Haar und brummelte leise und unverständlich vor sich hin, als wären die Gedanken, die sie bewegten, konkreter als die Realität. Vielleicht war es ja so. Penelope war sich nicht einmal sicher, ob das ein schlechtes Zeichen war. Normalerweise kam sie gut damit zurecht und beachtete dieses Gemurmel nicht weiter. Sich mit ihrer Mutter zu unterhalten – insbesondere über Dorset – war seit jeher schwierig. Ihre Unberechenbarkeit und ihr scharfer Ton würden sie bis zum Ende ihrer Tage begleiten. Penelope konnte dieses Verhalten nicht nachvollziehen. Vielleicht sollte sie dem Gemurmel mehr Gehör schenken.
»Neumodischer, seelenloser Unsinn.«
Penelope folgte Iris’ blassblauem Blick. Hinter der granitfarbenen Uferbalustrade spannten sich die Brücken über die schlammige grüne Themse, und die aneinandergereihten Gebäude verliehen dem Strom eine gewisse Würde. Missbilligend wandte Iris den Blick nach Westen zur Millennium Bridge. Penelope seufzte. Wirklich neumodisch. Sie hatten diesen Spaziergang schon einmal gemacht. Nervös schob sie eine Haarsträhne zurück.
»Es gibt Leute, die reisen meilenweit, nur um sich das hier anzusehen«, sagte sie.
»Manche wissen es nun mal nicht besser.«
Das stimmte. Penelope drückte den Arm ihrer Mutter. Es gab Momente, da brachte Iris sie tatsächlich zur Weißglut, andererseits wollte Penelope diese zarte Frau, die sie zur Welt gebracht hatte, beschützen. Iris war nach wie vor gesund und kam ohne Hilfe zurecht. Doch es gab auch andere Zeiten … Vielleicht war ihre Mutter einfach nur müde. Oder es war einfach nur typisch für ihr Alter. Wie auch immer, sie spürte, dass sich ihre Beziehung veränderte. Sie fühlte sich für ihre Mutter verantwortlich – ja, wirklich –, und auf diesen Rollentausch war Penelope nicht vorbereitet.
Und nun … Iris hatte kein leichtes Leben gehabt, und Penelope wollte es ihr nicht noch schwerer machen, indem sie die Vergangenheit erwähnte. Erinnerungen konnten verhängnisvolle Dinge nach sich ziehen; sie konnten flüchtig sein, aber Vergangenes auch glasklar und verlockend wie eine blühende, duftende Wiese im April darstellen.
Sie spazierten auf die Brücke zu. Penelope glich ihren Schritt dem unsicheren Gang ihrer Mutter an. »Ich nehme an einer neuen Ausgrabung teil«, sagte sie und versuchte beiläufig zu klingen. »Ich werde morgen aufbrechen.« Dabei hatte sie noch nicht einmal ihren Koffer gepackt, geschweige denn irgendwelche sonstigen Vorbereitungen getroffen. Als wäre ich mir nicht ganz sicher, dachte Penelope flüchtig.
Ihre Mutter antwortete nicht. Stattdessen stieg sie die Stufen zur Millennium Bridge hinauf, und Penelope folgte ihr. Vor ihnen erhob sich St. Paul’s Cathedral mit ihrer schmutzigen Fassade und wies hinauf zum Himmel. Was mochte Iris denken? Hatte sie nicht geantwortet, weil es sie nicht interessierte – oder weil sie es bereits vergessen hatte? Wie sollte man das wissen?
Oben angekommen verschnauften sie einen Augenblick und sahen hinunter auf den Fluss mit all seinen Geheimnissen.
»Und wie geht es Marianne?«, fragte Iris.
Marianne – ein heikles Thema. Aber Penelope antwortete natürlich. »Gut. Sie ist augenblicklich in Italien.« Das Gedächtnis ihrer Mutter war offenbar selektiv. Ob sie sich wohl an das erinnerte, was sich in Italien zugetragen hatte? Vermutlich nicht.
»Schön«, antwortete Iris, »in Italien gibt es wunderbare Sonnenblumenfelder …«
Sonnenblumen. Du lieber Himmel! Noch mehr Erinnerungen! Sie gingen in Richtung Tate Modern, deren Backsteinfassade nur durch schmale Fenster unterbrochen war. Wahrscheinlich noch mehr neumodischer Unsinn, vermutete Penelope, und zwar innen wie außen. Dabei hatte Iris immer ein ausgeprägtes Interesse für die Kunst besessen … Sogar ein viel zu ausgeprägtes Interesse. Verfluchte Sonnenblumen!
Die Sonne sank immer tiefer, sodass sie sich bald guten Gewissens in eine der Bars mit Blick auf den Fluss setzen könnten, um gemeinsam ein Glas moussierenden Frascati zu trinken. Vielleicht ergibt sich dann ja eine anregende, vertrauliche Unterhaltung, in der es weder um Schuld noch um emotionale Erpressung geht, dachte Penelope. Hauptsache keinen Streit. An schlechten Tagen hatte Penelope mit sich zu kämpfen. Vielleicht kämpfte ihre Mutter ja auch mit sich – Penelope war sich nie sicher.
Sie schlenderten weiter, vorbei an den üblichen Unterhaltungskünstlern – einem Mann im Rollstuhl, der auf einer Stahltrommel Spanish Eyes hämmerte und den Iris wütend anfunkelte, einem ausgelassenen Feuerschlucker in orangefarbenem Lycra, dem Iris ihre Missbilligung hörbar kundtat, sowie silbern und gold angemalten lebenden Statuen, von denen sie aber keine Notiz nahm. Jetzt haftete ihr Blick auf einem Punkt an einer sanften Biegung des graugrünen Flusses. Ja, Penelope wusste, dass Iris all die anderen Spaziergänge in ihrem Kopf wie einen Film abspulte – Hier haben wir dich immer im Kinderwagen ausgefahren, Schätzchen –, Spaziergänge mit Penelopes Vater, bevor Iris Mortimer die Wahrheit über ihren Mann erfahren hatte.
Selbst nach so vielen Jahren fiel es Penelope schwer, ihre Verbitterung zu verdrängen. Sie dachte vermutlich öfter daran, als ihr guttat. An ihn. Oder besser gesagt, an alle beide. Doch mit neunundvierzig war sie immerhin mit ihrem Leben einigermaßen zufrieden. Oder etwa nicht? Sie nahm sich bewusst zurück, um das schlingernde Boot auf Kurs zu halten. Oder hatte sie einfach nur Angst?
Sie erreichten die mit Kopfsteinpflaster versehenen Rundwege der Bernie Spain Gardens, und Penelope führte Iris zu einer der Bänke neben den Buchen. Ein begehrter Rastplatz – ruhig, mit einem wunderbaren Blick auf die Themse.
»Irgendwas Interessantes?« Iris warf Penelope einen schneidenden Blick zu. Na ja, ihre Augen hatten seit jeher einen leicht stechenden Schimmer. Sie beherrschte die mit Blicken ausgetragene Fechtkunst überzeugend.
Nur konnte Penelope diesmal nichts in ihren Augen lesen. »Was meinst du?«
»Die Ausgrabung«, antwortete Iris milde. »Etwas Interessantes?«
Sie hätte wissen müssen, dass ihre Mutter mehr erfahren wollte. Penelope überlegte. Was sollte sie antworten? Ja, der Grabungsort liegt nur fünf Meilen vom Hide Café entfernt, nur fünf Meilen entfernt von der Liebe meines Lebens, von dem Mann, den ich mir von ganzem Herzen ersehnt habe. Der einzige Mann, der meinen Kopf zum Summen, mein Herz zum Pochen, meinen Magen zum Kribbeln und meinen Geist zum Jubilieren gebracht hat …
»Schwer zu sagen.« Sie blickte hinüber zu der ausladenden Biegung der Themse und sah ein bunt angemaltes Schiff, auf dem – den Mädchen in schwarzen Kleidern und dem fröhlichen Gelächter der Passagiere nach zu urteilen – offenbar eine Art Cocktailparty im Gange war.
»Mittelalter?«, fragte Iris.
»Was meinst du?«
»Meinen sie, die Reste stammen aus dem Mittelalter?« Ihr Ton wurde schärfer. »Oder aus der Römerzeit?«
Du lieber Himmel! Wie oft schon hatte sich Penelope über ihre Arbeit ausgelassen. Oft genug auch nur, um die Minuten des Schweigens zu entschärfen, obwohl sich Iris in keiner Weise dafür interessierte. Und nun dieses! Noch eine Sekunde, und Iris würde ein winziges Detail der Geologie der Umgebung mit ihrer metaphorischen Maurerkelle durchleuchten.
»Na ja – wer kann in diesem Stadium schon Näheres sagen?«, fügte Penelope zur eigenen Absicherung an. Eine Taube näherte sich ihr. Vermutlich hoffte sie, ein paar Krumen zu erhaschen. Keine Chance!
»Du normalerweise.« Noch ein messerscharfer Blick. »Im Allgemeinen fällt dir doch immer etwas dazu ein.«
»Ach, wirklich?« Penelope gab sich weiterhin erstaunt.
»Warum sonst würdest du die Ausgrabung machen?«, fragte Iris – nicht zu Unrecht, wie Penelope sich eingestehen musste.
Penelope stellte sich eine Landschaft voller Supermärkte vor. Die Vergangenheit – unerforscht und für die Zukunft verloren. Nichts Großartiges zu erzählen.
»Du hast recht«, räumte sie ein und berichtete ihrer Mutter von dem Hobbyarchäologen, der römischen Mauer und den Mosaiksteinchen.
»Wo ist die Ausgrabung?«, verlangte Iris zu wissen. Sie erhob sich, zögerte, doch anstatt umzukehren – was Penelope erwartet hatte, schließlich hatte ihre Mutter einen ordentlichen Marsch hinter sich –, ging sie finster entschlossen weiter, bog links ab und steuerte auf Gabriel’s Wharf, das National Theatre und die Waterloo Bridge zu.
Penelope zuckte die Achseln. Sie schlug vor, die U-Bahn über Embankment zu nehmen und ihre Mutter nach Hause zu bringen. Sie könnten ein Taxi nehmen, und Iris würde wieder heil in ihre Wohnung zurückkehren. Aber woher hatte sie bloß diese Energie? »Hmm?«
»Ich will wissen, wo die Ausgrabungsstelle liegt.« Iris sah Penelope zornig an. »Oder ist auch das ein Geheimnis?« Als sie zu stolpern drohte, nahm Penelope sie beim Arm.
Einen Augenblick! »Mutter …«
»Alles in Ordnung. Bloß keine Aufregung!«
»Ich weiß.« Doch da ihr schmales Gesicht blasser als sonst wirkte, schob Penelope sie in ein Café am Flussufer. »Komm, wir trinken ein Glas, ja?«
»Hab ich’s denn nötig?«
Ja, vermutlich. »West Dorset«, sagte sie.
Iris zuckte zusammen. »In der Nähe von Marianne?«
»Na ja. Nicht ganz. Nein.«
Sie erwartete offensichtlich mehr Einzelheiten. Himmel noch mal. »Nördlich von Bridport«, fügte sie hinzu.
Sie merkte, dass Iris den Ellbogen anspannte. Seit wann ist sie so zerbrechlich? Seit wann hat sich ihr Haar so gelichtet, dass die Kopfhaut durchschimmert? Seit wann ist sie so gealtert?, fragte Penelope sich plötzlich. All das hatte sich vermutlich sehr langsam entwickelt, sodass sie es kaum bemerkt hatte.
»In seiner Nähe«, erwiderte Iris knapp.
Trotz ihres Alters konnte man Iris nichts vormachen. Sie wusste Bescheid. Penelope hatte Josh dreißig Jahre lang nicht ein einziges Mal erwähnt, und trotzdem war ihre Mutter bestens informiert.
»Ja.« Penelope bestellte Wein. Eine Flasche, entschied sie. Ihre Mutter hatte sie immer unter den Tisch getrunken, und selbst wenn sie sich in den letzten Jahren zurückgehalten hatte – heute herrschten besondere Umstände.
»Und?« Iris’ Frage hing in der Luft.
Penelope sah aus dem Fenster. Rechts von ihr stand der hoch aufragende Oxo Tower, zu ihrer Linken, hinter den Buchen, beherrschte das London Eye die Skyline. Auf der anderen Seite der Themse erkannte man in der Ferne den Palace of Westminster sowie den BT Tower, den Londoner Fernsehturm. »Ich werde mich nicht mit ihm treffen«, sagte sie. »Keinesfalls.«