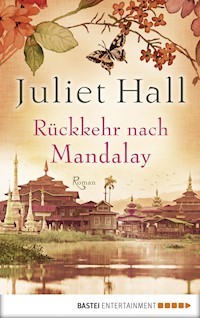5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die schönsten Sehnsuchtsromane von Juliet Hall
- Sprache: Deutsch
Jede Wahrheit findet eines Tages ihren Weg ans Licht ...
Nach dem plötzlichen Tod ihrer Eltern entdeckt Ruby ein Foto, das sie als Baby auf dem Arm einer fremden Frau zeigt. Später findet sie ihre Geburtsurkunde, auf der eine verspätete Registrierung vermerkt ist. Als sie dann auch noch auf einen Brief stößt, in der ihrer Mutter Unfruchtbarkeit attestiert wird, stellt sich Ruby die drängende Frage: Ist sie etwa nicht das leibliche Kind ihrer Eltern? Sie forscht nach und erfährt von einer alten Freundin, was einst geschah. Doch auf der Suche nach der ganzen Wahrheit kann Ruby nur eine Frau helfen: Julia, eine Krankenschwester, die im Spanischen Bürgerkrieg Buch über die Verbrechen Francos führte und ihr Wissen nun weitergeben will ...
Eine gefühlvoll packende Geschichte, die uns über unsere Wurzeln nachdenken lässt.
Weitere Familiengeheimnis-Romane von Juliet Hall bei beHEARTBEAT: Das Erbe der Töchter. Ein letzter Tanz in Havanna. Das Leuchten des Safrans.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 659
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
Danksagung
Weitere Titel der Autorin
Das Erbe der Töchter
Das Leuchten des Safrans
Ein letzter Tanz in Havanna
Ein verzauberter Sommer
Eine letzte Spur
Emilys Sehnsucht
Rückkehr nach Mandalay
Über dieses Buch
Jede Wahrheit findet eines Tages ihren Weg ans Licht
Nach dem plötzlichen Tod ihrer Eltern entdeckt Ruby ein Foto, das sie als Baby auf dem Arm einer fremden Frau zeigt. Später findet sie ihre Geburtsurkunde, auf der eine verspätete Registrierung vermerkt ist. Als sie dann auch noch auf einen Brief stößt, in der ihrer Mutter Unfruchtbarkeit attestiert wird, stellt sich Ruby die drängende Frage: Ist sie etwa nicht das leibliche Kind ihrer Eltern? Sie forscht nach und erfährt von einer alten Freundin, was einst geschah. Doch auf der Suche nach der ganzen Wahrheit kann Ruby nur eine Frau helfen: Julia, eine Krankenschwester, die im Spanischen Bürgerkrieg Buch über die Verbrechen Francos führte und ihr Wissen nun weitergeben will ...
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Juliet Hall unterrichtet Schreiben und organisiert Literatur- und Musikfestivals in ihrer Heimatstadt an der Küste von West Dorset, Großbritannien. Zu ihren liebsten Reisezielen gehört Italien, wohin sie die Leser mit ihrem Debüt „Das Erbe der Töchter“ führt. Nach Ausflügen durch viele wunderbare Städte Europas in „Emilys Sehnsucht“ und „Julias Geheimnis“ sowie nach Marokko in „Das Leuchten des Safrans“ bringt sie uns mit „Ein letzter Tanz in Havanna“ nach Kuba.
Juliet Hall
Julias Geheimnis
Aus dem Englischen von Barbara Röhl
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2013 by Juliet Hall
Titel der englischen Originalausgabe: „Bay of Secrets“
First published in the United Kingdom by Quercus Books, London under the pseudonym of „Rosanna Ley“
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2013/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Birgit Volk, Bonn
Covergestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven von © Traveller70/Shutterstock; © blackboard1965/Shutterstock; © R. de Bruijn_Photography/Shutterstock; © Adelveys/Shutterstock; © Makhh/Shutterstock; © Andrey Arkusha/Shutterstock; © S.Borisov/Shutterstock
eBook-Erstellung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-9530-3
be-ebooks.de
lesejury.de
Für Ana, in Liebe
Prolog
Es klingelte an der Tür – laut und ohne Unterbrechung.
Noch halb im Traum setzte sich Ruby auf. Sie war in einem schummrigen Nachtclub gewesen und hatte Saxofon gespielt. Someone to Watch Over Me. Sie rieb sich die Augen.
Es klingelte wieder. Noch nachdrücklicher.
Ruby stöhnte, als ihr der Traum entglitt. »Okay, okay. Ich komme schon.« Sie blinzelte und stellte fest, dass es gerade erst dämmerte. Sie warf einen Blick auf das Leuchtzifferblatt der Uhr, die auf James’ Seite stand, und sah ihn dabei an: blond, unrasiert, die Arme ausgestreckt, als wolle er selbst im Schlaf sagen: Was zum Teufel muss ich tun, um dich glücklich zu machen? – Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sie hatte immer gehofft, dass es einfach von selbst passieren würde.
Gestern Abend hatten sie sich schon wieder gestritten. Sie wusste nicht genau, worum es bei ihren Diskussionen eigentlich ging; sie wusste nur, dass sie das Gefühl hatte, als sei er in eine Richtung unterwegs, während sie sich mit Höchstgeschwindigkeit in eine andere entfernte. Sie lebten seit zwei Jahren zusammen. Die Frage war, wann sich ihre Wege endlich treffen würden.
Und warum klingelte es um sechs Uhr morgens an der Tür? So früh kam nicht einmal der Postbote.
Sie stolperte aus dem Bett. »James«, sagte sie, »wach auf. Da ist jemand an der Tür.«
»Wer denn?«, murmelte er schlaftrunken.
Wahnsinnig komisch. Ruby schnappte sich ihren Bademantel und zog ihn an. Bibbernd tappte sie den Flur entlang und fuhr sich durch das zerzauste Haar. Sie hätte das letzte Glas Wein gestern Abend nicht mehr trinken sollen. Sie hatte sich nach der Arbeit mit Jude auf einen Drink getroffen. Am Ende hatten sie die ganze Welt gerettet und dabei eine ganze Flasche geleert. Und als sie nach Hause gekommen war …
Vor der Tür standen zwei Personen. Durch das Glas konnte sie ihre Umrisse erkennen: ein Mann, eine etwas kleinere Frau. Sie sah ein verschwommenes kariertes Muster, etwas Dunkles. Wer klingelte um diese frühe Stunde bei anderen Leuten? Eine bange Vorahnung beschlich sie, und sie bekam weiche Knie.
Sie öffnete die Tür.
1. Kapitel
Das Haus sah noch genauso aus wie früher: roter Backstein, weiße Haustür, abgeblätterte Fensterrahmen. Ruby wechselte einen Blick mit Mel. »Danke fürs Fahren«, sagte sie. Hätte sie das auch allein geschafft? Sie dachte an James in London und die verschiedenen Richtungen, die sie einzuschlagen schienen. Ja, schon. Aber es wäre viel schwerer gewesen.
»Ich setze dich doch nicht einfach nur hier ab«, erklärte Mel. »Ich komme mit rein und helfe dir.«
»Helfen?«
Aber Mel war bereits aus dem Auto gestiegen. Ruby folgte ihr.
»Du brauchst aber nicht …«, begann sie.
»Red keinen Unsinn.« Mel öffnete das Gartentor und nahm Rubys Arm, während sie den Weg hinaufgingen. Der Rasen war seitdem nicht gemäht worden, und weil sich auch niemand um den Garten gekümmert hatte, wucherten die übrigen Pflanzen mittlerweile ebenfalls wild, und überall spross das Unkraut. Das geschah schnell.
Aber Ruby spürte auf einmal eine große Erleichterung. Mel war ihre älteste Freundin und genau das, was sie jetzt brauchte. Sie war fünfunddreißig Jahre alt, aber in diesem Moment fühlte sie sich wie ein Kind. Sie drückte Mels Arm. Es war zwei Monate her. Jetzt war es an der Zeit, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und die ersten Schritte in ein Leben danach zu tun.
An der Haustür schloss Ruby die Augen und sog den Duft des Jasmins ein, den ihre Mutter hier vor Jahren gepflanzt hatte. Der betörende Geruch der winzigen weißen Blüten umfing sie und schien sie voranzuschieben. Du kannst das.
Sie steckte den Schlüssel ins Schloss und hörte im Geist die Stimme ihrer Mutter. Du musst ein bisschen daran ziehen und ruckeln. Die Tür öffnete sich widerstrebend.
Mel blieb zurück; sie begriff, dass Ruby zuerst hineingehen musste. Ruby drückte die Schultern durch, trat über die Briefe und Wurfsendungen hinweg, die auf der Fußmatte gestrandet waren, und nahm zum ersten Mal, seit es passiert war, wieder den Geruch ihrer Eltern und ihres Zuhauses wahr.
Natürlich war Ruby seit dem Unfall schon in Dorset gewesen. Zum Begräbnis ihrer Eltern war sie zusammen mit James aus London gekommen. Jetzt dachte sie seufzend an die gemeinsame Fahrt im Auto zurück und an James’ Gesichtsausdruck. Die Lippen ernst zusammengepresst, hatte er den Blick fest auf die Straße gerichtet und kaum einen Blick für die Frau neben sich übrig gehabt. Nachdem in der Ferne die vertrauten grünen Hügel von Dorset in den Blick gekommen waren, hatte Ruby kaum mehr bemerkt, wie der Wagen die Meilen fraß. Die Freude der Heimkehr hatte sich in eine furchtbare Art von Leere verwandelt, und sie war nicht in der Lage gewesen, das Haus zu betreten, nicht einmal mit James an ihrer Seite. Wie lange war es her, seit sie einfach Hand in Hand am Fluss spazieren gegangen waren oder geredet hatten – richtig geredet, so als wolle jeder wirklich hören, was der andere zu sagen hatte? Und jetzt das. Armer James. Er hatte nicht gewusst, wie er damit umgehen sollte, wie er mit ihr umgehen sollte. Er hatte sie angesehen, als kenne er sie nicht mehr. Und so war es im Grunde ja auch. Es klang ein wenig verrückt, aber sie war jemand anderer geworden, seit sie die beiden verloren hatte.
Nach dem Begräbnis waren sie nach London zurückgefahren, Ruby hatte sich dem schrecklichen Nachspiel gestellt. Sie hatte Beileidskarten von Freunden und Bekannten ihrer Eltern gelesen, Karten von Menschen, die sie kaum gekannt hatte, und von einigen, die sie kannte, darunter Frances, die älteste Freundin ihrer Mutter, die bei der Beerdigung so nett gewesen war. Sie hatte Ruby ihre Adresse und ihre Telefonnummer gegeben und ihr ihre Hilfe angeboten, wann immer sie sie brauchen sollte. Dann waren die Testamentseröffnung gefolgt und die Abwicklung der Angelegenheiten ihrer Eltern, die Ruby irgendwie abgeschlossen hatte, indem sie aus einer Ecke ihres verzweifelten Selbst neben dem Kummer vorübergehend eine kalte Sachlichkeit zutage förderte.
Auf diese Weise schrieb sie auch den Artikel fertig, an dem sie gearbeitet hatte – ein Exposé über eine Hotelkette und das Recyceln von Tischwein. Im Anschluss daran hatte sie sich in das nächste Projekt gestürzt und dann in das übernächste. Ihre Freunde hatte sie kaum noch gesehen. Sie war nicht mehr ins Sportstudio gegangen und hatte sich keinen der gelegentlichen Mädchenabende mit Jude, Annie und den anderen mehr erlaubt, nach denen sie sich normalerweise in jeder Hinsicht besser fühlte. Sie arbeitete einfach. Es war, als bräuchte Ruby, solange sie ständig schrieb, Menschen interviewte und ihre Geschichten recherchierte, nicht über ihr eigenes Leben nachzudenken, über das, was ihren Eltern – und ihr – zugestoßen war. Sie funktionierte vollkommen automatisch. Und dabei blieb auch James irgendwie auf der Strecke und ihre Beziehung, die langsam zerbrach.
Doch Ruby war sich nicht sicher, ob sie sie schon loslassen konnte. Sie wusste, dass sie in das Haus in Dorset fahren musste, die Sachen ihrer Eltern sortieren und entscheiden, was aus dem Haus werden sollte, nachdem sie nicht mehr da waren. Aber wie sollte sie das fertigbringen? Wenn sie sich damit befasste, dann wäre das, als gebe sie zu … Dass es wahr war. Dass sie sie wirklich verlassen hatten.
Gestern Abend hatte sich die Situation zugespitzt. Ruby hatte die Geschichte, an der sie arbeitete, fertiggeschrieben und dann ein langes Bad genommen. Denn sie hatte das Gefühl, ihr Kopf würde platzen. Nachher hatte sie sich mit ihrem Notebook, ihrem Saxofon und ihrer Gitarre aufs Sofa gesetzt und auf eine Inspiration gewartet, aber nichts war passiert. Sie spielte kaum noch Saxofon und hatte seit Monaten keinen Song mehr geschrieben. Und das lag nicht nur daran, dass ihre Eltern gestorben waren. Noch etwas anderes war in ihrem Leben völlig aus den Fugen geraten.
James war nach der Arbeit noch mit Kollegen aus gewesen und spät nach Hause gekommen. Er war müde und gereizt und verschmähte sogar das Abendessen, das sie für ihn gekocht hatte. Er fuhr sich durch sein blondes Haar und stieß einen langen Seufzer aus. »Ich kann ebenso gut gleich ins Bett gehen«, sagte er. Er berührte sie nicht.
Da riss ihr der Geduldsfaden, und sie verlor die Beherrschung. »Was hat es für einen Sinn, wenn wir zusammenbleiben, James?«, wollte Ruby wissen. »Anscheinend haben wir vollkommen unterschiedliche Vorstellungen vom Leben. Wir verbringen ja kaum noch Zeit miteinander.« Halb wünschte sie sich, er werde Einwände erheben, ihre Zweifel zerstreuen, sie in die Arme nehmen. Sie hatte keine Lust, ständig diese Streitgespräche mit ihm zu führen. Aber wie konnten sie weiter so verschiedene Leben führen? Etwas musste sich ändern.
Doch er hatte ihr nicht widersprochen. »Ich weiß nicht, was du willst, Ruby«, hatte er stattdessen erklärt. »Ich weiß es einfach nicht mehr.« Er hatte die Hände in die Taschen gesteckt. Ruby fragte sich, was er damit verhindern wollte. Vielleicht, dass sie sich nach ihr ausstreckten?
Ja, was wollte sie? Und was wollte er, da sie schon einmal dabei waren? James liebte es, in London zu wohnen. Er ging gern in Bars und Restaurants und unternahm Städtereisen nach Prag oder Amsterdam – vorzugsweise zusammen mit ein paar seiner Kumpels. Abgesehen von ihrem gelegentlichen Mädchenabend sehnte Ruby sich momentan nach ein wenig mehr Ruhe und Alleinsein. Sie wanderte lieber auf den Klippen von Chesil Beach, statt in der Oxford Street zu shoppen. Er aß gern chinesisch, sie lieber italienisch. Er stand auf Hip-Hop, sie liebte Jazz. Er sah fern, sie las Bücher. Er spielte Fußball, sie tanzte gern. Die Liste in ihrem Kopf ließ sich beliebig fortsetzen. Sie konnte sich nicht einmal daran erinnern, wie oder warum sie sich damals in James verliebt hatte. Früher hatten sie gemeinsam Dinge unternommen. Sie hatten Spaß gehabt. Was war nur mit ihr los?
Ihr wurde bewusst, dass sie weinte.
Doch er wandte ihr den Rücken zu und bemerkte es nicht einmal.
Plötzlich erkannte Ruby, was sie tun musste. Sie musste sich eine Zeit lang freinehmen. Sie arbeitete nun schon seit über fünf Jahren als freie Journalistin. Doch ihre Eltern hatten ihr ein kleines Erbe sowie das Haus hinterlassen, sodass sie zumindest ein wenig Spielraum hatte. Und sie musste nach Hause, nach Dorset. Sie musste sich dem stellen, was passiert war. Sie war nun stark genug, um sich damit auseinanderzusetzen. Sie musste es einfach sein.
Die Sache mit dem Haus war jedoch nicht so einfach.
Ruby ging zuerst ins Wohnzimmer. Sie blieb wie angewurzelt stehen und sah sich um. Es war furchtbar, so als wären die beiden nur für ein, zwei Stunden weggegangen. Sie trat an den Tisch, fuhr mit einer Fingerspitze über das steife, blassgrüne Papier des Aquarells. Ihre Mutter hatte gemalt; ihre Pinsel standen noch in einem Glas mit fauligem Wasser, ihre Wasserfarben steckten in der alten Büchse, und ihre Palette lag auf dem Tisch. Dort stand auch eine Vase mit verwelkten Blumen. Ruby berührte sie, und sie zerbröselten unter ihren Fingern. Auf dem Tisch standen auch zwei Tassen mit eingetrockneten Teeresten. Der grüne Pullover ihres Vaters war über eine Sessellehne geworfen. Ruby hob ihn hoch, vergrub – nur ganz kurz – das Gesicht darin und nahm den Duft ihres Vaters wahr, das Rasierwasser mit der Zitrusnote, das sie ihm zu Weihnachten geschenkt hatte, gemischt mit Holzpoliturwachs und Kiefer. Sie waren noch so jung gewesen. Es war einfach nicht fair…
Was mochte er zu ihr gesagt haben? »Lust auf einen kleinen Ausflug mit dem Motorrad? Am Strand entlang? Komm schon. Was meinst du? Sollen wir mal wieder ein bisschen Staub aufwirbeln?«
Ihre Mutter hatte gemalt, aber sie hatte sicher lächelnd geseufzt, wie sie es immer getan hatte, und ihre Arbeit beiseitegeschoben. »Na gut, Liebling«, hatte sie vermutlich gesagt. »Wahrscheinlich tut mir eine Pause gut. Aber nur für eine Stunde.«
Einen Moment lang sah Ruby sie vor sich, sah, wie ihr das dunkle, von Grau durchzogene Haar beim Malen ins Gesicht fiel, wie sie die Augen zusammenzog, um ihr Motiv besser einzufangen, und sich das Licht auf ihren Silberohrringen spiegelte … Nein. Es war einfach nicht fair.
Mel schlang tröstend den Arm um sie. »Ich habe Milch im Auto«, sagte sie. »Ich hole sie und koche uns eine schöne Tasse Tee. Und dann fangen wir an, okay?«
»Okay«, schniefte Ruby und nickte. Deshalb waren sie hergekommen. Aber es waren so viele Sachen, und sie bedeuteten ihr alle so viel. Die Erinnerungen eines ganzen Lebens.
»Also, meiner Meinung nach«, erklärte Mel beim Tee, »müssen erst einmal ein paar von den persönlichen Gegenständen weg, bevor du klarer sehen kannst.«
Ruby nickte. Sie wusste genau, was ihre Freundin meinte.
»Denn du wirst das Haus doch verkaufen, oder?«
»Ja, natürlich.« Auch wenn … Bis jetzt hatte sie noch keine Entscheidung dafür oder dagegen getroffen. Aber im Zug nach Axminster hatte sie nachgedacht. Was hielt sie wirklich in London? Sie hatte ihren Job. Aber freiberuflich bedeutete auch, dass sie eigentlich überall arbeiten konnte, solange sie ihren Laptop dabeihatte. Nachdem sie zunächst für das lokale Käseblatt in Pridehaven und dann für das Hochglanzmagazin Women in Health in London gearbeitet hatte, war die Freiberuflichkeit ein riesiger Sprung gewesen. Doch nachdem sie ein Jahr lang mit beidem jongliert und neben ihrer normalen Arbeit bei der Zeitschrift auch freiberuflich gearbeitet hatte, hatte sie es geschafft. Heute konnte sie die Artikel schreiben, die sie wirklich schreiben wollte, und hatte die Freiheit, ihre eigenen Aufträge auszuwählen und zu recherchieren. Und sie konnte davon leben, auch wenn das Geld zugegebenermaßen manchmal knapp wurde.
Für Redaktionskonferenzen und Ähnliches war es schon praktisch, in der Stadt zu leben, aber es war keine zwingende Voraussetzung. Sie musste zwar ständig auf dem Sprung sein und alles stehen und liegen lassen, um dort hinzufahren, wo die nächste Geschichte oder der nächste Artikel sie hinführten, aber solange sie sich im Einzugsbereich eines anständigen Flughafens oder Bahnhofs befand, machte es keinen Unterschied. Ihre Texte konnte sie per E-Mail schicken. Gut, da waren ihre Freundinnen. Besonders Jude und ihre Frauenabende, bei denen sie gemeinsam eine Flasche Wein leerten und auf die ganze Welt schimpften, würden ihr fehlen. Und natürlich James. Sie dachte an ihn. Sie hatte ihn zuletzt gesehen, als sie mit dem Taxi zum Bahnhof gefahren war. Er hatte im Türrahmen gestanden, hochgewachsen und blond, und seine noch verschlafenen Augen hatten verwirrt dreingeblickt. Aber war James noch ein Teil ihres Lebens? Sie wusste es nicht.
»Also, wir nehmen uns ein Zimmer nach dem anderen vor. Immer drei Stapel, Liebes.« Mel strich sich eine rotbraune Haarsträhne hinters Ohr zurück. »Einen mit Sachen, die du behalten willst, einen für alles, was du verkaufen willst, und einen für die Wohlfahrt.«
So weit, so gut.
Als sie um die Mittagszeit Pause machten, um ein Bier zu trinken und ein Sandwich mit Käse und Chutney zu essen, hatte Ruby das Gefühl, dass sie wirklich vorankamen. Sie hatte viele Tränen vergossen, aber sie tat das, wozu sie zwei Monate lang nicht den Mut aufgebracht hatte. Endlich machte sie reinen Tisch. Es war schwer, aber heilsam.
Sie schaute sich um. Es war so warm, dass sie draußen am Gartentisch sitzen und die gute, frische Luft atmen konnten. Die altmodischen Duftwicken, die ihre Mutter geliebt hatte, blühten an dem verwitterten Spalier an der Rückwand des Hauses, und die Brise trug ihren Geruch herüber. Ihre Mutter hatte immer Sträuße davon für das Haus geschnitten. »Damit auch jeder weiß, dass es Sommer ist«, pflegte sie zu sagen. Ruby beschloss, dass sie heute Nachmittag dasselbe tun würde.
»Du willst sicher sobald als möglich zurück nach London.« Mel kaute ihr Sandwich und setzte eine furchtbar traurige Miene auf. Mel hatte ihre wahre Berufung im Leben verfehlt; sie hätte Schauspielerin werden sollen. Aber sie hatte mit achtzehn Stuart kennengelernt und sich heftig und unwiderruflich verliebt. Stuart war Buchhalter, und Mel hatte ihr eigenes Geschäft, das sie vor zehn Jahren gegründet hatte: den Hutladen in der High Street von Pridehaven, der sich inzwischen zu einem florierenden Konzern gemausert hatte. Mel hatte das Angebot erweitert und bot jetzt auch originelle Accessoires an: witzige Krawatten, bedruckte Seidenschals, handgemachte Lederhandtaschen und -gürtel. Doch am Schwerpunkt hatte sich nichts geändert. In Pridehaven gab es heute sogar ein eigenes Hutfestival, hatte sie Ruby vorhin erzählt. Vergiss London, Liebes, Pridehaven ist der neue Hotspot.
Vielleicht hatte Mel ja recht. »Ich bin mir nicht sicher, ob ich wieder zurückgehe.« Ruby streckte ihr Gesicht der Sonne entgegen. Dieser Garten hatte ihr gefehlt, die Möglichkeit, draußen zu sein. Und sie hatte es vermisst, am Meer zu leben.
Ruby hatte Dorset vor zehn Jahren verlassen. Sie war damals fünfundzwanzig Jahre alt und wollte unabhängig sein, Neues sehen, ein anderes Leben führen. Die Lokalgeschichten bei der Gazette, die Interviews mit kleineren Berühmtheiten aus der Gegend und ihre wöchentliche Gesundheitsseite langweilten sie. Um die Stelle bei Women in Health hatte sie sich beworben, weil sie ihr mondän und aufregend vorkam und sie damit etwas entfliehen konnte, was ihr inzwischen allzu provinziell erschien. Als sie James kennenlernte, hatte sie eine Zeit lang gedacht, dass sich alles wunderbar gefügt hatte. Er war attraktiv, intelligent, und sie fühlte sich wohl in seiner Gesellschaft. Sie hatten beide Jobs, die ihnen Spaß machten, und die Stadt lag ihnen zu Füßen. In London gab es alles, was man sich nur wünschen konnte – Theater, Musik, Kino, Galerien. Aber … Es hatte sich herausgestellt, dass auch Women in Health seine Grenzen hatte und Ruby im Grunde ihres Herzens keine Großstadtpflanze war. Sie hatte dieses Leben geführt und es genossen. Aber das war nicht das wahre Leben. Das wahre Leben fand zu Hause statt. Auch wenn ihre Eltern nicht mehr da waren, war Pridehaven tief in ihrem Herzen immer noch ihr Zuhause, und dort wollte sie sein – jedenfalls einstweilen.
Mel riss die Augen auf. »Und James?«
Ruby zeichnete mit der Fingerspitze ein Muster auf die Tischplatte.
»Aha«, sagte Mel.
»Genau.« Ruby seufzte.
»Ihr habt euch aber nicht getrennt?«
»Nein.« Jedenfalls noch nicht, dachte sie. Ich ruf dich an, war das Letzte gewesen, was er zu ihr gesagt hatte, als sie heute Morgen zum Bahnhof gefahren war. Aber wenn er das tat – was würde sie sagen? Er hatte nichts dagegen gehabt, dass sie hierher gefahren war. Aber war auch davon ausgegangen, dass sie nur ein, zwei Wochen fortbleiben würde – und nicht für immer.
»Was dann?«, erkundigte sich Mel.
Gute Frage. »Man könnte vielleicht sagen, dass wir eine kleine Pause einlegen.«
Mel kannte sie so lange – mehr brauchte sie nicht zu sagen. Aber Ruby würde nicht in diesem Haus wohnen, ob sie nun eine oder zwei Wochen blieb oder für immer. Es war viel zu groß für sie und von viel zu vielen Erinnerungen erfüllt. Hier würden sie die Geister ihrer Eltern auf Schritt und Tritt verfolgen.
Nach dem Mittagessen nahm Ruby das Schlafzimmer ihrer Eltern in Angriff. Sie hatte bereits alle Kleidungsstücke aus dem Schrank genommen und sie auf Stapel geworfen, als sie ganz hinten im Kleiderschrank, unter einem Sammelsurium von Handtaschen, einen Schuhkarton entdeckte. Er war mit einem dicken Gummiband verschlossen, und auf dem Deckel stand etwas geschrieben – vielleicht in Spanisch. Aber ansonsten sah der Karton ganz normal aus.
Ruby setzte sich auf den Boden. Sie hörte, wie Mel unten staubsaugte. Die Frau war ein Engel. Denn das hier fiel ihr so schwer, viel schwerer, als sie es sich je vorgestellt hatte.
Wenn dir so etwas passiert – wenn es früh am Morgen an deiner Tür klingelt, wenn du öffnest und zwei Polizisten vor dir stehen, die dir gleich sagen werden, dass deine Eltern tot sind –, dann fühlt sich das ganz anders an, als du es dir jemals vorstellen kannst. Dumme und unbedeutende Dinge waren ihr aufgefallen, zum Beispiel, dass die Beamtin eine gepolsterte Weste trug und dunkle Ringe unter den Augen hatte. Und dass es der 21. März war, Frühlingsanfang.
»Es gibt immer einen toten Winkel«, hatte der Beamte Ruby erklärt. »Deswegen sind Motorräder so gefährlich.« Er hatte sie entschuldigend angesehen. »Es ist nicht so, dass Motorradfahrer generell unvorsichtig sind. Meist liegt es an den Autofahrern.«
Es gibt immer einen toten Winkel…
»Sie haben nicht gelitten«, setzte seine Kollegin hinzu.
Ruby hatte sie angesehen. Wusste sie das genau? Ganz sicher?
Die Worte der Frau hatten ein Bild in ihr aufsteigen lassen – quietschende, qualmende Reifen, der Gestank von verbranntem Gummi. Ihre Arme, die seine Mitte umschlingen. Das Krachen von Metall auf Metall. Körper, die kopfüber durch die Luft geschleudert werden. Nicht irgendwelche Körper, sondern die ihrer Eltern. Und dann Stille. Gütiger Gott! Und sie sollten nicht gelitten haben?
Ruby schüttelte die Erinnerung ab. Man sagte, die Zeit heile alle Wunden. Aber wie lange dauerte das? Heilten ihre Wunden schon? An manchen Tagen war sie sich nicht sicher. Sie streckte die Hände aus. Wenigstens zitterten ihre Hände nicht mehr, und sie hatte auch aufgehört, gegen Türen zu laufen.
Vorsichtig löste sie das Gummiband von der Schachtel. Sie war nicht schwer genug, als dass Stiefel oder auch nur Schuhe darin sein konnten. Vorsichtig schüttelte sie den Karton. Es raschelte.
Hätte er nur das Motorrad nicht gekauft. Wie oft hatte sie das schon gedacht, seit es passiert war? Sie hatte ihn schließlich gewarnt, oder? Hatte sie ihm nicht die Meinung gesagt, weil er versuchte, seine versäumte Jugend nachzuholen? Er hatte kurz vor der Rente gestanden, da hätte er lieber übers Bowling- oder Kartenspielen nachdenken sollen, statt darüber, mit einem Motorrad durch die Landschaft zu rasen.
Ruby stieß den Atem aus. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass sie die Luft angehalten hatte. Sie war über das Wochenende hier gewesen. James hatte an diesem kühlen Wochenende Anfang März wieder einmal einen Ausflug mit seinen Jungs unternommen. Da hatte sie die beiden zum letzten Mal gesehen, und sie würde es wahrscheinlich nie vergessen.
»Hast du schon gehört, was es Neues gibt, Schatz? Das rätst du nie.« Ihre Mutter stellte einen frischen Becher Kaffee vor Ruby auf den Tisch und warf sich das Haar mit einer Kopfbewegung aus den Augen wie ein junges Mädchen.
»Nein, was denn?« Ruby erwiderte das Grinsen ihrer Mutter.
»Ach, er hat sich ein Rad gekauft. Kannst du dir das vorstellen? In seinem Alter?« Sie stemmte die Hände in die Hüften und versuchte, wütend auszusehen.
»Ein Rad?« Ruby hatte unwillkürlich eine hohe Lenkstange, einen schmalen Sattel und eine Querstange vor sich gesehen.
»Ein Motorrad.« Rubys Mutter nahm ihre Hand und drückte sie. »Ein Fahrrad wäre ihm nicht schnell genug. Alter Speedy Gonzales.«
»Du willst mich wohl auf den Arm nehmen.« Aber Ruby wusste, dass ihre Mutter keine Witze machte. Sie drehte sich auf ihrem Stuhl herum. »Dad? Bist du verrückt geworden? Was glaubst du, wie alt du bist?«
»Man ist nie zu alt, um Spaß zu haben, Schatz«, sagte er. Er hatte die Nase in der Zeitung vergraben, aber jetzt blickte er auf und bedachte sie mit einem seiner berühmten Augenbrauen-Wackler. »Bevor du auf die Welt gekommen bist, hatte ich eine Weile mal eine Triumph Bonneville 650. Ich wollte mir schon immer noch mal eine kaufen. Schuld ist Easy Rider, damit hat alles angefangen.« Er warf ihrer Mutter einen Blick zu. »Ich hab auch immer auf die Ledersachen gestanden.«
»Jetzt hör aber auf«, schimpfte ihre Mutter, aber sie war rot geworden, und zwar heftig. Die beiden sehen zehn Jahre jünger aus, hatte Ruby gedacht.
»Vielleicht sind das die männlichen Wechseljahre«, zog Ruby ihn auf. Sie besuchte die beiden gerne am Wochenende und wusste, dass sie sie ebenfalls gern zu Gast hatten. Trotzdem hatten sie nie Einwände gegen ihren Umzug nach London erhoben. Warum sollten sie auch? Sie hatten immer deutlich gemacht, dass sie ihre Berufswahl respektierten und nie versuchen würden, sie festzubinden. Die beiden hatten sie zu einem unabhängigen Menschen erzogen und immer damit gerechnet, dass sie flügge werden würde.
»Vielleicht wird es Zeit, dass er erwachsen wird.« Rubys Mutter ging am Sofa vorbei und zauste ihrem Mann das Haar. Der streckte plötzlich die Hand nach oben und packte sie am Handgelenk. Sie versuchte, sich loszumachen, aber er ließ sie nicht, und schließlich rangen und kicherten sie wie Jugendliche.
»Ihr zwei aber auch immer«, sagte Ruby. Sie war aufgestanden, hatte die Arme um die beiden gelegt und gespürt, wie sie in eine ihrer besonderen Umarmungen gezogen wurde. In diesem Moment hatte sie sich gewünscht, sie könnte so leben wie die beiden. Vielleicht mit James. Oder mit jemand anderem …
Am nächsten Tag hatte er ihr das Motorrad gezeigt. Es war rot und schwarz und ziemlich groß, und sie hatte mit verschränkten Armen zugesehen, wie ihr Vater die Straße auf und ab donnerte. »Wenn du willst, kannst du mitfahren, Schatz«, hatte er gesagt. »Ich habe meinen Motorradführerschein schon jahrelang.«
Ruby hatte ihm eine Hand auf den Arm gelegt. »Du fährst doch vorsichtig, oder, Dad?« Die Vorstellung, dass er auf einem Motorrad über die schmalen Straßen von West Dorset raste, gefiel ihr nicht. Dass ihre Mutter auf dem Sozius sitzen würde, ebenso wenig.
»Natürlich.« Er zwinkerte ihr zu. »So leicht wirst du mich nicht los, mein Mädchen.«
Aber genauso war es gekommen. Ruby blinzelte die Tränen weg. Sie hatte ihn verloren.
Sie holte tief Luft und öffnete die Schuhschachtel.
Seidenpapier und ein paar Fotos. Sie blätterte sie durch und stellte fest, dass sie niemanden darauf kannte. Aber wer waren diese Leute dann, und warum waren die Fotos hier? Die Bilder sahen auf jeden Fall recht interessant aus. Sie nahm eines in die Hand und betrachtete es genauer.
Sie sah einen Mittelmeerstrand und ein junges Paar, das an die orangefarbene Wand eines Strandhauses gelehnt war. Blassgoldener Sand, ein türkisfarbenes Meer, ein paar schwarze Felsen und ein rot-weiß gestreifter Leuchtturm bildeten den Hintergrund. Das Mädchen trug ein fließendes Maxikleid mit Aztekenmuster und weiten Ärmeln. Es hatte langes blondes Haar und lachte. Der junge Mann hatte olivfarbene Haut, krauses schwarzes Haar und einen Bart. Er hatte seinen Arm wie beiläufig um ihre Schultern gelegt.
Ruby griff nach einem weiteren Schnappschuss. Er zeigte dasselbe Mädchen – es wirkte nicht älter als Mitte zwanzig, hätte aber auch jünger sein können – auf dem Fahrersitz eines VW-Campingbusses in psychedelischen Farben. Ruby lächelte. Sie fühlte sich sofort in die Flowerpower-Zeit zurückversetzt. Das war natürlich lange vor ihrer Zeit gewesen, aber sie verstand, was daran so anziehend gewesen war. Das nächste Bild zeigte eine Gruppe Hippies am Stand. Sie saßen auf den schwarzen Felsen, und jemand spielte Gitarre. Vielleicht war es wieder dasselbe Mädchen, aber die Person war so weit entfernt, dass man es nicht erkennen konnte. Auf dem nächsten Bild war noch einmal dasselbe Mädchen am Strand zu sehen, diesmal allerdings mit einem kleinen Baby auf dem Arm. Einem Baby.
Etwas – Trauer vielleicht? – schnürte Ruby den Hals zu. Ihre Mutter würde Ruby nie mit einem Baby auf dem Arm sehen. Sie würde niemals Großmutter werden und ihr Vater niemals Großvater. Sie würden nicht miterleben, wie Ruby heiratete und Kinder bekam. Sie konnten nicht mehr stolz auf sie sein, wenn es einer ihrer Artikel bis in eine Sonntagsbeilage schaffte. Sie würden zu keinem ihrer Jazzauftritte mehr kommen, bei denen sie in Kneipen Saxofon spielte und ihre eigenen Songs mit Coverversionen all der berühmten Jazzstücke mischte, die ihre Eltern so liebten. Allerdings war sie seit ihrem Umzug nach London nicht mehr oft aufgetreten; sie hatte die Musik ziemlich schleifen lassen. Jedenfalls würden ihre Eltern bei all dem nicht mehr dabei sein, sie würden ihre Zukunft nicht mehr miterleben.
Ruby blinzelte die Tränen weg. Sie legte die Fotos neben sich auf den Boden und untersuchte den restlichen Inhalt der Schachtel. Sie fand ein Stück blassrosa Seidenpapier und faltete es auseinander. Eine bunte Hippie-Kette fiel heraus. Ruby ließ sie durch ihre Finger gleiten. So etwas hatte man in den Sechzigern und Siebzigern getragen. So etwas … Sie nahm noch einmal eines der Fotos zur Hand. Das Mädchen trug so eine Kette. Die Perlen waren alt, zart und zerbrechlich. Vielleicht war es ja wirklich dieselbe Kette.
Behutsam wickelte sie ein weiteres Seidenpapier-Päckchen auf, das am Boden der Schachtel lag, und entdeckte ein kleines, weißes Häkelmützchen – so klein, dass es nur … Sie runzelte die Stirn. Es würde nur einem Baby passen. Sie nahm es in die Hand – es war so weich – und legte es zu den Perlen. Dann schlug sie das letzte kleine Päckchen auseinander. Ein Stück graues Plastik, ein Plektrum. Genauso eines, wie sie es beim Gitarrenspielen benutzte. Aber warum legte jemand ein Gitarrenplektrum in eine Schuhschachtel? Sie betrachtete das kleine Häufchen aus anscheinend beliebig zusammengewürfelten Gegenständen. Warum befanden sie sich in einer Schuhschachtel im Kleiderschrank ihrer Eltern?
»Ich habe einen Stapel Papiere auf den Wohnzimmertisch gelegt«, sagte Mel, als sie die Treppe hinaufkam. »Du solltest sie dir vielleicht ansehen. Um ehrlich zu sein, hättest du sie schon vor Wochen durchgehen sollen.«
Ruby sah zu Mel auf, die in der Tür stand. »Okay«, gab sie zurück.
»Hast du etwas Interessantes gefunden?«
»Ach, nur eine Schuhschachtel mit ein paar Sachen.«
»Sachen, die keine Schuhe sind?« Mel setzte sich aufs Bett, und Ruby zeigte ihr die Fotos, die Hippie-Kette, das Plektrum und das weiße, gehäkelte Babymützchen.
»Was glaubst du, was das alles zu bedeuten hat?«, fragte sie.
Mel betrachtete das Foto von dem Mädchen und dem Baby. »Sieht aus, als gehörten die Sachen ihr.«
»Ja. Aber wer war sie?«
»Dann kennst du sie nicht?«
»Ich kenne niemanden auf den Fotos, und ich kann mich auch nicht erinnern, dass Mum oder Dad irgendwann einmal etwas von einem Hippie-Mädchen erzählt hätten.«
Mel zuckte die Achseln. »Vielleicht hat deine Mum die Sachen ja für jemand anderen aufbewahrt?«
»Vielleicht.« Aber für wen?
»Vermutlich hat es gar nichts zu sagen. Du solltest sehen, was ich alles unten in meinem Kleiderschrank habe.« Mel warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Ich muss los, Liebes. Stuarts Mum kommt zum Abendessen, und ich war noch nicht einmal im Supermarkt.«
Ruby lachte. Es wäre schön, Mel und Stuart wieder in der Nähe zu haben, dachte sie, und auch einige andere alte Freunde aus der Zeit, bevor sie weggezogen war. Es war genau das, was sie brauchte.
Vielleicht hatte es mit den Sachen ja tatsächlich nichts auf sich, dachte sie. Aber sie legte alle Gegenstände zurück in die Schuhschachtel und auf den »Behalten«-Stapel. Nur für den Fall, dass die Sachen wichtig waren. Dass ihre Eltern aus irgendeinem Grund gewollt hatten, dass sie sie fand.
An diesem Abend ging Ruby in das Zimmer, das auch nach ihrem Auszug weiter ihres gewesen war. An der Kommode lehnte noch eine ihrer alten Gitarren. Sie hatte sie hiergelassen, zum einen, weil sie noch eine andere, neuere hatte, die sie mit nach London genommen hatte, zum anderen aber auch, damit sie spielen konnte, wenn sie ihre Eltern besuchte. Man weiß nie, wann einem ein Song in den Kopf spaziert und man ein paar Akkorde anschlagen muss.
Jetzt nahm sie das Instrument in die Hand und setzte sich damit aufs Bett, wie sie es als Mädchen so oft getan hatte. Ganz automatisch neigte sie den Kopf leicht zur Seite, um besser hören zu können, und begann automatisch mit dem Stimmen. So klang es besser. Sie legte die Gitarre beiseite und nahm ihr Saxofon aus dem Kasten. Es war ziemlich umständlich gewesen, es im Zug mitzunehmen, aber sie hatte es nicht zurücklassen können. Es war der erste Gegenstand, den sie aus einem Feuer retten würde. Früher hatte sie es als etwas empfunden, dass sie ebenso dringend zum Leben brauchte wie ihre Arme. Ob es jemals wieder so werden würde? Seit sie mit James zusammen war, seit sie in London lebte und keine Band mehr hatte, mit der sie regelmäßig spielte, hatte sie nicht mehr viel geübt. Aber vielleicht konnte sie sich ja wieder mit den Jungs von der Band hier in Pridehaven zusammentun und wieder im Jazz-Café spielen. Warum nicht?
Ruby berührte die glänzenden Klappen, und das Saxofon schimmerte zur Antwort träge auf. Als sie damals zu spielen begann, hatte sie es kaum festhalten können. Der einzige Laut, den sie erzeugte, war ein jämmerliches Quieken gewesen. »Haben wir Mäuse?«, pflegte ihr Vater mit hochgezogener Augenbraue zu fragen. Heute jedoch … Hätte sie ohne das Instrument nicht leben können.
Plötzlich kam ihr eine Zeile in den Kopf, und sie kritzelte sie in das Notizbuch auf dem Nachttisch. Ihre Mutter war ein glücklicher Mensch gewesen, oder? Aber sie hatte auch Jazz und Blues geliebt. Ob beim Kochen, Putzen oder Malen, immer hatte sie ihre alten Alben und CDs gehört. Und ihre Lieblingssongs waren immer die traurigen gewesen. »The Nearness of You.« Ruby seufzte. Ihre Mutter fehlte ihr. Sie fehlten ihr beide. Sie sehnte sich so sehr nach ihnen, dass es schmerzte. Sie sehnte sich nach einer Umarmung. Danach, das Lachen ihres Vaters zu hören. Die Stimme ihrer Mutter.
Zärtlich legte sie das Saxofon in seinen Kasten zurück. »Ich wünschte, du würdest mich so berühren«, hatte James einmal gesagt. Ja, aber das Saxofon hatte auch nie zu viel von ihr verlangt. Und es gab etwas zurück.Es gab jeden Atem, jedes Gefühl und jede Stimmung wieder, die Ruby hineinblies.
»Bist du etwa eifersüchtig?«, hatte sie ihn geneckt. Das war ganz zu Beginn ihrer Beziehung gewesen. Bevor sie aufhörten, einander zu necken und bevor sie das Spielen aufgab.
»Natürlich«, hatte er gelacht. »Es kommt dir so nahe. Wenn du auf dem Ding spielst, entschwebst du in eine ganz andere Welt, ohne mich.«
Es stimmte. Das Saxofon berührte einen Punkt tief in ihrem Inneren. Es ließ sie von einem dunklen Nachtclub in den frühen Morgenstunden träumen. War es das, wo sie hinwollte? Ja, etwas in ihrem Inneren wollte dorthin. Obwohl es wehtat, in eine andere Welt zu entschweben. Sie schloss die Augen, während ein neuer Song in ihrem Kopf Gestalt annahm. Vor ihrem inneren Auge entstand ein Muster aus Steigen und Fallen, sie hörte den Takt, spürte seinen Rhythmus. Er erwachte zum Leben. Die Textzeile, die sie geschrieben hatte, passte genau. Ja, dachte sie, in eine andere Welt entschweben … Manchmal gab es nichts, was sie sich mehr wünschte.
Ungefähr eine Stunde später ging Ruby nach unten, um sich eine heiße Schokolade zu machen. Weil sie noch nicht müde genug war, um schlafen zu gehen, begann sie, die Papiere durchzusehen, die Mel im Sekretär ihrer Eltern gefunden hatte. Es handelte sich um Briefe von Banken und vom Elektrizitätswerk. Die Schreiben, in denen es um Hypotheken, Zinsen und Gemeindesteuern ging, waren uralt; die konnte sie vermutlich alle getrost wegwerfen. Sie schlug einen ramponierten Pappordner auf. Ärztliche Bescheinigungen. Ihr eigener Impfpass – schon lange nicht mehr aktuell. Sie entdeckte einen Brief, der von ihrem alten Hausarzt stammte, und überflog ihn. Es konnte ja sein, dass sich in diesem ganzen Kram doch etwas Wichtiges verbarg. Ihre Eltern waren beide nicht die ordentlichsten Menschen der Welt gewesen.
Moment mal … Sie betrachtete die Schrift genauer. Was war das denn? Sie setzte sich aufrecht hin, blinzelte und las es noch einmal. Im Anschluss an unsere Konsultationen und Untersuchungen bestätige ich die Diagnose »Unfruchtbarkeit ungeklärter Ursache«… Unfruchtbarkeit? Sollten Sie die Möglichkeit der besprochenen Fruchtbarkeitsbehandlung nutzen wollen, rufen Sie bitte in der Praxis an, um Ihren ersten Termin zu vereinbaren. Was in aller Welt hatte das zu bedeuten? Ruby überprüfte das Datum des Briefs. Er war sieben Monate vor ihrer Geburt verfasst worden.
Sie las den Brief noch einmal – und dann noch einmal. Aber an seinem Inhalt änderte sich nichts. Sieben Monate vor Rubys Geburt hatte man Rubys Eltern erklärt, dass einer von ihnen steril sei und dass sie keine Kinder bekommen könnten. Unfruchtbarkeit ungeklärter Ursache. Ganz gleich, wie man es betrachtete; es ergab keinen Sinn. Denn sieben Monate später hatte ihre Mutter Ruby zur Welt gebracht.
Ruby betrachtete die Wicken, die in einer Vase auf dem Tisch standen. Das stimmte doch, oder?
2. Kapitel
20. MÄRZ 2012
Sollte sie– oder sollte sie nicht? In letzter Zeit hatte Vivien immer öfter darüber nachgedacht – öfter, als sie es eigentlich wollte. Es störte ihr inneres Gleichgewicht und gefährdete ihren Seelenfrieden. Es war lange her. Also:Sollte sie die Wahrheit sagen oder nicht?
Um sich abzulenken, betrachtete sie die Blumen, die sie in ihrem verwilderten Garten gepflückt hatte, mit kritischem Blick. Ein dorniger, knallgelber Forsythienzweig, ein paar Zweige weichblättriger Salbei, der noch Knospen trug, eine einzige, frühe, cremefarbene Rose. Sie steckte sie so um, dass der duftende Salbei über den Rand des Terrakotta-Topfes hing. Von Gelb zu Grün zu Cremeweiß und zurück zu Gelb: Farben, die sich mischten, so hatte Vivien es gern. Malen, was man sieht, und nicht, was man zu sehen glaubt.
Ein berühmter Künstler hatte das gesagt – Monet oder vielleicht Van Gogh. Wahrscheinlich war es beim Impressionismus darum gegangen. Man sträubte sich dagegen, so zu malen, wie es das Hirn von einem verlangte: ein flaches Meer zum Beispiel, mit weißen Wellen. Stattdessen malte man es so, wie die eigenen Sinne es wahrnahmen: bewegte, gekräuselte, wogende Linien, gesprenkelt mit Lichtpunkten und Schattenflecken, alle Farben – Grau, Grün, Weiß, Blau, Dunkelviolett –, getrennt und ineinanderlaufend, sich mit der Brise und der Strömung verschiebend und auf Sandstränden oder grauen Felsen zu Kringeln auslaufend. Bei ihren Blumenaquarellen ging Vivien gern noch einen Schritt weiter und mischte die Farben so, dass sie verschwammen und ineinanderflossen. Nass in Nass, sodass alles im Fluss blieb und eins wurde.
Sollte sie– sollte sie nicht? Auf ganz ähnliche Art gab es bei dieser Entscheidung – die nichts mit Kunst zu tun hatte – keine klare Linie, die Grenzen waren verschwommen. Manche Wahrheiten waren so. Zuerst einmal würde sie sehr tapfer sein müssen.
Vivien kramte in ihren Farben herum. Sie zog Aquarellfarben hervor, weil sie die Transparenz, das opake Finish und das Fließvermögen besaßen, die sie anstrebte. War sie tapfer? Eigentlich nicht. Sie war allerdings dankbar. Gott, war sie dankbar!
Die Frage war nicht, ob sie es hätte tun sollen oder nicht. Wenigstens diese Entscheidung war eindeutig gewesen. Sie hatte gespürt, dass ihr nichts anderes übrig blieb – ihnen beiden. Jemand anderer hätte danach vielleicht einen anderen Weg beschritten. Aber nicht Vivien. Um sie war es geschehen gewesen. Widerstand zu leisten, lag nicht in ihrer Natur. Sie hatte schon immer mehr mit dem Herzen als mit dem Kopf entschieden. Und so …
Nein, die Frage war, ob sie ihr Geheimnis dem einen Menschen verraten sollte, der es vielleicht zu erfahren verdiente, oder nicht. Die schwierige Frage war, ob sie die Wahrheit sagen sollte. Denn manchmal war es schwer, die Wahrheit zu erzählen, und noch schwerer, sie anzuhören.
Für den Hintergrund wählte sie eine blasse, minzgrüne Lasur, so schwach, dass sie fast gar nicht vorhanden war, nur ein Hauch von Farbe, so leicht wie das Gefühl einer Gazestola auf ihren Schultern. Sie begann, die Farben zu mischen, und summte dabei leise einen Song von Joni Mitchell. »Little Green.« Er erinnerte sie an jenen Tag und würde es immer tun.
Das Dilemma, vermutete sie, war ein moralisches und bestand in der Frage, ob jeder ein Recht auf die Wahrheit hatte.
Im Allgemeinen sagte Vivien die Wahrheit und betrachtete sich als ehrlich, offen und geradeheraus. Und sie hatte auch dieses Geheimnis nie für sich behalten wollen – zumindest am Anfang nicht. Aber man musste an die Folgen denken. Schließlich gab es so etwas wie Notlügen – Unwahrheiten, die die Gefühle anderer schützten und verhinderten, dass sie verletzt wurden.
Schützte sie jemandes Gefühle? Verhinderte sie, dass jemand verletzt wurde? Vielleicht. Was würde passieren, wenn sie es erzählen würde? Dieser Gedanke machte Vivien Angst. Das war das Problem mit Geheimnissen; sie entwickelten ein verborgenes Eigenleben. Sie wählte einen breiten Pinsel aus und fuhr mit der Handkante über das Papier, um es zu glätten, damit sie beginnen konnte. Was konnte schlimmstenfalls geschehen?
Vivien hörte das Klappern der Haustür und Toms vertrautes Pfeifen.
»Wo bist du, meine Schöne?«, rief er.
Vivien lächelte. Ja, sie hatte Glück. »Bei der Arbeit«, antwortete sie. Sie befand sich im Wohnzimmer. Es war groß, es war unordentlich, und es war heimelig. Vivien hatte die Glastüren, die in den Garten führten, aufgerissen, und die Sonne setzte die abgeschabten Zotteln des Teppichs und das verblasste Rot ihres großen, alten, gemütlichen Sofas in Flammen und leuchtete den Staub aus, der sich auf den Holzmöbeln niedergelassen hatte. Die meisten Möbel hatte Tom geschreinert, zum Beispiel kurz nach ihrer Hochzeit das elegante Bücherregal aus Mahagoni. Der Tisch, an dem sie arbeitete, war zugestellt mit Farbtuben, einer Palette, einem Glas mit Pinseln und Wasser und der Blumenvase. Der Tisch stand so voll, dass man das wunderschöne, gemaserte Walnussholz darunter kaum erkennen konnte. Doch Vivien wusste, dass es da war, und das war ein gutes Gefühl. Sie liebte Toms Möbel und die manchmal wochenlange gewissenhafte Arbeit, die Liebe und Zuneigung, die er in seine Stücke steckte.
»Arbeit? An so einem sonnigen Tag?« Tom stand in der Tür. Er zog seinen Pullover aus, als wolle er demonstrieren, wie warm es war, und warf ihn über eine Sessellehne. Er hatte recht, für März war es ziemlich warm.
Manchmal wirkte Tom nicht viel älter als damals vor über dreißig Jahren, als sie sich kennengelernt hatten. Allerdings wurde sein Haar langsam grau, und er war ein wenig weltverdrossen. »Die Leute wollen keine handgemachten Möbel mehr«, sagte er manchmal wehmütig. »Sie wollen billige Möbel aus der Fabrik. Wer könnte es ihnen verdenken?« Dann legte Vivien die Arme um seinen traurig aussehenden Rücken, und sie nahm es diesen Leuten leidenschaftlich übel. Sie würde nie aufhören, seine Arbeit zu lieben, auch wenn er heutzutage mehr Zeit damit verbrachte, Küchenschränke und Fußleisten zu reparieren, als damit, Tische und Kommoden herzustellen. Trotzdem hatte Tom noch immer dieselben funkelnden braunen Augen und den Sinn für Spaß wie damals, als sie sich in ihn verliebt hatte.
Vivien hatte nie mit jemand anderem als Tom zusammen sein wollen.
Sie erinnerte sich daran, wie sie ihn zum ersten Mal gesehen hatte, an die blecherne Jahrmarktsmusik, das Zischen der Karussells, das Lachen der Jungen und das Kreischen der Mädchen. Der süße, klebrige Geruch von Zuckerwatte und kandierten Äpfeln hing in der Luft, und neonbunte Glühbirnen glitzerten im Dämmerlicht des Sommerabends. Jahrmarkt in Charmouth Fair.
Vivien war sechzehn. Sie und ihre Freundin Lucy campten auf einem Feld hinter einem Pub im Dorf. Sie machten zum ersten Mal allein Urlaub in Dorset. Ihren Eltern hatten sie erzählt, dass sie wandern und in Jugendherbergen übernachten würden, aber in Wahrheit trampten sie und blieben nach Lust und Laune, wo es ihnen gefiel.
Bei dieser Gelegenheit hatten Lust und Laune sie nach Charmouth geführt. Sie hatten gehört, dass in der Stadt Jahrmarkt war. Daher saßen sie mit Spiegeln und Wimperntusche auf ihren Schlafsäcken und machten sich zum Ausgehen fertig. Heute brauchten sie nicht um eine bestimmte Zeit zurück zu sein. Denn sie waren allein hier. Und sie waren frei …
Als sie zur Dorfwiese gingen und Vivien die Musik hörte, stieg ihre Aufregung. Es war nach acht Uhr, aber noch hell. Die meisten Familien waren schon nach Hause gegangen, doch auf dem Jahrmarkt ging es erst jetzt richtig los. Gruppen von Mädchen und Jungen waren unterwegs, junge Paare flanierten Hand in Hand, und die jungen Männer, die die Fahrgeschäfte betrieben, stolzierten über die Stege und machten den Mädchen schöne Augen.
Vivien und Lucy gingen zur Walzerbahn und sprangen in die silberne Gondel. Der junge Mann drehte den Wagen im Kreis, das Karussell fuhr schneller, und sie klammerten sich so fest an das metallene Handgeländer, dass ihre Knöchel weiß wurden. Sie warfen die Köpfe zurück und kreischten vor Lachen und Angst. Die wilde Fahrt war viel zu schnell vorüber.
»Noch einmal?«, fragte Vivien.
»Darauf kannst du wetten«, sagte Lucy. Sie kicherten.
Vivien sah die beiden jungen Männer, die geradewegs auf sie zukamen. Sie stieß Lucy an. »Schau nicht hin …« Aber sie tat es doch.
»Habt ihr noch Platz für zwei?«, erkundigte sich der größere der beiden und zog eine dunkle Augenbraue hoch.
Vivien kam sich sehr verwegen vor. »Warum nicht?« Sie rückte beiseite, um Platz zu machen, und er setzte sich neben sie.
»Ich heiße Tom«, erklärte er. »Tom Rae.« Er lächelte.
Vivien hatte gerade noch Zeit zu bemerken, dass seine Augen braun waren und bernsteinfarbene Flecken hatten. Dann wirbelte die Gondel los, die Mädchen kreischten, und die Fahrt begann.
»Wie heißt du?«, rief er ihr zu.
Sie war vollkommen der Meinung des Songs. »Vivien!«, schrie sie über das Geschrei und den Song von Amen Corner hinweg zurück, der ihr vollkommen aus dem Herzen sprach. »If Paradise is Half as Nice …«
Nach der Walzerfahrt hatten sich die Paare gefunden. Toms Freund Brian hatte schon den Arm um Lucy gelegt. Vivien fragte sich, was sie tun sollte, wenn Tom den Arm um sie legte. Ob er versuchen würde, sie zu küssen?
Als Nächstes fuhren sie Autoscooter. Die beiden jungen Männer übernahmen jeweils das Steuer, die Stromabnehmer schlugen Funken an dem Gitternetz unter der Decke, und die Wagen streiften sich, prallten gegeneinander und sprangen dabei sogar gelegentlich ein bisschen in die Luft. In Toms Nähe wurde Vivien ganz warm. Sie roch den Schweiß auf seiner Haut und einen Hauch von Sandelholz und schloss die Augen.
Danach kam die Achterbahn, und sie hatte das Gefühl, minutenlang bewegungslos hoch oben am dämmrigen Abendhimmel zu schweben, während Tom ihr ins Gesicht sah, als wolle er sich jeden ihrer Züge einprägen. Vivien erwiderte seinen Blick, ohne mit der Wimper zu zucken, und fragte sich, was er gesehen hatte. An der Schießbude fühlte sie sich bereits wie in Trance. Die anderen plauderten und lachten. Tom konzentrierte sich, zielte und schoss; drei Minuten später schenkte er ihr stolz einen gelben Teddy. Und dann aßen sie kandierte Äpfel, die an Viviens Zähnen klebten, und tranken Fanta aus der Dose.
Als Tom Vivien schließlich zu ihrem Zelt zurückbrachte – Lucy ging mit Brian hinterher –, hatte er bereits den Arm um sie gelegt, und die beiden hatten sich ihre Lebensgeschichten erzählt. Vivien wusste inzwischen, dass Tom in Sherborne in Dorset wohnte, weit entfernt von West Sussex, dass Werken sein Lieblingsfach war und dass er Tischler werden wollte. Möbelbauer. Meisterhandwerker, wenn man so will. Es gefiel ihr, wie er redete – leise und ruhig und mit dem sympathischen kehligen R des Dorseter Dialekts. Und sie spürte von Anfang an, dass Tom Rae zu seinem Wort stehen würde. Sie wusste, dass er ein Einzelkind war wie sie, dass er seine Eltern schon als Kind verloren hatte und bei seiner Tante und seinem Onkel lebte und dass er auf ein Motorrad sparte.
Als sie das Zelt erreicht hatten, verstummte er plötzlich.
Vivien wusste ebenfalls nicht, was sie sagen sollte. Sie hatte schon lockere Beziehungen zu Jungs gehabt, aber keiner davon hatte ihr wirklich etwas bedeutet. Hatte sie sich nur in diesen dunkelhaarigen, schlacksigen Jungen mit den braunen Augen und dem herzlichen Lächeln verguckt, weil sie im Urlaub war? Lag es an seinem Akzent und seinem fremden männlichen Geruch am Abend? Oder hatten der Rausch und die Aufregung der Karussellfahrten sie so aufgewühlt?
»Dann sage ich wohl besser gute Nacht«, erklärte Tom schließlich. Er trat einen Schritt auf sie zu.
Und dann lag sie in seinen Armen und hatte das Gefühl, dort besser aufgehoben zu sein als irgendwo zuvor. Er küsste gut und schmeckte nach Apfel. Sie hoffte nur, dass keine Toffeestückchen mehr an ihren Zähnen klebten.
Nachdem die beiden jungen Männer fort waren, analysierten Vivien und Lucy jeden Moment des Abends.
»Ich mag ihn wirklich gern, Luce«, hauchte Vivien. »Was hältst du davon, wenn wir den Rest unseres Urlaubs hierbleiben?«
»Ich habe nichts dagegen.« Lucy lag auf dem Rücken und hatte die Arme hinter dem Kopf verschränkt. »Ich würde Brian auch gern ein bisschen besser kennenlernen.« Sie kicherten.
Als sie wieder zu Hause in West Sussex waren, erklärten ihr alle, dass es nur ein Urlaubsflirt gewesen sei. Sie sei doch erst sechzehn, sagten sie, und habe noch das ganze Leben vor sich. Das stimmte. Es war nur so, dass Vivien es nun mit Tom verbringen wollte.
»Viv? Es ist so schön draußen. Viel zu schön, um hier drinnen zu sitzen«, sagte Tom.
Statt zu antworten, zog Vivien eine Augenbraue hoch und fuhr mit ihrem nassen Pinsel über den oberen Teil des Papiers.
Tom machte ein enttäuschtes Gesicht.
Sie spürte es. »Wenn du mit der Arbeit fertig bist, geh doch spielen«, sagte sie und lächelte, um ihren Worten die Schärfe zu nehmen.
Er betrachtete sie. »Wie lange brauchst du noch?«
Vivien seufzte leise und lächelte verhalten. Sie hatte alles genau geplant: die Lasur fertig machen, Abendessen vorbereiten, das Material zum Aufziehen des Bildes zusammmensuchen, weitermalen – die ersten richtigen Farben, der aufregende Teil –, Abendessen kochen, Ruby anrufen, dann ein entspannter Abend mit Tom und dem Fernseher.
Sie hob das Papier hoch, damit die Lavierung nach unten verlaufen konnte, und sorgte mit rhythmischen Pinselstrichen für die erwünschte Wirkung. Dann hielt sie inne und sah ihr Werk stirnrunzelnd an. »Woran hattest du denn gedacht?«
»Eine Motorradfahrt an die Pride Bay? Ich muss eine Testfahrt damit machen. Ich habe am Vergaser herumgebastelt.«
»Ach ja?« Er wusste wirklich, wie man eine Frau in Versuchung führte …
»Ein Eis?«, setzte er hinzu. »Ein Spaziergang am Hafen und vielleicht ein Bier?«
»In dieser Reihenfolge?« Vivien rüttelte ein wenig an dem Papier.
»Wir können auch zuerst spazieren gehen und dann ein Eis essen. Born to be wild, mein Schatz. Was meinst du?«
Sie schmunzelte. »Na schön. Ich könnte eine Pause gut gebrauchen. Lässt du mir noch zehn Minuten?« Innerlich plante Vivien ihren Abend um. Schließlich war Spontaneität eine der Eigenschaften, die sie an ihrem Mann liebte.
»Braves Mädchen. Schöne Farbe übrigens.« Er nickte beifällig. »Ich mache uns schnell noch eine Tasse Tee.« Und fort war er.
Vivien legte den Kopf zur Seite und inspizierte die Lasur. Sie war genau richtig – nur ein Hauch von Farbe, eine Andeutung.
Das Schlimmste, was passieren konnte, war, dass er ihr nicht verzeihen würde, dachte sie, während sie den Pinsel in das Wasserglas stellte. Deswegen hatte sie nie etwas gesagt. Zu Beginn hatte es viele stichhaltige Gründe dafür gegeben, nichts zu sagen. Die existierten immer noch. Aber jetzt … Wenn er ihr nicht verzeihen würde, wäre das zu furchtbar, um darüber nachzudenken. Das Geheimnis und seine Wahrung waren zu einer Mauer zwischen ihnen geworden, die schwer zu überwinden war.
Vivien überlegte, wie die Sache im besten Fall ausgehen könnte? Sie war sich nicht sicher, ob es einen besten Fall gab. Sie wählte aus dem Haufen, der vor ihr lag, ein paar Farbtuben aus und ließ den Rest wieder zurück in die große Keksdose klappern, in der sie aufbewahrt wurden. War Ehrlichkeit an und für sich ein Wert? Sie quetschte versuchsweise ein paar Farbkleckser heraus und schob sie mit ihrem Mischpinsel ein wenig herum. Nein. Das Beste – für sie – würde sein, dass sie sich dann keine Gedanken mehr deswegen zu machen brauchte. Dass sie offen über alles sprechen könnte, das Wie und Warum darlegen und erklären, wie das alles hatte passieren können.
Ah. Sie seufzte und schraubte die Verschlüsse wieder auf die Farben. Später.
Genau das musste sie tun – erklären, wie das alles passiert war.
3. Kapitel
FUERTEVENTURA, JUNI 2012
Langsam und nur mit Mühe richtete sich Schwester Julia auf. Es dämmerte. Sie wischte sich den feinen Staub von ihrem weißen Habit. Er war das sichtbare Zeichen ihres Rückzugs aus der Welt, das Symbol ihrer Zugehörigkeit zur Klostergemeinschaft, ihrer spirituellen Familie. Staub. Staub zu Staub. Asche zu Asche … Eine Erinnerung (als ob sie noch eine bräuchte) an all die Todesfälle, die sie miterlebt hatte. An die Entscheidung, die sie hatte treffen müssen.
Sie ließ den Rosenkranz durch ihre Finger gleiten. Hier war es immer staubig, selbst in der Kapelle, die verschnörkelte Steinornamente in Rosa- und Blautönen schmückten. Die verblassten Fresken über dem Altar stellten die Kreuzigung dar. Zwei Stunden hatte sie gebetet, aber heutzutage merkte sie kaum noch, wie die Zeit verging. Sie zog einfach vorüber. Sie hatte immer noch so viele Fragen an Ihn. Was sollte sie tun? Konnte Er ihr nicht ein Zeichen geben?
Doch jetzt musste sie sich beeilen. Sie lebten nur noch zu zwölft hier im Kloster Nuestra Señora del Carmen, der Schutzheiligen der Fischer, und diese Woche gehörte es zu Schwester Julias Pflichten, in dem kleinen Garten, der zu dem Kloster gehörte, Gemüse und Kräuter zu ernten. Sie zogen Wermut, Aloe und Echinacea sowie die verbreiteteren Kräuter Minze, Kamille und Rosmarin. Jede Pflanze hatte ihren Nutzen. Sí. So hatte Gott es geplant, und Er hatte der Menschheit die Kraft geschenkt, Seine Gaben zu gebrauchen. Aber die Menschen waren schwach. Hatte Er das denn nicht gesehen? Menschen konnten der Versuchung zum Opfer fallen. Die Menschen besaßen einen freien Willen, trafen aber so oft die falschen Entscheidungen. Und die Folgen dieser Entscheidungen konnten so weitreichend sein, dass man sie sich kaum vorstellen konnte. Schwester Julia wollte nicht die falsche Entscheidung treffen – nicht nach allem, was geschehen war. Es hatte schon so viel Leid gegeben, Leid, das immer noch tief in ihrem Herzen begraben war.
Schwester Julia ging durch die verwitterten, hellen Bogengänge der abgeschiedenen Steinkapelle und verließ sie durch die Hintertür. Dieser Ort unterschied sich nicht sehr vom Kloster Santa Ana in Barcelona, in dem sie gelebt hatte, als sie noch ein ganz junges Mädchen gewesen war. Ihre Gemeinschaft war kein Klausurorden; die Schwestern konnten nach Belieben kommen und gehen und in der Eingangshalle ihre Süßigkeiten verkaufen, genau wie früher die Schwestern in Santa Ana. Lächelnd dachte sie zurück an ihre suspiros de monja – die »Nonnenseufzer« aus dickem Backteig und kandierten Früchten. Außen waren sie goldbraun und knusprig und innen fett und cremig. Hmmm. Doch in Santa Ana hatte sich alles verändert. Man hatte noch etwas anderes von ihr verlangt … Schwester Julia sah zu dem kleinen Glockenturm auf, der sich auf einem Sockel an die Kapelle anschloss. Sie schwankte und hatte Mühe, das Gleichgewicht zu halten.
Draußen hatte sich das goldene Licht des Tages in ein blasses Pink verwandelt. Die Berge im Süden lagen da, als ob sie schliefen, und mit ihren tief eingeschnittenen Täler sahen sie aus wie verwundet, als trügen sie tiefe Narben in ihrem Rücken. Und über ihnen zückte der dämmrige Himmel Dolche in Rot, Orange und Weiß. Ein weiterer Tag war vorüber. Sie war dem Tod wieder einen Tag näher gekommen …
Hinter Schwester Julia lag ein langes Leben, ein Leben voller Herausforderungen, die so ganz anders gewesen waren, als sie es als Mädchen erwartet hatte, und auch anders als das, was sie sich vorgestellt hatte, als man sie gezwungen hatte, die ersten einfachen Gelübde abzulegen. Einfach war es nicht gewesen – vielleicht war Gottes Werk niemals leicht –, und oft hatte sie das Geschehene hinterfragt. Das tat sie immer noch. Sie hatte so unruhige, schwere Zeiten erlebt. Aber jetzt … Bitte, Gott … Im Moment wünschte sie sich nur, dass die Last, die sie trug, von ihren Schultern genommen würde. Dass sich Frieden ausbreiten würde wie eine sanfte Decke und ihrem Geist und ihrer Seele Ruhe schenken würde.
Sie holte den grob geflochtenen Korb und das scharfe Messer aus dem äußeren Vorratsraum, um in dem Garten, der von niedrigen Trockensteinmauern umgeben war, den Salat für das heutige Essen zu schneiden. Sie hatten Feigen- und Mandelbäume, Legehennen und drei Ziegen, die Milch und Käse lieferten. Die Nonnen aßen einfach, aber gut. Genau wie in Santa Ana zogen sie den größten Teil ihres Obsts und Gemüses selbst, obwohl das Land hier auf Fuerteventura ausgedörrt und trocken war. Sie ernteten Kartoffeln, Zwiebeln und die kleinen kanarischen Bananen. Auch gofio aßen sie noch, einst der Proviant für die Landarbeiter, die das geröstete Mehl in einem Beutel aus Ziegenleder mit Wasser und Zucker zu einem Teig kneteten. Heutzutage aßen sie es mit Milch als Frühstücksbrei, oder sie dickten damit ihre Suppen und ihre Schmorgerichte an. Wie so vieles hatte es überdauert und sich der neuen Zeit angepasst. Und doch symbolisierte es für Schwester Julia die Schlichtheit ihres Lebens hier.
Schwester Julia fürchtete den Tod nicht, das hatte sie nie getan. Im Lauf der Jahre hatte sie viele Menschen sterben sehen – Schwestern im Kloster, Menschen in dem Krankenhaus, in dem sie als junge Novizin gearbeitet hatte, und auch die Mitglieder ihrer eigenen Familie. Sie waren alle nicht mehr da. Und sie hatte den Bürgerkrieg miterlebt. Wer das getan hatte, der hatte an jeder Straßenecke den Tod gesehen, ihm ins Gesicht gestarrt und ihn gerochen – ein blutiger, widerlicher Gestank. Politik. Krieg. So viel Zerstörung. Schwester Julia erschauerte.
Denn sie fürchtete, dass sie nicht ohne Schuld war. Für viele Menschen waren das schwere, schmerzvolle Zeiten gewesen. Wie konnte man das verstehen, wenn man es nicht erlebt hatte? Sie hatte versucht, Gott um Verzeihung zu bitten für das, was sie getan hatte. Handlungen, die man von niemandem verlangen durfte. Taten, die nicht richtig gewesen sein konnten, die unmöglich Gottes Wille gewesen waren. Nicht, wenn Er der freundliche, gerechte und liebende Gott war, für den sie Ihn immer gehalten hatte. Aber hörte Er sie? Verstand Er, dass sie das Gefühl gehabt hatte, keine andere Wahl zu haben?
Sie hielt kurz inne, um über den campo hinaus auf die Landschaft aus braunem Wüstenboden zu schauen, die so erholsam für das Auge war. Schwester Julia kam sie wie eine biblische Landschaft vor, eine Landschaft, in der man erwarten würde, Kamele und Pferde zu sehen und drei weise Männer, die dem Licht eines Sterns nachreisten … Aber sie war alt, und ihre Gedanken schweiften ab. Sie musste den Salat in die Küche bringen. Die anderen warteten. Sie nahm ihren Korb.