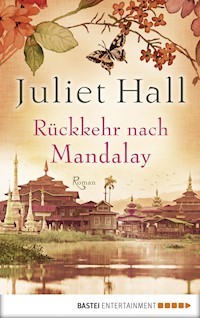5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die schönsten Sehnsuchtsromane von Juliet Hall
- Sprache: Deutsch
Eine Reise in die sinnlichste Stadt Kubas - Havanna!
Noch einmal eine Nacht durchtanzen! Danach sehnt sich Elisa. Obwohl sie seit Jahrzehnten in England lebt, vermisst sie ihre Heimat Kuba immer noch schmerzlich - und Duardo, mit dem sie sich vor der Revolution ein gemeinsames Leben aufbauen wollte.
Grace weiß nicht mehr, mit wem sie zusammenleben will - mit ihrem Mann oder mit dessen bestem Freund. Hin- und hergerissen zwischen Schuldgefühlen und Verliebtheit, droht sie den Halt zu verlieren. Erst als sie Elisa nach Kuba begleitet, beginnt sie zu begreifen, was sie wirklich will ...
"Ich habe das intensive, sinnliche Gefühl, direkt in Havanna zu sein, so genossen, dass ich jetzt dort hinreisen möchte. Eine faszinierende Geschichte!" Dinah Jefferies
Weitere gefühlvolle Romane von Juliet Hall bei beHEARTBEAT: Das Leuchten des Safrans. Julias Geheimnis. Das Erbe der Töchter.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
Dank
Weitere Titel der Autorin
Das Erbe der Töchter
Das Leuchten des Safrans
Ein verzauberter Sommer
Eine letzte Spur
Emilys Sehnsucht
Julias Geheimnis
Rückkehr nach Mandalay
Über dieses Buch
Eine Reise in die sinnlichste Stadt Kubas – Havanna!
Noch einmal eine Nacht durchtanzen! Danach sehnt sich Elisa. Obwohl sie seit Jahrzehnten in England lebt, vermisst sie ihre Heimat Kuba immer noch schmerzlich – und Duardo, mit dem sie sich vor der Revolution ein gemeinsames Leben aufbauen wollte.
Grace weiß nicht mehr, mit wem sie zusammenleben will – mit ihrem Mann oder mit dessen bestem Freund. Hin- und hergerissen zwischen Schuldgefühlen und Verliebtheit, droht sie den Halt zu verlieren. Erst als sie Elisa nach Kuba begleitet, beginnt sie zu begreifen, was sie wirklich will …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Juliet Hall unterrichtet Schreiben und organisiert Literatur- und Musikfestivals in ihrer Heimatstadt an der Küste von West Dorset, Großbritannien. Zu ihren liebsten Reisezielen gehört Italien, wohin sie die Leser mit ihrem Debüt »Das Erbe der Töchter« führt. Nach Ausflügen durch viele wunderbare Städte Europas in »Emilys Sehnsucht« und »Julias Geheimnis« sowie nach Marokko in »Das Leuchten des Safrans« bringt sie uns mit »Ein letzter Tanz in Havanna« nach Kuba.
Juliet Hall
Ein letzter Tanz in Havanna
Aus dem Englischen von Barbara Röhl
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:Copyright © 2016 by Rosanna LeyPublished by arrangement with Jan HenleyTitel der englischen Originalausgabe: »Last Dance in Havana«First published in the United Kingdom by Quercus Books, London, under the pseudonym of »Rosanna Ley«
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Für diese Ausgabe:Copyright © 2017/2020 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze, BonnTitelillustrationen: © Shutterstock: Sergiy Artsaba | Just dance | Guitar photographer | Joke van EeghemeBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-9529-7
www.be-ebooks.dewww.lesejury.de
Für Alexa, in Liebe
1. Kapitel
Havanna 1957
»Möchten Sie tanzen?«
Sie war so tief in ihre Gedanken versunken gewesen, dass die Stimme sie vollkommen überrascht hatte. Elisa sah auf, und da stand er.
Sie hatte darum gebettelt, dass Pablo sie an diesem Abend ins La Cueva mitnahm.
»Du bist zu jung«, hatte ihr Cousin gespöttelt. »Noch ein Baby. Glaubst du, irgendwer will mit dir tanzen?«
Elisa hatte den Kopf in den Nacken geworfen. »Ich kann zuschauen«, sagte sie. Ich kann so tun, als ob. Aber das sagte sie nicht. Sie war jung, ja, aber in zwei Monaten würde sie sechzehn. Und so jung war das nun auch wieder nicht.
»Dann komm eben mit, Cousinchen«, hatte Pablo schließlich gesagt. »Aber du musst dich um dich selbst kümmern. Ich werde nicht den ganzen Abend den Babysitter für dich spielen.«
»Mach ich.« Sie war so begeistert von der Aussicht, dass sie sogar vergaß, beleidigt zu sein.
Sie lieh sich das mimosengelbe Kleid von ihrer Cousine Ramira, und ihre Mutter steckte ihr eine weiße Schmetterlingslilie in das dunkle Haar. Während sie mit Pablo durch die dunklen Gassen von Havanna zum La Cueva eilte, konnte sie den honigsüßen Duft der Blume riechen.
Als sie das Lokal betraten, verließ Elisa fast der Mut. Die Wände waren rot und schwarz gestrichen, und man hatte tatsächlich das Gefühl, in eine cueva, in eine Höhle, hineinzugehen. Das Licht war schummrig, in der Luft hing schwer der Geruch nach Rauch, und auf der Tanzfläche hoben und drehten sich schimmernde, schwitzende Körper zu den Salsa-Rhythmen der Band. Elisa stand der Mund offen, und sie zwang sich, heftig zu schlucken. Sie war mit Tanzen großgeworden – aber nicht mit dieser Art von Tanz. Es ging etwas davon aus, das sie nicht ganz verstand, eine Sinnlichkeit, die ihr noch unbekannt war.
Ihre Gedanken schweiften zu den Jungen, mit denen sie aufgewachsen war – nicht nur zu ihrem Cousin Pablo, sondern zu den anderen jungen Burschen, die in ihrer Nachbarschaft wohnten und mit denen sie zur Schule gegangen war. Die im Meer schwammen und mit Bambusstöcken und Katzendarm pescado angelten, die am Strand Fangen spielten oder Baseball auf den Straßen und Plätzen in der Altstadt von Havanna. Sie waren ihr so vertraut wie Brüder: Miguel, Santino, Vicente und die anderen. Sie hatten als Kinder zusammen gespielt, und ihre Familien kannten sich alle untereinander – ein paar von ihnen lebten sogar in ihrem Wohnblock.
Inzwischen jedoch hatte sich vieles verändert. Sie alle waren nicht mehr so unschuldig, sie schauten sich anders und weniger offen an. Wenn Elisa und ihre Freundinnen an einer Straßenecke an ihnen vorbeigingen, warfen sie den Kopf zurück und ignorierten bewusst genau diese Jungen, mit denen sie großgeworden waren. Allerdings tanzten sie mit ihnen – bei Partys in den Wohnungen ihrer Familien oder an den lauen Abenden, an denen sich die Musik und der Tanz aus den Bars und Cafés der Stadt auf die von der heißen, schwülen Sonne Havannas aufgeheizten Gehsteige ergossen.
Während Elisa Pablo durch das Meer von Körpern in dem Nachtklub folgte, sah sie sich um. Mit den Jungs hatten sie nie so getanzt …
Pablo entdeckte seine Freunde, und in einer Ecke fand er einen Stuhl für Elisa. »Bleib hier«, befahl er. »Ich hol dir eine Limonade.« Und er verschwand.
Irgendwann später, als sie ausgetrunken und Pablo sie völlig vergessen hatte und viele Paare einander sich eng umschlungen über die Tanzfläche bewegten oder an der Bar und an Tischen lässig auf Stühlen saßen, fiel Elisa der junge Mann auf. Er war stämmig und hatte eine breite Brust, kurzes, krauses Haar und ausgeprägte, sinnliche afrikanische Züge. Er war ungefähr so groß wie sie und, wie sie vermutete, nicht viel älter, obwohl er ein Selbstbewusstsein ausstrahlte, um das sie ihn unwillkürlich beneidete. Sie schaute einmal zu ihm hinüber, dann noch einmal, und beim dritten Mal starrte er zurück. Ein Schauder überlief sie. Es lag etwas so Festes, so Intensives in diesem Blick, der geradewegs durch die Menschen auf der Tanzfläche hindurchging und auf sie traf – wie der Hitzeschwall aus dem Backofen ihrer Mutter, wenn sie sich hinhockte, um die Tür zu öffnen.
Die Trommler wechselten das Tempo, und die Sängerin begann mit der Einleitung zu einem neuen Stück, indem sie sinnlose Silben sang. Das war die diana, die Eröffnungssequenz der Rumba. Sie wurde mit einer kräftigen Stimme vorgetragen, die irgendwo tief im Inneren den Schmerz des kubanischen Volkes auszudrücken schien. Elisa seufzte. Sie hätte zu gern getanzt. Aber alle hier wirkten so selbstsicher. Sie war nur ein junges Mädchen – und vollkommen überfordert.
Die Rumba war Elisas Lieblingstanz. Er wurde überall in Havanna getanzt: am Sonntagabend an Straßenecken oder an den Abenden, wenn sich ein paar Freunde in jemandes Hinterhof trafen. Elisa machte es Spaß, mit den Jungs, die sie so gut kannte, Rumba zu tanzen. Ungefährlich war es auch, denn es war der aufreizendste Tanz, den sie kannte. Elisa war sich der sexuellen Symbolik und der Bedeutung der Bewegungen sehr wohl bewusst. Miguel, Santino und Vicente konnten posieren, stolzieren und sich an sie heranwerfen, so viel sie wollten. Elisa und ihre Freundinnen lachten sie nur aus.
Die Version der Rumba, die in ihrem Viertel am beliebtesten war und die sie am besten kannte, war der guaguancó. Bei diesem Tanz setzte der Mann vacunaos – schnelle Schritte, Fingerschnipsen und Hüftbewegungen – ein, um nach seiner Partnerin zu haschen oder sie abzulenken. Es war eine Art erotischer Wettbewerb. Die Frau bedeckte ihre Lendengegend mit den Händen oder einem Fächer, um sich zu schützen, auch wenn sie sich gleichzeitig lockend vorwärtsbewegte. Elisa gefiel besonders dieser Teil. Bei der Erinnerung daran, wie sie ihn beim letzten Mal mit Vicente getanzt hatte, lächelte sie in sich hinein.
»Du legst es wirklich drauf an, Elisa«, hatte er ihr ins Ohr gezischt, als die Musik schneller und schneller wurde und die Erregung wuchs. Sie hatte gelächelt und den Kopf geschüttelt und war davongewirbelt. Es war ja nur ein Tanz.
Und wie Elisa das Tanzen liebte … Sie seufzte wieder. Aber um Rumba zu tanzen, brauchte man einen Partner. Sie warf Pablo einen Blick zu, der sich an ein Mädchen mit langem schwarzem Haar schmiegte. Sie trug das engste und kürzeste rote Kleid, das Elisa je gesehen hatte, so tief ausgeschnitten, dass es ihre schimmernden Schultern und Brustansätze freigab. Keine Chance also, mit ihm zu tanzen. Er hatte vergessen, dass es sie überhaupt gab. Und zum ersten Mal wünschte sich Elisa sehnsüchtig, einer der Jungs, die sie so gut kannte – Miguel, Santino oder Vicente –, würde vorbeikommen, sie necken und sie mit aufreizendem Blick und breitem, strahlendem Lächeln auf die Tanzfläche ziehen.
»Möchten Sie tanzen?«
Sie war so tief in ihre Gedanken versunken gewesen, dass die Stimme sie vollkommen überrascht hatte. »Oh.« Elisa sah auf, und da stand er – der junge Mann mit dem eindringlichen Blick. Er streckte ihr die Hand entgegen. Im Gegensatz zu allen Jungs, mit denen sie je getanzt hatte, lächelte er nicht.
Ob sie tanzen wollte? »Ja.« Sie erhob sich. »Gern.«
Die anderen Sänger fielen in das Lied ein, und die Melodie begann sich aus dem sanften Pulsieren der Trommeln zu lösen. Elisa wartete. Sie wusste, wie es ging. Das Lied erzählte eine Geschichte, und die Trommeln erzählten eine eigene: Sie unterhielten sich, fragten, antworteten. Schließlich kamen die Tänzer hinzu.
Dann war es so weit. Der junge Mann fixierte sie mit seinem eigentümlichen Blick und fing an, sich zu bewegen, ebenso Elisa, exakt im selben Takt. Sie wusste, wohin er seinen Fuß setzen würde, und glitt mühelos hinein in den Rhythmus des Tanzes. Sie trat nach links und verlagerte ihr Gewicht auf diese Seite, sie trat nach rechts, neigte sich und hob und senkte ihren Körper auf den Fußballen. Sie bewegte die Arme und ließ ihre Hüften zu dem Rasseln und Klicken der Trommeln kreisen. Sie warf den Kopf zurück, sodass ihre dunklen Locken flogen. Ihre Schultern entspannten sich, ihre Knie beugten sich. Die Musik erfasste sie und zog sie in ihren berauschenden Rhythmus. Es war ein Dialog zwischen Tänzern und Trommeln. Die Trommelschläge reagierten auf ihre Geschichte und stupsten und drängten sie voran.
Der junge Mann lächelte noch immer nicht. Seine Augen wurden noch dunkler, als er ihr die Hand entgegenstreckte. Dann hob er mit einer fließenden Bewegung ihre miteinander verschränkten Hände an und zog sie so näher zu sich. Seine andere Hand lag auf ihrem Rücken. Elisa erlaubte sich, ihm in die Augen zu sehen. Sein Blick war hypnotisch, und einen Moment lang glaubte sie, sich nie wieder davon lösen zu können. Sie berührten einander fast, aber nicht ganz. Ein winziger Abstand war noch zwischen ihnen, und dieser Raum schien elektrisch aufgeladen zu sein. Er ruckte mit den Hüften und schnippte mit den Fingern, und sie reagierte darauf nach der Tradition des Tanzes. Aber die ganze Zeit über dachte sie: Es ist ihm ernst, er meint es wirklich! Das hatte sie noch nie erlebt. Sie spürte eine Leichtigkeit in ihrer Kehle, ihrer Brust, ein schwindelerregendes Gefühl, das ihr noch fremd war.
Seine Hand grub sich jetzt glühend in ihr Rückgrat, als drücke er ihr irgendwie ein Brandzeichen auf. Mit der leisesten Bewegung seiner anderen Hand drehte er sie herum und wieder zurück, aufwärts und abwärts, vorwärts und rückwärts. Mit einem komplizierten Schritt, der aus dem Takt fiel und von der quinto, der höchsten Trommel, untermalt wurde, rückte er an sie heran, und Elisa wich ihm anmutig aus. Lässig wedelte sie mit den Enden ihres gelben Kleides, als wische sie seine Energie weg und verweigere sich ihm. Doch bei der Rumba war das nie so einfach. Sie waren der Hahn und die Henne. Es war aufreizend und unschuldig zugleich. Sinnlich wiegte Elisa Ober- und Unterkörper in verschiedene Richtungen und schwang die Saumenden ihres Kleides zum Rhythmus des hölzernen Klangstabs und der klickenden Bambus-guagua auseinander und wieder zusammen. Sie hatte das Gefühl, unter dem Kleid nackt zu sein. Er zog eine Augenbraue hoch, als stelle er ihr eine stumme Frage. Sie sah ihn an. Er musste es doch wissen. Sie gehörte ihm.
Die tropische Hitze des Tanzes schien sich um sie beide herum zusammenzuballen, obwohl sich Elisa der anderen Paare auf der Tanzfläche kaum bewusst war. Es gab nur sie und diesen Jungen, diesen Fremden. Sie kannte ihn nicht, und doch hatte sie in diesem Moment das Gefühl, alles über ihn zu wissen. Sie spürte seine Hand an ihrem Rücken, ihren Schultern, ihren Händen, sein Schweiß hatte sich mit ihrem eigenen vermischt. Seine Augen, seine Intensität sogen sie förmlich auf. Sein Blick schien sich irgendwie um sie zu schlingen. Gemeinsam verschmolzen sie mit dem lebendigen Puls des Tanzes, bis sie meinte, sie müssten sich in die Lüfte erheben. Doch sie blieben am Boden. Und noch immer wurde mit jedem Gesang des Chors und mit jedem Refrain der auf- und abschwellende Rhythmus schneller und ekstatischer und trieb sie unter dem Schütteln der maracas, dem Klirren der marugas und den mächtigen Schlägen der Trommeln weiter voran. Bis zur Explosion am Schluss, mit der die Rumba endete und nach der sie sich schweißüberströmt und nach Atem ringend vom Tanzboden zurückzogen.
Er ließ ihre Hand nicht los. Sie sah die Schmetterlingsblume, die weiße Ingwerblüte, die ihr aus dem Haar gefallen war, schlaff auf dem Holzboden liegen, von den Tänzern fast zu Brei getreten.
»Wer bist du?«, flüsterte Elisa. Die Hitze seiner Haut war ihr noch nah, berührte sie noch immer. Es war das Feuer der Rumba. Und sie wollte nicht, dass es sie je wieder verließ.
»Mein Name ist Duardo.« Er zog ihre Hand an die Lippen, sah sie weiter mit diesem dunklen, eindringlichen Blick an und drückte einen Kuss darauf.
2. Kapitel
Bristol 2012
Als ihr Vater die Tür ihres Elternhauses in der King Street öffnete, wusste Grace sofort, dass er getrunken hatte. Seine Augen – blutunterlaufen und schuldbewusst – verrieten ihn. Früher einmal war er ein attraktiver Mann gewesen. Ohne sein gutes Aussehen und seinen außergewöhnlichen Charme hätte er auch keine so schöne Frau wie Grace’ Mutter erobern können. Grace’ Stiefmutter Elisa hatte er ebenso für sich eingenommen, rief sie sich ins Gedächtnis. Selbst jetzt, mit Anfang siebzig und mit weißgrauem, von blonden Strähnen durchzogenem Haar, war ihm diese Ausstrahlung geblieben, obwohl er durch den Alkohol stark zugenommen hatte.
Verstohlen warf Grace einen Blick auf ihre Uhr. Vier Uhr nachmittags. Sie roch es auch an ihm, der abgestandene Alkohol schien ihm aus allen Poren zu dringen. Aber wie üblich sagte sie nichts. Spürte nur den alten Schauder des Widerwillens.
»Ich habe dich nicht erwartet, Grace«, sagte er. Seine Hand, die auf dem Türknopf aus Messing lag, zitterte.
Offensichtlich nicht, dachte Grace. Sie zuckte kaum wahrnehmbar mit den Schultern. Damals, als sie alt genug geworden war, um zumindest teilweise zu verstehen, was los war, als eine lallende Stimme, Geschrei und Tränen zusammen mit dem schnell sinkenden Pegel in einer Whiskyflasche allmählich einen Sinn ergaben … Damals hatte sie etwas gesagt. Sie hatte ihn angefleht, damit aufzuhören. Auch Elisa hatte ihn angebettelt, das wusste Grace. Sie hatten Whiskyflaschen versteckt, geweint, ihm gut zugeredet und versucht, ihn dazu zu bringen, sich dem zu stellen, was er tat, was aus seinem Leben geworden war. Aber nichts hatte etwas bewirkt. Er war entschlossen, diesen Weg zu gehen, und wollte nicht zuhören. Grace wusste noch nicht einmal mit Gewissheit, wann oder warum es angefangen hatte. Als ihre Mutter gestorben war? Noch früher? Sie wusste es nicht, und sie war sich nicht sicher, ob das überhaupt noch eine Rolle spielte.
»Elisa hatte Robbie gebeten, sich ihren Laptop anzusehen.« Sie hielt ihm das Gerät entgegen wie eine Opfergabe, aber ihr Vater hatte sich schon von der Tür abgewandt und sie offen stehen lassen. Grace war in diesem Haus aufgewachsen, doch seit dem Tod ihrer Mutter hatte sie sich dort nicht mehr heimisch gefühlt. Das Haus in der King Street hatte einen prächtigen Eingang mit einer grün gestrichenen Tür, einem Briefkasten aus Messing und einem georgianischen Oberlicht. Früher hatte sie es geliebt – jetzt ließ es sie kalt. Die Wahrheit war, dass Grace die Versuche, ihrem Vater zu helfen, nach einer Weile – nach einer langen Zeit – aufgegeben hatte. Sie war fast zu einem Teil der Heuchelei geworden, eine weitere Mitspielerin auf der Bühne der Alkoholabhängigkeit ihres Vaters, dachte sie bitter. Zumindest oberflächlich betrachtet.
»Elisa ist nicht da«, rief er ihr über die Schulter zu, während er durch die Diele ging.
Verdammt. Grace hätte lieber gewartet, bis Elisa den Laptop bei ihr abholte, aber sie wusste, dass ihre Stiefmutter viel zu tun hatte, und Robbie hatte sie ausdrücklich gebeten, ihn ihr vorbeizubringen. Grace zögerte. Manchmal beschlich sie der Verdacht, dass Robbie und Elisa sich verschworen hatten, um sie dazu zu bringen, mit ihrem Vater zusammenzutreffen, so als glaubten sie an die Möglichkeit einer dauerhaften Versöhnung. Aber die würde es nicht geben. Das Leben war keine Fernsehshow. Man konnte nicht einfach ein sauberes Staubtuch nehmen und die Vergangenheit wegwischen. Was geschehen war, war geschehen.
Wie dieser Moment mit Theo nach dem Kartentrick vor drei Wochen, dachte Grace unwillkürlich. Sie schob den Gedanken weg. Es war passiert, ja, aber sie würde nicht darüber nachgrübeln, vor allem nicht jetzt. Robbie und sie hatten Theo seit drei Wochen nicht gesehen, aber dafür gab es bestimmt einen guten Grund – schließlich war er der beste Freund von ihnen beiden.
»Kommst du rein?«, rief ihr Vater.
»Natürlich.« Grace folgte ihm ins Haus.
Ihre Absätze klapperten über die schwarz-weißen viktorianischen Bodenfliesen. »Ist Elisa arbeiten?«, fragte sie. Ihre Stiefmutter war offiziell seit Jahren Rentnerin, aber sie gab noch immer gelegentlich Stunden in spanischer Konversation und veranstaltete Partys, bei denen nur Spanisch gesprochen wurde. Und dann waren da noch die regelmäßigen Treffen ihrer spanischsprachigen Gemeindegruppe. Dort hatte Elisa auch Theo kennengelernt, noch früher als Robbie.
Spanien lag Grace am Herzen. Nach dem Tod ihrer Mutter, nach der Beerdigung und diesen schrecklichen ersten Monaten, in denen sie unter dem Verlust litt, hatte Grace eine Weile bei der Schwester ihrer Mutter in Madrid verbracht. Damals war sie zehn Jahre alt gewesen, und seitdem war sie allem verfallen, was mit Spanien zu tun hatte.
Nicht allem Spanischen, verbesserte sie sich streng und dachte wieder an Theo und diesen verdammten Kartentrick. Und außerdem kam Theo wie Elisa aus Kuba, nicht aus Spanien. Beide hatten spanische Wurzeln und sprachen dieselbe Sprache, aber anders als Elisa hatte Theo nie in Kuba gelebt. Seine Familie hatte das Land verlassen, als er noch ein Baby war, hatte er ihnen erzählt, und er war in Florida, in den USA, aufgewachsen.
Als kleines Mädchen, das gerade seine Mutter verloren hatte und orientierungslos war, hatte sich Grace in Tante Mag, in Madrid und die spanische Sprache verliebt, die ihr damals so dramatisch und prächtig erschienen war. Das fand sie übrigens immer noch. Spanien war ihr auch wie eine andere Welt vorgekommen, und genau danach hatte Grace gesucht. Sie wollte anderswo leben und jemand anders sein – jemand, dessen Mutter nicht auf die Straße hinausgelaufen war, jemand, dessen Mutter nicht überfahren worden und gestorben war. Aber Grace konnte – leider – nicht für immer bei Tante Mag bleiben. Sie war noch ein Kind und musste zurück zu ihrem Vater nach Bristol.
Selbst ein Kind konnte Zukunftspläne schmieden, hatte Grace damals gedacht. Vielleicht könnte sie, wenn sie älter wäre, bei Tante Mag wohnen, in ihrer kühlen, minimalistischen Wohnung mit den kahlen weißen Wänden, den steinernen Bodenplatten und dem Balkon mit dem schmiedeeisernen Gitter, der auf eine belebte Straße hinausging. Grace hatte sich gewünscht, ihrem chaotischen Leben zu entfliehen, ihrem Zuhause, ihren Gedanken und ihrer Trauer. Das wäre eine gute Möglichkeit dazu gewesen. Und so hatte sie, als sie wieder in Großbritannien war, ihren Vater überredet, sie Spanisch lernen zu lassen. Tante Mag sagt, Kinder sollten so früh wie möglich Fremdsprachen lernen … Sie hörte sich noch selbst. Und den Seufzer ihres Vaters – damals, nur ein Jahr nach dem Tod von Grace’ Mutter, hatte er noch versucht, alles richtig zu machen –, bevor er jemanden fand, der privat Spanisch unterrichtete. Elisa.
Elisa hatte Grace’ Vater erzählt, sie sei Kubanerin. Aber mit ihrem dunklen, olivfarbenen Teint, dem rabenschwarzen Haar und den leicht hochmütigen Zügen erinnerte sie Grace an Spanien. In ihrem roten Wollkleid und mit ihren wohlgeformten Beinen sah sie ein bisschen aus wie die Flamencotänzerin auf der Schmuckschatulle ihrer Mutter, einem Geschenk ihrer Schwester aus Madrid. Grace hatte sich unwiderstehlich zu ihr hingezogen gefühlt.
»Warum magst du Spanien so gern?«, hatte Elisa sie damals gefragt. »Warum willst du Spanisch lernen?«
Grace wusste nicht, was sie antworten sollte. Sie mochte Spanien, weil es nicht England war. Weil die Schwester ihrer Mutter dort lebte und sie alles war, was sie noch hatte. »Weil es warm ist«, sagte sie, »und mir gefallen die Farben.«
»Meine Familie stammt aus Spanien – ursprünglich, meine ich«, sagte Elisa. Sie brachte Grace die Namen der Farben bei, einen nach dem anderen. Und da wusste Grace, dass sie bei ihr richtig war.
Grace pflegte ihr Spanisch weiter, und deshalb ging sie noch manchmal zu den Treffen von Elisas spanischer Gemeindegruppe im Gemeindesaal am Ende der Straße, in der sie nun wohnte. Aber nicht oft, nicht mehr. Jetzt gab es ihren Mann Robbie und ihr gemeinsames Leben, jetzt hatte sie ihre Arbeit, und sie hatte rasch festgestellt, dass ihre Selbstständigkeit den größten Teil ihrer Zeit verschlang. Spanien war in ihrem Leben in den Hintergrund getreten, und auch Tante Mag, die inzwischen in einer entlegenen Finca in den andalusischen Bergen lebte, schien unerreichbar.
»Elisa ist ständig mit irgendwas beschäftigt«, brummte ihr Vater, als er in die Küche vorausging. Wie immer war sie makellos sauber und ordentlich, wenn auch ein bisschen altmodisch, wie immer machte sie Grace ihre Unzulänglichkeiten in der hausfraulichen Arena bewusst. Robbie beklagte sich zwar nicht, er war ohnehin genauso unordentlich wie sie. Aber er verdiente mehr als Grace und arbeitete am Tag länger als sie, und Grace hatte entschieden, dass sie sich keine Putzfrau leisten konnten. Alles in allem war es ihre Aufgabe.
Wahrscheinlich will sie einfach mal von dir wegkommen. Grace sprach es nicht aus. Sie wollte keinen Streit. Davon hatte es schon zu viel gegeben.
Die Wände der Küche waren gelb, der Boden bestand noch aus den ursprünglichen Terrakottafliesen. Das alte Abwaschbecken war nie ersetzt worden, ebenso wenig der Brotkasten aus lackiertem Metall. Die hölzerne Arbeitsfläche hatte Brandflecken und Kratzer, die Grace schon ihr Leben lang kannte. Der Wasserkessel und der Toaster waren neu hinzugekommen, aber ansonsten … Diese Küche war Grace so vertraut, dass sie das Gefühl hatte, alles finden zu können, auch mitten in der Nacht.
»Kaffee?« Er öffnete den Schrank und nahm ein Glas Instantkaffee heraus. Grace wusste, dass es nur für den Fall gedacht war, dass Elisa nicht da war, um Kaffee zu kochen.
Sie wollte schon Nein sagen – was hatte es für einen Sinn, dass sie Zeit miteinander verbrachten, wenn sie sich am Ende immer stritten? –, als sie den Ausdruck in seinen blaugrauen Augen bemerkte. Sein Blick hatte etwas Draufgängerisches, immer war da etwas Draufgängerisches. Aber da war auch noch etwas anderes. Sie blinzelte. Es sah ein bisschen aus wie Einsamkeit.
»Ich mach das«, erklärte sie.
Während ihr Vater sich an den alten Bauerntisch setzte, der auch schon ewig hier stand, beschäftigte sich Grace mit Elisas Perkolator-Kanne, füllte sie mit Wasser, gab den aromatischen, starken Kaffee hinein, den ihre Stiefmutter bevorzugte – zweifellos ein Erbe aus ihren Tagen in Kuba –, und schraubte das Oberteil auf. Sie stellte die Kanne auf den Gasherd. Es war nur Kaffee. Und er war schließlich ihr Vater.
Seit wie langer Zeit sagte sie sich das schon? Sie spürte eine kleine Welle der Zuneigung zu ihm, zu dem Vater, der er einmal gewesen war. Drehte sich um und ertappte ihn dabei, wie er einen schnellen Schluck aus der kleinen Whiskyflasche nahm und sie wieder in die Tasche seines Tweedjacketts steckte. Scheiße, dachte sie, was machte sie überhaupt hier?
»Wie läuft’s mit der Arbeit?«, fragte er, als sie ein paar Minuten später den Kaffee vor ihn hinstellte.
»Okay.« Sie setzte sich ihm gegenüber, aber sie war misstrauisch. Ihr Vater war mit ihrem neuen Berufsweg nicht einverstanden. Er fand, er sei unter ihrer Würde – was schlicht lächerlich war. Er verlor nicht viele Worte darüber, aber das brauchte er auch nicht.
»Gibt’s irgendwelche neuen Kunden?«
Gott, bei ihm klang das so anrüchig. Wie machte er das nur? Grace umfasste ihren Kaffeebecher ein wenig fester. »Ein paar.« Sie war Massagetherapeutin. Eine Heilerin, dachte sie gern.
Grace hatte eine Weile gebraucht, um ihren Weg zu finden. Sie hatte sich in der Mittelstufe nicht besonders gut geschlagen und in der Oberstufe noch schlechter – manchmal hatte sie den Verdacht, dass sie absichtlich keine gute Schülerin gewesen war, um ein Argument ihrem Vater gegenüber zu haben –, aber sie hatte dennoch in einer Bank und dann bei einer Versicherung gearbeitet. Die Arbeit war zwar nicht aufregend gewesen, aber wenigstens war das Betriebsklima gut und … In Wahrheit hatte sie immer etwas anderes machen wollen. Wie oft hatte sie mit Robbie darüber gesprochen und gehofft, dass er ihr zureden würde, ihren Job aufzugeben, vielleicht sogar zu studieren. Du bist noch jung, sagte er in ihrer Fantasie, es ist nicht zu spät, was Neues anzufangen, etwas Befriedigenderes, Kreativeres vielleicht. Aber Robbie sagte nichts dergleichen, weil er, wie Grace nur zu gut wusste, wollte, dass sie etwas ganz anderes machte.
Und dann hatte sie mit Robbie und Theo eines Abends vor ungefähr zwei Jahren um den Küchentisch gesessen, und Robbie hatte über Schmerzen in den Schultern geklagt.
»Lass mich mal.« Sie war aufgestanden und hatte die Verspannungen wegmassiert, die davon kamen, dass er sich den ganzen Tag über seinen Computer beugte.
»Oh mein Gott. Das tut so gut …«
Theo hatte die Augen verdreht. »Bitte. Sucht euch doch ein Zimmer«, hatte er gebrummt.
Grace hatte spielerisch nach ihm geschlagen.
»Du solltest es mal ausprobieren.« Robbie rollte die Schultern. »Mach weiter, Grace. Bearbeite ihn fünf Minuten.«
Grace hatte Theo schon oft berührt, ohne darüber nachzudenken. Sie hatte ihn umarmt, sie hatte ihn auf die Wange geküsst, und er hatte sie sogar schon bei der Hand genommen, wenn sie die Straße überquerten. Aber das hier fühlte sich anders an. Sie stand hinter ihm und legte die Handflächen auf seine Schultern. Er trug ein grob gewebtes cremefarbenes Leinenhemd. Darunter fühlte sein Körper sich warm an.
Sie fing an, mit den Daumen zu massieren. Sanft zuerst und dann, als sie die Verspannungen spürte, fester.
»Jesus«, sagte Theo zu Robbie. »Jetzt weiß ich, was du meinst.« Und sie alle hatten gelacht.
Theo hatte nach ihrer Hand gegriffen, bevor sie sie wegnehmen konnte. »Du solltest eine Ausbildung machen«, erklärte er. Seine schwarzen Augen blickten ernst.
»Was?«
»Das zum Beruf machen. Du hast heilende Hände.«
Grace sah auf ihre Hände und entzog sie ihm leise lachend. »Klar«, sagte sie. »Das wäre besser als die Versicherung. Aber vergiss nicht, dass wir die Hypothek abzahlen müssen.«
Theo hatte es ernst gemeint. Er beugte sich auf seine typische Art vor, konzentriert und doch vollkommen entspannt, die Stirn gerunzelt, und strich sich das dunkle Haar aus dem Gesicht. »Wenn Robbie die Dinge an der finanziellen Front am Laufen hält, könntest du dich als Massagetherapeutin ausbilden lassen«, sagte er. »Dich selbstständig machen. Von zu Hause aus arbeiten.«
»Massagetherapeutin«, wiederholte sie. Die Vorstellung gefiel ihr. Sie warf Robbie einen Blick zu.
»Wir könnten das schaffen«, sagte er.
Sie hatte gewusst, was er dachte. Diese Neuorientierung war in Ordnung. Sie war ungefährlich. Damit könnte Grace auch noch weitermachen, wenn wir eine Familie gründen … Seit über einem Jahr kam dieses Thema jeden Monat auf den Tisch – und ja, Grace war sich des Problems bewusst. Sie war schon Ende dreißig. Und sie hatte keinen aufregenden Job, der ihr viel bedeutete. Wie lange wollte sie noch warten?
»Nicht schlecht, der Gedanke«, sagte Robbie. »Möchtest du ein Bier?«, fragte er Theo.
Der Moment war vorbei. Aber der Funke der Idee war auf Grace übergesprungen und hatte etwas in ihr entzündet. Um mehr herauszufinden, hatte sie sich über Kurse vor Ort und Möglichkeiten im Internet informiert. Sie hatte viel darüber nachgedacht. Manchmal fragte sie sich sogar, ob diese Vorstellung schon lange in ihrem Hinterkopf gewesen sei und nur darauf gewartet habe, hervorgeholt zu werden. Und dann … Sie hatte beschlossen, die Dinge richtig anzugehen. Sie wollte nicht in einem Schönheitssalon arbeiten, sondern wollte, dass das, was sie tat, einem ernsthaften Zweck diente. Und wenn sie wirklich den Schmerz und Stress von Menschen lindern wollte, musste sie die Prozesse so gut wie möglich verstehen: wie Massage funktionierte, wie Muskeln, Gelenke und Gewebe zusammenarbeiteten und auf unterschiedliche Methoden reagierten.
Je mehr sie herausfand, umso klarer wurde ihr, dass sie ihre Wohlfühlzone verließ. Aber sie hatte das Gefühl, sie müsse das tun. Die Ausbildung, für die sie sich entschied – und die glücklicherweise direkt hier in Bristol angeboten wurde –, war intensiv und verlangte ein großes Lernpensum, vierzig Stunden Massagepraxis – und viel Engagement, nicht nur für die Inhalte, sondern auch sich selbst gegenüber. Dazu gehörten ehrliche Selbstreflexion, das Führen eines Tagebuchs, in dem sie ihre Erkenntnisse und Erfahrungen im Verlauf des Kurses festhielt, das Studium von Anatomie und Pathologie. Sie musste lernen, wie die körperlichen Systeme – der Atemapparat, der Verdauungstrakt – funktionieren, welche Art von Berührung die richtige war.
Je mehr sie darüber nachdachte, desto besser gefiel Grace die Vorstellung, mit Menschen zu arbeiten, und sie genoss den Gedanken, etwas Wertvolles zu tun. Sie war bereit, sich der Herausforderung zu stellen. Sie wollte sich als Persönlichkeit weiterentwickeln und sich ihrer selbst stärker bewusst werden. Sie wollte ihren Sinn für Berührung einsetzen. Natürlich würde es Selbstzweifel geben, Zeiten, in denen ihre Zuversicht ins Wanken geraten und die ganze Idee vielleicht ein bisschen verrückt erscheinen würde. Aber Grace war entschlossen, es zu schaffen. Sie würde sich ihre Praxis und einen Patientenstamm aufbauen und sich damit auf eigene Beine stellen.
Auch Elisa war einverstanden gewesen, nur Grace’ Vater konnte nicht damit umgehen. Robbie und Theo fanden beide, dass sie gut massieren konnte. Theo hatte gesagt, sie habe heilende Hände. Es stimmte, wenn sie Robbies Schultern bearbeitete, fühlte sie die Knoten und Verspannungen, sie spürte beinahe, was nötig war, um alles in Ordnung zu bringen. Eine neue Karriere, eine neue Richtung in ihrem Leben winkten ihr. Und Grace beschloss, die Chance zu ergreifen. Den Einführungskurs absolvierte sie als Vorgeschmack und genoss ihn. Er schenkte ihr die Zuversicht, die sie brauchte, um weiterzumachen.
Sie hatte ihre Praxis »Equilibrium« genannt, denn Harmonie und Balance waren das, was sie zu erreichen versuchte. Physische Harmonie dadurch, dass der Körper so funktionierte, wie er sollte, aber auch geistige Harmonie. Geistige Entspannung stand in Verbindung mit der Entspannung des Körpers, zumindest war Grace davon überzeugt. Und sie glaubte an die heilende Kraft der Berührung. Manche Menschen erlebten so selten Berührungen, und selbst wenn – wie häufig bedeutete dies Kommunikation, Trost, Heilung und war nicht sexueller Natur? Berührungen waren ein integraler Bestandteil des Menschseins, waren es immer schon gewesen. Grace erinnerte sich daran, wie sie Cathy in einer Kursstunde die Füße massiert hatte. Als sie fertig war, war Cathy so warm und entspannt gewesen, dass sie volle fünf Minuten lang nicht gemerkt hatte, dass Grace sie nicht mehr berührte. Die starke Empfindung der Berührung hatte angehalten … und Grace war stolz gewesen.
Grace sah hinüber zu ihrem Vater. »Vielleicht solltest du mal zu einer Massage vorbeikommen.« Sie versuchte, ihre Stimme ungezwungen klingen zu lassen.
Sie arbeitete in ihrem kleinen Haus in der Passage Street, machte aber, wenn gewünscht, auch Hausbesuche, um mehr Optionen zu haben und ihren Kundenkreis zu erweitern. Manchmal war es gut, Dienstleistungen mobil anzubieten. Niemand hatte mehr Zeit. Und genau das bot sie an: Zeit, die man sich selbst schenkte, in der man umsorgt und betreut wurde. Zeit, die in dieser stressigen, technischen Welt, in der sie alle lebten, jeder brauchte. Oder ich komme zu Ihnen, stand auf ihrer Website und ihren Visitenkarten. Und bis jetzt schien ihre Flexibilität sich auszuzahlen.
»Ich?« Ihr Vater schnaubte ungläubig.
»Vielleicht … wäre es hilfreich.«
Er sah sie an, als hätte sie etwas Unaussprechliches vorgeschlagen. »Ich brauche keine Hilfe«, knurrte er.
Trotzdem sah sie etwas in seinen Augen. Angst vielleicht? Und wieder wurde sie weich. Er gehörte schließlich einer anderen Generation an. Es gab so viel, das sie ihm vorwarf, aber letztlich war er noch immer ihr Vater, und er war ihr wichtig. Sie stellte ihren Kaffee ab und beugte sich zu ihm hinüber. »Ich weiß, es ist nicht ganz das, was du dir für mein Leben vorgestellt hast.« Am liebsten hätte sie gesagt, es sei eine gute Sache, obwohl er anders darüber dachte. Sie wollte ihm sagen, dass er sich mit seinen Vermutungen irrte. Sie wünschte, er würde sie in die Arme nehmen und so festhalten, wie ein Vater es tun sollte. Aber es stand so vieles zwischen ihnen. Seine Einstellung und die Vorwürfe, die Grace ihm machte. Sein Trinken, der Tod ihrer Mutter, seine Schuld. All diese Dinge standen da wie Wachposten, die entschlossen waren, sie nicht durchzulassen.
»Ist es nicht, nein.« Er warf ihr einen ungewöhnlich ernsten und direkten Blick zu. »Aber es ist deine Entscheidung, Grace. Uns beiden, deiner Mutter und mir, war eine gute Bildung für dich wichtig, das ist alles.«
Grace hätte schreien mögen. Musste er auch noch ihre Mutter ins Spiel bringen? »Aber ich habe diese Bildung genutzt«, sagte sie und zwang sich, ruhig zu bleiben. Sie sollte ihm ihr Abschlusszeugnis als Physiotherapeutin zeigen. Das Studium der Anatomie war komplex und eine Herausforderung gewesen. Zudem trugen Therapeuten eine große Verantwortung. Die Patienten vertrauten darauf, dass sie etwas bewirkten. Und wenn sie sozusagen nicht lieferten, waren sie gescheitert. »Ich habe einen Abschluss, Dad. Ich hab mich über die Kurse informiert und einen guten ausgesucht. Warum verstehst du das nicht? Massagetherapie ist ein seriöser Beruf.« Sie war amtlich registriert und verpflichtet, regelmäßig an Fortbildungen teilzunehmen. Aber es hätte nicht nötig sein müssen, dass sie ihm das alles erklärte.
»Nenn es, wie du willst, es ist trotzdem, was es ist«, murmelte ihr Vater. Sein linkes Auge hatte zu zucken begonnen. Ein Zeichen, das sie zu erkennen gelernt hatte. »Massagesalons gibt’s schon seit undenklichen Zeiten.«
»Ich arbeite nicht in einem Massagesalon.« Grace war sich bewusst, dass sie spröde und kalt klang. Sie stellte ihre Kaffeetasse ab. Sie würde nicht in die Falle tappen. Diese Befriedigung wollte sie ihm nicht gönnen, und aufregen konnte sie sich später. Aber es war so verdammt ärgerlich. Ja, gelegentlich bekam sie schon Anrufe von potenziellen Kunden, die sich vorstellten, Massagetherapie sei eine freundliche Umschreibung für etwas Intimeres. Aber darauf hatte sie eine wohl erprobte Antwort parat, und davon würde sie ihrem Vater nicht erzählen.
»Ich wollte nur, dass dir alle akademischen Möglichkeiten offenstehen«, sagte er traurig. »Ich habe dich als Lehrerin und sogar Anwältin gesehen. Du bist ein kluges Mädchen, Grace, warst du schon immer. Ich hab mir einfach nicht vorgestellt, dass du so was machst.«
So was. »Deine Vorstellung, Dad«, sagte sie. »Nicht meine. Deine Erwartungen. Nicht meine.«
Er nickte. »Ich habe versucht, dir beizubringen, wie man sich hohe Ziele steckt, Grace«, sagte er. Er klang verletzt, voller Selbstmitleid. Sie wusste, dass jetzt der Alkohol aus ihm sprach. Er hatte sie auch anderes gelehrt. Zum Beispiel, jemanden zu zerstören. Oder wie man ein Kind nicht großzieht und wie man seinem Kind die Mutter nimmt. Wertvolle Lektionen fürs Leben. Lass uns doch darüber reden, dachte sie.
»Deine Mutter …«
Nicht! Grace schob ihren Stuhl zurück. Sie ging hinüber zum Spülbecken, um die Tassen abzuwaschen, und hielt sich, nur einen Moment lang, haltsuchend am Rand des Beckens fest. Sogar das weiße Porzellan roch nach Alkohol, der durch den Geruch des Putzmittels hindurch wahrnehmbar war, als hätte er ein Glas Whisky in den Ausguss geschüttet, als er ihr Klopfen an der Tür gehört hatte. Lass los … Grace zwang sich, ihren Griff zu lockern. Wie hielt Elisa das nur aus?
»Tut mir leid, Schatz. Es ist nur …« Nun klang er verwirrt. Aber Grace’ mitfühlender Moment war verflogen. Sie war zurück in der Vergangenheit. Was hatte ihr Vater getan, dass ihre Mutter damals, vor vielen Jahren, auf die Straße gerannt war? Sie konnte es sich gut vorstellen.
»Meine Mutter hätte es vielleicht verstanden«, sagte sie kühl, ohne sich zu ihm umzudrehen. »Meine Mutter hätte vielleicht gewollt, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe.« Doch sicher war sich Grace nicht. Sie blinzelte heftig. Das Weiß des alten Porzellans war zu grell, zu kalt. Und Grace’ Erinnerungen an ihre Mutter waren verschwommen. Sie wusste noch, wie schön sie gewesen war – aber sie hatte auch ein Foto in ihrem Schlafzimmer, das sie daran erinnerte. Sie erinnerte sich auch an das Parfüm ihrer Mutter, es roch blumig und süßlich, und an ihr Lächeln – leicht wehmütig, leicht vage. Sie erinnerte sich daran, wie ihre Mutter ihr mit leiser Stimme Gutenachtgeschichten vorgelesen hatte, an das frühmorgendliche Kuscheln im Bett ihrer Eltern und an einzelne Details der Kleidung, die ihre Mutter getragen hatte: einen Seidenschal in Dunkelrot- und Cremetönen, das Zickzackmuster eines Minikleids, eines ihrer Lieblingsstücke. Sie erinnerte sich an ihr aschblondes Haar, das sie mit den Spitzen nach außen frisiert getragen hatte. Aber merkwürdigerweise bezog sich der Großteil von Grace’ Kindheitserinnerungen auf ihren Vater. Hatte sie die an ihre Mutter verdrängt, um den Schmerz ihres Verlusts zu lindern?
»Oh ja.« Seine Stimme wurde hart. »Erzähl mir bloß nichts von Entscheidungen.«
»Werd ich nicht«, sagte sie knapp. Weil ich nicht mehr herkommen werde. Sogar jetzt würde sie das nicht laut aussprechen. Sie drehte sich um.
»Tut mir leid, Liebes.« Ganz plötzlich wirkte die Miene ihres Vaters zerknirscht, beinahe niedergeschmettert, und Grace wusste, dass die Trinkerei das bewirkte. Abrupte Ausbrüche von Wut und Gereiztheit, gefolgt von Entschuldigungen. An diesem Punkt wäre es eigentlich Grace’ Part gewesen, ihm zu beteuern, dass alles in Ordnung sei, dass sie ihm nicht böse wäre, dass es ihr nichts ausmache.
Tränen traten ihr in die Augen. »Ich mag meine Arbeit.« Obwohl sie fest an die Kraft menschlicher Berührungen glaubte, ging sie bewusst nicht zu ihm, um ihm sanft die Hand auf die Schulter zu legen. »Und du irrst dich – was ich tue, ist wichtig. Es hilft Menschen.«
»Ich weiß, Grace. Ich hätte das alles nicht sagen sollen. Ich bin nur ein dummer alter Mann. Bitte …«
Sie stapfte in die Diele, um ihre Jacke zu holen. Die Wut war von den Zehen her in ihr hochgestiegen. Es war immer das Gleiche. Grace versuchte, versöhnlich zu sein, und dann sagte er etwas, das sie zornig machte. Etwas, das sie in Rage brachte. Aber der wirkliche Grund, aus dem sie nicht nett zueinander sein konnten … Der, dachte sie, lag so tief begraben wie ihre Mutter.
3. Kapitel
»Na, Theo«, sagte Elisa, »wo hast du dich versteckt?«
»Versteckt?« Einen Moment lang lag in seinen dunklen Augen ein Ausdruck, den sie nicht deuten konnte, dann setzte er sein strahlendes Lächeln auf, und der Eindruck war verschwunden. »Du weißt doch, was man so sagt, Elisa.«
»Nein, das weiß ich ganz bestimmt nicht.« Bei diesen Worten lächelte, winkte und nickte Elisa weiter, um die Gruppenmitglieder zu verabschieden. Sie vermutete, dass Theo ebenfalls auf dem Sprung war, aber woran hätte sie das erkennen können? Er war schon immer ein unruhiger Geist gewesen.
Er beugte sich näher zu ihr. »Man sagt, dass Zauberer sich besser als andere darauf verstehen, etwas zu verstecken.«
Hm. Sie verstanden sich jedenfalls gut darauf, rätselhaft zu erscheinen, und waren nicht weniger exzellent darin, zu verhindern, dass man wusste, was sie dachten. Das waren keine kubanischen Charakterzüge, also konnte sie nur annehmen, dass sie wirklich ins Reich der Magie gehörten. Sie beschränkte sich darauf zu sagen: »Ich hab dich einfach eine Weile nicht gesehen.« Er kam und ging, aber Elisa hatte sich Theo immer besonders verbunden gefühlt. Teils, weil sie aus demselben Land stammten, teils, weil er so gut mit ihrer Stieftochter und Robbie befreundet war, aber auch, weil Elisa ihn gern mochte. Theo war ein junger Mann, der andere gern auf den Arm nahm, aber sie spürte, dass er das Herz auf dem rechten Fleck hatte.
»Hast mich wohl vermisst, was?« Und da war es wieder, dieses Lächeln.
Elisa schnalzte mit der Zunge. »Natürlich. Du hast immer etwas Interessantes zu den Treffen beizutragen.« Zumindest war er das einzige Gruppenmitglied, das kubanisches Spanisch mit amerikanischem Akzent sprach.
Er lachte. »Wenn das so ist, werde ich mir Mühe geben, öfter zu kommen.« Er küsste sie leicht auf beide Wangen.
»Hm. Gut. Hasta luego.« Bis bald. Sie sah ihm nach, als er rasch davonging. Er war also nicht mit dem Auto gekommen. Er wandte sich in Richtung Castle Park und hatte einen langen Heimweg vor sich. Aber er war jung, und junge Leute besaßen grenzenlose Energie. Das waren noch Zeiten gewesen, was?
Elisa ging weiter an der imposanten Kirche mit ihrem hohen Turm und den gotischen Fenstern vorbei. Selbst war sie keine Kirchgängerin. Ihre Eltern hatten ihr Leben lang am Katholizismus festgehalten, aber Elisas religiöse Inbrunst war noch nie besonders groß gewesen. Sie war ihr als Teenager in Kuba nach und nach abhandengekommen, und nichts, was sie seitdem gesehen oder erlebt hatte, hatte sie dazu bewogen, zu ihrem Glauben zurückzukehren. Sie ließ den Blick über den goldbraunen Stein des Bauwerks schweifen. Im Vergleich dazu wirkte das kleine Gemeindezentrum, das daran angrenzte, geradezu winzig und bescheiden, aber es diente einem guten Zweck: Es beherbergte nicht nur ihre spanischsprachige Gemeindegruppe, sondern eine Kinderkrippe, eine Mutter-Kind-Gruppe und anderes. Elisa ertappte sich bei dem Gedanken, dass sie ihren Liebsten vielleicht nicht verloren hätte, wenn es einen Gott gäbe. Konnte das wahr sein? Religiöser Glaube war eine Unterstützung, aber manche Menschen zogen es eben vor, sich allein durchzuschlagen. Es hatte allerdings Zeiten gegeben, da war sie versucht gewesen …
Sie spazierte über das dürre Gras des Kirchhofs und trat auf die Straße. Sie wollte zu Fuß in die King Street zurückgehen, weil es nicht weit war. Es war ein lebhaftes Treffen gewesen. Die Teilnehmer waren anständige Leute, und Elisa betrachtete es als ihre Pflicht, dafür zu sorgen, dass sie sich hier in England heimisch fühlten. Einige von ihnen waren Briten und wollten einfach ihre spanischen Konversationsfähigkeiten auffrischen, aber die meisten waren hergekommen, um in einen Neuanfang zu starten. Genau wie Elisa – damals, als sie erst achtzehn Jahre alt gewesen war. Das war, dachte sie jetzt, während sie den Tower Hill überquerte, so lange her, dass sie sich fast gar nicht mehr daran erinnern konnte. Aber nur fast. Damals hatte sie nicht viel mitzureden gehabt. Und als sie zum ersten Mal einen Fuß auf britischen Boden gesetzt hatte, wäre sie nie auf die Idee gekommen, dass sie jetzt noch hier sein und tun würde, was sie tat. Wirklich nicht. Es war ihr nie wie ein dauerhaftes Arrangement vorgekommen.
Sie ging über die Queen Street und passierte den kleinen Pub an der Ecke. Kurz meinte sie, am Fenster Theos dunklen Kopf zu sehen, aber im nächsten Moment war er verschwunden. Jetzt habe ich schon Halluzinationen, dachte sie. Was kommt als Nächstes? Sie kam an einem Gitarrenladen und einer Sandwich-Bar vorbei und natürlich an Grace’ und Robbies kleines Haus. Sie blieb stehen. Sollte sie an die Tür klopfen und einen Schwatz mit Grace halten? Wenn sie schon hier war, konnte sie auch gleich ihren Laptop abholen. Sie wusste, dass Robbie unterwegs war, bei irgendeiner Konferenz. Aber es brannte kein Licht, also musste Grace ausgegangen sein. Vielleicht sogar zur King Street. Sie beschleunigte ihre Schritte. Es sah mehr und mehr nach Regen aus.
Es war kalt, obwohl angeblich Frühling war. Elisa dachte an die Wärme der kubanischen Sonne. Noch so lange hin … In Bristol würde es bis April oder Mai kalt bleiben, und dann würde der englische Frühling zögernd und unentschieden in einen unruhigen Sommer übergehen: An einem Tag schien die Sonne, und der nächste brachte Wolken und Nieselregen. Bei diesem Wetter wusste man nie, woran man war – kein Wunder, dass die Leute so viel darüber redeten.
Elisa fröstelte trotz des Mantels mit dem Pelzkragen, den sie schon den ganzen Winter über getragen hatte, trotz ihrer Lederhandschuhe und gefütterten Stiefel, die sie noch nicht bis November wegräumen mochte. Mit vorsichtigen Schritten ging sie zum Kai hinunter, dann unter dem Torbogen entlang und beobachtete ein gelbes Fährboot, das gemächlich vorbeituckerte. Sie wurde allmählich alt. Sie spürte die Kälte viel stärker als mit achtzehn. Manchmal hatte sie das Gefühl, sie könnte sich die Hitze der kubanischen Sonne nicht einmal mehr vorstellen – die Art, wie sie einem die Knochen wärmte, die Muskeln entspannte und das Herz erhellte. Und dann wieder war es, als sei das alles – Kuba, Duardo, das letzte Mal, als sie in Havanna Rumba mit ihm getanzt hatte – erst gestern geschehen.
Nach jener ersten Rumba mit Duardo im La Cueva, damals mit fünfzehn, war Elisa wie in einem Traum nach Hause gegangen. Sie hatte in ihrem schmalen Bett in der überfüllten Wohnung, in der die ganze Familie lebte, gelegen, die wackligen Fensterläden aufgestoßen, die Sterne am Nachthimmel betrachtet und jeden Moment des Tanzes noch einmal erlebt. Wieder hatte sie die Musik gehört, die in ihrem Kopf pulsierte, wieder Duardos Körper gespürt, der sich an sie drückte, und war fast in diesen eindringlichen Augen ertrunken. Und am nächsten Tag hatte er sie aufgespürt.
Von da an trafen sie sich regelmäßig. Damals, Ende der 1950er-Jahre, war das in Kuba kein Problem. Die Menschen machten sich größere Sorgen darum, dass sie genug zu essen hatten, als darum, was ihre Kinder trieben. Elisa und Duardo spazierten in dieser Zeit zwischen Hausierern, Karren und Straßenhändlern durch die halbe Stadt. Nicht durch ihr eigenes Viertel, sondern weiter draußen, wo sie niemand erkennen und Fragen stellen würde. Und sie verbrachten Stunden am Malecón – der Uferpromenade –, saßen nebeneinander am Strand, steckten die Köpfe zusammen oder beobachteten die braunen Pelikane, die in das aufgewühlte Meer tauchten. Dort hatte er sie zum ersten Mal geküsst – sanft am Anfang, forschend, und dann fordernder, und die Leidenschaft war über die beiden hereingebrochen wie die Brandung ans Ufer.
Bei der Erinnerung erschauerte Elisa. Das mochte zwar viele Jahre her sein, aber manchmal stand es ihr klarer vor Augen als der gestrige Tag. Dort hatte Duardo ihr auch von all seinen Träumen und Zielen erzählt. Wie sie gleich vermutet hatte, war er kein gewöhnlicher Junge. Er glaubte an die kubanische Revolution und an den Kampf ihres Landes um wahre Unabhängigkeit.
»Wusstest du«, hatte er Elisa eines Tages gefragt, und seine dunklen Augen glühten, »dass an dem Tag im Jahr 1898, als Spanien Kuba die Unabhängigkeit gewährte und der Vertrag von Paris unterzeichnet wurde, über Havanna die US-Flagge und nicht die kubanische Fahne wehte?« Er trug seinen Hut gewöhnlich schief aufgesetzt, sodass ein Teil seines Gesichts immer im Schatten lag.
Sie schüttelte den Kopf und traute sich nicht, etwas zu dieser Tatsache zu sagen, die ihn so erzürnte. Aber sie wusste schon, dass Duardo sich nichts mehr wünschte, als mit den Rebellen zu kämpfen, an der Seite von Che Guevara und Fidel Castro. Er war bereit, sich für die Sache zu opfern. Das hatte er ihr gesagt.
»Und was dann?«, fragte Elisa ihn. Damals hatte sie wenig Interesse an Politik gehabt. Sie war fünfzehn Jahre alt und zum ersten Mal bis über beide Ohren verliebt. Sie wollte etwas über Liebe und Romantik hören. Was empfand er für sie? Das wollte sie wissen.
»Dann wird unser Leben besser werden«, erklärte Duardo. Er streckte die Beine aus, nahm einen Kieselstein und warf ihn in Richtung Wasser.
»Du meinst, wir haben dann mehr zu essen?« Elisa konnte nicht weit darüber hinausdenken. Sie schlang die Arme um die Knie und sah zum purpurn angehauchten Horizont hinaus. Ihre Familie, die Fernández García, war einmal relativ wohlhabend gewesen – ihr Vater sprach immer noch oft davon. Elisas Vorfahren hatten östlich von Havanna auf dem Land eine Zuckerrohrplantage betrieben, bis die Amerikaner mit ihren teuren Maschinen und ihren neumodischen Ideen herübergekommen waren und sie mehr oder weniger gezwungen hatten, ihnen das Land zu überlassen, indem sie sie langsam vom Markt verdrängten. Elisas Familie konnte einfach nicht mithalten. Die Branche war im Umbruch, und sie konnten unmöglich mit den US-amerikanischen Plantagenbesitzern konkurrieren. Elisas Vater – der sonst wohl die Plantage geerbt hätte – war stattdessen Page in einem protzigen Hotel in Havanna geworden und hatte die Amerikaner bedient, die sie alle hassten. Das musste eine schreckliche Demütigung für ihn gewesen sein. Aber so war nun einmal ihr Leben, und Elisa hatte nie etwas anderes gekannt. Wenigstens hatte ihr Vater – anders als so viele andere – eine Anstellung. Wenigstens hatten sie ein richtiges Dach über dem Kopf. Wenigstens hatten sie zu essen.
»Mehr zu essen, ja. Aber noch wichtiger … Freiheit«, sagte Duardo. Er warf noch einen Kieselstein und sah zu, wie er über die Wellen hüpfte. »Wir werden frei sein, Elisa, denk doch. Wir werden frei sein.«
»Und werden wir auch frei sein, um zusammen zu sein?«, fragte sie ihn schüchtern. Sie beschattete ihre Augen gegen die Sonne und sah ihn an, seine wie gemeißelten afrikanischen Züge, seine sinnlichen, vollen Lippen, die kleine Lücke zwischen seinen Schneidezähnen. Sie war noch jung, aber das wünschte sie sich mehr als alles andere.
»Oh ja«, sagte er und richtete diese intensive Aufmerksamkeit, die sie liebte, wieder auf sie. Er umfasste ihre Schultern und küsste sie hart auf den Mund, bis sie das Gefühl hatte, sich gleich hier auf den Kieselsteinen aufzulösen und mit der Flut davongeschwemmt zu werden. Schließlich hatte er sich von ihr gelöst. »Wir werden zusammen sein, Elisa, darauf kannst du dich verlassen.«
Aber so einfach war das nicht gewesen, dachte Elisa jetzt, während sie in Richtung Castle Park ging. Vor ihnen lagen viele Hindernisse, und damals kannten sie nicht einmal die Hälfte davon. Sie waren nur ein Junge und ein Mädchen mit vollkommen verschiedenem Hintergrund, die Kubaner und frei sein wollten. Ein Junge und ein Mädchen, die verliebt waren. Betrübt schüttelte Elisa den Kopf. Mehr waren sie nicht gewesen.
Im Castle Park vor ihr erhob sich eine weitere Kirche – St. Peter’s –, die heutzutage verfallen war. In Bristol gab es so viele Kirchen, es grenzte an ein Wunder, dass sie alle voll waren – falls sie es denn waren. Elisa nickte einem Passanten grüßend zu und tätschelte den Golden Retriever, der neben ihm hersprang. Sie war immer noch fröhlich. Jedes der Treffen mit ihrer spanischen Gemeinde machten ihr Freude, und mittlerweile war es natürlich auch eine Erleichterung, aus dem Haus zu kommen. Ihre Miene veränderte sich, und sie wusste, dass ihr Lächeln verblasst war. Sie schlug den kürzeren Weg am Wasser entlang ein.
Philips Zustand verschlechterte sich, daran bestand kein Zweifel. Dieser dunkle Vorhang zeigte keine Anzeichen, sich zu heben. Aber abgesehen von ihrem Bedürfnis, aus dem Haus zu kommen, waren diese Treffen auch eine Art, die Verbindung aufrechtzuerhalten – nicht nur mit der spanischen Sprache, ihren Eigenarten, ihren Rhythmen und ihrem Tonfall, sondern auch mit dem kleinen Kreis spanisch sprechender Menschen, die hier lebten.
Elisa ließ den Blick über das Ufer schweifen und dachte wieder an all diese Hindernisse. Ihre unterschiedliche Herkunft war nur die erste Hürde gewesen, die Duardo und sie hatten überwinden müssen.
Als eine Tante ihm verriet, mit wem sich seine Tochter traf, war ihr Vater nicht einverstanden gewesen, und auch ihre Mutter hatte ihr Vorwürfe gemacht. »Es geht nicht darum, wer er ist«, hatte sie beharrlich behauptet, »sondern, dass ihr so jung seid.« Aber das war noch gar nichts gegen die Reaktion von Duardos Mutter gewesen, als die Wahrheit herauskam.
Elisa schüttelte den Kopf. Es war die Ironie des Schicksals, dass sie jetzt, nach allem, was geschehen war, in Bristol lebte. Bristol war eine Hafenstadt mit einer langen, historischen Verbindung zu allen Handelsgeschäften, in denen Kuba sich hervorgetan hatte, und es war eine kosmopolitische Stadt. Ja, viele Kaufleute hatten von hier aus Sklavenschiffe losgeschickt – Himmel, irgendwann war Bristol anscheinend der geschäftsträchtigste Hafen Großbritanniens gewesen, zumindest was Rum, Zucker und Sklaven betraf. Und man brauchte nur durch die Altstadt zu spazieren, um auf die Gebäude zu stoßen, die mit den Gewinnen aus diesem Handel erbaut worden waren. Aber Elisa war überzeugt davon, dass man alles in seinem Zusammenhang betrachten musste. Auch ihre Familie hatte einst eine Zuckerplantage in Kuba besessen, auch ihre Familie hatte früher Sklaven gehalten. Sie war nicht stolz darauf. Aber die Sklaverei – so brutal und unmenschlich sie auch gewesen war – war ein Teil ihrer Geschichte. Und der von Duardo. Doch die Welt hatte sich weiterentwickelt, zumindest wollte Elisa das gerne glauben.
Sie wandte sich in Richtung Hauptstraße und Bristol Bridge, und der Wind peitschte auf ihren Pelzkragen. Duardos Mutter hatte nicht geglaubt, dass die Welt sich weiterentwickelt hatte. Sie hatte alles getan, was sie konnte, um die Beziehung zu zerstören – und eine Zeit lang hatte sie Erfolg gehabt. Aber … Elisa lächelte in sich hinein. Wenn sie an Duardo dachte, würde es immer ein »Aber« geben. Sie hatten dieses Hindernis überwunden und getan, was unzählige Verliebte vor ihnen getan hatten, wenn ihre Eltern gegen ihre Beziehung gewesen waren: Sie waren zusammen davongelaufen.
Elisa ging weiter. Heute hätte sie nicht einmal rennen können, wenn sie es versucht hätte. Auf den Wegen im Castle Park schlenderten immer viele Menschen umher. Sie tranken Kaffee an dem kleinen Verkaufsstand auf dem Platz vor der Kirche, saßen auf den blauen Bänken und genossen die Aussicht auf das Wasser, die alten Lagerhäuser und die Brauerei dahinter. Natürlich fühlten sich die Menschen, die heutzutage aus dem Ausland hierherzogen, bis zu einem gewissen Grad fremd, genau wie es Elisa ergangen war und immer noch ab und zu erging, sogar nach all den Jahren. Spanisch zu sprechen sorgte dafür, dass sie lebendig blieb, die Sprache war ein Faden, der Elisa mit ihrem Heimatland verband. Es war ein schweres Leben gewesen, aber in vieler Hinsicht auch ein gutes.
Ihre spanischsprachige Gemeindegruppe hielt auch außer der Reihe kleine Treffen am Nachmittag ab. Manchmal sprachen sie über Politik, oft tranken sie starken Kaffee oder sogar englischen Tee, oder jemand brachte ein Instrument mit – eine spanische Gitarre, eine Conga-Trommel und ein paar maracas, Rumbarasseln –, und dann sangen sie auf Spanisch und lächelten sich an, denn Musik war ein direkter Zugang zur Seele und nährte sie wie nichts anderes auf Erden. Es war eine seltsame Mischung aus englischen, spanischen, kubanischen und südamerikanischen Bräuchen, dachte Elisa jetzt, als sie die Straße in Richtung Welsh Back am Hafen überquerte. Heute hatte eine junge Spanierin, die Flamenco unterrichtete, Tapas mitgebracht und jemand anderer einen weichen Rioja, und sie hatten beieinandergesessen, den schweren, im Eichenfass gereiften Wein getrunken und über Essen geredet. Sie lächelte. Es war ein angenehmer Nachmittag gewesen.
In Bristol sollte ein neues kubanisches Restaurant eröffnen. Sie hatten darüber spekuliert, wie erfolgreich es sein und wie wohlschmeckend und authentisch das Essen sein würde. Elisa fand, dass die kubanische Küche stark unterschätzt wurde. Briten, die auf die Insel gereist waren, klagten bei ihrer Rückkehr über das Essen in den Hotels, über die mangelnde Auswahl, die Einfachheit der Gerichte. Elisa runzelte die Stirn. So etwas machte sie wütend, denn es stimmte einfach nicht. Die Kubaner kamen mit wenig aus – was eine Kunst für sich war –, aber was sie nicht alles aus einer Handvoll Reis, ein paar Kichererbsen, einem Freiland-Huhn und ein paar schwarzen Bohnen zaubern konnten … Sie selbst bereitete immer noch viele der Gerichte zu, die Mami vor ihrem Tod gekocht hatte.
Ihre Mutter hatte, glaubte Elisa, immer der kubanischen Hitze nachgetrauert, dem Verlust ihrer Familie und eines Lebens, das nie das gewesen war, das sie erwartet oder sich gewünscht hatte. Qué frío, hatte sie gemurmelt, als sie zum ersten Mal einen Fuß auf englischen Boden gesetzt hatte. Wie kalt … Und qué frío hatte sie immer wieder gemurmelt, bis zu dem Tag, an dem sie starb.
Papi hatte unermüdlich weitergekämpft und nie zugegeben, dass er enttäuscht von ihrem neuen Leben war – falls es denn so gewesen war. Er hatte mit der englischen Sprache gerungen, sie aber ausreichend gemeistert, um eine Anstellung als Schaffner bei der Eisenbahn zu finden, und darauf war er stolz. Es war nicht ganz das, was er vorausgesagt hatte, aber es war ein anständiger Job mit einer angemessenen Bezahlung. Hier in Bristol gab es jedenfalls mehr Arbeit, obwohl ein großer Teil davon Jobs für ungelernte Arbeiter waren, was lange Arbeitszeiten bedeutete. Auch aus anderen Ländern kamen Einwanderer nach Großbritannien, erfuhr Elisa – ihr Vater war mit seinen Ambitionen nicht der Einzige gewesen. Hier war der Lebensstandard höher. Im Vereinigten Königreich waren sich die Leute in der Regierung offenbar der Probleme bewusst, die durch mangelhafte Sozialwohnungen entstehen konnten, und sie wollten keine Gettos oder Abgrenzungen fördern. Doch der Kapitalismus erwies sich als Teil einer komplexeren Welt, und Elisa sah, wie ihr Vater darum kämpfte, die Konkurrenzaspekte dieses neuen Lebens in den Griff zu bekommen: die Bürokratie, die Tatsache, dass man sich hier nicht an den Staat wenden konnte – jeder war für seine eigene Zukunft und die seiner Familie selbst verantwortlich.
Er hatte es versucht. Aber nach Mamis Tod war der arme Papi in seinem neuen Leben nicht mehr mit dem Herzen dabei gewesen. Auch er war früh gestorben und hatte Elisa, als sie nur wenig jünger war als Grace heute, allein hier in Bristol zurückgelassen. Elisa hatte sich schon vor ihrer Zeit alt gefühlt. War es möglich, dass die eigene Jugend für immer an dem Ort gefangen war, den man zurückgelassen hatte?
Das war eine äußerst schwierige Zeit gewesen. Sollte sie zurückkehren? Darüber nachgedacht hatte sie auf jeden Fall. Sie hatte noch Verwandte in Kuba – die Schwester ihrer Mutter, ihre Tante Beatriz und einige Cousins und Cousinen. Freunde hatte sie bestimmt auch noch, obwohl sie einander aus den Augen verloren hatten.
Aber unterdessen hatte sich Elisa in England ein Leben aufgebaut. Sie hatte die englische Sprache erlernt, hier das College besucht und eine Lehrerausbildung absolviert. Sie hatte sowohl an Schulen als auch privat Spanisch unterrichtet, und ihr Einkommen war akzeptabel. Sie hatte auch Freunde gehabt – obwohl keiner von ihnen Duardo das Wasser reichen konnte –, und sie hatte ihre spanischsprachige Gruppe aus Freunden und Landsleuten. Sie hielt sich über die Ereignisse in Kuba auf dem Laufenden, war sich aber nicht sicher, ob sie zurückkehren sollte. Dort würde das Leben viel schwerer sein. Wenn sie ehrlich war, lag für sie immer noch Duardos Schatten über Havanna. Es hieß, die Stadt, in der man sich zum ersten Mal verliebe, habe einen für immer in der Hand … Sie war sich nicht sicher, ob sie je frei von ihm sein würde, wenn sie nach Kuba zurückginge.
Was für eine Ironie – nach allem, was bald danach geschehen war. Die bloße Anstrengung des Gehens ließ Elisa aufstöhnen. Der Fußweg vom Gemeindesaal in die King Street dauerte zwar nur eine Viertelstunde, aber sie war fast den ganzen Tag über auf den Beinen gewesen und wurde jetzt müde. Früher hatte sie den ganzen Tag gearbeitet und den ganzen Abend gekocht und geputzt, früher hatte sie mit Duardo im La Cueva die Nacht durchgetanzt … Aber die Zeiten, in denen sie getanzt hatte, waren vorüber. Das war ihr jetzt klar. Ja, sie wurde allmählich alt.