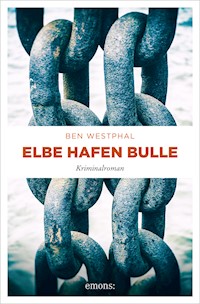
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Gerd Sehling
- Sprache: Deutsch
Tiefe Einblicke in die Subkultur der organisierten Kriminalität von einem echten Hamburger Drogenfahnder. Um sich von seinem ungeliebten Ruhestand abzulenken, betreut der ehemalige Drogenfahnder Gerd Sehling im Hamburger Hafen ehrenamtlich ortsfremde Matrosen bei ihren Landgängen. Als er einen heftigen Streit zwischen einem Schiffsoffizier und einem Hafenarbeiter beobachtet, an dessen Ende ein dickes Geldbündel den Besitzer wechselt, wird sein Ermittlerinstinkt geweckt. Entschlossen mischt er sich in die Arbeit seiner einstigen Kollegen ein und kommt dabei mehr als einem Verbrecher in die Quere.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Ben Westphal, 1981 in Hamburg geboren, machte nach dem Abitur eine Ausbildung als Kriminalbeamter. 2006 wechselte er ins Rauschgiftdezernat. Einige Jahre später begann er, Rauschgift-Krimis mit Hamburg-Bezug zu schreiben – und was als einmaliges Pensionsgeschenk für einen Kollegen begann, wurde zu einer Leidenschaft fürs Schreiben.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: arcangel.com/Mohamad Itani
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Marit Obsen
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-017-4
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Der Kampf gegen die Drogenkann nicht gewonnen werden,aber das ist kein Grund,ihn nicht zu führen.
Bernd Buchali, Rauschgiftfahnder
Prolog
Am braunen Río Guayas in Ecuador liegt das farbenprächtige Guayaquil. Fast drei Millionen Menschen leben von Geburt an hier oder sind in die pulsierende Hafenmetropole gezogen, um ihr Glück zu suchen. Im Schatten des modernen Übersee-Terminals erheben sich auf einem Hügel viele flache Hütten, in denen die Armen der Stadt ein Zuhause gefunden haben.
Etliche Containerschiffe verlassen in Guayaquil tagtäglich über einen Meereszufluss den südamerikanischen Kontinent, um die beliebten Güter des Landes wie Kakao, Kaffee und Bananen in die ganze Welt zu transportieren.
José Lima de Soares, den alle nur Pescadinho nennen, steht am groben Sandstrand gegenüber dem Containerhafen und blickt auf die MS Santa Rosa, die gerade beladen wird. Der Nachthimmel ist dunkel, nur der gelbliche Schein der Hafenbeleuchtung liegt flackernd auf dem Wasser. Der gerade eben erwachsene Mann steht bis zu den Knöcheln im kühlen Wasser des pazifischen Ozeans, die Arme in die schmalen Hüften gestemmt. Er hat seine dunklen Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Der hagere Körper steckt in einem dünnen Neoprenanzug. Den Reißverschluss hat er noch nicht hochgezogen.
Josés brauner Rücken ist übersät mit Narben, die sich über die Schulterblätter ziehen. Er hatte keine einfache Kindheit. Immer wieder zog sein Vater den Gürtel aus seiner Hose, wenn er gefrustet war von seinem Leben. Das Leder ließ er dann auf den Sohn niedersausen, der zu klein und zu schwach war, um sich gegen den stämmigen Mann zur Wehr zu setzen. Nicht selten ertrug José es sogar freiwillig, um seine jüngeren Geschwister vor der Wut des Vaters zu schützen.
In manchen Momenten empfand er Hass gegenüber seinem Vater, doch häufiger war es Mitleid. Der Alkohol hatte Carlos Lima de Soares’ Wesen zerstört. Der stetig abnehmende Ertrag mit dem Fischkutter und das drohende Ende der langen Familientradition taten ihr Übriges.
Als die letzte Fahrt des Vaters hinaus auf den Pazifik ohne Wiederkehr endete, war José von seinem Peiniger erlöst, aber auch in der Pflicht, für seine Familie zu sorgen.
Die Arbeit auf der nahe gelegenen Fischfarm brachte kaum ausreichend Geld, um sich selbst, die Mutter und seine Geschwister zu ernähren. Hunger war ihr steter Begleiter. An die Bezahlung eines Schulgeldes war kaum zu denken.
Josés Leidenschaft für das Schwimmen sollte ihm aber eine Tür öffnen, mit der er nicht gerechnet hatte.
An einem Abend, unmittelbar nach dem allabendlichen Training, stand ein Mann neben seinem Spind. Er kannte ihn bereits von den letzten Einheiten, bei denen er als Zuschauer am Beckenrand stand. Die lockigen, zurückgegelten Haare lagen eng am Kopf an. Sein Blick aus dunklen Augen wirkte offen und freundlich.
José schaute den Mann fragend an. Hatte er richtig gehört? Dieser blasshäutige Fremde bot ihm einen lukrativen Job als Schwimmer an, der ihm neue Möglichkeiten eröffnen sollte. Der Akzent verriet, dass der Mann vermutlich Kolumbianer war. Einen Namen nannte er ihm nicht. Er drückte ihm nur ein Telefon in die Hand und sagte, er solle sich bereithalten.
Bei seinen ersten Aufträgen wurde er von einem erfahrenen Schwimmer begleitet. Damals musste er nur halb so viel leisten wie heute. Doch ein gutes Maß an Übung und das angepasste Training ließen ihn immer besser mit der Arbeit zurechtkommen, und lange schon schafft er es auch allein.
Das Erklimmen der wackeligen Strickleiter mit der schweren Tasche auf dem Rücken ist besonders ermüdend. Wenn es lediglich um das Schwimmen ginge – es wäre keine Herausforderung für ihn. Auch wenn die Strömungen teilweise tückisch sein können. Er muss den richtigen Moment der Gezeiten abwarten, um nicht zu weit abzutreiben.
Wie immer liegen vier dunkle, wasserdichte Taschen neben ihm am Ufer. An jeder von ihnen hat er dunkle Bojen befestigt, die ihnen im Wasser ausreichend Auftrieb verleihen sollen. Viermal nacheinander wird er nun mit jeder Tasche einzeln zur MS Santa Rosa schwimmen. Vorher wartet er allerdings noch auf das Lichtzeichen vom Schiff. Die Antwort auf sein selbst gegebenes Lichtzeichen mit der Taschenlampe.
Die Minuten ziehen sich. Er ist ungeduldig. Die Patrouillenboote sind fest an Land vertäut. Der Schiffsverkehr ruht in der Nacht, während die zwei Ozeanriesen mit Containern beladen werden. Doch schon bald wird die Morgendämmerung einsetzen, und dann fehlt ihm der Schutz der Dunkelheit.
Ein sanftes Leuchten strahlt zu ihm herüber. »Endlich!«, murmelt er erleichtert, greift nach der ersten der schweren Taschen und geht weiter ins Wasser hinein, bis es ihm um die Hüften schlägt. Mit einem leichten Surren schließt er den Reißverschluss seines Neoprenanzugs.
Er legt die Tasche sanft ins Wasser, lässt sie erst los, als er spürt, dass sie von der Boje getragen wird.
Wie ein Rettungsschwimmer wirft er sich eine Schlinge über den Oberkörper, an der die Tasche festgebunden ist, und gleitet nahezu lautlos ins Wasser.
Mit langsamen, kräftigen Zügen schwimmt er durch das erdig schmeckende Wasser. Ungefähr zweihundert Meter muss er zurücklegen, bis er am Rumpf der Santa Rosa ankommt. Das Wasser schlägt immer wieder leicht gegen die dunkle Metallwand des Containerschiffs. In ihrem Schatten schwimmt er zum Heck, wo er bereits schemenhaft die gesuchte Strickleiter entdecken kann. Die an den Seilen festgeknoteten Planken hängen an dicken Tampen.
Er ergreift mit einer Hand die unterste Stufe, um sich erst einmal festzuhalten. Dann streift er sich einen Trageriemen der Tasche über die linke und den anderen über die rechte Schulter. Er stemmt sich gegen das Gewicht des schweren Packsacks und versucht, sich möglichst lautlos aus dem Wasser zu ziehen. Stufe für Stufe erklimmt er die Leiter, bis er in zwanzig Meter Höhe die Reling des Containerschiffs erreicht. Vorsichtig schaut er über das Deck. Es ist menschenleer und dunkel. Kein Licht brennt hier. Die Container scheinen inzwischen verladen worden zu sein, denn das Scheppern der alles überragenden Containerbrücken ist verstummt.
José klettert über die Reling und steigt auf ein Metallgitter, durch das er tief hinunter in den Laderaum des Schiffs blicken kann. Er stellt die Tasche neben sich ab, löst das Seil mit der Boje und steigt damit auf der Strickleiter wieder nach unten. Noch nie hat er diejenigen gesehen, die von ihm die Taschen entgegennehmen. Er weiß nur, dass die zuletzt gebrachte stets weg ist, wenn er mit der nächsten die Strickleiter hinaufklettert.
Die Strecke zurück zum Ufer will er etwas schneller schwimmen. Noch drei weitere Male, dann kann er sich wieder auf den Heimweg machen.
Morgen früh wird er einen Umschlag mit zweitausend Dollar in bar erhalten. So wie jedes Mal, seit er diesen Job erledigt. Seine Geschwister werden auch weiterhin die gute Schule besuchen, und seiner Mutter wird er kleine Wünsche erfüllen können.
Leise gleitet er am Fuß der Strickleiter ins Wasser. Heute ist ein guter Tag, denkt er und beginnt, mit kräftigen Zügen zum Ufer zurückzuschwimmen.
1
Mit einem dumpfen Brummen schiebt die MS Valderrama eine kräftige Bugwelle vor sich her. Das knapp vierhundert Meter lange Schiff türmt das Wasser regelrecht auf. Es liegt tief in der Elbe. Auf den Decks des Ozeanriesen stapeln sich die bunten Container. Darin werden Südfrüchte, Fleisch und andere Waren aus Südamerika hierher nach Hamburg transportiert und später per Bahn und Laster zu ihren Zielorten in Europa gebracht. Das braungelbe Wasser läuft in größer werdenden Wellen zum Ufer der Elbstrände, wo es auf den hellen Sand schwemmt. Die dort buddelnden Kinder schreien auf, weil ihre Staudämme das Wasser nicht von den kunstvoll errichteten Sandburgen fernhalten können.
Mitten zwischen den Kindern sitzt auch Gerd Sehling, eine kleine blaue Schaufel in der Hand. Der ehemalige Rauschgiftfahnder, der sich seit einem guten Jahr in Pension befindet, häuft den feuchten Sand aus einem tiefen Loch zu einem Berg auf. Dass er mal Förmchen mit Sand füllen wird, statt den bösen Jungs hinterherzujagen, und das auch noch gerne, hätte er sich vor der Pensionierung auch nicht träumen lassen. Neben ihm hockt ein kleines blondes Mädchen, dessen Haare seitlich am Kopf entlang zu einem Zopf geflochten sind. Die Kleine versucht, ihre Sandburg mit immer mehr Türmen auszustatten.
»Siehste! Gut, dass wir deine Burg weiter oben aufgebaut haben. Jedes Mal, wenn so ein großer Pott kommt, gibt es ’ne ordentliche Brandung«, sagt Gerd zufrieden und sonnt sich in seiner weitsichtigen Entscheidung.
»Das ist keine Burg. Das wird ein Schloss, Onkel Gerd! Für eine wunderschöne Prinzessin«, erklärt Emilia ernst.
»Na klar. Ein Schloss. Natürlich. Wie konnte ich das nicht erkennen.« Gerd strahlt das sechsjährige Mädchen an, um das er sich in letzter Zeit häufig kümmert, wenn die Eltern arbeiten. »Emilia, kannst du den Schiffsnamen von dem großen Containerschiff dort vorne lesen? Ich bin ja schon ein bisschen älter. Das kann ich nicht mehr so gut erkennen.«
Emilia schaut auf, blickt zu dem Schiff und dann zu Gerd. Sie schüttelt lachend den Kopf. »Ich bin doch gerade erst eingeschult worden, Onkel Gerd. Aber ich kenne schon die Buchstaben. V-A-L-D-E-R-R-A-M-A«, liest sie nacheinander vor.
»Oh, dann muss ich gleich rüber zu den Duckdalben. Das ist der Kahn, bei dem ich helfen soll«, erklärt Gerd und schaut zum Hafenbecken des Eurogates am anderen Elbufer.
Während er das Entladen der bereits vertäuten Containerschiffe und die Bewegungen der großen Kräne beobachtet, muss er an den Vater von Emilia denken, Steven Winter, der dort auf dem Gelände des Eurogates seit Kurzem als Lascher arbeitet. Der Job wurde ihm für den Freigang aus der Justizvollzugsanstalt Glasmoor vermittelt. Gerd überkommt bei dem Gedanken daran regelmäßig ein ungutes Gefühl. Er befürchtet, dass Steven durch die Arbeit im Hafen womöglich von seiner Vergangenheit als Drogendealer eingeholt werden wird. Seine Gläubiger könnten ihn unter Druck setzen, die neuen Kontakte zu nutzen und Dinge zu tun, die er eigentlich nicht mehr tun will.
Nachdem Steven von Gerds Kollegen im letzten Jahr, am Tag nach Gerds Pensionierung, beim Handel mit Marihuana erwischt worden war, hatte man ihn zu drei Jahren Haft verurteilt. Doch aufgrund des in Aussicht gestellten Jobs im Hafen, der zu betreuenden Tochter und der umfassenden Aussage im Verfahren gegen seine damaligen Hinterleute kam er bereits nach wenigen Wochen in den offenen Vollzug. Er muss inzwischen nur noch unter der Woche im Gefängnis schlafen, hat jeden Tag sechs Sozialstunden Zeit für Emilia und am Wochenende Hafturlaub.
Gerd hätte vor einem Jahr noch jeden für verrückt erklärt, der ihm prophezeit hätte, dass er einmal eine enge Freundschaft zu einem verurteilten Straftäter aufbauen würde. Doch nachdem er und seine Frau Dörte in Barcelona unverhofft die Bekanntschaft von Emilia und ihren Eltern gemacht hatten, verdeutlichte ihm Stevens gelebte Fürsorge und Liebe zu seiner Stieftochter Emilia schnell, dass tief in Stevens harter Schale ein herzensguter Mensch steckt.
Auch in Gerds Leben lief nicht immer alles rund. Er hatte Glück, dass ihm in jungen Jahren stets der rechte Weg aufgezeigt wurde, wenn er abzugleiten drohte. Vielleicht fühlt er sich auch deswegen ein wenig in der Pflicht, Steven als väterlicher Freund auf dieselbe Weise beizustehen.
»Wieso musst du da denn hin?«, fragt Emilia. »Wir wollen doch unser Schloss fertig bauen.« Sie sieht Gerd mit skeptischer Miene an.
»Auf dem Schiff sind einige Matrosen, die sind seit Wochen und Monaten unterwegs. Die konnten in keinen Supermarkt, möchten gerne mit ihren Kindern zu Hause telefonieren, Geld in die Heimat schicken oder einfach ein paar Kleidungsstücke kaufen. Sie können aber kein Deutsch und nur wenig Englisch. Da muss man ihnen helfen, damit sie sich hier zurechtfinden und nicht an böse Menschen geraten, die sie um ihr hart verdientes Geld bringen«, erklärt Gerd.
»Ach so. Kriegst du dafür viel Geld, Onkel Gerd?«, will Emilia wissen.
Gerd fängt laut an zu lachen, wobei sich um seine Augen viele kleine Falten bilden. Die Schiebermütze hat er leicht nach oben geschoben. »Nein, Emilia. Ich kriege gar kein Geld dafür. Ich mache das ehrenamtlich. Ich helfe gerne. Dafür braucht man mir kein Geld geben.«
»Meine Mama sagt immer, dass sie arbeiten geht, damit wir viel Geld haben, um uns alle Wünsche erfüllen zu können. Du kannst dir doch gar nichts Tolles kaufen, wenn du kein Geld dafür bekommst«, stellt Emilia irritiert fest.
»Ich habe ja schon alles, was ich brauche, Emilia. Unser schönes kleines Haus in Dalldorf, dazu noch ein fahrbares Heim, und von meiner Pension und Tante Dörtes Rente können wir so leben, wie wir es uns vorstellen, und auch immer mal wieder in den Urlaub fahren. Außerdem gibt es Dinge auf der Welt, die wesentlich mehr wert sind als Geld. Zum Beispiel hier mit dir zu sitzen, zu buddeln und die Schiffe zu beobachten. Aber auch den Matrosen das Leben leichter zu machen und dafür ein Stück Dankbarkeit geschenkt zu bekommen, gehört dazu. Das ist etwas sehr Wertvolles, denn ein ehrliches Lächeln kann man nicht kaufen.«
Emilia schweigt und grübelt über Gerds Worte nach. »Ich mag aber auch Geld. Für Geld kann man sich ein Eis kaufen«, erwidert sie nach einer längeren Pause.
»Mmh. Da magst du recht haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn du jetzt zu Tante Dörte läufst und ihr dein schönstes Lächeln schenkst, bekommst du von ihr ebenfalls einen großen Eisbecher. Und wenn du in der ›Strandperle‹ dann noch den Kellner anstrahlst, kriegst du bestimmt eine Waffel mehr ins Eis gesteckt als ein muffeliger Gast, der nur mit Geld bezahlt.«
Ohne weitere Worte springt Emilia auf und rennt zu Gerds Ehefrau, die ganz in der Nähe auf einer Picknickdecke sitzt und in einem dicken Buch liest.
Gerd sucht das Sandspielzeug zusammen, steht auf und schlendert ebenfalls zu Dörte hinüber, die bereits ihre Sachen einpackt, um dem aufgeregt um sie herumhüpfenden Mädchen den freudig geäußerten Wunsch zu erfüllen.
2
Gegenüber dem Elbstrand ragen die rot-blauen Containerbrücken empor und prägen das Bild des Containerhafens. Die Kräne, die sich stoisch über den im Wasser liegenden Ozeanriesen erheben, bilden die Skyline. Gerade wird die MS Valderrama von ihrem Kapitän vorsichtig an die Kaimauer herangesteuert. Dort warten auch schon die ersten Hafenarbeiter, um sie an der über einen Kilometer langen Kaimauer zu befestigen.
In den Umkleideräumen des Eurogate-Terminals steht Steven Winter mit nacktem Oberkörper vor einem offenen Spind. Er verstaut seine Alltagskleidung in dem grauen Stahlschrank und schaut, während er sich wieder aufrichtet, auf das an der Innentür klebende Bild seiner Tochter. Um Stevens Hüften hängt das Oberteil des Arbeitsanzugs, den er gerade angezogen hat. An den Füßen trägt er dunkle, mit Stahlkappen verstärkte Arbeitsstiefel. Er entnimmt dem Schrank ein rotes Arbeitshemd und zieht es über. An den Schultern und den Oberarmen spannt der Stoff über der dunkel tätowierten Haut. Er richtet sich den kleinen Pferdeschwanz am Hinterkopf. An den Seiten sind die blonden Haare, die er streng nach hinten gebunden trägt, wegrasiert.
Als Steven sich das Oberteil des Arbeitsoveralls über die breiten Schultern zieht, tritt jemand von hinten an ihn heran. Der Mann hat kurz geschnittene Haare, trägt den gleichen Arbeitsoverall wie Steven und darüber eine grellgelbe Warnweste, auf der in breiten Lettern »Eurogate« steht. Über seiner Schulter hängen zwei große, leere Rücksäcke. Er ist deutlich kleiner als Steven, doch seine dunklen Augen blitzen angriffslustig. Von unten schaut er Steven an.
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Digger«, sagt er und klopft mit einem Umschlag gegen Stevens Unterarm.
»Heute ist nicht mein Geburtstag«, erwidert Steven, ohne ihn anzusehen.
»Wenn ich sage, dass du Geburtstag hast, dann hast du Geburtstag. Verstanden?« Erneut schlägt er mit dem Umschlag gegen Stevens Arm und hält ihm zudem einen der beiden Rucksäcke entgegen.
Jetzt wendet sich Steven zu ihm um und schaut ihn von oben herab an. »Was wird das?«, fragt er, ohne Anstalten zu machen, den Umschlag oder den Rucksack an sich zu nehmen.
»Nimm!«, sagt sein Gegenüber, ohne eine Miene zu verziehen.
Steven nimmt den Umschlag entgegen und schaut hinein. In dem Kuvert reihen sich viele gelbe Euroscheine aneinander. Auf den ersten Blick sind es mehr als zwanzig Stück. »Was wird das?«, wiederholt er.
»Heute ist dein Glückstag. Du arbeitest mit mir und Ivan auf der Valderrama. Den zweiten Teil der Treueprämie gibt es zum Feierabend. Jetzt nimm den Rucksack und stell nicht so viele Fragen. Wir gehen aufs Schiff, arbeiten, gehen runter und geben die Rucksäcke wieder ab«, erklärt der Mann, der ungefähr dreißig Jahre alt ist. In seinem Gesicht ist eine tiefe Narbe, die über die Wange bis zum Hals verläuft.
»Ich bau keine Scheiße mehr. Vergiss es, Ashraf.« Steven drückt ihm den Umschlag wieder in die Hand, bevor er seinen Helm und die Weste überzieht. »Ich hab Familie.«
»Digger, von mir erfährt es keiner. Wir sind hier auch Familie. Heute haben wir Geburtstag. Beim nächsten Mal sind vielleicht wieder andere an der Reihe.« Ashraf streckt den Arm aus und hält die Hand in Stevens Spind, bevor dieser die Tür schließen kann. Er legt den Umschlag hinein, direkt unter Stevens Klamotten. Anschließend drückt er ihm den Rucksack gegen die Brust. »Jeder macht mit. Verstehst du? Du bist jetzt dabei, ob du willst oder nicht. Tu es, ansonsten wird der Chef ungemütlich. Wir sind ein Team. Es trifft uns alle, wenn der Job nicht erledigt wird. Und das Hafenbecken ist tief, Digger. Überall Eisenstangen, die einem das Leben schwer machen können, wenn du verstehst, was ich meine, Digger. Is besser für dich. Und für deine Familie!«
Steven betrachtet Ashraf nachdenklich, er sieht ihm direkt in die nachdrücklich funkelnden Augen. Dann verschließt er, ohne den Blick von ihm zu lösen, das kräftige Bügelschloss am Schrank, schultert den leeren Rucksack und verlässt wortlos die Umkleideräume.
3
In seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Walddörferstraße in Hamburg-Wandsbek liegt Tim Dombrowski im Bett und schaut immer wieder zu seinem linken Arm, auf dem ein braunhaariger, wuscheliger Kopf ruht. Gelegentlich riecht er an den Haaren und genießt den süßlichen Duft, der von dem französischen Parfüm ausgeht.
Der weite Ausschnitt des T-Shirts gibt die braune Haut von Claires Hals preis. Gelegentlich drückt er einen leichten Kuss auf ihren Nacken, doch außer einem tiefen Schnaufen oder einem leichten, lieblichen Grunzen gibt sie keine Regung von sich.
Die Sonne strahlt inzwischen kräftig durch die Lamellen der Rollos hindurch. Auch die Vögel zwitschern im Eichtalpark, der direkt an den rückwärtigen Teil der Wohnung grenzt. Von der anderen Seite dröhnen die Geräusche der fahrenden Autos von der Walddörferstraße wie Meeresrauschen zu ihm herauf.
Seinen Arm spürt Dombrowski schon seit Längerem nicht mehr. Der schläft ähnlich tief wie seine Freundin, die ihn nun seit mehreren Monaten am Wochenende besucht. Bislang haben sie keine Lösung für ihre Fernbeziehung gefunden, denn Claire arbeitet in der französischen Botschaft in Berlin und Tim als Landesbeamter im Hamburger Rauschgiftdezernat. Die Arbeit war bislang sein Leben, die Kollegen seine Freunde, und Claire ist nun sein unverhofftes Glück.
Dombrowski versucht, keine tieferen Gedanken an ihre mittelbare Zukunft zu verschwenden. Er genießt lieber den Moment, der so zerbrechlich wirkt. Er will ihn unter keinen Umständen gefährden. Am liebsten würde er ihn ewig festhalten und einfach so liegen bleiben.
Mit einem lauten Kreischen durchbricht das Klingeln von Dombrowskis Handy die Stille im Schlafzimmer. Mühsam zieht er den Arm unter Claire hervor, die sich brummend zur Seite rollt, und steht auf. Er läuft zum Schreibtisch, auf dem er das Smartphone abgelegt hat.
Auf dem Display prangt der Schriftzug »Harry Goldutt« und blinkt immer wieder auf, während darunter ein roter und ein grüner Hörer aufleuchten. Dombrowski will mit der linken Hand nach dem Telefon greifen, doch der Arm ist noch immer taub und unbeweglich. Mit der rechten Hand nimmt er das brummende und schreiende Gerät und drückt den grünen Hörer.
»Harry, wat is los?«, fragt er seinen Chef genervt, während der linke Arm zu kribbeln beginnt. Mit einem Kopfschütteln versucht er, die halblangen braunen Haare aus der Stirn zu wedeln, deren Enden ihm in die Augen piksen. »Hast du vergessen, dass heute Samstag ist?«
»Guten Morgen, Dumbo. Ich freue mich auch, deine Stimme zu hören.« Ein schadenfrohes Kichern liegt in Harry Goldutts Stimme, das aber zum Ende hin einer ruhigen Strenge weicht. »Hast du vielleicht vergessen, dass du heute Rufbereitschaft hast?«
»Wieso das denn? Ehrlich jetzt? Claire ist da. Das ist nicht dein Ernst, oder?« Dombrowski hat genug vom erfolglosen Kopfschütteln und wischt sich mit der kribbelnden Hand die Haare aus dem Gesicht.
»Eigentlich nicht, aber Otto hat sich krankgemeldet. Er hätte Bereitschaft gehabt, und jetzt haben wir einen Fall reinbekommen«, erklärt Harry sein Anliegen.
»Otto ist doch nie krank.«
»Heute ist er es. Ich möchte dich daher bitten, den Fall für ihn zu übernehmen. Es geht erst mal nur um eine Vernehmung. Die Kollegen vom Straßendeal haben einen Jungen aus Hamm festgenommen, und der will umfassend aussagen. Soll ein großes Ding sein. Sie bringen ihn gerade zum Erkennungsdienst ins Präsidium. Vielleicht bist du ja fertig, bevor deine Freundin richtig wach wird.«
Harrys letzter Kommentar wird von einem schnarchenden Grunzen aus der Ecke von Dombrowskis Schlafzimmer quittiert.
»Okay, Chef. Ich fahre ins Büro und melde mich, wenn ich mehr weiß.«
Ernüchtert beendet Dombrowski das Gespräch, nachdem sich Harry dankend von ihm verabschiedet hat.
4
Zwischen dem Eurogate-Containerterminal und dem Hauptzollamt in Hamburg liegt das Quartier der Duckdalben. Der Rotklinkerbau ist eine Anlaufstation und oft auch ein Stück Heimat für jeden Matrosen. Seemänner haben hier die Möglichkeit, Kontakt zu ihren Familien aufzunehmen, was an Bord oft lange Zeit nicht möglich ist. Gefahrlos können sie das hart verdiente Geld in die Heimat überweisen. Kostengünstig sich mit Zahnpasta, Kleidung oder Naschereien eindecken. Einfach mal eine Runde Billard oder Kicker spielen, während die Kollegen der anderen Schiffe an der Karaokemaschine ihre liebsten Lieder zum Besten geben.
Gerd Sehling hat in diesem Verein der Deutschen Seemannsmission eine Aufgabe für sich gefunden. Er fährt regelmäßig das Shuttle, mit dem die Matrosen kostenfrei vom Schiff in die Mission gelangen. Die wenigen Stunden des Landgangs können so optimal genutzt werden, ehe die Fahrten nach Asien oder Südamerika fortgesetzt werden.
Gerd chauffiert sie zum Vereinsheim und betreut sie vor Ort. Seine Erfahrungen aus den langen Jahren bei der Polizei und der freiwilligen Feuerwehr helfen ihm dabei, den vertrauensvollen Kontakt zu den Gästen herzustellen.
Schon in seinem Berufsleben hatte er immer ein offenes Ohr für die Kollegen und war jederzeit für sie erreichbar, wenn ihnen etwas auf der Seele brannte. Jetzt hilft er den Matrosen mit seinem großen Herzen, versucht, sich irgendwie auf Englisch, Deutsch oder mit Händen und Füßen mit ihnen zu verständigen und dabei ein Lachen auf ihre Gesichter zu zaubern.
Gerade ist Gerd in einen roten Bus eingestiegen, der den Namen Elmo trägt. Gemütlich fährt er in Richtung der Kaimauer, an der die MS Valderrama angelegt hat und von den Hafenarbeitern vertäut wird. Die Landungsluke des Schiffs ist geöffnet. Ein, zwei bekannte Gesichter hat er bereits ausgemacht. Bei ihrer letzten Ankunft im Hafen hatte er die Matrosen der MS Valderrama zum ersten Mal betreut und sich auch deswegen heute freiwillig zum Dienst gemeldet.
Gerd bleibt vor der Gangway stehen und hupt dreimal kräftig zur Begrüßung. Er schaltet den Motor aus und steigt vom Fahrersitz. Die ihm schon vertrauten Matrosen will er persönlich empfangen.
Mit einem breiten Lächeln tritt er ihnen entgegen und steckt sie mit seiner guten Laune sogleich an. Auch sie zeigen all ihre Zähne, mit vor Freude strahlenden Gesichtern.
»Moin moin, Gerd!«, ruft Joe und winkt ausufernd mit beiden Armen. Über der Schulter trägt er eine kleine Umhängetasche. Die dunkelblaue Jeans und das rote Hemd sind, vermutlich ungewollt, farblich perfekt auf die Containerbrücken am Eurogate abgestimmt.
»Moin moin! Ich freue mich, euch zu sehen. Welcome to Hamburg!«, begrüßt Gerd die fünf Matrosen. Mit einem kräftigen Ruck zieht er die Seitentür des Busses auf.
Joe bleibt neben ihm stehen, während die anderen in den Bus einsteigen.
»Na, mien Jung? Willste vorne sitzen?«, fragt Gerd mit einem Augenzwinkern.
»Sehr gerne, mein Freund. Wie geht es dir?«, erwidert Joe, der aus seiner Zeit auf exklusiven Kreuzfahrtschiffen fließend Deutsch sprechen kann, und grinst. Seine sonnengegerbte Haut lässt die weißen Zähne dabei noch heller wirken. Er ist einen ganzen Kopf kleiner als Gerd. Das dunkle Haar hat er mit einem Scheitel zur Seite gekämmt. Er ist frisch rasiert. Nur ein paar vereinzelte, tiefe Lachfalten an den Augen verraten, dass Joe bereits ein wenig älter ist.
»Gut. Sehr gut. Wie immer, wenn ich dich sehe.«
Beide lachen heiter. Während Joe zur Beifahrerseite schlendert, sieht Gerd, wie Steven mit zwei Kollegen die Gangway hinaufsteigt, um mit der Arbeit zu beginnen. Etwas stört ihn bei dem Anblick, doch er weiß nicht genau, was. Ist es die Körpersprache seines Freundes oder dessen Kleidung? Gerds Bauch sagt ihm, dass hier etwas nicht stimmt, und sein Bauch irrt sich eigentlich nie.
Gerd betätigt mehrfach die Zündung und würgt Elmos startenden Motor dabei immer wieder ab. »One moment please. I will do the problem away!«, ruft er den wartenden Fahrgästen im Fond zu, steigt aus, öffnet die Motorhaube und sieht mit fachmännischem Blick in den Motorraum. Er prüft allerdings nicht ein mögliches Problem, sondern starrt den Personen auf der Gangway hinterher.
Schweigend folgt Steven seinen Kollegen in den Bauch des Schiffes hinein. Hätte er Gerds Anwesenheit bemerkt, wäre er jetzt sicherlich beunruhigt. Er hat sich entschlossen, einfach geschehen zu lassen, was gleich passieren wird. Dennoch überlegt er bereits, wie er sich solchen Aktionen zukünftig entziehen kann. Bei diesem einen Mal wird schon nichts schiefgehen.
In Glasmoor hatten die Mitinsassen ihm zu dem neuen Job gratuliert. Manche zeigten sich gar neidisch angesichts von Stevens Glück. Dort ist jedem bekannt, dass man sich im Hafen immer mal wieder ein sattes Zubrot verdienen kann. Steven ging allerdings davon aus, dass man sich aktiv darum bemühen muss. Er hat nicht damit gerechnet, dass er von den Kollegen vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Ganz so, als wäre das, was hier gemacht werden soll, das Normalste auf der Welt.
An Deck kommt ihnen ein Offizier entgegen. Er trägt eine dunkle Hose. Das weiße Hemd hat er tief in den Bund gesteckt. Auf den Schultern prangen vier goldene Streifen.
Ashraf geht direkt auf den Mann zu. Dabei zieht er locker den Rucksack von Stevens Schulter, und auch den dritten Rucksack von Ivan trägt er bereits in der Hand. Er gibt sie dem Offizier. Der nickt bestätigend, woraufhin Ashraf sich zu seinen Kollegen umdreht. »An die Arbeit, Jungs. Es ist viel zu tun.«
Die drei teilen sich auf und klettern in verschiedenen Gängen die steilen Treppen hinauf, um die Verankerungen durch das Laschen zu lösen. Sie werden nun einige Stunden zu tun haben. Steven dreht sich noch einmal zu dem Offizier um, doch der ist vom Deck verschwunden. Ebenso ihre ihm übergebenen Rucksäcke.
Am Sockel der Gangway klappt Gerd Elmos Motorhaube zu. Wider Erwarten konnte er doch nichts weiter beobachten. Mit einem unguten Gefühl klettert er hinter das Steuer.
Kurz bevor er den Schlüssel in die Zündung steckt, sieht er einen Mann mit blonden Haaren und hellem Hemd die Gangway hinablaufen. Den Uniformstreifen nach ist es ein Schiffsoffizier. Gerd wartet einen Moment, um zu sehen, ob der mittelalte Mann ebenfalls mit ihm ins Vereinshaus fahren will. Doch dann eilt ein weiterer Mann im Arbeitsanzug herbei und marschiert zielgerichtet auf den Schiffsoffizier zu. Die beiden scheinen sich zu kennen.
Während der Arbeiter dem Schiffsoffizier freundlich entgegensieht, schaut der den anderen eher verbissen an.
Sie begrüßen sich am Kai. Gerd sieht, wie der Mitarbeiter einen Briefumschlag an den Offizier übergibt.
»Worauf warten wir?«, fragt Joe ein wenig ungeduldig. Er sehnt sich nach dem Kontakt zu seiner Familie auf den Philippinen.
»Wer is denn der Typ im Hemd, Joe?«, fragt Gerd interessiert, ohne auf Joes Frage einzugehen.
»Das ist Chief Mate Sergej Kruschkow«, erklärt Joe, der sich vorgebeugt hat und die Situation nun ebenfalls mit kritischem Blick beobachtet.
»Wat kriegt der denn von dem Hafenarbeiter übergeben? Frachtpapiere?«, überlegt Gerd laut, als der Chief Mate den Inhalt des Umschlags überprüft. Er scheint unzufrieden zu sein mit dem, was er sieht, und beginnt, mit dem Mitarbeiter vom Eurogate zu diskutieren. Der hat offenbar kein Einsehen. Er steht stocksteif da, schüttelt gelegentlich den Kopf und antwortet schmallippig mit wenigen Worten auf Kruschkows Tiraden.
»Frachtpapiere nicht. Die kommen per E-Mail. Ich weiß nicht«, antwortet Joe nach einer kurzen Denkpause. In dem Moment zieht der Eurogate-Mitarbeiter aus seiner Hosentasche ein dickes Bündel grüner und gelber Geldscheine. Er nimmt einige und gibt sie dem Chief Mate, der sie missmutig in die Hemdtasche steckt. Mit forderndem Blick bleibt er noch kurz stehen, wendet sich dann aber wieder der Gangway zu, als der Mann in Arbeitskleidung abdreht und in Richtung der Mitarbeitergebäude davongeht.
»Hier stimmt was nich«, brummt Gerd leise in seinen Bart und startet widerwillig den Motor.
5
Die vielen Krähen hüpfen in den Baumwipfeln vor dem Polizeipräsidium in Hamburg-Alsterdorf in ihren Nestern umher und krächzen dabei immer wieder laut. Ebenfalls leicht hüpfend, fast springend, eilt Tim Dombrowski die lange Treppe zum Präsidium hinauf.
Er will keine Zeit verlieren und sich möglichst schnell wieder aus den Büroräumlichkeiten des Rauschgiftdezernats verabschieden. Immerhin ist Claire nur noch einen Tag da, bevor sie wieder nach Berlin zurückmuss.
Er geht durch die Sicherheitsschleuse und zum Fahrstuhl, der im Erdgeschoss auf ihn wartet. Langsam schließen sich die Türen. Im zweiten Stockwerk steigt er wieder aus, um zu dem Gebäudefinger zu gehen, in dem das Rauschgiftdezernat beheimatet ist. Mit einem leichten Surren entriegelt sich die Tür zur Dienststelle, ehe sie sich mit einem lauten Klacken aufreißen lässt.
Die Geräusche des Türmechanismus scheinen den auf Dombrowski wartenden Kollegen vom Straßendeal aufgeschreckt zu haben. Zumindest tritt er aus der Tür des Besprechungsraums und begrüßt ihn freudig mit einem lang gezogenen »Naaa!«.
Auch Dombrowski freut sich, endlich den langjährigen Kollegen wiederzusehen, den es aufgrund einer in Aussicht gestellten Beförderung in die andere Ermittlungsgruppe zog.
»Olli, mein Freund. Ich hoffe, du bescherst uns nur Gutes am heiligen Wochenende«, begrüßt er ihn und schlägt kräftig in die ausgestreckte Hand ein.
»Immer! Weißt du doch«, erwidert Olli grinsend, schließt die Lippen dann aber sogleich wieder zu einem leicht grimmigen Gesichtsausdruck. Nur mit wenigen Leuten spricht Olli mehr als das Nötigste. Es soll sogar Kriminalbeamte geben, die sich mehrere Monate lang vor ihm fürchteten, bevor sie es wagten, ihn anzusprechen. Eine gewisse ablehnende Körpersprache mit einem durchdringenden Blick, der immer von oben herab auf einen gerichtet ist, weil Olli knapp zwei Meter groß ist, scheinen unbewusst abschreckend zu wirken.
Dombrowski hat längst keine Angst mehr vor ihm und biegt sogleich in den Besprechungsraum ab. Dort nimmt er erst einmal einen Schokoriegel aus dem Kühlschrank und lässt sich dann erwartungsvoll auf einen Stuhl fallen.
»Also, pass auf, Dumbo«, beginnt Olli zu erklären und lehnt sich mit dem Rücken gegen einen Schrank. »Wir haben unten in der Zelle einen gewissen Dominik Nguyen sitzen. Den haben wir auf der Straße mit einem Kilogramm Gras angehalten. Er hatte einen Schlagring in der Jacke und ein Messer in der Hosentasche. Bei ihm zu Hause lagen weitere vier Kilogramm im Keller. Das Ganze arbeiten wir jetzt ab. Er ist auf Bewährung draußen und wird heute zugeführt. Das weiß er auch schon. Er will darum umfassend gegen Alex Freiberg aussagen und so noch etwas für sich rausholen.«
»Ach was! Jetzt wird es aber mal interessant. Ist der schon wieder draußen?«, fragt Dombrowski seinen Kollegen. Die Neugier ist geweckt. Immerhin hat er Freiberg erst vor drei Jahren bei der Einfuhr von zehn Kilogramm Kokain aus den Niederlanden festgenommen. »Der hatte doch sieben Jahre bekommen«, ergänzt er verwundert.
»Der ist im offenen Vollzug und arbeitet jetzt im Hafen am Eurogate«, erklärt Olli.
»Ein Einfuhrschmuggler von Kokain am Terminal für Frachter aus Südamerika. Na, das passt ja. Demnächst arbeiten die Marihuanaplantagen-Betreiber in Gewächshäusern und die Grasdealer in Shishalounges, wenn sie in den offenen Vollzug kommen.«
»Ja, so ungefähr«, entgegnet Olli wortkarg. »In jedem Fall will Nguyen umfassend aussagen. Ich dachte mir, dass du das lieber sofort machen willst, bevor sein Anwalt ihm das Ganze ausredet. Dann kannst du ihn gleich erstens, zwotens, drittens und hast du nicht gesehen abfragen. Was du halt wissen musst und wissen willst.«
»Geht klar. Ich hol ihn mir gleich rauf. Und bei dir so? Schmeckt es noch am Straßendeal?«, erkundigt sich Dombrowski.
»Geht so, ne. Viel zu tun. Ich habe in den letzten drei Jahren vielleicht zweimal Zeit für eine Mittagspause gehabt. Alle müssen ackern. Masse halt. Hab mich schon öfter gefragt, ob es das wert war. Aber ich stehe dort im Wort und haue jetzt auch erst mal nicht wieder ab. So denn. Ich muss los. Bis bald.« Olli verabschiedet sich und geht aus dem Besprechungsraum, ohne auf eine Erwiderung zu warten.
Unter leisem Knistern wickelt Dombrowski den Schokoriegel aus und beißt ab. Während er kaut, denkt er zurück an das damalige Verfahren und versucht, sich an die Mittäter von Freiberg zu erinnern.
Nachdem er den Riegel komplett vertilgt hat, erhebt er sich und geht zum Fahrstuhl, um zum Zellentrakt hinabzufahren.
6
Vor dem Vereinshaus der Duckdalben parkt Gerd den roten Bus und schaltet den Motor aus. »Vereinshaus Duckdalben«, ruft er grölend, »Endstation!«, und zwinkert Joe zu. Er steigt aus, eilt im Laufschritt um den Bus herum und reißt laut scheppernd die Schiebetür auf. Er mag es einfach, den Chauffeur für die Matrosen zu spielen. Ihnen zur Abwechslung einmal das Gefühl zu geben, Könige zu sein. Ihr erfreutes Lächeln ist ihm Dank genug.
Mit Schwung schließt Gerd die Tür hinter den Männern und folgt ihnen zum Eingang. Er freut sich bereits auf die Einlagen an der Karaokemaschine. Dieses Mal wird er sich jedoch nicht animieren lassen, ebenfalls am Gesang teilzunehmen. Das letzte Mal ließ er sich breitschlagen. Noch immer ist er den Matrosen dankbar dafür, dass sie seinen hilfesuchenden Blicken schnell folgten und ihn auf der Bühne bei »You’re My Heart, You’re My Soul« lautstark übertönten.
Vor dem Clubhaus steht bereits Frau Windheim, die Leiterin der Duckdalben, in ihrer gelben Windjacke, die sie halb geschlossen trägt. Die kurzen grauen Haare wehen im Wind. Sie schenkt jedem Ankömmling ein Lächeln. Ihre hellen Augen leuchten geradezu im Sonnenlicht. Anschließend kommt sie auf Gerd zu. Sie begrüßt ihn und Joe freundlich. Dann sagt sie: »Mein lieber Gerd, magst du uns einen Gefallen tun?«
»Dafür bin ich hier. Euer Wunsch ist mir Befehl«, erwidert Gerd mit einer galanten Verbeugung. »Wat darf ich denn tun?«
»Nun, wir wollen eine kleine Außenterrasse aus Holzplanken bauen. Unsere Tischler sind schon dabei und haben mir einen Einkaufszettel mit ein paar Dingen geschrieben, die noch fehlen. Wäre toll, wenn du das aus dem Baumarkt holen könntest.« Sie hält ihm den vorbereiteten Einkaufszettel entgegen.
»Logo. Ich fahr gleich los.« Gerd schnappt sich den Zettel, wendet sich ab und geht wieder in Richtung Fahrertür.
»Ich helfe dir, Gerd«, sagt Joe und läuft um das Auto herum.
»Aber deine Familie? Du willst doch sicher zu Hause anrufen?«
»Ich habe noch viel Zeit. Ihr seid so nett zu uns. Ich will etwas machen und Danke sagen. Außerdem bist du ein alter Mann. Ich kann dich nicht allein schwere Dinge tragen lassen«, antwortet Joe feixend.
Gerd lacht mit ihm. »Na, dann steig mal ein, mein Lieber. Auf geht’s!«
»Wartet, ich gebe euch noch Geld mit«, ruft Petra Windheim den beiden hinterher.
»Dat können wir nachher abrechnen«, erwidert Gerd durch das offene Fenster und startet den Motor. Kurz darauf fährt er bereits auf die Autobahn, um zum nahe gelegenen Baumarkt an der Abfahrt Heimfeld zu kommen.
»Und? Alles gut bei dir an Bord?«, fragt Gerd, nachdem sie eine Weile gefahren sind.
»Ja. Alles gut. Eine gute Arbeit. Aber der Chief Mate ist nicht normal. Und manchmal geschehen komische Dinge«, beginnt Joe zu erzählen. »Heute hat er uns fast von Bord gejagt, kaum dass die Taue an der Mauer befestigt waren. Er wurde richtig sauer, als zwei Kollegen zu lange brauchten. Und in Ecuador hat er meine Nachtwache übernommen, obwohl ich Dienst hatte. Am nächsten Morgen schwammen im Meer Bananen. Stell dir das mal vor! Als wir ankamen, waren noch keine Bananen im Wasser. Ich habe extra geguckt, das war mir nämlich beim letzten Mal schon aufgefallen.«
»Du meinst den Typen, der vorhin mit dem Hafenarbeiter gestritten hat?«, hakt Gerd nach.
»Ja, genau. Der ist neu an Bord. Kam vor vier Monaten zu uns. War wohl vorher auf einem anderen Containerschiff der Reederei.«
»Ist dir noch mehr aufgefallen bei ihm?«, fragt Gerd interessiert. »Macht der auf See auch komische Sachen?«
»Nein. Auf See ist kaum was von ihm zu sehen. Da ist er ganz normal. Macht seine Arbeit, aber auch nicht mehr«, antwortet Joe.
Das Klackern des Blinkers ertönt. Gerd steuert Elmo auf den Parkplatz vor dem Baumarkt, parkt ihn nahe der Eingangstür ein und schaltet den Motor aus.
»Wenn beim nächsten Mal Bananen im Meer schwimmen in Ecuador, sagst du mir dann Bescheid?«, fragt er Joe vorsichtig und schaut ihn abschätzend an.
»Kommst du dann vorbei und fischst sie aus dem Wasser? Die sind noch ganz grün. Das lohnt sich nicht«, erwidert Joe. Er lacht gackernd und präsentiert seine weißen Zähne.
»Würde mich einfach interessieren, wenn das noch einmal passiert. Tu mir bitte den Gefallen. Dafür gebe ich dir jetzt ein original Mettbrötchen mit extra viel Zwiebeln aus«, schlägt Gerd grinsend vor.
»Ich werde dir ein Foto schicken, wenn es dich so glücklich macht«, sagt Joe beim Aussteigen und schlendert mit Gerd zum Bäcker des Baumarktes hinüber.
7
Im Erdgeschoss des Polizeipräsidiums steht Tim Dombrowski vor einer schweren Holztür. Ein grelles Piepen ist zu hören, seit er vor einer halben Minute die Klingel betätigt hat.
Das erlösende Surren im Schloss beendet das nervtötende Geräusch. Erleichtert schiebt Dombrowski die wuchtige Tür auf und betritt den Flur des Erkennungsdienstes. Hier befinden sich die achtzehn Zellen des Polizeipräsidiums, die mit grauen Stahltüren sowie jeweils zwei Sicherheitsriegeln verschlossen sind. In den Zellen schimmert grelles Licht aus Neonröhren. Auf harten Holzbänken liegen die Festnahmen der letzten Nacht, die ihren Rausch ausschlafen, auf die Abnahme von Fingerabdrücken und die Fertigung von Fotos warten oder auf den Gefangenentransporter, der sie ins Untersuchungsgefängnis zum Haftrichter bringt.
Dombrowski geht am Zugang zum Zellentrakt vorbei, wo er kurzzeitig einen Mann im Blick hat, der gerade torkelnd von der Toilette zurück in seine Zelle geführt wird. Das grün und blau angeschwollene Gesicht sowie die genähten Wunden auf Stirn und Nase deuten darauf hin, dass er nicht unbedingt als Gewinner aus der Auseinandersetzung hervorgegangen ist.
Ein paar Schritte weiter kommt er in den Raum des Wachhabenden, der in einem überdimensional großen Chefsessel sitzt und ihm erwartungsvoll entgegenblickt.
»Ich möchte Dominik Nguyen abholen«, erklärt Dombrowski sein Anliegen und lehnt sich gegen den Türrahmen.
»Zelle drei«, lautet die knappe Antwort.
Dombrowski will sich gerade abwenden, als der Wachhabende »Halt!« schreit.
»Was ist denn noch?«, fragt Dombrowski irritiert.
»Du hast das Schild vergessen.« Er drückt Dombrowski ein Papierschild mit der Aufschrift »Vernehmung« in die Hand.
»Jo. Häng ich an die Tür«, versichert Dombrowski und geht zur Zelle mit der großen Nummer »3«.
Er öffnet eine graue Klappe in der Tür, um kurz in das Innere der Zelle zu schauen. Dort sitzt ein junger Mann mit blondierten Haaren, der sich nervös in die Handflächen schaut und dabei auf und ab schaukelt.
Dombrowski hängt das Schild an die Klappe und öffnet die Metallriegel an der Tür.
Dominik Nguyen schaut ihm schweigend entgegen, als er die Tür aufzieht, und wartet offenbar auf eine Aufforderung.
»Moin. Mein Name ist Dombrowski. Sie wollen mir etwas erzählen, wurde mir angekündigt.«
Der Junge springt geradezu auf und nickt Dombrowski eifrig zu. Er tritt aus der Zelle und schlüpft in die durchgetretenen Turnschuhe vor der Tür. Die Hosenbeine seiner weiten Jeans hängen über die Schuhe, während sein eng anliegendes T-Shirt den Oberkörper deutlich vom Unterkörper absetzt.
Dombrowski geht an dem hageren Jungen vorbei, dessen hochgestyltes Haar ihn größer wirken lässt, als er wirklich ist. Die Tür des Erkennungsdienstes surrt, und Dombrowski schiebt sie auf. Gemeinsam gehen sie bis zum Fahrstuhl. Dann stehen sie schweigend da und warten. Der eine in Unwissenheit darüber, was auf ihn zukommt, der andere in dem Wissen, dass er erst im Vernehmungsraum mit dem Gespräch beginnen möchte, nachdem er die förmliche Belehrung abgeschlossen hat.
Der Gang, in dem sich die Vernehmungsräume befinden, liegt still vor ihnen, als sie aus dem Fahrstuhl steigen. Sämtliche Mitarbeiter, die hier sonst in Hektik hin und her laufen, befinden sich im verdienten Wochenende. Mit schnellen Schritten geht Dombrowski voran bis zum Ende des Flurs, betritt eins der Zimmer und lässt sich auf dem Bürostuhl am Computer nieder, während Nguyen auf einem grünen Stuhl am Kopf des Schreibtisches Platz nimmt.
»Okay, Herr Nguyen. Dann wollen wir mal. Zunächst muss ich Ihnen sagen, dass Sie sich nicht selber belasten müssen. Auch nicht direkte Familienangehörige. Sie dürfen sich natürlich vollumfänglich äußern. Wenn Sie im Rahmen der Kronzeugenregelung aussagen, dann kann sich das strafmildernd für Sie auswirken. Ich darf Ihnen aber nichts versprechen, denn darüber entscheidet am Ende der Richter in Ihrem Gerichtsverfahren.«
Nach ein paar Klicks auf dem PC rattert der Drucker hinter Dombrowski. Er nimmt zwei Blätter aus dem Auswurf und legt sie Nguyen zusammen mit einem Kugelschreiber vor.
»Sie wollten ja gerne aussagen, dann lesen Sie sich die Belehrung bitte noch einmal durch und machen Sie das Kreuz an der richtigen Stelle, damit wir dann anfangen können«, fordert er ihn auf.
»Ja, nee. Ich will erst mal sprechen, wenn Sie verstehen, wie ich meine. Ich will eine Zusage, dass ich rauskomme. Sie müssen mit dem Staatsanwalt reden. Ich will nicht in ’n Knast. Verstehen Sie? Da bin ich nicht der Typ für, wenn Sie verstehen, wie ich mein.« Nguyen schaut Dombrowski eindringlich an.
»Na, wenn das so ist. Dann rufe ich mal den Staatsanwalt an und bitte um Ihre Freilassung.« Dombrowski nimmt den Hörer vom Telefon, während sich Nguyen zufrieden zurücklehnt.
Doch statt zu wählen, legt Dombrowski den Hörer wieder auf. »Glauben Sie wirklich, dass es hier so abläuft? Wir sind hier nicht in Hollywood, Freundchen. Nun pass mal auf. Bei uns läuft das ungefähr so: Du lässt die Hosen runter und erzählst alles, was uns hilft, die großen Jungs einzufangen und viel Stoff sicherzustellen. Dann betest du, dass der Richter in deinem Verfahren die Hose wieder ein Stück weit hochzieht. Hier gibt es keine Versprechungen oder Vorableistungen. Erst einmal bist du dran und kannst dir damit vielleicht eine ordentliche Haft ersparen. Das zeigt sich aber erst, wenn wir unsere Arbeit erledigt haben. Dann wissen wir nämlich, ob deine Geschichte stimmt oder nicht. Verstanden?« Zwischen Dombrowskis Augenbrauen hat sich vor Ärger eine tiefe Furche gebildet. Er ist es leid, dass die kleinen Jungs von der Straße immer denken, sie seien der Nabel der Welt.
»Ich kann euch helfen. Ich kann euch richtig helfen«, beteuert Nguyen. »Das sind krasse Typen. Wenn die das erfahren, dann töten die mich. Das geht ganz schnell, wenn Sie verstehen, wie ich mein. Ich brauche da eine Sicherheit. Keinen Schutz, okay, aber ich muss raus, dann tauche ich unter, und ihr seht mich nie wieder.« Zufrieden mit der Erklärung beugt sich Nguyen vor und greift nach dem Kugelschreiber, auf dem er mehrfach herumklickt, ohne die Belehrung auch nur anzusehen.
»Kannste vergessen«, erwidert Dombrowski emotionslos.
Stille kehrt im Raum ein. Nguyen grübelt und klickt mit dem Kugelschreiber. Dombrowski schaut ihn abwartend an.
»Du hast nicht einmal gesagt, was du überhaupt aussagen willst, und stellst hier sonst was für Forderungen. So wird das nichts. Der Tatvorwurf gegen dich bedeutet nicht weniger als fünf Jahre Freiheitsstrafe. Ist dir das eigentlich klar?«
»Ich kann ganz dicke Fische liefern«, wiederholt Nguyen.
»Dann mach das Kreuz, unterschreib die Belehrung, und wir schauen weiter.«
»Aber lesen die das dann?«, fragt Nguyen mit schockiertem Blick.
»Ja, klar. Was hast du denn gedacht? Das gehört zu einem ordentlichen Verfahren dazu. Du sagst jetzt gegen die Jungs aus, und später vor Gericht darfst du das Ganze noch einmal wiederholen«, macht Dombrowski deutlich.
»Sitzen die dann auch im Raum?«, will Nguyen mit besorgter Miene wissen.
»Jupp. So wird es sein. Das ist unser Rechtsstaat. Da hat man das Recht, in das Gesicht desjenigen zu schauen, der einen beschuldigt, und sich gegen die Vorwürfe zu verteidigen. Aber bevor wir uns jetzt endlos im Kreis drehen. Vielleicht gibst du mir mal ein paar Hinweise, worüber du mir etwas erzählen möchtest, wer die dicken Fische sind, und dann schauen wir zusammen, ob es sich lohnt, die Geschichte zu erzählen«, lenkt Dombrowski ein. Auch um endlich ein Gefühl dafür zu bekommen, ob er hier seine eigentlich mit Claire verplante Freizeit verschwendet.
»Okay. Passen Sie auf. Ich sage Ihnen, was ich weiß. Aber Sie müssen echt ein gutes Wort für mich einlegen. Wenn die das rauskriegen, dann jagen die mich«, beginnt Nguyen.
Dombrowski wagt es nicht, ihn zu unterbrechen, und nickt ihm nur leicht aufmunternd zu. Mit einem wilden Rucken unterschreibt Nguyen den Belehrungsbogen und kreuzt an, dass er vor der Polizei aussagen will.
»Ich habe über meinen Marihuanadealer einen krassen Typen kennengelernt. Der heißt Alex Freiberg und handelt im ganz großen Stil mit Kokain. Der hat eine direkte Quelle aus Südamerika. Soweit ich weiß, kriegt er es aus dem Hafen.«
»Und wer ist dein Marihuanadealer?«, fragt Dombrowski, als Nguyen kurz innehält.
»Den will ich eigentlich nicht nennen. Das ist ein feiner Kerl, der tut keinem was«, sagt Nguyen zögernd und streicht sich durch die blondierten Haare, die er dabei wieder ein wenig aufrichtet.
»Wennschon, dennschon, würde ich mal sagen«, erwidert Dombrowski ungerührt.
Nguyen betrachtet grübelnd seine Handinnenflächen. Dann schaut er Dombrowski an, der fordernd die Augenbrauen hebt. »Nee, wirklich nicht. Der tut mir leid. Den will ich nicht weiter belasten. Wenn Sie Alex Freiberg verfolgen, werden Sie vermutlich eh auf ihn kommen. Die hängen irgendwie zusammen, obwohl sie sehr unterschiedlich sind.«
»Dann kannst du mir auch gleich seinen Namen nennen. Woher holt er es denn? Aus Holland? Aus Spanien oder vielleicht sogar von Freiberg?«
»Nee. Der baut selber an, aber mehr will ich dazu wirklich nicht sagen. Freiberg ist der dicke Fisch. Den müssen Sie sich holen. Ich weiß, dass der kilogrammweise mit Kokain handelt. Richtig große Mengen.« Nguyen schaut kurz aus dem Fenster und beobachtet ein Flugzeug, das am Horizont am Hamburger Flughafen in die Lüfte aufsteigt.
»Woher weißt du das denn? Hast du bei ihm Kokain eingekauft?«, fragt Dombrowski vorsichtig, wohl wissend, dass Nguyen sich mit einer positiven Antwort erheblich selbst belasten würde.
»Nee, sind Sie verrückt? Mit solchen Leuten mache ich keine Geschäfte. Kokain ist nicht mein Business. Ich weiß es von meinem Dealer. Der hat mir davon erzählt. Bei ihm habe ich den Freiberg dann auch gesehen und kennengelernt. Der hat eiskalte Augen. Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum die beiden überhaupt etwas miteinander zu tun haben. Mein Dealer sagt, dass Freiberg ihn dazu bringen will zu expandieren. Der soll bei ihm einsteigen, beim Verkaufen helfen. Ich habe ihm davon abgeraten. Mit solchen Leuten sollte man nichts machen, wenn Sie verstehen, wie ich mein«, erzählt Nguyen immer aufgeregter und verstummt schließlich.
»Also, wenn ich das mal zusammenfassen darf. Du weißt von deinem Kumpel, dem Dealer, dass Alex Freiberg mit Kokain handelt. Direktware aus Südamerika, die er aus dem Hafen bekommt. Hast es nie selber gesehen, weißt weder, wie er es aus dem Hafen bekommt, noch, wo er es lagert oder an wen er es verkauft. Und den Namen von deinem Kumpel willst du mir auch nicht sagen.« Dombrowski bläst mit pessimistischer Miene die Wangen auf.
»Das hört sich bei Ihnen jetzt so negativ an«, sagt Nguyen unzufrieden. »Das ist ein fetter Fisch, den ich Ihnen liefere. Ach ja, der sitzt eigentlich im Knast. Kommt aber immer raus zum Arbeiten. Der ist kaum noch drinnen. Den müssen Sie nur zwei, drei Tage observieren, wenn er draußen ist, dann finden Sie das schon alles selbst heraus«, versichert er voller Überzeugung.
»Mehr kannst du mir nicht sagen?«, hakt Dombrowski noch einmal nach.
»Das ist schon eine Menge, das ist ein ganz Großer, wenn Sie verstehen, wie ich mein.«
»Na, die einen meinen so, die anderen meinen anders.« Dombrowski hat genug gehört. Er speichert das bisherige Protokoll. Der Drucker beginnt zu brummen und wirft zwei Seiten Papier aus, die Dombrowski zu Nguyen über den Tisch schiebt. »Einmal durchlesen und auf jeder Seite einmal unterschreiben. Dann bringe ich dich wieder runter.«
Ohne die Aussage zu prüfen, unterschreibt Nguyen hastig die Zettel und erhebt sich vom Stuhl.
»Willst du nicht lesen, was ich aufgeschrieben habe?«, wundert sich Dombrowski.
»Ich vertraue Ihnen. Das stimmt schon alles. Ich habe ja gesehen, dass Sie mitgeschrieben haben«, erwidert Nguyen und zieht sein Shirt über die weite Hose.
»Wie du meinst.« Dombrowski steht schulterzuckend auf. »Dann wollen wir mal.«
Zufrieden verlässt Dombrowski den Vernehmungsraum. Der Einsatz war so kurz, wie er ihn sich erhofft hatte. Bei so einer inhaltslosen Vernehmung kann er sich den Freiberg auch in den nächsten Tagen noch genauer anschauen. In Gedanken ist er bereits wieder bei Claire, die er gleich mit frischen Brötchen und Croissants überraschen will.
8
Gerd und Joe sitzen in der Bäckerei des Baumarkts und beobachten die Kundschaft. Vor ihnen stehen vier halbe Mettbrötchen und zwei Tassen Filterkaffee.
»Jetzt lernst du mal was Gutes kennen, mien Jung«, sagt Gerd und greift nach der ersten Hälfte, auf der besonders viele rohe Zwiebeln angehäuft sind. Als er hineinbeißt, fallen gleich mehrere davon auf den Boden, aber das stört ihn nicht.
Nach kurzem Zögern greift Joe ebenfalls nach einer Hälfte und beißt vorsichtig hinein. Gerd beobachtet seinen Gast aufmerksam. Zu seiner Freude beginnt Joe, zustimmend zu nicken, und streckt den Daumen der freien Hand nach oben.
»Das ist ein Sterneessen. Das hat ein Sternekoch sogar mal im deutschen Fernsehen gezeigt, wie man das macht. Lecker, oder?«
Joe grinst bestätigend, wobei zwischen den weißen Zähnen überall noch Reste vom Mett kleben. Anschließend beißt er ein zweites Mal ab.
Genüsslich essen beide ihre Brötchenhälften und trinken den Kaffee.
»Magst noch was Süßes zum Nachtisch?«, fragt Gerd und erhebt sich bereits, ohne eine Antwort abzuwarten. Watschelnd bewegt er sich zum Verkaufstresen und bestellt zwei Franzbrötchen.
Als er mit den beiden Tellern zum Tisch zurückgeht, fällt sein Blick auf einen jungen Mann mit dunkelblonden Haaren und schwarzer Hornbrille, der mit schlurfenden Schritten einen mit Erde und Pflanzböden bepackten Lastentrolley Richtung Ausgang schiebt.
»Sag mal, hab ich ’n Déjà-vu, oder wat?«, spricht er leise mit sich selbst. Gerd ist sich sicher, dass er bereits vor einer halben Stunde gesehen hat, wie der Mann mit gleichen Einkäufen den Laden verließ. Schon zuvor hat es ihn gestört, dass der Kerl die Füße beim Gehen nicht angehoben bekommt.
Gerd geht an Joe vorbei, der voller Vorfreude auf die beiden Teller mit dem karamellisierten Plunderteiggebäck in Gerds Händen blickt und umso irritierter dreinschaut, als der seinen Weg einfach fortsetzt. In der Lobby des Baumarktes bleibt Gerd stehen und beobachtet durch das Schaufenster den Kunden, der seine Einkäufe in einen grünen Transporter lädt. Irritiert betrachtet er die Seitenwand des Lieferwagens, die Werbung für ein Gartenbauunternehmen zeigt.
Er spürt einen leichten Druck auf einem der Teller in seinen Händen. Im Augenwinkel sieht er, dass Joe sich neben ihn gestellt hat und vollmundig in das Franzbrötchen beißt.
»Kenn ich schon. Lecker. Esse ich immer in Hamburg«, erzählt er selig schmatzend und folgt dann Gerds Blick zum Transporter. »Was ist los?«
»Da stimmt was nicht«, antwortet Gerd.
»Sagst du das öfter? Das hast du im Hafen schon gesagt.«
»Los. Zurück an unseren Platz. Der kommt noch einmal rein«, ruft Gerd fast zu laut. Er eilt an ihren Tisch zurück und greift nach der eigentlich leeren Kaffeetasse. Dabei beobachtet er den Mann, der erneut den Laden betritt und schnellen Schrittes die Sicherheitsschranken passiert. »Hör zu, Joe. Du holst ’nen Einkaufswagen, und ich folge dem Typen. Er geht nach rechts zu den Baustoffen. Da müssen wir eh hin.« Gerd nippt an der leeren Kaffeetasse, schaut verwundert hinein und stellt sie wieder ab. Dann reißt er die Hälfte vom Franzbrötchen ab und steckt sie sich in den Mund, ehe er dem Mann hinterhereilt.
Joe nimmt den Rest und geht nach draußen, um, wie ihm aufgetragen wurde, einen Einkaufswagen zu holen.
9
Auf den Decks der MS Valderrama laufen Steven und seine beiden Kollegen mit Metallstäben in ihren Händen über unterschiedliche Traversen und öffnen die Verbindungslaschen an den Containern. Über ihnen rauscht immer wieder der Ausleger der Containerbrücke hinweg. Der Brückenfahrzeugführer hat bereits begonnen, weiter vorne die ersten Container zu verladen.
Steven gelingt das Laschen noch nicht so souverän wie Ashraf und Ivan, die beide bereits seit mehreren Jahren als Lascher am Eurogate arbeiten. Er muss bei weiter entfernten Ösen sehr genau zielen, um sie zu treffen und im Anschluss zu lockern.
In die Ohren hat er Kopfhörer gesteckt und lauscht einer rhythmischen Reggaemusik. Im Takt von Bob-Marley-Songs geht er über die verschiedenen Brücken. Manchmal muss er sich zusammenreißen, denn durch die Metallgitter der Traversen kann man bis zu vierzig Meter tief in den Schiffsbauch hinabblicken. Die Höhe war noch nie sein bester Freund, aber er arrangiert sich inzwischen mit ihr.
Auf dem Unterdeck sieht er in einiger Entfernung auf einmal einen Schatten vorbeihuschen. Eine Person scheint sich dort zwischen den Containern zu bewegen. Es war aber weder Ashraf noch Ivan. Die Person trägt keine gelbe Warnweste wie seine Kollegen. Es wirkte eher wie das helle Hemd eines Schiffsoffiziers. Doch warum treibt der sich hier unten herum? Noch dazu, während sie die schweren Metalllaschen lösen? Immerhin hatte der Kerl einen Helm auf dem Kopf.
Irritiert zieht Steven die Kopfhörer aus den Ohren. Er macht ein paar Schritte vorwärts und schaut, ob er den Mann dort irgendwo entdecken kann. Vorsorglich blickt er sich um, ob Ashraf oder Ivan in der Nähe sind. Sie sollen nicht sehen, dass er die Arbeit kurzzeitig unterbricht. Sie haben ihn vorhin bereits argwöhnisch beobachtet. Er will keine weitere Missgunst schüren. Dennoch will er wissen, was hier vor sich geht. Ein Verdacht treibt ihn an, der ihn zugleich auch beunruhigt.
Ein metallisches Ratschen tönt von unten zu ihm herauf. Steven kann es kaum lokalisieren. Das Echo erschwert es ihm zusätzlich.
Vorsichtig nähert er sich den Containern. Eine Brücke weiter sieht er Ashraf beim Lösen der Laschen. Ebenso schnell, wie er aufgetaucht war, ist der Kollege auch schon wieder verschwunden. Sichtlich in Gedanken vertieft, schenkte er Steven keine Beachtung.
Wieder hört er ein Klirren. Scheppernd und dumpf. Dann erblickt er den Mann. Zwanzig Meter unter Steven steht er vor einem roten Container. Ein Metallriegel ist geöffnet. Quietschend öffnet er die rechte Tür des Containers. Direkt dahinter stehen bis zur Decke gestapelt Kartons mit Bananen. Steven kneift die Augen zusammen. Er meint, den Offizier zu erkennen, dem Ashraf vorhin die Rucksäcke gegeben hat.
Der Mann nimmt einige Kartons aus dem Container und stellt sie neben sich auf den Boden. Anschließend holt er daraus diverse Pakete hervor, die er in die besagten Rucksäcke steckt.
»Fuck!«, flucht Steven leise. Er schaut sich kurz um, kann aber weder Ivan noch Ashraf entdecken. Rasch zieht er sein Handy aus dem Overall und filmt die Entnahme mehrerer Pakete aus den Kartons. Er steckt das Handy wieder weg und beobachtet den Offizier weiter bei dessen Tun.
»Digger!«, tönt es plötzlich lautstark über die Traverse. Der Mann schaut sich hektisch in alle Richtungen um, doch bevor er Steven erblicken kann, hat der sich weit genug zurückgelehnt.
Ashraf kommt mit ärgerlicher Miene auf ihn zu. »Steven, Digger. Nichts hier mit Pause, was is los mit dir? Was machst du da?«, ruft er wütend.
Steven springt aufgeschreckt vorwärts, um zu verhindern, dass er den Offizier auf dem Unterdeck entdeckt. »Ich habe nur … also die Höhe ist echt krass hier, weißt du. Manchmal muss ich dabei an eine alte Schulfreundin aus Steilshoop denken. Die hat den Adler gemacht«, bemüht er sich um eine plausible Erklärung.
Ashraf tritt an ihn heran und wirft einen Blick auf die unten stehenden Container. Bohrend schaut er Steven in die Augen. »Pass lieber auf, dass du hier nicht den Adler machst! Und jetzt ab an die Arbeit. Dann kannst du auch bald wieder zu deiner Tochter.« Grimmig dreinschauend wendet er sich ab und verschwindet hinter einem Containerturm.
Steven atmet tief durch. Schweiß läuft ihm im Nacken den Rücken hinab. Sein Herz rast. Mit zitternden Händen geht er zum nächsten Container und versucht, in die Lasche zu stechen, um sie zu lösen. Er braucht zwei Versuche. Tränen steigen ihm in die Augen und verwässern den Blick. »Fuck. Mann. Fuck«, wispert er leise vor sich hin und schüttelt dabei den Kopf.
10
Fröhlich hüpft Tim Dombrowski die Treppe des Polizeipräsidiums hinab. Die Vernehmung konnte er schneller als gedacht hinter sich bringen. Die Aussage war viel zu schwammig, um heute noch aktiv werden zu müssen. Es gab auch keine konkreten Hinweise auf bevorstehende Lieferungen.
Während er zu seinem Kleinwagen schlendert, wählt er auf dem Handy die Nummer von Harry Goldutt.
Nach längerem Klingeln nimmt sein Chef den Anruf entgegen. »Na, Dumbo? Kurze Pause, oder war nichts?«, fragt er neugierig zur Begrüßung.
»›Nichts‹ würde ich nicht sagen, aber auch nicht viel mehr. Das werden die nächsten Tage zeigen. Ich ruf ein paar Leute an, aber es ist nichts Akutes, was uns mal wieder den freien Tag klauen würde«, erzählt Dombrowski erfreut, ohne weiter ins Detail zu gehen.
»Bist du dir sicher? Bei Olli hörte sich das ganz anders an.«
»Du kennst mich. Wäre der Typ heiß gewesen, hätte ich alles aus ihm rausgeholt. Der wollte bloß mit irgendwelchem Halbwissen seinen Arsch retten. Aber dem Hauch eines Verdachts werde ich natürlich nachgehen. Ich kenne Freiberg, und immerhin habe ich jetzt einen Grund, gegen ihn zu ermitteln. Ab Montag!«, setzt Dombrowski entschieden nach. Er ist ein wenig enttäuscht, dass ihm hier unterschwellig mangelnder Ehrgeiz unterstellt wird. So etwas ist ihm noch nie untergekommen.
»Wenn du das sagst, dann ist das auch so«, erwidert Harry gleich viel freundlicher und verabschiedet sich mit besten Grüßen an Claire.
Unzufrieden setzt Dombrowski sich hinter das Steuer seines Autos. Er steckt den Schlüssel in die Zündung, startet den Motor aber noch nicht. Hat er wirklich alles versucht, um jede verwertbare Information aus Nguyen herauszubekommen? Oder hat er zu früh aufgegeben? Hätte er stärker nachbohren sollen? Er ist sich nach dem Telefonat mit Harry nicht mehr sicher, ob er den eigenen Ansprüchen gerecht geworden ist. Mit der linken Hand fasst er sich ins Gesicht und streicht sich nachdenklich über den Dreitagebart. Anschließend wischt er sich die Haare aus der Stirn und startet den Motor.
Bevor er losfährt, zieht er aber noch das Handy aus der Jackentasche und sucht in den Kontakten nach Toni. Sein ehemaliger Büropartner kümmert sich bereits seit mehreren Jahren um Vertrauenspersonen der Polizei aus dem Milieu, die ihn mit Informationen versorgen. Gelegentlich schreibt er auf, was ihm zu Ohren kommt. Meistens erzählt er es den Kollegen jedoch als heißen Tipp und überlässt den Rest der Arbeit dann ihnen. Wenn einer etwas Aktuelles und Konkretes über Alex Freibergs derzeitige Geschäfte weiß, ist das Toni.
Dombrowski wählt seine Nummer, und auf dem Display erscheint der Schnappschuss eines mittelalten rotblonden Mannes, dessen spitzbübisch grinsender Mund von einem kurzen, gepflegten Bart umrahmt wird.
»Dumbo, altes Haus. Was kann ich für dich tun?«, meldet sich Toni. »Ich schätze mal, es ist dienstlich?«
»Moin moin. Da schätzt du richtig. Ich komme gerade aus einer Vernehmung. Und zwar habe ich eine Ansage auf Alex Freiberg bekommen. Kannst du dich noch erinnern?«
»An Freiberg? Na klar. Mmh. Der wuselt doch inzwischen im Hafen als Vorarbeiter bei den Laschern rum. Ich kann mich mal umhören. Würde mich nicht wundern, wenn der wieder im Geschäft ist. Reicht es dir am Montag? Oder lieber gestern?«, will Toni wissen. Der Vorschlag kommt etwas zögerlich, denn eigentlich genießt er gerne das Wochenende mit seiner Familie.
»›Gestern‹ klingt gut, wenn du das bis Montag schaffst«, entgegnet Dombrowski amüsiert. »Ich will am Montag mit den Ermittlungen starten. Wenn du was beisteuern kannst, wäre das gut. Ansonsten schaffe ich es auch ohne dich«, frotzelt er.
»Ey, ey, ey. So nich, mein Lieber. Ohne mich kriegst du doch gar nichts hin«, stellt Toni klar und lacht. »Ich gebe mein Bestes. Ich hab schon eine Idee, wen ich jetzt anrufe, und bis Montag kann ich dir mehr sagen. Okay?«





























