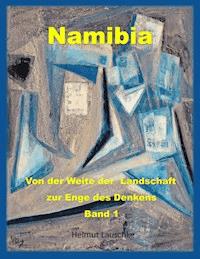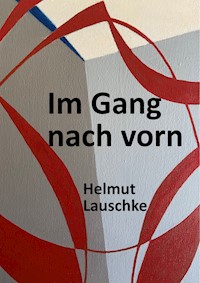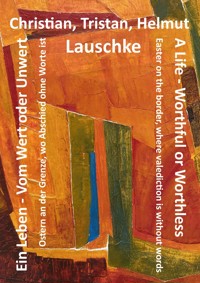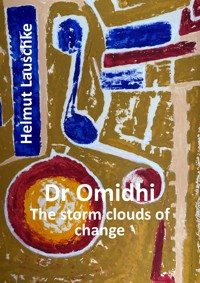Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Ovahimbas von der anderen Flussseite des Kunene hielten leere Plastikbehälter in den Händen, die sie mit Benzin gefüllt haben wollten, weil es Benzin im Süden Angolas durch den langen Bruderkrieg so gut wie nicht, und wenn doch, nur zu horrenden Wucherpreisen gab. Da wollten auch sie ihren Profit machen und den Sprit billig über den Fluss importieren und zu Höchstpreisen in ihrem Land verkaufen. Der Freund zeigte auf die Sandbank auf der namibischen Seite des Flusses mit den frischen Eindrücken eines Riesenkrokodils, das die Nacht dort gelegen hatte. "Da haben Sie aber Glück gehabt, dass Sie dieses Monster in Ruhe gelassen hat. Das wäre mit Sicherheit nicht gut ausgegangen." Der Anstand fiel nicht vom Himmel. Jeder musste sich anstrengen, die weggerutschten Dinge ins Lot der Ethik zu bringen, sie im Zusammenhang der höheren Ordnung zu begreifen, um zu verstehen, was ein Arzt zu tun hatte, damit der Inhalt wieder stimmte. Wenn der Arzt das tat, dann hatte sich das Studium gelohnt und die Koordinaten der Geradlinigkeit und Gleichförmigkeit entsprachen dem Relativitätsprinzip. So wusste es die Vernunft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 646
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Lauschke
Elf Geschichten aus dem Leben in Namibia
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Elf Geschichten aus dem Leben in Namibia
Elf Geschichten aus dem Leben in Namibia
Auf alten Sandalen in die Zukunft
Von den frühen moralischen Entgleisungen
Vom Drang nach Freiheit; Platos Höhlengleichnis
Probleme in der Notfallchirurgie
Die Morgenbesprechungen und die alten Themen
Eine kleine Nachtmeditation
Zurück in die Wirklichkeit
Besuch der Missionsstation Oshikuku
Ein Montag
Eine Fahrt ins Kaokoland
Medizin und das Relativitätsprinzip
Impressum neobooks
Elf Geschichten aus dem Leben in Namibia
Elf Geschichten aus dem Leben in Namibia
Auf alten Sandalen in die Zukunft
Namibia war seit etwas mehr als fünf Jahren unabhängig. Swapo stellte die Regierungspartei und hatte die Macht sicher in den Händen. Die ersten freien Wahlen (one man - one vote) hatten in Südafrika vor etwas mehr als einem Jahr stattgefunden, wobei der ANC mit Nelson Mandela als deutlicher Sieger hervorgegangen war. Politisch wurde damit die Übergabe der Macht aus den weißen Händen in die schwarzen Hände im südlichen Afrika abgeschlossen. Diese Art der Renaissance hatte nun Gültigkeit für den ganzen afrikanischen Kontinent. Der Wandel war deutlich genug, um die letzten weißen Zweifel auszuräumen und zu erkennen, dass der Händewechsel an den Hebeln der Macht ein endgültiger Prozess war, der eine Umkehr für alle Zeiten ausschloss.
In diese Zeit der afrikanischen Renaissance ging auch Dr. Ferdinand. Er tat es mit seinen Füßen ebenso wie mit seinen Gedanken. Galt die Renaissance auch ihm, der ja nicht in Afrika geboren und aufgewachsen war, der vom Gesicht und der hellen Haut her Europäer war, auch wenn er seit über zehn Jahren für die kranken und verletzten Menschen im Norden des Landes sich einsetzte und an ihnen als Chirurg arbeitete. Er hatte die letzten Jahre der weißen Apartheid und die letzte Entscheidungsschlacht vor der angolanischen Grenze miterlebt, die die Arbeit an den schwarzen Menschen erheblich erschwerten. Er erinnerte sich gut an den Ausspruch des südafrikanischen Brigadiers in einer Morgenbesprechung, dass bei der letzten Entscheidungsschlacht für die Weißen viel auf dem Spiele stehe, und dass er und alle übrigen Weißen auf einem Pulverfass sässen, das jederzeit hochgehen kann. Das weiße Kommandoschiff war gesunken, und das neue Schiff mit den schwarzen Masten und der schwarzen Besatzung hatte angelegt und lag seit einigen Jahren schweigend vor Anker. Ob im Bauch des Schiffes mit den schwarzen Masten alles aufgeräumt war, konnte Dr. Ferdinand nicht sagen. Er hatte seine Vermutung, dass da noch manches nicht aufgeräumt herumlag. Er stützte diese Vermutung auf Aussagen von Menschen, die dort einst an Bord waren und sich nun als Freiheitskämpfer bezeichneten, die im Exil waren und aus dem Exil heraus die Freiheit Stück für Stück, Quadratmeter für Quadratmeter ins Land kämpften. Dr. Ferdinand verfolgte die letzte Phase mit der letzten Entscheidungsschlacht praktisch durch die verschmierten und jene Fensterscheiben des Hospitals, die nach einem Stock- oder Steinschlag gesprungen oder das 'x-te Mal eingeschlagen waren. Er bekam die letzte Schlacht mit allen Vibrationen und größeren Erschütterungen aus nächster Nähe mit, wenn er an den Krankenbetten stand und nach den Patienten sah oder bei Operieren war, wenn ihm ein mächtiger Knall auf die Trommelfelle schlug, dass ihm die Instrumente aus der Hand fielen und der Instrumententisch mit den klappernden Instrumenten vom OP-Tisch wegrollte. Die Nähe zum Geschehen blieb, als die neue Mannschaft an Land ging und in die Zentren der Macht eilte, um die entsprechenden Hebel der Entscheidung schnell in die Hände zu bekommen, die noch warm von den weißen Händen waren, die diese Hebel in irgendwelche Gänge oder Leerläufe geschaltet hatten. Für die neue Mannschaft war es dringend, das Steuerrad so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen. Viele, die da kamen und auf dem Wege zur Macht und den hohen Positionen waren, unterbrachen für kurze Zeit ihre Fahrt mit dem Auto und statteten dem Hospital einen Besuch ab, wo sie vom ärztlichen Direktor und dem Superintendent, die beide mit den reichlichen Melanozyten gesegnet waren, brüderlich begrüßt und über den neuesten Stand informiert wurden. Da war so etwas wie der Wunsch nach einer afrikanischen Renaissance im Sinne einer schwarzen Wiedergeburt zu spüren. Dem Beobachter solcher Besuche fiel die Zielstrebigkeit und Zielsicherheit derjenigen Männer und Frauen auf, die auf ihrer Fahrt in die Machtzentrale noch unweit der angolanischen Grenze einen Abstecher zum Hospital machten. Bei der Betrachtung ihrer Gesichter gab es so gut wie keine Zweifel mehr, dass es ihnen um die Macht und ein besseres Leben ging. Ob sie beim Trachten nach dem besseren Leben mit den offensichtlich versprochenen Vergünstigungen auch an die Menschen im Lande dachten, die nicht im Exil waren und dafür die Armut und das Leid menschlich grenzenlos erlitten, dachten und sie in ihr Trachten nach dem besseren Leben einbezogen, das war ihren Gesichtern nicht anzusehen und aus ihren Worten nicht herauszuhören.
Dr. Ferdinand verschloss die Bauchdecke eines Mannes, der so alt nicht war und von einem Tumor verzehrt wurde, der, wie sich bei der Operation herausstellte, vom Magen ausging und den angrenzenden Querdarm bereits befallen hatte. Diesem Patienten hatte das Schicksal einen Schlussstrich unter das Leben in naher Zukunft gezogen, dem chirurgisch nicht mehr anzukommen war. Diese Operation war also nur ein Öffnen und Schließen des Bauches, eine sogenannte Probelaparotomie, wie sie Dr. Ferdinand schon so oft durchgeführt hatte und ihn immer wieder bedrückte, dass er da nicht helfen konnte. Die OP-Schwester erinnerte ihn an den alten Mann mit dem weit fortgeschrittenen Magenkarzinom, bei dem er vor Jahresfrist auch eine Probelaparotomie durchgeführt hatte. "Ja, an diesen Patienten erinnere ich mich gut", sagte er, "weil der, als er aus der Narkose erwachte, mit der Hand über seinen Bauch strich und spürte, dass sich da im Bauch nichts verändert hatte. Von diesem Moment an hatte der alte Mann mit seinem Leben abgeschlossen, schloss seine Augen und hielt sie auch dann geschlossen, wenn ich an seinem Bett stand und zu ihm redete. Er wollte sich am Ende seines Lebens von keinem mehr stören lassen, auch nicht von mir."
Dr. Ferdinand knüpfte den Faden nach Verschluss der Muskelblätter, streckte den verknoteten Faden nach oben, und die Schwester durchschnitt ihn mit der Schere oberhalb des Knotens. "Haben Sie mal was von dem freundlichen Kollegen gehört, der hier in der Uniform eines frisch gebackenen Leutnants der südafrikanischen Armee seinen Dienst getan hatte?", fragte ihn die Schwester, als sie ihm den Nadelhalter mit Faden für die Hautnaht in die rechte Hand drückte. "Meinen Sie Dr. van der Merwe?", fragte er zurück. Es war ein Name, den Dr. Ferdinand in seinem Leben nicht vergessen wollte, weil sich mit diesem Namen ein hervorragender junger Mensch und Arzt verband, der auf seine Uniform keine Rücksicht nahm, wenn er am Patienten arbeitete. Dazu kam, dass Dr. van der Merwe wie ein Freund zu ihm war, als er noch ganz unsicher seine Füße auf den afrikanischen Boden setzte. Oft hatte er seine Hilfe angeboten, damit er als Neuling afrikanischer Verhältnisse beim Aufsetzen der Füße keine weichen Knie bekam. Da gab es den Krieg, der fürchterlich und schonungslos unweit der angolanischen Grenze wütete, der die Sicht des Dr. Ferdinand trübte, an vielen Tagen so stark, dass er depressiv war und nicht recht wusste, wo vorn und hinten war. "Dr. van der Merwe ist kurz vor seinem Abschluss als orthopädischer Chirurg. Er ist glücklich verheiratet mit einer lieben Frau, von der inzwischen zwei Kinder hat. In seinen Briefen erwähnt er jedesmal das Hospital, in dem er soviel gelernt hätte, und richtet Grüsse an die Schwestern aus, mit denen zusammen er gearbeitet hatte." Ein sanftes Lächeln glättete das Gesicht der Schwester, die diesen Arzt in guter Erinnerung behalten hatte, weil er für die Menschen in der schwierigen Zeit des Krieges ein Arzt mit menschlichem Antlitz gewesen war. "Dieser Arzt war ganz anders als die andern uniformierten Ärzte", sagte sie und fuhr fort: "diesen Arzt haben alle geachtet und gemocht, weil er ein gutes Herz hatte und voll in der Arbeit am Menschen aufging. Bei ihm störte das Tragen der Uniform der Besatzer nicht, weil unter ihr der gute Mensch zu spüren war." Dr. Ferdinand stimmte ihr voll zu und erinnerte an seine oft mit Gips bekleckerte Uniform, wenn er abends die OPD (Outpatient department) verließ, weil ihm das Tragen der Uniform weniger bedeutete als die Arbeit am Patienten, bei der er sich ganz forderte. Die OP-Schwester erwähnte, wie viele von den Schwestern Tränen in den Augen hatten, als sich Dr. van der Merwe verabschiedete, um nach Südafrika zurückzukehren. "Solche Menschen sind wie das Licht in der Dunkelheit, dem man freudig folgt, wenn man die Richtung verloren hat", fügte Dr. Ferdinand hinzu, als sie gemeinsam den Patienten vom OP-Tisch auf die Trage rüberhoben.
Als er das 'theatre' verließ, war die Mitternacht überschritten. Er zog sich die durchschwitzte OP-Kleidung vom Körper und warf sie in den Wäschesack, zog sich das Zivile an, fuhr mit den Fingern durchs feuchte Haar und machte sich auf den Rückweg zur Wohnstelle in der Hoffnung, für die letzten Stunden noch einen kurzen Schlaf zu finden.
Die Hähne krähten das fünfte Mal. Es war halbsechs, als sich Dr. Ferdinand unter die Brause stellte und sich den Schlaf aus dem Gesicht wusch. An diesem Morgen wollte er früh im Hospital sein, um die Patienten vor der Morgenbesprechung zu sehen. Überhaupt wollte er an seinem Arbeitsstil festhalten, wie er ihn vor der Unabhängigkeit eingehalten hatte, auch wenn er gewisse Schwächezeichen spürte, die sich durch die jahrelange Überforderung eingestellt hatten. So vermisste er seit über einem Jahr das Gefühl des Frischseins beim Aufwachen, das Gefühl, wirklich ausgeschlafen und erholt zu sein. Stets waren da Reste der vorangegangenen Tage im Gesicht und im Denken, die, wenn sich die Ladungen ballten, sich bis zum Kopfschmerz schon am frühen Morgen zusammendrückten. So musste er an manchen Morgen eine Schmerztablette nehmen.
Nach einer Tasse Kaffee machte er sich auf den Weg zum Hospital, wobei er an diesem Mittwochmorgen den kürzeren Weg zwischen zerfleddertem Lattenzaun und ausgerolltem Stacheldraht nahm. Es war ein Weg, den er in beiden Richtungen schon einige tausend Male genommen hatte. Von den fünf aufgestelzten Caravan-Häusern, die er nun links stehen ließ, standen nur noch zwei leer, während die drei, die dem Hospital am nächsten standen, von Schwestern bewohnt wurden. In dem Blockhaus, das dem Hospital am nächsten stand, wohnte Schwester, die bei der Explosion in der Barclay's Bank am Freitag, den 19. Februar 1988, dem schwarzen Freitag, schwere Verbrennungen erlitt und das rechte Bein verlor. Sarah wohnte dort mit ihren zwei kleinen Kindern und musste nur die Straße überqueren, wenn sie zur Arbeit ins Hospital ging. Ihr Arbeitsplatz war in der CSD (Central Sterilisation and Disinfection), die sich am hinteren Ende des Operationshauses befand. Dr. Ferdinand ging durch die Hospitaleinfahrt, deren Tore seit Jahren wieder verbeult waren. Das rechte Tor mit dem weniger verknickten Torrahmen stand offen, hinter dem zurückgesetzt auf einem Stuhl der Pförtner saß und sein Morgenei entpellte, dessen Schalenstücke er mit dem linken Schuh in den Sand einrieb. Er war mit dem Ei voll und ganz beschäftigt, das er sich dann in den Mund schob, als ihn Dr. Ferdinand passierte und ihm einen guten Morgen wünschte. Der Pförtner nickte mit dem Kopf, während er das Ei genüsslich zerkaute. Der Vorplatz roch nach Urin, auch wenn es Dr. Ferdinand als normal empfand, denn in all den Jahren, soweit er sich erinnern konnte, waren es nur der Tag des Besuchs der britischen Königin und einige Tage danach, dass dieser Geruch die Nasenschleimhaut nicht kratzte. Die namibische Flagge vom kleineren Format war noch nicht an der überhohen Fahnenstange auf dem gemauerten Podest des Vorplatzes hochgezogen, als er die 'Intensiv'-Station betrat und die Patienten mit dem erhöhten Risiko besah, untersuchte und die Ergebnisse in den Verlaufsbögen notierte. Die zwei, ihn begleitenden Schwestern waren freundlich. Doch die Seele, die auch in diesem Beruf da sein muss, um für die Patienten eine Schwester mit menschlichem Antlitz zu sein, konnte Dr. Ferdinand bei ihnen, wie bei vielen andern Schwestern, von den Matronen ganz abgesehen, nicht mehr spüren. Die Seele im Beruf der Krankenpflege, oder des Helfenwollens im allgemeinen, war in den wenigen Jahren der Unabhängigkeit weitgehend verkümmert. Da war die Zahl der Schwestern immer kleiner geworden, die ihre Arbeit am Patienten aufmerksam und liebevoll, mit menschlicher Hingabe, verrichteten, ohne dabei auf die Uhr zu sehen und an die Tee-, Kaffee- oder Mittagspause zu denken. Diese Seele konnte sich als wunderbare Blume oder menschliche Krone in diesem herausragenden Beruf, der den ganzen Menschen körperlich und seelisch forderte und während der kriegerischen Erschütterungen jahrelang überforderte, nicht mehr halten. Dr. Ferdinand sah im Verlust der besonderen, menschlichen Zuwendung am kranken Mitmenschen das Syndrom der Erschöpfung mit der inneren Leere und Richtlosigkeit. Die Schwere des Syndroms stand in direktem Bezug zur Bildung und Ausbildung des Menschen, der sich für den pflegerischen Beruf als tauglich betrachtete und sich schließlich dabei überfordert, überhoben und Schiffbruch erlitten hatte. Natürlich gab es Ausnahmen, die immer weniger, aber nicht weniger erfreulich waren. Da dachte Dr. Ferdinand zuerst an den Engel bei den Kinderschwestern, die nach wie vor der Unabhängigkeit mit großer Geduld und Hingabe, mit Herz und Nächstenliebe an den kranken Kindern arbeitete. Das hatte bei ihr die Folge, dass sie im Gegensatz zu den meisten andern Schwestern und fast allen Matronen sich körperlich verzehrte und an Körpergewicht verlor. Dr. Ferdinand stellte diesen Schwesternengel nach der Unabhängigkeit einige Male auf die Waage und musste beim Ablesen der verbliebenen Kilogramme mit ernsten Worten diesem herausragenden Menschen erklären, dass sie sich nicht übernehmen und sich etwas mehr Zeit zum Essen geben müsse. Diese Schwester in ihrer Erwiderung fragte dann mit einem Lächeln auf ihrem Gesicht, ob es das sei, und bat, wobei sich das Lächeln legte, zu ihrer Arbeit zurückkehren zu können. Die kranken und verletzten Kinder, die sie versorgte, liebten diese Schwester heiss und innig.
Es war der Zeitgeist mit dem aufkommenden Selbstwertgefühl nach den langen Jahren der Unterdrückung, dass die vorbildliche Arbeit dieser Schwester von ihren Kollegen und Kolleginnen aus Gründen der Bequemlichkeit nicht zu Herzen genommen wurde. Die mangelnde oder gar fehlende Hingabe an den Kranken, der doch der Allernächste im Hospital und der Grund aller Arbeit und des Geldverdienens am Hospital war, war ein schwerer Mangel innerhalb der Krankenpflege, der erst nach der Unabhängigkeit deutlich ans Tageslicht kam und bereits in den ersten fünf Jahren in erschreckendem Masse zugenommen hatte. Es war sichtbar, da gab es keine Zweifel mehr, dass die Menschen, und wenn es die in den Pflegeberufen waren, zunächst und vorwiegend an sich und mehr oder nur am Rande an den Nächsten dachten. Dr. Ferdinand fasste die fehlende Hingabe der Krankenschwester an den Patienten mit der auffälligen Zunahme des Körpergewichts durch das Mehr-essen und Coca-trinken und das Mehr-sitzen, aus dem Fenster Gucken und Palavern (anstatt mit Hand und Herz zu arbeiten) im Hingabemangelsyndrom zusammen, dem er den Namen "Seelen-Kwashiorkor" in Anlehnung an den Körper-Kwashiorkor beim anhaltenden Eiweißmangel gab. Letztere Form führte bei Kindern zur extremen Abmagerung mit spindeldürren Armen und aufgedunsenen Wasserbäuchen auf stelzigen Beinen. Beim "Seelen-Kwashiorkor" handelt es sich um eine Mangelerscheinung ausschließlich bei Erwachsenen, deren Körper durch zu vieles Essen (bei fehlender Kontrolle (Selbstdisziplin) zum rechtzeitigen Aufhören beim Essen) sowie durch den chronischen Mangel an der nötigen Bewegung bei der richtig durchgeführten Krankenpflege durch zu vieles (Herum-) Sitzen überfettet und fürs Aufstehen vom Stuhl schwerfällig geworden sind. Bei diesen Erwachsenen war es das Fett in und an den Bäuchen, an den Oberarmen, Oberschenkeln und Gesäßen, was bei den Kindern bis auf das Wasser in den ausladenden Bäuchen alles fehlte. Bei den chronisch unterernährten Kindern war die Seele bis zum letzten Atemzug lebendig. Sie hofften auf Hilfe und ein Mehr an Essen. Die meisten hofften vergeblich, weil da nichts kam, was längst hätte kommen müssen. Darum packten die meisten dieser Kinder mit den Wasserbäuchen auf den stelzigen Beinen das Leben nicht mehr. Sie fielen um und schauten mit großen Augen in den Himmel, wenn ihr letzter Atemzug verwehte.
Bei den Erwachsenen war es dagegen die Seele, die sich in erschreckendem Masse nach der Unabhängigkeit verschrumpfte und verschalte, als gäbe es da Steine in den Herzen, während sie gleichzeitig an der körperlichen Überfettung litten, die sie aufgrund des seelischen Mangel- oder Schwachzustandes, wenn sich seelisch überhaupt noch etwas bewegte, nicht unter Kontrolle brachten. So hieß die Kurzformel:
Ist das Wasser in den Kinderbäuchen,
dann schreit die Seele auf vor Schmerz.
Große Augen trüben sich zum Ende,
mit dem Fett bringt Seelentod die Wende.
Da macht das fette Essen Bäuche dick,
hart drückt der Stein aufs schwache Herz.
Dr. Ferdinand sah auch nach den Patienten in den andern Sälen, notierte die Besonderheiten in die Krankenblätter und ging dann noch früh genug zur Morgenbesprechung in das Büro des Superintendenten. Er setzte sich auf einen der Stühle gegenüber den verhängten Fenstern. Die Klimaanlage ratterte bereits und bewegte die verbrauchte Luft vom vergangenen Tag. Der Superintendent, ein Kollege der schwarzen Hautfarbe im fortgeschrittenen Alter um die fünfzig, drückte den Telefonhörer mit der linken Hand ans linke Ohr, sprach englisch mit einigen Bemerkungen in Oshivambo, spannte und entspannte die Gesichtszüge bei dem länger dauernden Telefonat, während er mit der rechten Hand einige Notizen in ein Tagebuch vom DIN-A3-Format schrieb. Dieser Superintendent war der vierte mit einer schwarzen Haut. Er folgte dem schwarzen Kollegen, der als Exilant in Moskau Medizin studierte und nun auf dem Stuhl des ärztlichen Direktors saß, der als vorheriger Superintendent der schwarzen Kollegin auf dem Stuhl folgte, deren Exilsprache ebenfalls russisch war, die sich nach der ersten Exilstation mit Schwangerschaft in Sambia an einem Moskauer Hospital, das der Lumumba-Universität angeschlossen war, in der Gynäkologie ausbilden ließ, diese Ausbildung, wie so viele Exil-Namibier, aufgrund der vorzeitigen Rückkehr abbrechen musste, um an den UN-überwachten Wahlen teilzunehmen und das Stimmkreuzchen ins Swapokästchen zu setzen. Dieser Superintendent war nicht im Exil, sondern machte in Durban seine gynäkologische Ausbildung, die er aus persönlichen Gründen, die auch mit der Politik zu tun hatten, nicht abschloss. Er reservierte sich den Dienstagnachmittag sowie den privaten Untersuchungsraum in der 'Intensiv'-Station für seine Patientinnen, die als Privatpatienten kamen und ihren Obulus anstandslos entrichteten. Von den Nacht- und Wochenenddiensten für die allgemeinen Patienten mit den leeren Händen, die sich das Private nicht leisten konnten, nahm er sich jedoch aus.
Der Superintendent legte den Telefonhörer zurück und machte sich noch einige Notizen. Die Zeit, dass die Morgenbesprechung beginnen sollte, war überschritten, als noch Kollegen nachzogen und ihre Stühle einnahmen. Es waren vor allem die kubanischen Kollegen, die die Pünktlichkeit karibisch sahen und sich fast regelmässig verspäteten. Sie waren die weitaus grösste Gruppe und machten mehr als 50 Prozent der Ärzte aus. Die schwarze Kollegin, die schon vor der Unabhängigkeit nur sporadisch, über lange Zeitstrecken überhaupt nicht zur Morgenbesprechung erschienen war, erschien auch nach der Unabhängigkeit nur gelegentlich zu diesen Besprechungen und kam dann meistens noch zu spät. Sie hatte sich vom normalen Stationsdienst im pädiatrischen Kindersaal abgesetzt und füllte nun den Posten eines Managers zur Bekämpfung der Malaria in der Region aus, den sie von einem Büro aus führte, das gut klimatisiert und mit einem Schreibtisch der normalen Größe und einem bequemen Schreibtischsessel ausgestattet war. Die Gesichter der Anwesenden, die ihre Plätze eingenommen hatten, sahen entweder müde oder gelangweilt aus. Einige gähnten sogar in den Besprechungsraum hinein, wobei es wieder die kubanischen Kollegen waren, die sich beim Gähnen auch nicht die Hand vor den Mund hielten. Der stumpfe bis satte Ausdruck in den meisten Gesichtern stand im krassen Gegensatz zu den gespannten Gesichtern, die im Besprechungsraum saßen, als noch die Granaten krachten und der Brigadegrneral von der letzten Entscheidungsschlacht sprach, wo für alle viel auf dem Spiele stand. Davon und von den nächtlichen Ruhestörungen durch die Koevoet (was soviel wie Brecheisen bedeutet), die das Hospitalgelände nach Swapokämpfern absuchte und dabei durch die Krankensäle von Bett zu Bett ging, war nun nichts mehr zu spüren. Das Feuer der ständigen Aufregung und Angst, von einer Granate erschlagen zu werden, war erloschen. So war auch der besondere Geist des Helfen-müssens erloschen, den es damals gab, als sich unter diesen gefährlichen Umständen wenige Ärzte für die Menschen in größter Not einsetzten und dafür ihr eigenes Leben aufs Spiel setzten. Die Zeit des Für- und Miteinanders unter Einsatz des persönlichen Lebens endete mit Eintritt der Unabhängigkeit Namibias. Nun gab es kein Lebensrisiko mehr, weder für die Ärzte noch für die Schwestern, wenn sie am Patienten arbeiteten, beziehungsweise zu arbeiten hatten. Das war den teilnehmenden Gesichtern in der Morgenbesprechung auch abzulesen. Nun füllte die Routine des Arbeiten-müssens neben der risikolosen, stumpfen Gleichgültigkeit die ablesbaren Züge auf den glatten, mehr oder weniger ausgeschlafenen Gesichtern. Die tiefen, horizontalen und schrägen Sorgenfalten mit den übermüdeten Augen, die einst die Gesichter so eindrucksvoll und unverwechselbar markierten, waren von der Bildfläche verschwunden. Mit dem Zuschütten der Schieß- und Wehrgräben sowie der Granatenlöcher hatte auch der Gesichtsausdruck die platten Züge des sicheren Sitzens angenommen. Es war geglättet, wo noch vor garnicht langer Zeit Not und Verzweiflung, der nicht endende Schmerz tiefe Gräben und Löcher gerissen hatten.
Der Superintendent führte eingangs das, was er zu sagen hatte, in einer fast emotionslosen Sprache aus, als wäre es ein Geschäft, das zu tätigen sei. Die Art und Weise des Sprechens, Zuhörens, Fragens und Diskutierens ließ das Wort 'Job' zur Geltung kommen, das in seiner Flach- oder Plattheit den Zugang zur Tiefgründigkeit des ärztlichen Berufes mit der Vielseitigkeit der An- und Herausforderungen verloren hatte. So ließ sich aus dem Berufsethos kein 'Jobethos' denken oder machen. Der Superintendent sprach, schaute mit seinen Augen in irgendeine Richtung, ohne einen beim Herumfahren des Blickes gezielt positiv oder negativ zu berühren. Er konnte völlig ungestört reden, denn außer dem Telefon unterbrach ihn keiner der teilnehmenden Gesichter mit den überwiegend teilnahmlosen Gesichtszügen. Die Themen, die da aufgerollt und abgespult wurden, waren oft dieselben, wie vor der Unabhängigkeit. Der Unterschied lag in der inneren Teilnahme an der Not der Menschen, in der Bekundung des Willens zum Helfen unter den härtesten Bedingungen, in der Leidenschaftlichkeit, den bedrängten Menschen in ihrer Verzehrung ein guter Arzt zu sein. Hinzu kam besonders bei den kubanischen Kollegen die Schwierigkeit, sich in der englischen Sprache auszudrücken. Doch mit zunehmender Übung waren sie es und nicht die einheimischen, aus dem Exil zurückgekehrten Ärzte und Ärztinnen, die ihrerseits Punkte der Mangelhaftigkeit vorbrachten, diskutierten und nach einer Verbesserung verlangten. Es zeigte sich bald, dass ohne die kubanische Verstärkung das Hospital nicht betrieben werden konnte. Hinzu kamen die Kollegen aus Nigeria, Tansania, Uganda, von Ägypten, Birma, Bulgarien und der Ukraine, die einen wertvollen Dienst am Patienten in den unterschiedlichen Fächern der Medizin leisteten.
Mit zunehmender Gewöhnung an die Unabhängigkeit unter dem ersten Präsidenten mit der schwarzen Hautfarbe und einem aufgeblähten Verwaltungsapparat mit Menschen der zumeist gleichen Hautfarbe brachten es die Minister und ihre Vertreter sowie die Staatssekretäre, ihre Stellvertreter und nachgeordneten Direktoren in kürzester Zeit zu beachtlichem Wohlstand, der im krassen Widerspruch zur allgemeinen Armut stand. Es war kein Zweifel, dass die Armut weiter zunahm. In dieser Neuzeit, genauer, fünf Jahre nach Beginn der Neuzeit wurde über bestimmte Dinge nicht mehr gesprochen. Dazu gehörte der Vorplatz des Hospitals mit seinem ständigen Uringeruch, der miserable Zustand in den Krankensälen mit den tropfenden und klemmenden Wasserhähnen, die mangelnde Sauberkeit in den Waschräumen und Toiletten, die verbrauchten, angerissenen, verschmierten und nach Urin riechenden Schaumgummimatratzen, die alten Betten mit den angebrochenen Gestellen, die angerosteten Nachttische mit den klemmenden oder fehlenden Schubladen, und so vieles mehr. Es wurden also ganz elementare Dinge verschwiegen, die picobello sein sollten, weil an denen der Zustand eines Hospitals direkt abzulesen war. Diese Mängel wurden nach der Unabhängigkeit schweigend hingenommen, die noch wenige Jahre zuvor, also zur Zeit der letzten Entscheidungsschlacht, moniert und durch starke Worte angeprangert wurden. Hier war es insbesondere die hagere, kämpferische Matrone mit dem blassen, weißen Gesicht, die sich für eine bessere Hygiene zum Wohle der Patienten pausenlos einsetzte. Es erstaunte in erschreckendem Masse, wie der Geist des vollen Einsatzes für den kranken Menschen so rasch nach der Unabhängigkeit erlosch, obwohl viele der Missstände unverändert vorhanden waren und einige von ihnen weiterhin zum Himmel stanken.
Zahlreiche orthopädische Operationen standen auf dem Tagesprogramm. Dr. Ferdinand ging nach der Besprechung zum OP-Haus, hängte die Zivilkleidung an den Nagel, zog sich das Grüne über und ging in den Teeraum, um noch eine Tasse Tee zu trinken. Die Morgenbesprechung betrachtete er als ein tägliches Ritual, das so gut wie keine praktischen Auswirkungen hatte. Das Gesprochene, auch wenn es tausendmal wiederholt wurde, erreichte kaum, meist keine praktischen Verbesserungen in den Kranken- und OP-Sälen sowie im 'Outpatient department', die die Arbeit am Patienten erleichtert hätten. Im Teeraum waren die Stühle mit den ausgesessenen und eingerissenen Sitz- und Rückenpolstern international besetzt. Die kubanische Kollegin hatte ihren Tee fertig getrunken und ging zum 'theatre 3', um dort eine Laparotomie durchzuführen. Außer ihr gab es nur Kollegen, die da noch ihren Tee tranken. Keiner von allen vermittelte den Eindruck eines überragenden Arbeitseifers. Keiner stürzte sich da in die Arbeit, oder ließ sich in die Arbeit stürzen, obwohl es mehr als genug zu tun gab. Da machten die namibischen Ärzte keinen Unterschied. Dr. Ferdinand leerte die Tasse, stellte sie auf die kleine Durchreiche und ging zum 'theatre 2', wo der Patient zur Oberschenkelnagelung auf dem OP-Tisch lag. Der burmesische Kollege leitete die Narkose ein und führte den Atemtubus in die Luftröhre, den er über Verlängerungsschläuche an das Narkosegerät anschloss. Dr. Ferdinand und der philippinische Kollege drehten den Patienten auf die linke Seite und zogen lange Pflasterstreifen über seinen Körper, um die Seitenlage für die Operation zu halten. Dann gingen sie in den Waschraum, aus dem sie zehn Minuten später mit übergezogenen sterilen Kitteln und Handschuhen zurückkamen. Die OP-Schwester hatte in der Zwischenzeit das rechte Bein mit der braunen Desinfektionslösung gesäubert und den Patienten mit sterilen grünen Tüchern abgedeckt. Auch bei dieser Operation musste improvisiert werden, da die verfügbaren Marknägel entweder zu kurz oder zu lang waren. Es war eine missliche Situation, wie sie so oft in den Jahren der Apartheid in der Behandlung nichtweißer Patienten störend empfunden wurde. Da hatte sich auch nach der Unabhängigkeit trotz ständiger Reklamation nichts gebessert. Die Erklärung lautete nun, dass die Nägel zwar seit Monaten bestellt seien, aber aufgrund nicht bezahlter Rechnungen für bereits gelieferte Instrumente und anderer Waren nicht geliefert würden. Nun waren es die fehlenden Gelder, was früher die rassenpolitische Ausgrenzung war. Im Bemühen, das Instrumentarium für die Operative Knochenbruchbehandlung zu verbessern und auf den Stand der Zeit zu bringen, hatte sich im Resultat wenig oder nichts geändert. Auch am Schwitzen beim Operieren hatte sich nichts geändert, da es die Klimaanlage im OP weiterhin nicht tat. Es ist viel darüber geredet worden, auch darüber, dass das Operieren in der Bullenhitze nicht nur unmenschlich ist, sondern auch den Kreislauf des Operateurs, des Assistenten und der OP-Schwester ungebührlich strapaziert, die das Risiko der Operation erhöht. Es wurde eingesehen, dass dem Patienten eine unnötige Erhöhung des OP-Risikos nicht zugemutet werden durfte. Da schlugen die Klöppel des ärztlichen Ethos bereits und unüberhörbar aufs Trommelfell. Doch es passierte nichts. Die Taten blieben aus. Auch hatte sich die Atmosphäre während des Operierens verändert. Die hatte sich trotz der Bullenhitze im OP-Saal abgekühlt, auch wenn es da Unterschiede von OP-Saal zu OP-Saal gab, je nachdem wer der Operateur und wer die OP-Schwester war. Die Kommunikation im allgemeinen war zurückgegangen. Man empfand das Miteinander-sprechen nicht mehr so stark wie vor der Unabhängigkeit, als die Granaten noch ringsum einschlugen und die Einschläge immer näher ans Hospital kamen, in einer Zeit, als das eigene Leben tagtäglich bedroht war.
Trotz der Improvisation mit dem Marknagel verlief die Operation ohne nennenswerte Störung und dauerte etwa eineinhalb Stunden, das war gut eine halbe Stunde länger, als die Nagelung eines gebrochenen Oberschenkelknochens gewöhnlich dauerte. Dafür gab es zwei Gründe. Erstens: die Einleitung der Narkose nahm bei diesem Kollegen immer mehr Zeit in Anspruch. Der ließ sich da nicht aus der Ruhe bringen, egal, wie eilig es der Operateur hatte. Mit andern Worten, für den Anästhesisten, der aus dem fernen Birma gekommen war und einen Augenfehler insofern hatte, als er das rechte Auge nicht so weit öffnen konnte wie das linke, spielte die Eile in der Dringlichkeit nicht die oberste Rolle. Da kam bei ihm das asiatische Zeitverständnis zum Tragen, von dem er sich auch nicht im südlichen Afrika, genauer, fündunddreißig Kilometer südlich der angolanischen Grenze abbringen ließ, egal, ob es ein Notfall war oder nicht. Der zweite Grund war die fehlende Bereitschaft der an der Operation Beteiligten, unter erhöhten Stressbedingungen zu arbeiten, was vor der Unabhängigkeit die Regel war. Nun ließ man sich nicht mehr hetzen. Das sagte man auch in einem Ton, der kein Missverständnis aufkommen ließ. Es wurde häufig auf die unerträgliche Hitze im OP verwiesen, die vor der Unabhängigkeit bei der viel größeren Anspannung und Belastung lautlos ertragen wurde. Die Selbstverständlichkeit von "gestern", Höchstleistungen unter miserablen Bedingungen zu bringen, als die Not und die Leiden des Krieges unter den Fingernägeln brannte, gab es "heute" nicht mehr. Das Leben im Alltag war so weit sicher wie das Gehalt am Monatsende, dass man sich da nicht mehr auf zusätzliche Anforderungen einließ. Die Leistungsschraube wurde auf eine Norm zurückgedreht, die mit der einstigen nicht mehr vergleichbar war. Als wäre diese Schraube nicht richtig reingedreht; sie saß nicht mehr fest und wackelte im vorgedrehten Schraubenloch. Der SchraubenKopf stand nicht nur vorwitzig sondern noch weiter heraus, dass man sich an ihm verletzen konnte. Es war die Zeit der neuen Normen, die mit der Uhr eingehalten wurden, wenn es darum ging, die Tee- und Mittagspausen zu nehmen und sich bei Schichtende pünktlich auf den Heimweg zu machen. Arbeitsende und Zwischenpausen wurden besonders von jenen genau beachtet, die es mit der morgendlichen Pünktlichkeit zur Arbeit nicht so genau nahmen.
Der Patient atmete spontan, so dass der birmanische Narkosearzt, der kein fertiger Anästhesist war, ihm den Atemtubus aus der Luftröhre herauszog und die Sauerstoffmaske aufs Gesicht setzte. Dann wurde der Patient vom OP-Tisch auf die Trage herüber gehoben und in den Aufwachraum gefahren. Beim Rüberheben gab es genügend Hände, die gemeinsam den FrischOperierten fassten. Da war noch jene Gemeinsamkeit, wie sie vor der Unabhängigkeit alltäglich und selbstverständlich war. Dr. Ferdinand erfüllte das kurzzeitige Aufleben des alten Gemeinschaftsgeistes mit tiefer Befriedigung. Er wünschte sich diesbezüglich so manches Mal die alte Zeit zurück, als die Granaten noch mordsjämmerlich krachten und die Angst, erschlagen oder zerrissen zu werden, voll in den Augen mit den geröteten Bindehäuten stand.
Er zog sich die Handschuhe von den Händen, während eine Schwesternschülerin im zweiten Ausbildungsjahr ihm den angeschwitzten Kittel öffnete und vom Körper zog. Er ging in den Umkleideraum, wechselte das durchschwitzte OP-Hemd gegen ein trockenes aus, hielt das Gesicht vor den Spiegel und sah die Züge der Erschöpfung nach all den Jahren harter Arbeit, ging in den Teeraum, füllte eine Tasse mit Tee, rührte zwei Löffel Zucker ein und setzte sich vor den niedrigen Tisch mit der verkratzten und von eingedrückten Kugelschreibern vollgekritzelten Holzplatte. Im Teeraum saßen der kubanische Kollege, der der Gynäkologie zugeteilt war und eine Hysterektomie (Entfernung der Gebärmutter) im 'theatre 1' vorgenommen hatte, und die kubanische Kollegin, die in der Chirurgie arbeitete und gerade eine Operation an der Schilddrüse beendet hatte. Beide tranken Tee und hingen irgendwelchen Gedanken nach. Sie sagten nichts und fuhren schweigend eine lange Strecke ab. Etwas bedrückte sie schwer. Kubanische Menschen schienen gefesselt in ihrem latein-amerikanischen Temperament. Da sprühte nichts mehr in ihnen von innen nach außen. Dr. Ferdinand fiel seit langem auf, dass die kubanischen Kollegen mehr schwiegen, als gäbe es bei ihnen eine Scheu zu reden, eine Angst, sich zu versprechen, zuviel zu sagen, was die parteipolitische Indoktrination ins Wackeln bringen, die Fugen der eingeschworenen Disziplin lockern könnte. Die Angst vor dem Verpfiffenwerden lag ständig in ihren Augen. Denn die kubanischen Kollegen empfanden es als eine Befreiung aus dem drückenden Korsett der Staatsräson mit den Maulkörben, wenn es um die Meinungsäusserung geht, und den zahlreichen anderen Einschränkungen, wenn sie der allmächtige Generalsekretär des ZK der kommunistischen Partei und langjährige Staatspräsident Fidel Castro als Ärzte in ferne Entwicklungsländer schickte. Die Aufschnürung oder Entfesselung aus dem Politkorsett mit dem fidelischen Raketenstoss in die transkontinentalen Lufträume mit dem Anders und dem Mehr an Freiheit kam jedoch nur für geprüfte linientreue Kader für eine begrenzte Zeit in Frage. Die Führungsgremien mit den roten Schreibtischen, den roten Telefonen und den roten Manifesten waren zugleich auch die Speditionszentralen, die Ärzte und andere Akademiker an Länder quasi vermieteten, deren politische Führer den bärtigen Revolutionshelden in Havanna (La Habana) in freundschaftlich-brüderlicher Weise, die vor 1990 unweigerlich mit dem sozialistischen Bruderkuss verbunden war, um Hilfe baten. Da zog der große Fidel die obere Schublade mit den guten humanitären Gesten auf und die darunterliegende, leere Devisenschublade gleich dazu. Man konnte es auf den Reim bringen:
Fidel Castro spielt auf großem Cello,
das dem Pablo, dem großen Casals gehört,
der Castro 'fidelt' sozialistisch seine Melo,
die das Ohr des großen Pablo stört.
Da zeigt es sich, der Fidel hat Probleme mit den Noten,
hat er sie denn nicht gelernt ?
Der alte Pablo fasst sich an die Stirn,
rutscht fast vom Stuhl und ruft mit aller Kraft:
Fidel, halt!, so kann's nicht gehn,
wenn wir auf der großen Bühne stehn,
um zu spielen, vor den Menschen, jung und alt.
Lern erst die Noten, so schwer kann's doch nicht sein,
dann spiel dein Solo vor den Lebenden
und den Toten, spiel dein Solo dann allein!
Dr. Ferdinand erinnerte sich gut an den Kollegen Dr. George, der als orthopädischer Chirurg mit großer Erfahrung und in den besten Jahren auf die Fidel-Tournee oder den Castro'schen Devisentrip mit vielen andern Kollegen nach Namibia geschickt wurde. Dieser Kollege war ein brillanter Operateur und sprach dazu noch ein gebrochenes Englisch. Da gab es doch eine Kommunikation, wenn auch in engen Grenzen, weil Dr. George, nicht anders als die andern kubanischen Kollegen, an seiner Linientreue keinen Zweifel aufkommen lassen wollte. Er wollte als zuverlässiger Genosse gelten und nicht aus der Rolle fallen. Ein Wegrutscher von der offiziellen roten Parteilinie, mochte er noch so versehentlich sein und auf einem bloßen Missverständnis beruhen, konnte die vorzeitige Rückkehr in das Fidel'sche Inselreich bedeuten, was einer Strafversetzung gleichkam. Es dauerte nicht lange, um zu erkennen, dass er wie seine karibischen Kollegen die afrikanische Luft gern und tief atmeten. Warum die Luft hier besser war als über der Schweinebucht oder den baufälligen Prachtalleen von Havanna, Santiago de Cuba oder den verkommenen Armenvierteln von Guantánamo, dazu sagte Dr. George wie die andern kein Wort. Man musste es erraten, dass es da offensichtlich Gründe der persönlichen Unsicherheit gab, von einem der Kollegen, der es noch genauer nahm, bei dem wachsamen Politbeisser der Botschaft verpetzt zu werden.
Es brauchte einige Wochen, bis Dr. George im vertraulichen Gespräch sagte, dass er seine Familie vermisse, die aus finanziellen und Sicherheitsgründen in Kuba zurückblieb. Er zeigte, nachdem weitere Wochen vergangen waren, einige Fotos von seiner Familie und seinem Haus in einer der vornehmen Gegenden Havannas. Da standen vorm Eingang des Hauses seine Frau mit zwei beinahe attraktiven Töchtern, wie sie nach vorne schauten und sich beim Lächeln abzumühen schienen. Das Haus im Hintergrund war nicht besonders groß, das Mauerwerk aber in einem ordentlichen Zustand. Beim Betrachten der Fotos fiel doch ein Wohlstand auf, der sich von der kubanischen Armutsmasse abhob. Es war schon eine Vertrauenssache, wenn ein kubanischer Kollege etwas von seiner Familie und dem täglichen Leben unter Fidel Castro's Regime erzählte. Dem einfachen Volk ging es nicht gut. Die Nahrungsmittel waren für alte Leute und kinderreiche Familien oft nicht erschwinglich, wenn sie überhaupt zu kaufen waren. Weite Zweige der Industrie kamen zum Erliegen. Kuba ist ein Agrarland geworden, in dem die landwirtschaftlichen Staatsbetriebe das Rückgrat sind. Da werden hauptsächlich Zucker und Tabak exportiert. Die Havanna-Zigarre ist ein Exportschlager geblieben. Dagegen ist der Zuckerexport aufgrund der gesunkenen Weltmarktpreise zurückgegangen. Das Benzin ist rationiert. Größere Importe finden wegen fehlender Devisen nicht statt. Man versucht, die riesigen Zuckerplantagen zur Gewinnung von Brennstoff zu nutzen. Was Dr. Ferdinand erst viel später erfuhr, war die Tatsache, dass die Reisepässe aller Kubaner in der Botschaft "sichergestellt" waren und die monatlichen Lohnzahlungen von der Finanzabteilung des Ministeriums direkt an die Botschaft gingen. Von diesen Zahlungen erhielten die Kollegen nur einen kleinen Teil zur freien Verfügung. Der Großteil des Geldes wurde an den kubanischen Staat abgeführt, der durch diese Einnahmen seine Devisenlöcher stopfte.
Einmal im Jahr bekamen die Kollegen Heimaturlaub. Dafür wurde ihnen vom Ministerium des Gastlandes das Flugticket gezahlt und von der kubanischen Botschaft der Reisepass ausgehändigt. Dr. George sagte zu Dr. Ferdinand, dass er auf Urlaub gehe und sich darauf freue, seine Familie wiederzusehen. Als die Maschine in Kanada zwischenlandete, um aufzutanken, verließ Dr. George in einem Überraschungsmanöver seinen Platz, eilte mit dem kubanischen Reisepass in der Hand über das Rollfeld und stellte sich den kanadischen Behörden als politischer Flüchtling. Die Maschine flog ohne ihn nach Havanna weiter, wo andere Kollegen ihre Familien wiedersahen. Dr. George machte seinen amerikanischen Weg von Kanada aus bis nach Florida. Von Miami schickte er nach einem Jahr Dr. Ferdinand eine Karte, auf der er ihm mitteilte, dass es ihm gut gehe und er bei seinem Bruder arbeite, der als Chirurg eine Privatklinik in Miami führe. Da hatte dieser talentierte Kollege seinen Weg in die Freiheit genommen, von dem so viele andere Kubaner noch träumten. Es waren die Träume von der vorenthaltenen Freiheit, die in ihren Augen steckten, wenn sie von den guten Dingen ihres sozialistischen Staates sprachen und gleichzeitig kritisch oder schlecht darüber dachten.
Dr. Ferdinand ging zum 'theatre 2' zurück, wo der nächste Patient, ein sechsjähriges Mädchen zur Korrektur des rechten SpitzFußes auf dem OP-Tisch lag, wo der Narkosearzt von Birma mit der Einleitung zugange war. Er intubierte das Mädchen, schloss den Tubus über die Gasschläuche an den Narkoseapparat an, regulierte das Verhältnis Lachgas zu Sauerstoff zugunsten des Lachgases und drehte den Kopf des Mädchen nach links, als eine Hilfsschwester den Körper auf die linke Seite drehte. Dann säuberte die OP-Schwester den rechten Fuß und Unterschenkel und deckte den Patienten mit sterilen, grünen Tüchern ab. Dr. Ferdinand schnitt die Haut an der Rückseite des Unterschenkels längs an der Außenseite des Verlaufs der Achillessehne ein und stellte die Sehne nach Öffnung der Sehnenscheide über eine Länge von zehn Zentimetern dar. Dann durchtrennte er die Sehne durch einen etwa sieben Zentimeter hohen 'Z'-Schnitt, legte die in der Dicke halbierten Sehnenstümpfe auf eine Länge von einem Zentimeter übereinander und vernähte sie. Nach Verlängerung der Achillessehne um etwa sechs Zentimeter ließ sich der Fuß im oberen Sprunggelenk über den rechten Winkel hinaus bis auf achtzig Grad zum Unterschenkel heben. Dr. Ferdinand dachte beim Vernähen der Sehnenstümpfe an die vielen Kinder mit missgebildeten Füßen, an denen er in den Jahren, die er die afrikanischen nannte, Operiert hatte. Da war der achtjährige Junge mit beidseitigen KlumpFüßen, der nach der Operation normal laufen konnte, oder der Zehnjährige mit dem SpitzFuß links und dem verkürzten spindeldürren rechten Bein nach spinaler Kinderlähmung, der sich an zwei hausgemachten Unterarmkrücken fortbewegte und nach der Operation erstmals seinen linken Fuß normal aufsetzen und belasten konnte, oder der Dreizehnjährige mit dem rechten KlumpFuß, dem eine Mine den linken Arm und den Daumen und Zeigefinger der rechten Hand abgerissen hatte.
Die Wunde wurde verbunden und der Fuß in überkorrigierter Hebestellung eingegipst. Die verfügbaren Gipsbinden waren von schlechter Qualität, dass viele Gipsbinden angewickelt werden mussten, um den Fuß in der gewünschten Stellung zu halten. Da erinnerte sich Dr. Ferdinand an die gute Qualität der Gipsbinden, mit denen das von den Schweizern geführte Lazarett der UNTAG (United Nations Transition Assistance Group) während der Übergangsperiode in die namibische Unabhängigkeit ausgestattet war. Von jenen Gipsbinden genügten wenige, um einen Knochenbruch nach Reposition oder einen korrigierten Spitz- oder KlumpFuß in der gewünschten Stellung ruhigzustellen. Das Mädchen wurde vom OP-Tisch auf die Trage gehoben und in den Aufwachraum gefahren, als der Strom ausfiel und es dunkel nicht nur im Teeraum, sondern in allen OP-Sälen wurde. Dr. Ferdinand setzte sich mit seiner Tasse Tee zu den Kollegen im Teeraum, die bereits ihre Teepause machten und über den Stromausfall ihre Bemerkungen machten. Es waren die Kubaner, die sich miteinander in ihrer Sprache unterhielten, wo es mehr um private Dinge als um die Patienten ging. Dagegen hüllten sich die namibischen Kollegen in Schweigen, als nähmen sie die Dunkelheit als ein Schicksalszeichen widerspruchslos hin. Dann ging doch nach zwanzig Minuten das Licht wieder an. Der Strom kam nun aus den Dieselgeneratoren, die vor einigen Monaten gewartet und repariert wurden, so dass die Arbeit in den Sälen wieder ausgenommen wurde. Die kubanische Kollegin von der Chirurgie diskutierte einige Operative Aspekte mit dem Leiter der Abteilung, während Dr. Ferdinand zum 'theatre 2' ging, um die Operation am Patienten mit der Ellenbogenfraktur vorzunehmen. Die anderen Kollegen im Teeraum saßen so lange, bis sie von den Schwestern zu den OP's gerufen wurden. Diese Sitte der Sitzfleischbequemlichkeit hatte es früher nicht gegeben. Da halfen die Ärzte den Schwestern beim Rüberheben der Patienten von der Trage auf den OP-Tisch und nach der Operation auf die Trage zurück. Der Sitzdrang und die Sitzfleischbequemlichkeit setzten erst mit der Unabhängigkeit und der neuen Freiheit ein. Sie arteten mittlerweile zur Unsitte aus. Da konnte man mit gutem Grund fragen, wo denn das Interesse und der Einsatzwille für den Patienten geblieben war. Diese Frage galt insbesondere den namibischen Kollegen, die aus dem Exil zurückgekehrt waren. Denn diese Kollegen hätten durch ihre Vergangenheit besonders sensibel für die Not der Menschen und somit motiviert für die Arbeit an den Patienten sein sollen.
Doch entwickelte sich gerade bei diesen Kollegen der Wunsch nach einem 'Office' mit gutgehender Klimaanlage. Sie wollten mehr administrativ als direkt am Patienten arbeiten. Das Administrative hatte für sie und ihre berufliche Karriere offenbar die größere Bedeutung. Diese Einstellung zur ärztlichen Tätigkeit erklärte mitunter manuelle Ungeschicklichkeiten mit linkischen Bewegungselementen, als gäbe es keinen rechten, sondern nur zwei linke Daumen. Das drückte sich in den Operativen Fächern besonders negativ aus, wenn es darum ging, eine spritzende Blutung zum Stehen zu bringen oder andere lebensrettende Massnahmen in Notsituationen zu ergreifen, die grundsätzlich keinen Raum zur Überlegung geben, ob der Arzt sich dabei "schmutzig" macht oder nicht. Für diese Art von Überlegungen, die meist nichts anderes als unethische Saubermannsvorbehalte sind, sich die Hände und Kleidung weder blutig noch anderweitig schmutzig zu machen, ist für einen Arzt in der Wirklichkeit des Helfens weder Raum noch Zeit, besonders dann nicht, wenn es um die Rettung eines Lebens geht. Dr. Ferdinand stellte sich bei solchen Beobachtungen oft die Frage, wie denn diese Kolleginnen und Kollegen im Exil ihr ärztliches Handwerk verrichteten, wenn da Not am Mann oder ein Freiheitskämpfer vor dem Verbluten zu retten war. Da musste doch schnell gehandelt werden. Sicherlich waren die meisten der jungen Kollegen noch an den Universitäten in der Sowjetunion und den anderen Ostblockländern, um das medizinische Handwerk zu erlernen. Einige von ihnen studierten sogar in den skandinavischen Ländern oder den USA. Sie alle wollten Ärzte werden, um am kranken Menschen zu arbeiten und in Notfällen das Leben zu retten. Da musste doch Hand an den Patienten gelegt werden, besonders wenn ein PLAN-Kämpfer (People’s Liberation Army of Namibia) mit einem abgerissenen Arm oder Bein oder sonst einer blutenden Wunde ins Lazarett gebracht wurde. Oder waren es die Ärzte aus der DDR und den anderen sozialistischen Bruderländern, die in Angola diese Arbeit taten, wenn es um schwere Verwundungen und das hohe Lebensrisiko ging?
Mit diesen Gedanken ging Dr. Ferdinand zum 'theatre 2' zurück, um die folgende Operation, eine Amputation des rechten Oberschenkels durchzuführen. Es war ein noch jüngerer Mann, der bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde und dabei das rechte Bein abgequetscht hatte. Die Durchblutung des Beines war hochgradig gestört. Der Haut des Unterschenkels war dunkel und fühlte sich kalt an. Eine Rekonstruktion der gebrochenen Knochen kam somit nicht mehr in Frage. Der Patient war bereits intubiert und an den Narkoseapparat angeschlossen. Die OP-Schwester hatte das Bein mit der braunen Desinfektionslösung gesäubert und deckte den Körper mit den sterilen grünen Tüchern so ab, dass nur das rechte Bein sichtbar war, dessen Unterschenkel bis zum Knie in ein grünes Tuch eingewickelt war. Dr. Ferdinand trocknete sich Hände und Unterarme ab und ließ sich den grünen OP-Kittel überziehen. Er trat an den OP-Tisch heran, als er den Handschuh über die rechte Hand streifte. Der philippinische Kollege stand ihm gegenüber. Die OP-Schwester reichte das Skalpell für den Hautschnitt, als ein junger Kollege, der an der Lumumba-Universität in Moskau sein Arzt-Diplom bekam, den Grund der Beinamputation wissen wollte. Dr. Ferdinand erklärte es ihm in kurzen Zügen, während er den Fischmaulschnitt setzte. Der junge Kollege hatte Schwierigkeiten, das Ausmass der Durchblutungsstörung zu verstehen. So fragte er, ob es zur Amputation keine Alternative gab, die zur Wiederherstellung einer ordentlichen Durchblutung führte. Dr. Ferdinand strengte sich an, ihm die Gründe plausibel zu machen, warum es für die Amputation keine Alternative gab. Der junge Kollege machte noch einige theoretische Bemerkungen, aus denen recht mangelhafte Kenntnisse auf dem Gebiet der Physiologie und Pathologie des Blutkreislaufs herauszuhören waren. Da entschuldigte sich Dr. Ferdinand damit, dass er sich nun auf die Operation konzentrieren müsse, wo er dabei war, die großen Blutgefäße unterhalb der Leiste abzubinden und zu durchtrennen sowie die großen Beinnerven zu kürzen. Der assistierende Kollege und die OP-Schwester mühten sich ab, um die Operation zum baldigen Abschluss zu bringen. Beim Ansetzen der oszillierenden Säge zum Durchtrennen des Oberschenkelknochens versagte der nötige Luftdruck in der großen Stahlflasche, so dass eine volle Druckluftflasche gebracht und angeschlossen wurde. Dr. Ferdinand befürchtete aufgrund seiner wiederholt gemachten Erfahrung, dass es keine volle Flasche mehr gäbe und die Knochendurchtrennung mit der Handsäge zu erfolgen hatte, wobei er schon einige Male ins Schwitzen kam, weil es keine vernünftige Knochensäge zur Handbedienung gab. Nach Anschluss an die neue Flasche setzte er die oszillierende Säge an und durchtrennte den langen Röhrenknochen problemlos am Übergang vom oberen zum mittleren Schaftdrittel. Die letzten Hautnähte waren gesetzt. Dr. Ferdinand wickelte den Verband über den Beinstumpf und hob den Operierten mit dem philippinischen Kollegen und einer Schwester vom OP-Tisch auf die Trage. Der junge Kollege mit dem Moskauer Arzt-Diplom sah sich die ganze Prozedur bis zum Ende an. Dabei kam ihm nicht der Gedanke, seine Hände und Muskelkraft zum Rüberheben des Patienten zur Verfügung zu stellen oder zumindest anzubieten.
Es war Mittagszeit. Dr. Ferdinand dankte dem Team für die gute Zusammenarbeit und verließ das 'theatre 2'. Im Umkleideraum zog er das durchschwitzte OP-Hemd von der klebrigen Haut, warf es zusammengeknüllt in den schon vollen Wäschesack, rieb sich den Schweiß von der Haut und zog sich das Zivile an. Im 'Nurses tea room' saßen einige der OP-Schwestern und Hilfsschwestern und assen ihr Fleisch mit Reis oder Mahangu-Papp und einem Ei. Andere waren frühzeitig genug in die Kantine gegangen, um dort die warme Mahlzeit einzunehmen. Nach der Unabhängigkeit wurde darauf geachtet, die Mahlzeiten pünktlich und ausführlich einzuhalten. Da mussten Operationen von der Liste gestrichen und auf den nächsten Tag verschoben werden, wenn sie mit den Pausenzeiten kollidierten oder die Möglichkeit einer solchen Kollision bestand. Die Einstellung zur Arbeit war auf dieses Mass abgerutscht, um pünktlich die Tee- und Mittagspause anzutreten. Diese Einstellung sicherte auch die pünktliche Beendigung der Arbeit innerhalb der offiziellen Schichtzeit. Es waren meist dieselben Schwestern, die schon während der letzten Stunde die Arbeit einstellten und irgendwo unauffällig im Saal auf die Ablösung warteten. Im Wandel der Zeit war das einst Großartige verlorengegangen. Es gab es nicht mehr: die hohe Motivation und Selbstlosigkeit, dem Menschen in der Not zu helfen. Nun schauten die Krankenpfleger und Schwestern, und mit ihnen die Matronen, auf die Uhr, um es mit der Arbeit nicht zu "übertreiben". Da hat es menschlich einen Knacks gegeben, von dem sich der Pflegeberuf nicht mehr erholt hat. Und die Patienten spürten es. Mit der ethischen Verkümmerung ging eine allgemeine Zunahme der Körpergewichte einher, die in einigen Fällen so extrem war, dass das Bücken beschwerlich und das zügige Gehen unmöglich wurde. In Einzelfällen kam es zu derartigen Verfettungen, dass über Rücken-, Hüft- und Kniegelenksschmerzen geklagt wurde. Diese Schmerzen waren zweifellos glaubhaft und führten in einigen Fällen zur Arbeitsuntauglichkeit. Da gab es mitunter Versetzungen in eine sitzende Tätigkeit. Der vakante Pflegeposten im Krankensaal wurde dann mit einer jungen Schwester aufgefüllt, die gerade ihr letztes Examen in der Krankenpflegeschule bestanden hatte. In anderen Fällen, wo eine Versetzung von der stehenden Pflegetätigkeit am Patienten in eine sitzende Kontrolltätigkeit über die arbeitenden Pflegekräfte und die Utensilien nicht möglich war, weil die Sitzstellen erschöpft waren, traten dann eine Vielzahl von Problemen auf, die von Krankmeldungen und den ständigen Verlängerungen bis zum Antrag auf Frührente reichten. Da verwunderte es in einigen Fällen, dass es Schwestern gab, die die Rücken-, Hüft- und Knieschmerzen ausschließlich auf ihre Pflegetätigkeit zurückführten und vom eigenen Übergewicht nichts wissen wollten. Dass mit zunehmendem Appetit die Leistung und Qualität der Arbeit am Patienten sank, das war ein bedenkliches Phänomen der Zeit. Es war Ausdruck der Schwäche und Zügellosigkeit, wo Disziplin auch beim Essen gefordert war. Das hatte nicht nur ernste Folgen für die Patienten, sondern auch für die betroffenen "Übergewichtler" und ihre Familien. Bei den meisten der Betroffenen kamen die Kreislaufprobleme mit dem hohen Blutdruck, dem Schwindelgefühl und Kopfschmerz noch dazu.
Dr. Ferdinand nahm den Weg zum Speisesaal und ging an der Tür zum Sekretariat vorbei, die weit offen stand. Im Sekretariat saßen alte Menschen und warteten darauf, mit dem Superintendent zu reden. Die Schreibmaschine stand verwaist auf dem kleinen Schreibtisch. Die Sekretärin war, wie es für alle Schreiberlinge von jeher Sitte war, pünktlich zum Mittagstisch gegangen. Diese Angestellten legten mit Pausenbeginn den Schreibstift zur Seite, egal, ob der Satz, wenn es einer werden sollte, beendet war oder nicht. Sie hielten die Pausenzeiten oft mehr als genau ein, wenn sie dann mit einer halbstündigen oder längeren Verspätung an ihren Schreibtisch zurückkehrten und unmotiviert in der Nase bohrten oder irgendetwas auf einem Papier zurechtkritzelten oder den Bleistift solange spitzten, bis es nichts mehr zu spitzen gab. Diese auf Bequemlichkeit beim Sitzen ausgerichteten und auf eine gut funktionierende Klimaanlage angewiesenen Schreiberlinge, von denen keiner bei der Arbeit schwitzte, hatten durch ihr stumpfes, gelangweiltes Verhalten keinen direkten Einfluss auf das Befinden der Patienten.
Der Laborant war zum Labor zurückgegangen. Die Tische hatten sich geleert. Wie so oft war Dr. Ferdinand der letzte Esser, der über seinem Teller saß, am hartgekochten Fleischlappen säbelte, es schließlich unschneidbar zur Seite schob, auch den Reis nicht ganz schaffte, obwohl er nicht versalzen war, und "genüsslich" das gekochte Fruchtfleisch aus den Pumpkinschalen gabelte. Seine Gedanken streiften die Vergangenheit, wo es zwar einen Teufel gab, der als junger Arzt in Uniform mit sauber eingeschobenem Barett unter der rechten Schulterklappe eines Leutnants verkleidet war, der einem in böser Absicht nachstieg und seine infamen Intrigen dem Major-Superintendent oder dem Colonel und ärztlichen Direktor, alle geschniegelt in stets gebügelter Uniform, zuspielte. Doch gab es zu jener Zeit noch den Geist des wirklichen Helfenwollens unter Einsatz des ganzen Menschen für den Menschen in Not, der in der Rechtlosigkeit verelendet und unter der weißen Apartheid verzweifelt und krank geworden war. Es war Krieg, und die Granateneinschläge erschütterten das Hospital, dass der Instrumententisch durch den OP rollte und die Instrumente auf ihm klimperten, es in den Decken knackte und die Türen im Schloss klapperten, dann auf und zu schlugen. Die Detonationen waren so stark, dass Fensterscheiben platzten, Wände in den Sälen rissen, die Tür zum privaten Untersuchungsraum in der 'Intensiv'-Station verklemmte, Dr. Lizette vom Drehstuhl im 'theatre 2' rutschte und Dr. Nestor, als er der erste schwarze Superintendent noch vor der Unabhängigkeit war, während einer Morgenbesprechung an einem Freitag fast aus dem Drehstuhl hinter dem großen Schreibtisch gekippt wäre. Dass es bei solchen Detonationen, die jeden in Angst und Schrecken versetzten, nur wenige Ärzte am Hospital gab, ist verständlich. Denn nicht nur Politiker mit ihren "großen" Reden zogen ein Leben in Ruhe und Sicherheit den Unbilden des Krieges und seinen unmittelbaren Gefahren für die eigene Person vor. Ähnliches galt auch für Ärzte, Anwälte und andere Intellektuelle. Wer es machen konnte, hielt sich da persönlich raus, wo es knallte und krachte, und überließ die Krachzone mit den Granateinschlägen den andern, die sich eben nicht selbst helfen konnten. Das Schlachtfeld mit dem Risiko des persönlichen Abgeschlachtetwerdens wurde von jeher den andern zugeschoben. Das Geld bestimmte, wo das Schlachtfeld errichtet wurde. Je stärker die Macht des Geldes war, desto weiter entfernt war das Schlachtfeld und umso grausamer für die, die arm geblieben waren und sich nicht verdrücken konnten.
Dr. Ferdinand erinnerte sich noch gut an die letzten Jahre der weißen Herrschaft. Da gab es eine Zeit, in der es ganze elf Ärzte am Hospital gab, die einer Bevölkerung von etwa 600 000 gegenüberstanden, hoffnungslos überfordert waren und trotzdem unter Einsatz des persönlichen Lebens Tag und Nacht an den Patienten arbeiteten. Es war die Zeit der heftigsten Granateneinschläge, als täglich die Verletzten mit abgerissenen Armen und Beinen, blutenden Köpfen und Bäuchen ins Hospital gebracht wurden. Die Patienten waren verängstigt und verzweifelt. Sie griffen nach jedem Halm der geringsten Hoffnung und waren für die Hilfe dankbar, die ihnen im Hospital gegeben wurde. Die wenigen Ärzte waren erschöpft und doch zufrieden, dass sie helfen konnten, soweit es in ihrer Macht stand.
Dr. Ferdinand blickte auf seine Hände, deren Finger in dieser Granatenzeit vom ständigen Händewaschen und Operieren verwundet und oft verbunden gewesen waren, damit er als Chirurg weiter arbeiten konnte. Dieser große Geist der Hilfe mit der vollen Opferbereitschaft für den Menschen in Not war mit der Unabhängigkeit und der neuen Freiheit dahingeschwunden, hat sich in Luft aufgelöst, als gäbe es keine Menschen in Not und in Elend mehr. Wohin auch immer dieser Geist geschwunden war, er war unwiderruflich weg, obwohl es weiterhin genug Menschen gab, die in Not und Elend waren und in ihrer Armut versanken.
Der Küchenwärter räumte die geleerten und nicht geleerten Teller sowie die gebrauchten Kaffeetassen mit den Resten der Süßchemie vom Orangengeschmack von den Tischen. Es war der freundliche Wärter, der den Dr. Ferdinand vielleicht ins Herz geschlossen hatte, wenn er vom "goeie duitse man" sprach. Wie so oft brachte er die große Blechkanne mit frisch gebrühtem Tee der Marke 'rooi bos', aus der die acht Beutelfäden mit den kleinen Markenschildchen außen herunterhingen, setzte eine saubere Kaffeetasse mit Untertasse und Teelöffel vor die Kanne, schob die blecherne Zuckerdose neben die Tasse und legte links neben die Kanne noch zwei grüne Äpfel auf den Tisch. Das war Ausdruck seiner Sympathie, wie er sie die Jahre vor der Unabhängigkeit diesem Doktor gegenüber bekundete. Da hatte sich nichts verändert, so wie sich an der Qualität des Essens nichts verändert hatte, die weiterhin zu wünschen übrigließ. Es war eben das Essen für die Patienten und das normale Fußvolk der Ärzte, Schwestern, Laboranten und Verwaltungsleute. Für diese Leute sollte die Qualität genügen. Wie anders war dann das Essen für die Politiker und geladenen Gäste anlässlich des Staatsbesuches der britischen Königin, wo es bereits Menschen mit breiten, kurzen Hälsen und ausladenden Bäuchen und Ärschen gab, die da die Teller vollschaufelten und das ein zweites Mal taten, als könnten sie vom guten Essen nicht genug kriegen. Bei diesem Bankett, wo am Kopftisch die Königin neben dem Präsidenten der Republik und ihrem Gemahl, dem Prinzen Philip mit der schütteren, grauen Kopfbehaarung, saß, der Außenminister der Republik saß links neben dem Präsidenten, wurde an die hungernden Menschen und verhungernden Kinder in keiner Weise gedacht. Da konnte man sagen, was man wollte. An den übervollen Tellern und der Art des Essens, das mitunter an Fressallüren herankam, war klar und eindeutig zu erkennen, dass es diesen Menschen um das Ab- und Vollfüllen der eigenen Mägen ging, die bei einigen Männern der Politik und großen Reden tierische Ausmaße haben mussten. Da gab es nichts zu beschwichtigen, aber auch nichts zu entschuldigen. In den Räumen und Sälen der Politik bogen sich die Tische und der Last des guten Essens. Da durfte nicht gehungert werden, und da wurde nicht gehungert. In allen anderen Räumen und Sälen, und wenn es die für die Patienten waren, nahm es die Politik mit dem Hungern nicht mehr so gewissenhaft ernst. Da sah es meist und in der Regel anders, meist dürftig aus. Da waren die Tische, wenn es da überhaupt welche gab, leer oder mit jenen Resten bekleckert und bedeckt, die von den großen Rednern und nicht minder großen Essern zurückgelassen wurden. Am hungrigsten sah es dort aus, wo es weder Räume noch Säle gab. Da waren die Menschen halt von allen Geistern und guten Sprüchen verlassen und auf sich allein gestellt, wenn sie vor sich hin hungerten, eingefallene Gesichter und große Augen, Wasserbäuche auf stelzigen Beinen bekamen und das Leben nicht mehr schafften. Das war für alle Menschen frühzeitig genug erkennbar, die es sehen wollten und sich vor dem Anblick armer und hungernder Menschen nicht scheuten. Bei diesem traurigen Anblick waren auch die Politiker nicht ausgenommen. Denn jeder hatte beim Anblick hungernder Menschen und verhungerter Kinder Grund genug sich in Grund und Boden zu schämen. Im Wissen um den Hunger in der Welt war es doch das Mindeste, wenn es noch so etwas wie Anstand und Gewissen gab, die Disziplin beim Essen einzuhalten und sich nicht zu überfressen, solange vor der eigenen Tür abgemagerte Menschen anklopfen und nach etwas Nahrung fragen. Dr. Ferdinand kamen bei der Betrachtung des großen Hungers in der Welt die Kinderplastiken mit den Wasserbäuchen auf den spindeldürren Stelzbeinen in den Sinn, die man den Fresssäcken auf die vollen Tische knallen müsste, damit das Fressen einmal aufhörte. Die Hungerplastiken sollten die übervollen Tische zerschlagen, damit Ordnung eintritt und dem Wort, auch wenn es beim Beten ist, die Scheinheiligkeit entzogen wird. Das Wort sollte zur Tat werden, für die hungernden Menschen wirksam zu sorgen, das Essen mit ihnen zu teilen und für sauberes Trinkwasser und den nötigsten Schutz für das Leben der Armen zu sorgen.
Dr. Ferdinand erinnerte sich gut an die Notiz, die er am Abend des Tages auf einem Papier vermerkte, nachdem er mit dem freundlichen Chirurgie-Professor aus Pretoria einige Kwashiorkor-Kinder auf dem Hospitalgelände betrachtet hatte. Die Kinder hatten eingefallene, alt aussehende Gesichter, aus denen große Augen hilflos schauten. Sie trugen ausladende Bäuche vor sich her, auf die sie ihre spindeldürren Hände und Unterarme legten. Die aufgedunsenen Bäuche waren so prall mit Wasser gefüllt, dass sich diese Kinder kaum auf ihren spindeldürren Beinen halten konnten und meist auf dem Boden saßen, schwer atmeten und buchstäblich auf ihr Ende warteten. Beide waren vom Anblick dieser Kinder zutiefst erschüttert. Der Professor fügte hinzu, dass er so viele Kinder mit Wasserbäuchen auf einmal noch nicht gesehen habe. Als Dr. Ferdinand die Notiz machte, konnte noch niemand den Zeitpunkt des Eintritts der lang ersehnten Unabhängigkeit vorherbestimmen:
Ihr, die ihr dasteht in eurer Armseligkeit
nackt und abgemagert, spindeldürr
mit Wasserbäuchen auf stelzigen Beinen,
Menschen seid ihr wie der Mensch ist,
den der andere vergisst, aufgegeben hat,
der sich selbst den Magen vollschlägt,
sich um die eigne Achse dreht,
dem das Fett vom Munde trOPft,
als sei er ein triefender ButterTopf,
in dem nichts weiter als Butter ist.
Ihr mit den großen Augen,
die ihr mitten im Unglück steht,
wisst, was euch erwartet,
doch wisst ihr nicht,
dass es die Buttertöpfe wissen,
die sich weiter tropfen lassen,
sich nur um die Butter kümmern,
nicht aber um die Menschen
mit den leeren Mägen.
Ihr steht da und hofft vergebens,
weil da nichts kommt,
was längst hätte kommen müssen.