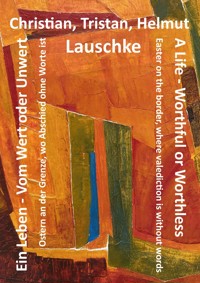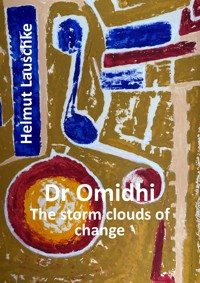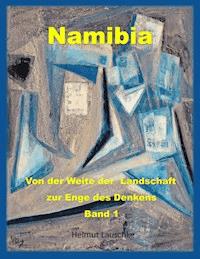
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Die Zeiten hatten sich verschlechtert, und die Front der Ablehnung zwischen der schwarzen Bevölkerung und der weißen Besatzungsmacht hatte sich verhärtet. Jeden Tag gab es Tote und Verletzte, und ihre Zahl nahm weiter zu. Die Koevoet - was 'Brecheisen' bedeutet - walzte die Krale platt, wenn der Verdacht bestand, dass sich ein SWAPO-Kämpfer dort versteckt hielt, beziehungsweise versteckt halten könnte. Die Jugend machte es nicht mehr mit, dass Menschen mit der schwarzen Haut weniger wert sein sollten als jene mit der weißen Haut. Viele junge Menschen verließen das Land, um aktiv am Befreiungskampf teilzunehmen. Sie bildeten die Schicksalsgemeinschaft, die enger und stärker war als in der Schule durch die Unbedingtheit der Disziplin und des gegenseitigen Vertrauens. Brot und Wasser wurden wie alles andere geteilt, und die Kameradschaft der gegenseitigen Hilfe wurde als unabdingbar vorausgesetzt. Die Erkenntnis kam, dass aus einer solchen Gemeinschaft die unbezwingbare Kraft erwächst, mit der das Ziel der Befreiung zu erreichen war. Es war eine lange Fahrt in den hohen Norden Namibias unweit der angolanischen Grenze. Die Sonne hatte den Teer der Straßendecke weichgebrannt, sodass die Reifen den monotonen Klebeton über hunderte von Kilometern summten. Nach zweihundertfünfzig Kilometern gab es in Otjiwarongo eine kurze Pause. Schweißgebadet ging ich in den Supermarkt an der Straße und kaufte eine Flasche Mineralwasser, die ich aus dem Kühlschrank nahm und in wenigen Zügen leerte. Beim Betasten der Reifen verbrannte ich mir die rechte Hand, an dessen Fingern der heiße Teer kleben blieb. Auf der Fahrt in den Norden stellte ich mir die Frage, ob ich den gewaltigen Anforderungen unter den völlig neuen klimatischen Bedingungen überhaupt gewachsen bin. Und das um so mehr, als es galt, die Chirurgie und Traumatologie an einer unübersehbaren Zahl von Patienten und Verletzten zu betreiben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 920
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Lauschke
Namibia - Von der Weite der Landschaft zur Enge des Denkens
Band 1
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Namibia – Von der Weite der Landschaft zur Enge des Denkens
Band I
Ein erster Rückblick
Die letzten Jahre der Apartheid
Medizin inmitten des Krieges
Charakter gegen Charakterlosigkeit; vom interkontinentalen Genpool
Gesichter und Gespräche im International Guesthouse
Der erste Arbeitstag für Dr. Ferdinand
Der Intrigant und das Verhör
Jahre der Entscheidung
Perspektiven in die Zukunft
Aus den Tiefen der Daseins- und Glaubenskonflikte
Von großen Ärzten und ihrer Menschlichkeit in der schweren Zeit
Die orthopädische Arbeit an verkrüppelten Menschen
Die Dorfsirene heult
Anhang
Impressum neobooks
Namibia – Von der Weite der Landschaft zur Enge des Denkens
Band I
Den Menschen, die in der schwersten Zeit Menschlichkeit zeigten und Vorbild waren, zum Dank.
Ihr steht da und hofft vergebens, weil da nichts kommt, was längst hätte kommen müssen.
Im Gedenken der Kinder, die ihre Väter oder Mütter oder beide verloren haben, der Kinder, die vor Hunger Steine schluckten, der Kinder mit den Wasserbäuchen auf stelzigen Beinen und den großen Augen, die das Leben nicht mehr packten, der vielen Kinder, die die Minen in der Luft zerrissen, denen, weil sie überlebten, Arme und Beine abgeschnitten wurden, der Kinder, denen die Geburt den Nachteil brachte, und jener, die es zur Geburt nicht schafften.
Ein erster Rückblick
Jahre später, es war an einem Junidienstag, sollte Dr. Ferdinand endlich begreifen, dass das Leben auch für ihn seine Grenzen hatte. Es waren persönliche Gründe, dass er vor gut dreißig Jahren den Jahreswechsel in dem afrikanischen Land, das noch den alten Namen "Südwest-Afrika” trug, mit dem Gefühl höchster Einsamkeit verbracht hatte. Menschen, mit denen er zusammen war und sich als Freunde ihm gegenüber bekannten, sprachen vom guten Leben, das sie führten, und vom Wohlstand, zu dem sie es gebracht hatten, und Dr. Ferdinand es auch bald bringen werde. Diese Gespräche, zu denen Kaffee und Kuchen oder südafrikanische Weine aufgetischt wurden, offenbarten die aufs Materielle zusammengeschrumpfte Sichtweise dieser Erfolgsmenschen, denen es an geistigen Inhalten in erschreckendem Maße fehlte. Sie konnten es nicht erfühlen, was in seinem Herzen vorging. Ihre Oberflächlichkeit berührte ihn nicht. So blieb er innerlich allein. Doch Windhoek war nur die erste Zwischenstation, die er nach wenigen Tagen in Richtung Norden verlassen sollte.
Es war die Bundesrepublik Deutschland der achtziger Jahre, wo Dr. Ferdinand in einer kleinen Stadt im Flusstal der Lahn, die sich zwischen den Hügelketten des Taunus und Westerwalds in kurzen Kurven entlangschlängelt, als Chirurg und Unfallarzt in einem Krankenhaus tätig war, dessen erstes Fundament auf die Töchter des Reichsfreiherrn Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein, geboren am 26. Oktober 1757 in Nassau an der Lahn, zurückging. In diesem Tal mit seiner dahinfließenden Idylle hielten sich in großer Zahl jene Menschen auf, die die Ausübung ihrer Berufe mehr oder weniger abgeschlossen hatten. Menschen, die das Leben in Ruhe zu Ende gehen wollten, waren auch jene, die die Großzahl der Patienten von Dr. Ferdinand ausmachten.
Die letzten Jahre der Apartheid
Im Norden des Landes, wohin ihn Dr. Witthuhn in seinem Wagen als Superintendent eines dortigen Krankenhauses in einer Tagesfahrt über die siebenhundertdreißig Kilometer lange, kochendheiße Teerstrasse gebracht hatte, wo die afrikanische Sonne erbarmungslos sengte, war alles anders. Das Hemd mit weit geöffnetem Kragen war schweißdurchtränkt und klebte widerspenstig auf der Haut, als Dr. Ferdinand mit dem unwohlen Gefühl der Trockenheit im Munde den Eingang betrat, dessen Türen aus den oberen Angeln herausgebrochen waren und den Durchgang halb versperrend spitzwinklig gegen die Seitenwände lehnten. Ungewöhnlich war für ihn der penetrante, atemberaubende Uringestank, der ihm beim Betreten des Hospitalgeländes entgegenschlug. Seine Schritte wurden schneller, als wäre er in großer Eile. Doch diesem Gestank konnte er nicht entrinnen, auch nicht bei dem kurzfristigen Versuch, den Atem anzuhalten.
So kam es, dass Dr. Ferdinand seiner Begleitung fast entschlüpfte, durch den Eingang eilte und in einer hitzekochenden Halle stehenblieb, in der Menschen auf dem Boden wie verdrückte Trauben hockten, saßen und lagen und sich in ätzenden Schweißgerüchen verballten. Da bewegte sich kein Lüftchen, und die Menschen warteten geduldig auf einen Arzt. Der Anblick nahm ihm fast die Luft, denn so etwas hatte er noch nicht gesehen. Dr. Witthuhn, der Superintendent des Hospitals, folgte ihm mit auffallender Gelassenheit und ging mit der Sicherheit des Instinkts zwischen den menschlichen Knäuels, die das Gefühl der Trostlosigkeit erweckten, hindurch und zielsicher auf den fast verloren dastehenden Kollegen zu, um ihn mit den Gegebenheiten bekannt zu machen. “Es ist alles nicht so schlimm”, brummte Dr. Witthuhn vor sich hin und nahm den Kollegen am Arm und bahnte sich einen Weg durch die wartenden Menschenmassen, um ihm den Operationsraum im ‘Outpatient department’ zu zeigen. Dr. Ferdinand bahnte sich den engen Pfad zwischen Menschentrauben hindurch, über denen eine schwere Wolke scharfer Schweißgerüchen stand. Dieser Pfad war gesäumt von barfüßigen Müttern mit den Gesichtern der Hilf- und Trostlosigkeit, die abgemagerte Kinder mit großen Augen auf den Armen hielten, wenn sie nicht, weil völlig erschöpft, mit einem Tuch hochgebunden auf den Rücken der Frauen und anderer kindlicher Begleitpersonen wie der nur wenige Jahre älteren Schwestern schliefen. Der Pfad war auch gesäumt von alten Männern und Frauen in dürftiger, oft zerrissener Körperbedeckung. Ihre Gesichter schienen bereits zu erkennen, was dem diesseitigen Dasein abgekehrt war; manche von ihnen trugen hochgradige Zeichen der Abmagerung und Entkräftung mit den spindeldürren Armen und Beinen, einer gespensterhaften Fleischausdünnung bis aufs Skelett.
Es gab Kinder in diesen Trauben, die weinten; andere schrien vor Angst oder Schmerz, wieder andere lagen mit ihren Mündern an den schlaff herabhängenden Brüsten ihrer von Zweifel und Armut gezeichneten Mütter. Daneben gab es Männer und Frauen, die ihre Hände oder Füße bei der Feldarbeit verletzt, von einem Skorpion oder einem tollwütigen Hund gebissen wurden, oder jene, die durch unfreundliche Akte anderer Menschen an den Augen oder sonst wo verletzt waren. Der Gang durch die dichten Menschentrauben mit den Schweißgerüchen und Gesichtern, in denen das Leid stand, war ein erstes erschreckendes Erlebnis für Dr. Ferdinand. Es war ein erster Gang durch eine ihm vom Ausmaß her unbekannte menschliche Armut und Not hindurch bis zu der reichen Erkenntnis, die später folgen sollte, wie vielseitig und prägend der Alltag an dem war, was dem Leben alles fehlte, und wie der Mangel über Generationen ihr Leben ausgeformt hatte. Der Pfad zwischen den wartenden Menschen hindurch wurde noch enger, je mehr sie sich der Stelle näherten, auf die Dr. Witthuhn mit seiner hochgestreckten linken Hand zeigte und die der Operationsraum zur ambulanten Wundversorgung sein sollte. Auch hier, wie schon am Eingang zum Hospital, waren die Türflügel von den harten Schlägen vergangener Jahre zerschunden; der linke Flügel war aus den Angeln gerissen, und das Glas im rechten Türflügel war zerschlagen. Spitz ragten messerscharfe Scherben aus dem Glasrahmen heraus.
Der erste flüchtige Blick erkannte einen völlig veralteten Operationstisch, vom Typ Heidelberg, wie ihn sein Vater schon hatte, der deutliche Rostflecken aufwies, und an dessen Halterungen der Nickelüberzug zum großen Teil abgeblättert war, so dass der rostgebräunte Stahl zum Vorschein kam. Ein junger Arzt in der Uniform der südafrikanischen Armee machte sich an ihm zu schaffen, um eine Handverletzung eines auf dem Tisch liegenden jungen Mannes, dessen Gesicht vom Schmerz verzerrt war, zu versorgen. Da eine an der Wand befestigte Klimaanlage nicht arbeitete, grenzte der Hitzegrad ans Unerträgliche. Von den sieben Lichtkreisen der schief über dem Tisch hängenden Operationslampe waren drei erleuchtet. Es wunderte nicht, dass dem jungen Militärarzt der Schweiß im Strahl von der Stirn tropfte. Ihm zur Seite stand eine junge Schwester mit dem Gesicht einer schwarzen Madonna, die ihm behende Skalpell, Schere und Pinzette, welche teilweise von einer Rostpatina überzogen waren, von einem dürftig bestückten Instrumententisch reichte, dessen Rollen jede Bewegung quietschend bremsten. Eine ältere Frau mit einem Mädchen auf den Schenkeln saß auf einem gebrechlichen Stuhl mit wackelnder Lehne auch in diesem Raum. Es konnte eine Pflegeschülerin gewesen sein, die sich fast unbeholfen damit abmühte, dem Mädchen einen Fußverband anzulegen. Die Enge des Raumes, in die sich die wartende Menschentraube langsam vorschob, und die atemnehmende Hitze mit der raumfüllenden Palette penetranter Schweißgerüche nahmen zu, so dass Dr. Witthuhn seinem Kollegen vorschlug, den Rückweg anzutreten, um ihn durch die chirurgischen Stationen zu führen. “Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wo unsere Patienten liegen.” Der Rückweg war noch beschwerlicher, da die Menschen in der Hoffnung auf eine baldige Behandlung noch enger gestaut standen. Denn mit Sonnenuntergang trat das Ausgehverbot in Kraft, das bedeutete, dass sie den Heimweg nicht mehr antreten konnten. Nachdem sie die dichte Menschentraube durchschritten hatten, als hätten sie sich einen Pfad durch den dichten Dschungel zu schlagen, waren sie draußen auf einem von Rissen durchsetzten betonierten Gang gelangt, der durch eine Überdachung von der erbarmungslosen Strahlung der sich neigenden Sonne auf halber Breite verschont war. Dr. Witthuhn, breitschultrig mit hervortretendem Bauch, wischte sich den Schweiß von der Stirn. “Gleich werden Sie sich selbst ein Bild machen können von dem, was unsere Ärzte und Schwestern leisten”, sagte er mit rückwärts gewandtem Kopf dem ihm folgenden Kollegen, während sie Patienten mit Kopf- und Armverbänden und andere passierten, die sich an selbstgefertigten Krücken unbeholfen vorwärts bewegten. .
“Jetzt folgen wir der blauen Linie.” Dr. Witthuhn zeigte auf einen vom Wetter verblichenen, ins irgendwo hinziehenden, blau gewesenen Strich, der neben nicht weniger blassen roten, grünen und gelben Strichen links auf dem von Rissen durchsetzten Betonboden verlief. “Diese Striche sind Wegweiser. Sie führen zu den verschiedenen Stationen und erleichtern den Patienten und ihren Angehörigen das Finden”, fügte er hinzu. Es war also der blaue Strich, den Dr. Ferdinand ins Auge nahm, als er Patienten, die sich kaum auf den eigenen Beinen halten konnten, Müttern mit abgemagerten Kindern auf den Armen oder auf den Rücken gebunden, alten Menschen mit zerfalteten Gesichtern und erblindeten Augen, die am Stock von einem vorangehenden Kind geführt wurden, den Weg frei machte. Sie folgten der langgezogenen, blauen Markierung mit den nach rechts und links abgehenden Winkeln und kamen schließlich an einem Flachbau mit einem Blechdach an, dessen Mauern Zeichen der fortgeschrittenen Verwitterung aufwiesen. Die sandbraun gestrichene Tür am Eingang war verfleckt und ramponiert. In diesem Moment wurde ein frisch Operierter mit einem dicken Verband an seinem kurz geratenen, linken Oberschenkelstumpf auf einer Trage hereingefahren, die statt auf vier nur auf drei Rollen rollte. Es war ein Jugendlicher, der noch nicht zu vollem Bewusstsein zurückgekehrt war, als zwei Krankenpfleger ihn auf der wackligen Trage in den ersten Raum fuhren und ihn ins Bett herüberhoben. In diesem Raum waren vier Betten links und vier Betten rechts. Alle waren von Männern belegt, die in den letzten Tagen operiert worden sind. Fünf von ihnen wurden wegen Verletzungen an den Armen oder Beinen chirurgisch versorgt.
“Es vergeht kein Tag, an dem nicht Verletzte gebracht werden”, bemerkte Dr. Witthuhn, “viele von ihnen kommen mit schweren Verletzungen, nachdem sie auf eine Personenmine getreten sind und die Explosion überlebt haben oder angeschossen wurden.” Die Männersaal verströmte den ätzenden Geruch von Schweiß und Urin und war hoffnungslos überfüllt. Was Dr. Ferdinand das erste Mal sah, war die Situation, dass außer den acht Patienten in den Betten noch weitere Patienten mit frischen Verbänden an einer oder beiden Händen auf Decken zwischen den Betten auf dem Boden lagen. Zwei ältere Männer waren an den Leisten operiert. Der mit vierunddreißig Betten bestückte Männersaal wurde von zwei Schwestern, einem Krankenpfleger und einer Krankenpflegeschülerin im zweiten Ausbildungsjahr pflegerisch betreut. Trotz der unverkennbaren Überlastung begrüßten sie Dr. Ferdinand mit ausnehmender Höflichkeit, die an Herzlichkeit reichte, und gaben ihm die Hand. In Afrikaans, der offiziellen Landessprache, fragten sie ihn, ob er nicht am Hospital arbeiten wolle, da die wenigen Ärzte überlastet seien, und ein Chirurg ganz fehle. “Eine Entscheidung wird bald fallen”, erwiderte er vorausahnend, dass da eine Herausforderung auf ihn zukommt, die er noch nicht hatte, wozu die völlig ungewohnten, klimatischen Bedingungen kamen, unter denen ein solches Arbeitspensum zu bewältigen war. Da erschienen ihm die Stunden des Tages kaum ausreichend. “Kommen Sie”, sagte Dr. Witthuhn, “es ist alles nicht so schlimm. Wir werden die Dinge in Ruhe in meinem Dienstzimmer besprechen.”
Das Dienstzimmer war auffallend geräumig, mit einem Sammelsurium unterschiedlicher Stühle, einem riesigen Schreibtisch, alten Regalen und einer großen Wandtafel im Rücken des leicht erhöhten, auf fünf Rollen beweglichen Schreibtischstuhls bestückt und durch eine arbeitende Klimaanlage auf eine angenehme Temperatur gebracht. Die beiden Kollegen setzten sich gegenüber, Dr. Ferdinand auf einen harten Stuhl, während sich Dr. Witthuhn mit dem Stöhnen der Erleichterung in den gepolsterten Stuhl mit erhöhter Rückenlehne und den abgegriffenen Armlehnen hinter dem Schreibtisch einsinken ließ. Der Polsterbezug war an der Rückenlehne eingerissen, und der vergilbte und durchlöcherte Schaumgummi trat hervor. Dr. Witthuhn schaute auf seine Armbanduhr, rief die Sekretärin und bestellte Tee mit Zucker und Milch. Währenddessen fragte er Dr. Ferdinand, ob er sich einen ersten Eindruck vom Hospital machen konnte. Dessen Blicke fuhren die Fensterfront ab, fixierten die schütter behängten Äste eines alten Baumes mit einigen herausragenden, dicken Aststümpfen, der sich zwischen dem Administrationsgebäude mit den Klimaanlagen und dem gegenüberliegenden Krankensaal ohne Klimaanlagen gehalten hat. In diesem Krankensaal war die Intensiv-Station für Patienten im kritischen Zustand sowie zwei Krankenzimmer für Privatpatienten. “Der erste Eindruck sprengt meine bisherigen Erfahrungen, ich habe eine solche Ansammlung von Patienten und Verletzten noch nicht gesehen”, sagte Dr. Ferdinand, dessen Augen die Aststümpfe, nachdem er sie gezählt hatte, verließen und den gegenübersitzenden Kollegen betrachteten. Dr. Witthuhn war ein Mann der Mittvierziger mit einem leicht geschwollenen Gesicht und tiefbraunen Augen unter dem dunklen Wildwuchs der Brauen. Seine Nase hatte einen breiten Rücken mit den ersten Zeichen der knolligen Entartung. Sein Mund führte dicke Lippen europäischer Ausmaße und zeigte beim Öffnen blendende Zahnreihen. Das Schwarz seines buschigen Haarwuchses wurde an den Schläfen von den ersten Grautönen des frühen Alterns durchzogen. “Herr Ferdinand”, sagte Dr. Witthuhn, “seitdem ich hier Superintendent bin, und das ist seit fünf Monaten, haben sich die Dinge bereits gebessert. So konnten einige alte Instrumente gegen neue ausgetauscht werden, zwei der vier Operationstische wurden überholt, und die Zahl der Ärzte konnte von elf auf vierzehn erhöht werden. Es ist richtig, dass diese Zahl für eine ordentliche Versorgung der Patienten noch immer zu klein ist. Doch bedenken Sie, dass hier Kriegsgebiet ist. Dafür ist diese Zahl schon beachtlich.”
Die Sekretärin, eine junge schwarze Frau mit den stimmenden Proportionen, die durchaus als schön zu bezeichnen war, brachte auf einem Tablett eine Kanne mit Tee, zwei Tassen, Zucker und Milch. Beim Abstellen des Tabletts auf den Schreibtisch sagte sie mit wohlklingender Stimme zu Dr. Witthuhn, dass Dr. Erasmus, der Sekretär der zentralen Gesundheitsverwaltung, aus Windhoek angerufen und um einen Rückruf gebeten habe, und dass Dr. Hutman ihn sprechen möchte. “Die Unterredung kann jetzt nicht stattfinden”, erwiderte Dr. Witthuhn, “Sie sehen, dass ich mit dem Kollegen im Gespräch bin, der aus Deutschland kommt, um hier als Chirurg zu arbeiten.” Die Sekretärin brachte Dr. Ferdinand ein Lächeln der Erleichterung entgegen, weil sie um die Ärztenot am Hospital wusste. “Sagen Sie Dr. Hutman, dass ich heute keine Zeit habe”, sagte Dr. Witthuhn, “wir können erst morgen früh nach Morgenbesprechung miteinander reden.” Mit einiger Mühe erhob er sich aus seinem gepolsterten Stuhl und goss Tee in die Tassen. “Nehmen Sie Zucker und Milch?” Dr. Ferdinand bat um Tee ohne Milch, dafür mit zwei Löffeln Zucker. Am Schreibtisch stehend rührte Dr. Witthuhn den Zucker in die gefüllten Tassen ein. Mit der Tasse in der Hand erwähnte er, dass für die Arbeitserlaubnis, die unbedingt erforderlich war, das “Medical & Dental Council” in Pretoria zuständig sei und diese von dort eingeholt werden müsse. Die Prozedur würde wahrscheinlich eine Woche in Anspruch nehmen. Dr. Witthuhn war zweckoptimistisch, als er bemerkte, dass das “Council” bisher immer behilflich war. Des Weiteren bot er dem deutschen Kollegen an, vorerst in seinem Haus zu wohnen, bis eine andere Möglichkeit der Unterbringung gefunden sei.
Es klopfte heftig an der Tür, und ein mittelgroßer Mann mit blassem Gesicht, rechts gescheiteltem Haar und auffallend dunkelbraunen Augen, die Feuer sprühten und den Angriff signalisierten, trat in korrekt gebügelter Leutnantsuniform der südafrikanischen Armee in den Raum, ohne auf das "Herein" zu warten. Dr. Witthuhn stellte den knapp dreißigjährigen Arzt mit dem Namen Dr. Daryll Hutman vor. Dieser setzte sich in einen gepolsterten Stuhl neben Dr. Witthuhn, während Dr. Ferdinand seinen harten Stuhl wieder einnahm. Der junge Arzt hielt seine Zunge für geraume Zeit unter Kontrolle und musterte mit seinen dunklen, nervös hin und her fahrenden Augen den Neuankömmling aus Deutschland mit einer nicht zu übersehenen Feindseligkeit. Diesem jungen Arzt machte es nichts aus, dass er das orientierende Gespräch zwischen den beiden anderen unterbrach und Dr. Ferdinand mit unerwarteter Aufdringlichkeit fragte, ob er hier auf Urlaub ist, ein Spezialist sei und ob er gar beabsichtige, hier zu arbeiten. Da sollte er den Krieg nicht unterschätzen, der in den vergangenen Monaten an Schärfe erheblich zugenommen habe, wodurch die Zahl der Verletzten stark gestiegen sei.
Dr. Hutman zeigte im Sprechen deutlich mehr Talent als im Zuhören. Das wurde deutlich, als er einen Beschwerdezettel aus der Brusttasche zog, mit den Beschwerden loslegte und schlichtweg keine Rücksicht darauf nahm, dass die beiden anderen Kollegen miteinander sprechen wollten, ohne dabei gestört zu werden. Er beschwerte sich über mangelnde Zusammenarbeit mit den Schwestern und Pflegern im Männersaal, die die Verbände nicht zu der vorgeschriebenen Zeit wechselten, die Infusionen und Bluttransfusionen nicht pünktlich anhängten und die Injektionen nicht wie vorgeschrieben gaben. Sie verweigerten schlichtweg ihre Kooperation. Der Versuch, das Problem in friedlicher Weise zu klären, scheiterte daran, dass Dr. Hutman den Superintendenten nicht aussprechen ließ. Bei seinem langen Beschwerdemonolog mit dem Herausstellen seines persönlichen Einsatzes, in dem er sich nicht unterbrechen ließ, konnte sich Dr. Ferdinand des Eindrucks nicht erwehren, dass das Uniformtragen eine Zurschaustellung von Macht an einer völlig falschen Stelle war. Da erinnerte er sich an seine Kindheit zurück, als Uniformträger in oft unerträglicher Weise ihre Macht zur Schau stellten und sich wichtig taten, so dass es für die Erwachsenen entweder lächerlich oder gefährlich wurde.
Dr. Witthuhn war dagegen Zivilist, und als solcher war er es, der mit dem ärztlichen Direktor, Dr. Eisenstein, welcher es sich in der Uniform eines Colonels auf seinem Sessel in einem geräumigen und angenehm klimatisierten Büro bequem machte, im Clinch lag. Die Sorgen des Dr. Eisenstein kreisten um die zahnärztliche Behandlung seines persönlichen Gebisses und seine Tätigkeit beschränkte sich auf die Herausgabe von Erlassen, die am laufenden Meter kamen, von Woche zu Woche schärfer wurden und in denen Zeichen der Diskriminierung nicht zu überlesen waren. Diskriminiert wurden Menschen der schwarzen Bevölkerung, die im Norden des Landes, unweit der angolanischen Grenze, wo der Krieg hauste, am meisten litten. Für diese „Bantu“-Menschen setzte sich Dr. Witthuhn als Superintendent des Hospitals ein, kämpfte für sie mit den Argumenten eines gebildeten Zivilisten gegen bornierte und machtbewusste Uniformträger, die ihre Aufgabe offensichtlich in Beschwerden und der Fließbanderarbeitung von Erlassen sahen. Dr. Witthuhn war ein Arzt mit Herz, der seine Arbeit in der Hilfe für die Menschen sah, und dem das Herz schwer wurde, wenn es wegen dieses Helfens zu Zusammenstößen mit den Uniformträgern kam. Er setzte sich dafür ein, dass das Hospital für die Zivilbevölkerung offen stand, um den leidgeplagten Menschen die Hilfe zukommen zu lassen, die sie so dringend brauchten. Einen Unterschied in der Hautfarbe durfte es für ihn in der ärztlichen Behandlung nicht geben, diese sollte für alle Menschen gleich sein. Dr. Hutman ließ den Superintendenten nicht aussprechen, der erst auf Englisch, dann in Afrikaans versuchte, auf die Beschwerdepunkte und ihre Ursachen einzugehen. Der Superintendent musste energisch werden, bat den jungen Arzt, ihn nicht ständig zu unterbrechen und schlug ihm vor, die intravenösen Injektionen und Infusionen selbst vor Operationsbeginn zu verabreichen. Er versuchte den jungen Kollegen davon zu überzeugen, dass eine gute Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal durchaus zu erreichen ist, wenn er als Arzt freundlich ist und mit mehr Geduld und Verständnis auf die Probleme im Krankensaal eingehe. Das Problem mit dem Fehlen von Antibiotika und bestimmter Infusionslösungen könne er auch nicht lösen, da er wie das ganze Hospital auf die Zuteilung von der Zentralapotheke in Windhoek angewiesen sei. Das wollte der junge Arzt in seiner geschniegelten Uniform nicht begreifen, und am wenigsten den Vorschlag, die Spritzen an den Patienten selbst zu setzen und die Infusionen vor Operationsbeginn selbst anzulegen. Für dieses Mehr an persönlichem Engagement und Verständnis für die Saalprobleme hatte der junge Arzt kein offenes Ohr. Eine diesbezügliche Belehrung lehnte er nachdrücklich ab. Der Eindruck entstand, dass das Tragen einer Leutnantsuniform der süd-afrikanischen Streitmacht mit dem Vorrecht verbunden war, einem Superintendenten kategorisch zu widersprechen. Das wollte sich Dr. Witthuhn nicht gefallen lassen. Den Kompromiss der Vernunft gab es nicht. Dr. Hutman, dessen Jähzorn sich mit dem Blut im Gesicht staute, stand auf und machte sich durch die Bemerkung unbeliebt, dass er sich beim ärztlichen Direktor beschweren werde, jenem Militäroberst, dessen zentraler Sorgenkreis die persönliche Zahnsanierung war. Der freche Arztkerl beschwerte sich, die Beschwerde hatte Erfolg, und der neue Erlass ließ nicht lange auf sich warten. In ihm war dann zu lesen, dass das Pflegepersonal den Anweisungen des Arztes strikt zu folgen und wegen der permanenten Überlastung der Ärzte auch ärztliche Aufgaben in den Sälen auszuführen hätte. Gezeichnet war er, wie alle Erlasse, von Dr. Eisenstein, „Colonel, Direkt or of Health & Welfare“.
Mehr über die verzwickte Situation im Gesundheitswesen des Landes und in der regionalen „Administration for Ovambos“ sollte Dr. Ferdinand am ersten Abend im Hause von Dr. Witthuhn erfahren, der als Sohn eines deutschen Missionars in der Kap-Provinz geboren und für einige Jahre sogar als Fliegerarzt beim Luftgeschwader „Richthofen“ im Oldenburgischen tätig war. Er sprach das Deutsch fließend mit einem südafrikanischen Akzent, wobei es gelegentlich zu „afrikaansen“ Verwechslungen kam. „Kommen Sie, ich zeige ihnen ihr Zimmer.“ Dr. Ferdinand folgte ihm und fand einen engen, vollgestopften Raum vor, wo auf dem Bett Hemden, Hosen, Socken und viele andere Dinge neben beschriebenen und unbeschriebenen Blättern und Zeitschriften lagen. Dr. Witthuhn räumte die Sachen mit wenigen Griffen vom Bett und schob übervolle und halb gefüllte Kartons zur gegenüberliegenden Wand, wo er sie zu einer Pyramide übereinander stapelte, deren Spitze bis zur Zimmerdecke reichte. Während Dr. Ferdinand sich in der Enge zu drehen und zurechtzufinden versuchte, ging Dr. Witthuhn ins Wohnzimmer zurück, legte eine Platte auf den Plattenteller und ließ Mozarts Zauberflöte erklingen. Im Auf und Ab dieser wunderbaren Flöte erfreute er sich besonders an der Papageno-Arie, die er musikalisch begleitete. Er war vor vielen Jahren Mitglied des Windhoeker „Cantare audire“-Chores und schwärmte davon, wie der Chor anlässlich des irischen Musikfestivals 1976 in Dublin den dritten Preis ersang. Dr. Witthuhn hätte ebenso Musiker sein können. Auch kannte er sich glänzend in der zeitgenössischen Malerei aus. Das zeigten die ausgesuchten, meist schief hängenden Bildreproduktionen an den Wänden seines ihm von der Owambo-Administration zur Verfügung gestellten Flachbauhauses mit Asbestwänden und Wellblechdach, das sich aus vier Zimmern, Küche, Duschraum und einer separaten Toilette zusammensetzte. Ein nicht weniger wichtiges Augenmerk in seinem Leben galt dem Gaumen und seinen Genüssen. Es schien zu seinen Abenden zu gehören, dass er mit Beginn des Sonnenuntergangs ungleich zerhacktes Ast- und Wurzelholz in die durchlöcherte Blechwanne in genialischer Unordnung übereinander legte, das Feuer entfachte und dabei den Papageno imitierte. „Ist das nicht herrlich?“, entzückte sich Dr. Witthuhn mit Blick gegen den sich rot färbenden Himmel mit der untergehenden Sonne, während unter leichtem Quietschen der Grammophonnadel in den ausgefahrenen Rillen der zu viel gespielten Platte Mozarts Zauberflöte aus der offenen Tür und dem gekippten Oberfenster des Wohnraums in der Wiedergabe der Wiener Philharmoniker unter Karl Böhm drang. „Das ist meine Medizin nach einem Tag Oshakati Hospital“, lachte er. Dann ging er zu seinem blauen BMW der Mittelklasse, den er als Superintendent eines Hospitals von der Gesundheitsadministration gratis bekam, öffnete den Kofferraum, holte Fleisch verschiedener Sorten, „Boerewors“ (Burenwurst), ein Zweikilonetz mit Kartoffeln, eine Plastiktüte mit vegetarischem Zubehör und eine Zwölferlage Bierdumpies der Marke „Guinness“ heran. Das Feuer in der durchlöcherten Wanne brannte lichterloh, als er die ersten zwei Dumpies öffnete, den Willkommensgruß für Dr. Ferdinand in Oshakati aufsagte, mit seiner Flasche leicht gekreuzt gegen dessen stieß und nach dem „Prost!“ sein Bier fast austrank.
Als die Flammen mit dem Züngeln aufhörten, verteilte Dr. Witthuhn die Glutstücke in der Wanne, wobei kleinere Stücke durch die Wannenlöcher glühend auf den Boden fielen, so dass man mit den Füßen aufpassen musste. Er legte den alten Rost mit den weit auseinander liegenden Quer- und Längsstäben auf die Wanne und die Schweinekoteletts, die Filetstücke vom Rind und die „Boerewors“-Kringel auf den Rost. Ein köstlicher Bratenduft begann aufzusteigen, dass einem das Wasser im Munde zusammenlief. Steaks und „Boerewors“ schmorten auf dem Grill, Dr. Witthuhn öffnete die nächsten Dumpies, man prostete sich zu, als plötzlich schwere Kanonenschüsse losdonnerten, Geschosse über Haus und Grill zischten, in der Ferne einschlugen und fürchterlich detonierten. Dr. Ferdinand erschrak dermaßen, dass ihm die Flasche aus der Hand rutschte und das auslaufende Bier seine Hose bekleckerte. Er erinnerte sich an die Fliegernächte seiner Kindheit in Köln, als die Bomben vom Nachthimmel runterzischten und in die Häuser krachten und sein Vater ihn, als er acht Jahre alt war, aufforderte, ihm mit einem Eimer Sand zu folgen, um die Brandbombe mit dem roten Streifen um den Zylinder gemeinsam zu löschen, die in die Bodenetage der Nippeser Zweigstelle der Kölner Stadtsparkasse eingeschlagen war. „So etwas kommt hier häufiger vor“, sagte Dr. Witthuhn, als er ihm eine neue Flasche öffnete, „besonders dann, wenn die Brigade ausgewechselt wird.“ Dickbereifte Militärfahrzeuge, die gefürchteten „Casspirs“ mit MGs über dem Fahrerhaus und aufsitzenden Mannschaften rasten über die Straße und wirbelten riesige Sandwolken auf, die über Haus und Grillplatz zogen und erst dahinter niedergingen. „Jetzt trinken wir erst einmal, das ist alles nicht so schlimm. Prosit der Geselligkeit!“ Nach diesen aufmunternden Worten leerte er seine Flasche, legte Kartoffeln auf den Rost zwischen die dampfenden Steaks und die „Boerewors“ und drehte und verschob mit der verrußten, fettverschmierten Zange die Dinge auf dem Rost wie ein Küchenmeister. Beide tranken auf eine gute Zusammenarbeit und eine bessere Zukunft und bestätigten einander, dass es nichts Besseres gegen den Durst gibt als ein gut gekühltes Bier. Für Dr. Ferdinand war der Satz, dass es sich hier im Norden auch unter den Granaten leben lässt, mit Zweckoptimismus gekoppelt, wobei die Kopplung für jene Menschen zutraf, denen es schon dreckig genug erging. Aus dem „guten Leben im Norden“ konnte er seine ersten Vermutungen ziehen, in welcher Lebenssituation Dr. Witthuhn steckte.
Der Dorfname „Oshakati“, ein Bantuwort aus der Sprache der Ovambos, bedeutete so viel wie Stadt der Mitte. Vieles, was mit diesem Namen verbunden war, sollte erst noch erlebt werden. Doch zeigte sich mit dem Lauf der Jahre, dass mit diesem Namen eine Schlüsselfunktion verbunden war. Der Bart dieses Schlüssels wurde zunächst von weißen Händen gedreht, erst langsam und dann schneller, bis die Türen fest verschlossen waren, dass für die Menschen der schwarzen Haut, die ums nackte Leben kämpften, nichts mehr ging. Jahre später drehten schwarze Hände den Bart des Schlüssels andersrum, um die Tür aufzumachen, die zum Leben nötig ist. Doch das mit dem völligen Rumdrehen des Schlüssels mit dem „Upsidedown-Syndrom“, dem Oben-unten-Prinzip, stand noch vor der Drehung der Münze. Das Ringen um die Schlüsseldrehung, um die offene Tür, war in den Gesichtern der Menschen zu lesen. So sollte Oshakati, das in der Kriegszone lag, eine zentrale Bedeutung zukommen, wenn es um das Oben-unten-Prinzip und seine Umkehrung ging, die direkt mit dem Freiheitskampf und der UN-Resolution 435 in Beziehung stand. Noch war es das Phänomen der verschlossenen Tür, die nur für die Weißen offen, für die schwarze Bevölkerung dagegen nicht passierbar war. Die Weißen hatten die Macht, sie hielten den Machtschlüssel fest in ihren Händen und bestimmten das Leben der Menschen, auch wenn sie es nicht mehr ertragen konnten. Es war eine politische Realität, die mit der Vernunft nichts am Hut hatte. Wer den Schlüssel hat, der hat die Macht. Mit guter Erziehung oder herausragender Bildung hatten diese Realitäten nichts zu tun, im Gegenteil, sie schlugen der Bildung mit dem menschlichen Antlitz mitten ins Gesicht.
„Sehen Sie, da gibt es noch einige Formalitäten zu erledigen, ehe Sie mit der Arbeit beginnen können“, setzte Dr. Witthuhn beim genüsslichen Verzehren seines Steaks an, „wir brauchen die Arbeitsgenehmigung vom ,Medical & Dental Council’ in Pretoria. Ich werde gleich Montag früh dort anrufen. Doch brauche ich dafür noch ein Schreiben des ärztlichen Direktors, aus dem hervorgeht, dass Sie hier dringend gebraucht werden.“ Was Dr. Witthuhn nicht sagte, war, dass der deutsche Facharzt in Pretoria im Gegensatz zum britischen nicht anerkannt wurde, und dass die Arbeitserlaubnis, als „Practitioner“ zu arbeiten, sich ausschließlich auf das Oshakati Hospital beschränkte. Dr. Ferdinand sah die ersten beruflichen Wolken aufziehen und spürte Bitternis über die ungleiche Behandlung von Ärzten, die hier so dringend gebraucht wurden. Dr. Witthuhn wusste, dass der neue Kollege ein hoch qualifizierter Chirurg mit den Teilgebieten Traumatologie und Plastische Chirurgie war. Zudem hatte Dr. Ferdinand eine stattliche Anzahl von Publikationen in deutschen und internationalen Journalen aufzuweisen. Doch die deutsche Expertise war hier wie in Pretoria, wenn es um Formalitäten ging, nicht erwünscht. Dr. Eisenstein, „Colonel, Direkt or of Health and Welfare“, ließ sein kurz gefasstes Schreiben über die Dringlichkeit eines Chirurgen am Oshakati Hospital erst am Dienstagmorgen Dr. Witthuhn überreichen, der es zusammen mit den deutschen Zertifikaten und einem persönlichen Anschreiben noch am selben Tag per Fax an das Council absandte. Den Empfang dieser Papiere ließ er sich telefonisch durch eine Frau van Vuuren bestätigen. Jeden Morgen war um 7.30 Uhr eine Besprechung im Arbeitszimmer des Superintendenten angesetzt, an der die im Hospital arbeitenden Ärzte, die Matronen und je ein Vertreter der Pharmazie und der sozialen Dienste teilnahmen. Von den elf Ärzten waren sieben in der Uniform der südafrikanischen Streitmacht; die restlichen vier waren drei Ovambos, zwei Kolleginnen und ein Kollege, von denen zwei in Durban und eine an der UCT (University of Cape Town) studiert und den „Bachelor of Science“ erreicht hatten, und Dr. Ferdinand. Bis auf die drei Ovambos hatten alle die weiße Hautfarbe. Das war die Situation in der ersten Januarwoche des Jahres 1985. Das Ovamboland war Kriegs- und Sperrgebiet, und ein Ende des Krieges zwischen den Partisanenkämpfern der SWAPO (Southwest African People’s Organisation) und den Streitkräften der südafrikanischen Besatzungsmacht war nicht abzusehen. Die Lage war gespannt und das Oshakati Hospital in einer kritischen Situation. Es war hoffnungslos überfüllt, und die Ärzte waren bei Weitem überfordert. Die Arbeit wurde erschwert durch den Mangel an wichtigsten Medikamenten, die notwendig waren zur Bekämpfung von Wundinfektionen, Malaria, Lepra, Tuberkulose, Eiweiß- und Vitaminmangelerkrankungen; auch an Instrumenten und dem nötigsten Material zur Durchführung von Operationen und der Versorgung von Knochenbrüchen fehlte es.
So war die Morgenbesprechung von Montag bis Freitag meist eine Wiederholung der schier unlösbaren Probleme bei der Beschaffung des Allernötigsten. In dieser Situation offensichtlicher Machtlosigkeit, erbärmlicher Hospitalausstattung und quälender personeller Unterbesetzung lag das Wissen um die totale Abhängigkeit von der zentralen Administration in Windhoek, von Menschen, die ihre verantwortlichen Positionen missbrauchten und ihre Augen mit den Blicken der Gefälligkeit in Richtung Pretoria wandten und vor den dringendsten Notwendigkeiten im Norden verschlossen. Es war an einem Mittwochmorgen in der ersten Januarwoche, als Dr. Witthuhn den deutschen Kollegen offiziell den Ärzten vorstellte. Während der schwarze Kollege, Dr. Nestor, und seine zwei Kolleginnen, Dr. Ruth und Dr. Teopolina, ein Lächeln der Erleichterung erkennen ließen, verzogen die uniformierten Ärzte, die das zusammengefaltete Barett unter die rechte Epaulette geschoben hatten, keine Miene. Ihre Gesichter bekamen lediglich, bis auf einige Ausnahmen, Züge der Nachdenklichkeit, Neugierde und der frühesten Abwehr. Als Dr. Witthuhn erwähnte, dass Dr. Ferdinand ein Spezialist der Chirurgie sei und zuständig sein werde für die Leitung der chirurgischen und orthopädischen Männer-, Frauen- und Kinderstationen, verspannten einige Militärärzte ihre Gesichter, die sich durch einen Nichtafrikaner um ihren Status beraubt oder zurückgesetzt fühlten. Es war der dunkelhaarige Dr. Daryll Hutman, dem das Gesicht rot anlief, der finster blickte und aus dessen dunklen Augen Hassflammen sprühten. Es war unverkennbar, dass er einen deutschen Kollegen neben und über sich nicht dulden und die Erklärung des Superintendenten nicht akzeptieren würde. Dann schoss er los: „Haben Sie denn schon eine Arbeitserlaubnis aus Pretoria? Werden Sie denn hier als Spezialist überhaupt anerkannt?“ Diese und weitere Fragen richtete er, als die Wutröte der Zornesblässe wich, als ein unverträglicher Karrieremacher an Dr. Ferdinand und den Superintendenten. Die anderen Kollegen begriffen, dass sich hinter den Fragen eine abgrundtiefe Feindschaft verbarg. So schwiegen sie aus Gründen des Anstands. Dr. Witthuhn atmete hörbar und erwiderte, dass der Antrag auf Arbeitsbewilligung bereits in Pretoria sei und mit einer positiven Entscheidung innerhalb einer Woche zu rechnen sei. Der junge Leutnant gab nicht auf. Da platzte dem Superintendenten der Kragen: „Zähmen Sie ihre Zunge, schließlich sind Sie noch in der Ausbildung und Dr. Ferdinand ist ein ausgewachsener Chirurg, der mit reichen Erfahrungen gekommen ist, um unseren Patienten zu helfen.“ Dr. Hutman schlug das rechte Bein über das linke und schwieg mit dem aschfahlen Gesicht des Zorns. Seine Augen schworen dem deutschen Kollegen Feindschaft. Dr. Ferdinand begriff, dass die Arbeit in diesem Hospital schwierig werden würde. Das Ausmaß der Probleme hatte er allerdings unterschätzt, und das in der Annahme, dass die Not der Menschen hier, wo der Krieg eskalierte, Ärzte dringend erforderlich machte. Dr. Witthuhn saß als Superintendent mit seiner Entscheidung auf einem Stuhl, an dessen Beinen bereits gesägt wurde. So trafen sich die uniformierten Jungärzte nicht nur mit dem ärztlichen Direktor, sondern auch mit dem Regimentskommandeur, um ihre Haltung gegen einen deutschen Arzt, der ihnen übergeordnet werden sollte, zu bekräftigen. Es fanden entsprechende Telefonate mit dem Superintendenten statt, die durchaus als eine Frühwarnung zu verstehen waren, doch Dr. Witthuhn ließ sich weder vom Kommandeur noch vom Sekretär der „Administration for Ovambos“ von seiner Entscheidung abbringen. Das Hospital sollte für die Zivilbevölkerung offen gehalten werden und ein Chirurg wurde dringend gebraucht. Es sollte patientenfreundlicher werden, und das war nur mit Zivilärzten zu schaffen. Dass Dr. Witthuhn als Arzt auch ein Patriot war, weil er sich für die Menschen in Not bedingungslos einsetzte und für sie kämpfte, ist ihm eigentlich nie gedankt worden; im Gegenteil, seine Achtung vor den Menschen und seine Hilfsbereitschaft gegenüber der leidenden Bevölkerung sollte ihm binnen Jahresfrist die Stellung als Superintendent kosten.
Die „theatre list“ (Operationsliste) der chirurgischen und orthopädischen Operationen, für die Dr. Hutman verantwortlich war, war so angelegt, dass der Montag für ausgiebige Saalrunden frei gehalten wurde, um die Diagnostik der Patienten, die über das Wochenende aufgenommen worden waren, abzuschließen. Jede operative Station hatte ihren speziellen Tag zur Ausführung der Operationen; so waren der Dienstag und Freitag reserviert für die Männerstationen, der Mittwoch und Donnerstag für die Frauen- und Kinderstation. Die Stationsärzte schrieben Namen und Diagnose des jeweiligen Patienten auf ein Papier, das Dr. Hutman in Empfang nahm und daraus das Operationsprogramm zusammenstellte. Ein Durchschlag dieser Liste ging an den Superintendenten des Hospitals, ein weiterer an den ärztlichen Direktor. Je ein Jungarzt mit dem Barett unter den Schulterklappen kam auf eine der Stationen; es waren jedoch zwei, die für die chirurgischen Stationen verantwortlich waren, von denen der maßgebende Dr. Hutman war. Dieser stand am Beginn der Spezialisierung, die an der Witwatersrand-Universität in Johannesburg erfolgte, wenn auch sein Mund wie der eines fertigen Chirurgen sprach. Lediglich der gynäkologische Saal und der Kreißsaal standen unter der Leitung der fleißigen und menschlich sympathischen Dr. Ruth, die ein großes Pensum meist ohne Hilfe zu bewältigen hatte. Sie sprach die Sprache der Menschen und verstand am besten die Nöte der Frauen und Mütter mit allen Aspekten des täglichen Lebens. Ihr wurde einer der jungen Militärärzte zugeteilt. Wie sich herausstellte, war dieser noch ein Student, der an der UCT gerade den vorklinischen Abschnitt seines Studiums erfolgreich abgeschlossen hatte. Er war ein ungewöhnlich freundlicher und gebildeter Mensch, der mit den Merkmalen des Charismas und der Fähigkeit des geduldigen Zuhörens versehen war. Sein Name war Jakobus Burger. Er absolvierte hier das erste klinische Praktikum während seines Militärdienstes in der südafrikanischen Streitmacht.
Es war ein Donnerstag. Die Morgenbesprechung dauerte länger. Wieder saß Dr. Ferdinand zwischen den schwarzen Kollegen und den uniformierten Jungärzten. Mühsam mahlten die Mühlen an den Stolpersteinen in der alltäglichen Arbeit. Die Probleme waren dieselben wie gestern. Die Säle waren hoffnungslos überbelegt, die Wundinfektionen nahmen kritische Ausmaße an, es fehlte an den einfachsten Antibiotika der ersten und zweiten Generation und die Tuberkulosepatienten spuckten sich vor dem Saaleingang aus, da es an Spucknäpfen fehlte. Die Reinigung mit antiseptischer Lösung lag im Argen, die Toiletten in einigen Sälen waren extrem verschmutzt und verstopft, da die Wasserspülung nicht funktionierte. „Ein penetranter Uringeruch schlägt den Patienten und Besuchern beim Betreten des Hospitalgeländes entgegen, das ist eine unmögliche Situation“, beklagte die Hauptmatrone, Antje P. Die Ursache des Gestanks waren die vielen Menschen, die wegen der Sperrstunden nicht nach Hause konnten, auf dem Vorplatz übernachteten und die dortige Toilette benutzten, die meist verstopft war. Es wurde angeordnet, den Vorplatz jeden Morgen abzuspritzen und die Toilette täglich zu säubern. In verständlicher Sprache sollte der Superintendent eine Anweisung für die Toilettenbenutzer zur Sauberhaltung dieser Einrichtung verfassen, die gut sichtbar am Toiletteneingang angebracht werden sollte. Dann hob Dr. Hutman mit dem Gesicht der Wichtigkeit die linke Hand. In einem längeren Monolog zeichnete er Bilder des Chaos in den chirurgischen Krankensälen als auch der kritischen Situation im „theatre“. „Die Patienten werden unzureichend versorgt, sie erhalten nicht zu den angegebenen Zeiten die angeordneten Medikamente, die Räume sind verschmutzt, die Fenster verschmiert und das Glas an vielen Fenstern ist eingeschlagen, eine ordnungsgemäße Übergabe zur nächsten Schicht findet nicht statt, um einige Punkte zu nennen.“ Zur Situation im „theatre“ klagte Dr. Hutman, dass der Operationstisch nicht richtig arbeite, die Hydraulik ab einer gewissen Höhe klemme und zudem völlig veraltet sei, dass viele Instrumente schrottreif seien, die Scheren nicht schnitten, die Klemmen nicht klemmten und die Pinzetten nicht fassten. Manche Instrumente seien so abgenutzt, dass sie beim Gebrauch auseinander brechen würden. Letzteres brachte bei den Zuhörern ein befreiendes Lachen hervor, wenn es auch jedem klar war, dass die Arbeit an den Patienten mit schier unlösbaren Problemen verbunden war. Dr. Witthuhn gab Weisung, dass die Matronen für eine ordnungsgemäße Übergabe der Patienten beim Schichtwechsel des Pflegepersonals sorgen sollten, dass die Fenster geputzt, die zerbrochenen Scheiben ersetzt und die Patientensäle mit den Toiletten täglich gereinigt werden. Bezüglich der klemmenden Hydraulik am Operationstisch und der schrottreifen Instrumente machte er nur vorsichtige Vorhersagen. Er konnte jedoch glaubhaft machen, dass ein neuer Operationstisch und neue Instrumente seit über einem Jahr von der „Administration for Ovambos“ angefordert wurden. Die Dringlichkeit sei dem „Sekretaris“ bekannt, und er habe die Unterstützung zugesagt. „Mehr kann ich von hier aus nicht tun.“ So endete die Morgenbesprechung mit dem Wissen um die totale Abhängigkeit vom „Sekretaris“ und seiner Bantu-Administration und die Notwendigkeit zur Improvisation, um mit den verfügbaren Mitteln den Hospitalbetrieb aufrecht zu halten. Es war ein Wissen, der Not begegnen zu müssen, entgegen der hinter vorgehaltener Hand getriebenen politischen Intrigen und Machenschaften in der Zone des Krieges.
Vom ersten Tag an redeten sich Dr. Leon Witthuhn und der deutsche Kollege mit den Vornamen an, wenn sie unter sich waren. „Bleib noch hier, Hartmut, ich rufe Pretoria an, ich will wissen, wie weit es mit deiner Arbeitserlaubnis ist.“ Dr. Witthuhn ließ sich durch seine Sekretärin verbinden. Frau van Vuuren vom „Medical & Dental Council“ gab zu verstehen, dass sein Anschreiben mit dem Begleitschreiben von Dr. Eisenstein und den ins Englische übersetzten und beglaubigten Zertifikaten des Dr. Ferdinand der begutachtenden Kommission vorliegen. Mit einer Entscheidung sei in den nächsten Tagen zu rechnen. Dr. Witthuhn legte den Hörer mit der Bemerkung auf, dass sich Pretoria bislang kooperativ gezeigt hatte, wenn es um die ärztliche Arbeitserlaubnis ging. „Doch deinen Facharzt werden sie nicht anerkennen, dafür musst du dich einer Prüfung in Südafrika unterziehen. Ich möchte dir das jedoch nicht zumuten und rate dir aus meinen Erfahrungen und der Tatsache, dass wir hier in einem Kriegsgebiet sind, von einer solchen Prüfung ab.“ Es war ein gut gemeintes Statement des Superintendenten, das darauf hinzielte, seinen deutschen Kollegen vor einer derartigen Stresssituation zu bewahren. Dr. Ferdinand verstand die Intention eines solchen Ratschlages; doch bedrückte ihn die Tatsache der Nichtanerkennung dessen, was er seit vielen Jahren war. Was hatte er persönlich in Afrika zu erwarten? Mit einem Bündel ungelöster Fragen, die sein Leben betrafen, ging er zum orthopädischen Männersaal, um an der Saalrunde teilzunehmen. Sie war bereits im dritten Raum, der acht Betten umfasste, angelangt. Dr. van der Merwe, ein uniformtragender Arzt von etwa dreißig Jahren, war verantwortlich für die orthopädischen Säle. Sein fast quadratisches Gesicht mit den leicht abstehenden Ohren eines Farmers strahlte Freundlichkeit aus. Er führte die Runde, gefolgt von einer männlichen Pflegekraft und zwei Schwestern, und er tat es in einer angenehm menschlichen Weise. Er begrüßte die Patienten mit Respekt und manchmal mit einem Gefühl des Mitleids, und er befragte sie gründlich über ihr Befinden. Seine Augen hefteten sich an den Temperaturverlauf auf dem Messblatt und bekamen einen ernsten Ausdruck, wenn der Pegel die 38,5-Marke überschritt. Wenn das der Fall war, begann das Frage-und-Antwort-Gefecht zwischen ihm und dem Pflegepersonal, das sich neben und hinter ihm verteilte. Dieses Gefecht, das die Note „ernsthaft“ verdiente, wurde in einer schlichten und fairen Weise ausgetragen. Es war bei einigen Patienten offensichtlich, dass eine Wundinfektion vorlag. Die Antwort auf seine Frage, ob die Antibiotika wie vorgeschrieben verabreicht wurden, entsprach ebenso der Wahrheit, wenn sie lautete, dass sie „out of stock“ seien, weil das mit der Mitteilung der Apotheke des Hospitals übereinstimmte. Die Situation war zu ernst, als dass Dr. van der Merwe zusätzlich noch in einen Anfall von Wut und Beschimpfung verfallen musste. Er hielt die Emotionen unter Kontrolle, öffnete mit einer schlecht schneidenden Schere den Verband, entfernte einige oder alle Hautnähte mit der Skalpellklinge, die er zwischen Daumen und Zeigefinger führte, und beendete erfolgreich den Eingriff durch Entlastung der Wunde, aus der Eiter quoll und sich auf die sterilisierte papierne Unterlage und das Bettlaken ergoss. Es wurde eine offene Wundbehandlung angeordnet und man vermerkte die Zeiten der Verbandswechsel im Krankenblatt. Das entsprach durchaus den Behandlungsregeln einer septischen Wunde, wenn man die Augen vor den hygienischen Missständen um den Patienten herum verschloss. Die Ausstattung des Krankensaales war völlig unzureichend, die Betten waren alt und gebrechlich, der nackte Schaumgummi kam unter den Laken zerrissen und braun gefleckt zum Vorschein. Das Ausmaß der Primitivität entsprach eher den Darstellungen eines Krankensaales zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts, es widersprach allen Errungenschaften der modernen Medizin.
Viele Patienten hatten Gipsverbände an den Armen oder Beinen. Die Gipsschienen zur Ruhigstellung von Knochenbrüchen zumeist distaler Extremitätenabschnitte ergaben oft keinen therapeutischen Sinn, weil sie entweder aufgeweicht oder gerissen waren. Die Bewegungen über der Bruchzone standen der Knochenheilung demzufolge mit der Gefahr einer Falschgelenkbildung entgegen. Waren Rundgipse an den Gliedmaßen angebracht, die nach Abschwellung des Weichteilgewebes zur Ruhigstellung des Knochenbruches durch ein Mehr an Festigkeit besser geeignet waren, so fand Dr. Ferdinand, dass einige Beingipse in den körpernahen Abschnitten nicht nur kotverschmiert waren, sondern dass das ganze Bein eine Biegung aufwies, die eine anatomiegerechte Heilung und damit die Wiederherstellung der vollen Funktion in Frage stellte. Knochenbrüche anderer Patienten wurden durch Extension behandelt. Es handelte sich hier vorwiegend um Schaft- und Halsbrüche des Oberarm- oder Oberschenkelknochens als auch um Diagnosen der zentralen oder oberen Hüftkopfverrenkung. Das Zuggewicht, das an den quer durch den Ellbogenhöcker oder die Vorbuchtung des Schienbeinkopfes geschlagenen Drähten ansetzte, deren Enden an einem Spanngerät festgemacht waren, das mit einer auf einer Rolle laufenden Schnur verbunden war, um die Knochenbrüche in eine achsengerechte Stellung zu ziehen, bestand oftmals aus angehängten Beuteln, die mit Steinen gefüllt waren, oder aus einem oder mehreren Infusionsbehältern. Daneben waren Vorrichtungen zu sehen, bei denen die Zugschnur neben der Rolle lag, die Rolle falsch platziert oder aus Rollenmangel erst gar nicht angebracht war. Die Notwendigkeit zur Improvisation aus Mangel an Geräten war ebenso offensichtlich wie die, das vorhandene, wenn auch völlig veraltete und fast untaugliche Gerät mit der Logik des klinischen Verstandes zur Anwendung zu bringen.
Im letzten Achtbettzimmer lagen Patienten, die Grund zu ernster Sorge gaben, entweder weil die Wundinfektionen unbeherrschbar schienen oder weil andere Komplikationen der Wundheilung vorlagen. Unter diesen Patienten waren jene, deren Amputationsstümpfe am Unterschenkel infolge einer schlechten Blutzirkulation klafften und den Fäulnisgeruch toten Gewebes verströmten. Andere Patienten hielten ihre Hand mit gerunzelten, mumifizierten Fingern hoch. Ein anderer, etwa fünfundzwanzigjähriger Patient, der bereits sein drittes Jahr in diesem Bett zubrachte, saß mit großflächigen Druckgeschwüren über dem Gesäß auf unnatürlich verbogenen Beinen und bewegte seine etwas weniger verbogenen Arme fast gespensterhaft. Ursache seines Leidens war die angeborene unvollständige Knochenbildung (Osteogenesis imperfecta), weshalb er schon im Kindesalter mit Schienen und zahlreichen Operationen, insbesondere an den Beinen, behandelt wurde. Doch das alles führte zu keinem anhaltenden Erfolg. Das Gehen an Stöcken und Krücken, das in seinen Kindheitsjahren noch möglich war, bescherte ihm Brüche an den Armen, die trotz vieler Behandlungsversuche in Fehlstellungen endeten, so dass er seit über zehn Jahren gehunfähig war. Die Eltern und Geschwister brachten ihn auf einem Eselskarren ins Krankenhaus, da sie ihn zu Hause nicht mehr versorgen konnten. Einen Rollstuhl gab es nicht.
Die Saalrunde erwies sich als ein afrikanischer Augenöffner. Dr. Ferdinand sah hier eine Wirklichkeit, die er in Deutschland nur aus Büchern kannte. Nach der Saalrunde folgte ein Gespräch bei einer Tasse Tee im „Doctors tearoom“, der durch eine Glaswand vom Flur der gegenüberliegenden Operationssäle getrennt war. Hier sprach Dr. van der Merwe in sehr menschlicher Weise die Komplexität der Probleme und die daraus resultierenden Schwierigkeiten in der Behandlung der Patienten, für die er zuständig war, an. „Die meisten Frakturen behandeln wir konservativ“, sagte er, „nur in einzelnen Fällen habe ich eine Knöchelfraktur mit einer Schraube fixiert.“ Es waren der Mangel an Instrumenten und Material sowie die fehlende praktische Erfahrung, weswegen schwerere Verletzungen mit schwierigen oder Mehrfachbrüchen nach Windhoek gebracht wurden. In einigen Fällen assistierten ihm bei Operationen die „Consultants“, die zweimal in der Woche vom Lazarett des Militärflughafens in Ondangwa, das etwa vierzig Kilometer ostwärts von Oshakati lag, gebracht wurden. Doch diese „Consultants“ in Offiziersrängen nicht unter einem Colonel waren in der Regel Spezialisten der Chirurgie, die Verletzungen mit Frakturen per Flugzeug direkt in das Militärhospital nach Pretoria verlegten. Auf die Frage, ob die Arbeit ihn nicht überfordere, antwortete Dr. van der Merwe, dass er froh sei, seine Dienstzeit als Arzt zu verbringen, denn hier könne er Erfahrungen sammeln, die ihm später in Südafrika zugute kommen würden. „Auch gibt es hier Weiterbildung“, fuhr er fort, „jeden Freitag halten die Spezialisten einen Vortrag über aktuelle Themen aus der Chirurgie, dem sich eine Diskussion anschließt. Das ist für uns, die wir noch in der Ausbildung sind, sehr nützlich.“ Andere Kollegen, die eben eine Operation beendet hatten, kamen in der grünen, durchgeschwitzten Operationskleidung in den „Doctors tearoom“. Während einige schweigend heißen Tee schlürften und dazu belegte Brote verschlangen, berichteten andere über die Besonderheiten, die sie bei der Operation vorgefunden hatten. Die durchgesessenen Polsterstühle waren besetzt, als auch Dr. Hutman eintrat, auf dessen Programm zwei Leistenbrüche, eine Cholezystektomie und zwei weitere Eingriffe an Hauttumoren standen. Ein Kollege verließ den Raum, nachdem er seine Teezeremonie mit der erheiternden Bemerkung, dass ein kaltes Bier jetzt besser wäre, beendet hatte. Dr. Hutman nahm seinen Stuhl ein; er tat das mit der Bestimmtheit eines erfolgreichen Arztes, dessen Gesicht Wissen und eine reiche Erfahrung signalisierte. Nach dem ersten Schluck Tee begann sein Erguss der Selbstzufriedenheit und Kenntnis über diese oder jene Operationstechnik zu strömen. Seine belehrende Art der Mitteilung anderen gegenüber und eine blendende Überheblichkeit waren dabei unverkennbar. Er nahm sich wichtig, der Sohn wohlhabender jüdischer Eltern aus Johannesburg, der an der Wits-Universität in der Mitte seiner chirurgischen Facharztausbildung stand. Seine Funktion am Oshakati Hospital ragte heraus, da die anderen uniformtragenden Kollegen ausbildungsmäßig jünger waren. Unter ihnen beobachtete Dr. Ferdinand einige, die dem herausragenden Kollegen beim Zuhören ein devotes Verhalten entgegenbrachten, während bei anderen ein leichtes Grinsen über das Zuviel seiner Selbstgefälligkeit nicht zu verkennen war. Auf die Frage, welche Methode die sicherste bei der Entfernung der Gallenblase sei, setzte Dr. Hutman zu einem längeren Monolog an, der allerdings mit dem chirurgischen Textbuch nicht immer übereinstimmte. Das zentrale Problem dabei war das rechtzeitige Auffinden der Gefäße am Gallenblasenhals und ihre Unterbindung und Durchtrennung. Die Einwände von Dr. Ferdinand aufgrund seiner Erfahrungen entkräftete Dr. Hutman mit der linken Hand und der Bemerkung, dass das nach den neuesten Erkenntnissen doch obsolet sei. Erst Wochen später stellte sich heraus, dass Dr. Hutman nicht nur den Buchtext falsch verstanden hatte, sondern dass er das Kapitel über die Verfahren der Cholezystektomie gar nicht gelesen hatte. Es zeigte sich aufs Neue, dass Dr. Hutman dem deutschen Kollegen negativ gegenüberstand und ihm mit bissiger Arroganz, die er nicht als ein Wissen vom Nichtwissen verstehen wollte, entgegentrat. „Ich werde Ihnen das Kapitel aus dem Textbuch bringen“, entgegnete Dr. Ferdinand. Dr. Hutman wehrte nun mit beiden Händen ab und empfahl ihm, er solle sich um seine eigenen Sachen kümmern und erst einmal zusehen, dass er die Arbeitserlaubnis aus Pretoria bekomme. „Dann können wir weiterreden“, schloss Dr. Hutman bedeutungsvoll die Diskussion ab.
Dr. van der Merwe hatte sich schweigend verhalten, bis er beim Leeren der Tasse bemerkte, dass er zum „Outpatient department“ gehen müsse, um die dort wartenden Patienten zu untersuchen. Auf seine Empfehlung an Dr. Ferdinand, mitzukommen, verließen beide den Teeraum. Unterwegs sprach Dr. van der Merwe von seinem Unbehagen, wie Dr. Hutman auf die Fragen reagiert und sich selbst in eine Position gehoben habe, die ihm überhaupt nicht zustehe. „Um es verständlicher zu machen“, ergänzte er, „Dr. Hutman gehört der englisch sprechenden Gruppe der Südafrikaner an und der noch kleineren Gruppe der reichen Juden. Doch das gibt ihm nicht das Recht, so unkollegial und arrogant aufzutreten.“ Dr. Ferdinand ging neben ihm her und versuchte sich ein Bild zu machen, wie die Menschen in Südafrika wohl lebten. Da gab es das Apartheidsystem mit den Gesetzen der Rassentrennung, das die weiße Minderheit zu einem Leben in Wohlstand und Reichtum und die schwarze Mehrheit der Bevölkerung zu bitterer Armut und Abhängigkeit geführt hatte; dann gab es weitere Markierungen innerhalb der weißen Minderheit, deren Linien sich zwischen den verschiedenen Sprachgruppen entlangzogen. Dr. van der Merwe war Sohn eines Farmers und gehörte der Afrikaans sprechenden Gruppe der „Boere“ an. Die Juden in Johannesburg oder Cape Town hingegen sprachen überwiegend englisch. Einige von ihnen kamen noch vor dem Zweiten Weltkrieg nach Südafrika und hatten es als Ärzte, Rechtsanwälte und Kaufleute zu enormen Reichtümern gebracht. „Ihr Einfluss auf Banken und Handel ist groß, auch besitzen sie große Farmen in den schönsten Gegenden des Landes. Sie achten mehr als die anderen Afrikaner auf die strikte Einhaltung der Apartheid.“
Es ging auf elf Uhr zu, und die Sonne brannte über den Gängen. Dr. van der Merwe öffnete eine zerrammte Tür, und sie betraten das überfüllte „Outpatient department“. Direkt links vom Eingang saß Dr. Nestor Shivute an einem ausladenden Tisch, auf dem ein bereits verjährter Blutdruckapparat zwischen Glasbehältern, Plastikspritzen und Kanülen zur Blutentnahme sowie zahlreichen weißen, gelben und blauen Formularen stand. Neben ihm saß auf einem herangerückten Stuhl mit fehlender Rückenlehne eine alte Frau, die die Jahre der Entbehrung auf ihrem Gesicht wie eine Käthe-Kollwitz-Zeichnung festhielt und den abgegriffenen Knauf eines selbstgefertigten Stockes mit seinen zahlreichen Krümmungen zwischen ihren abgemagerten Händen hielt. Dr. Nestor, im Begriff den Blutdruck zu messen, sprach den vorbeigehenden Kollegen an. Er teilte ihm mit, dass diese Patientin über starke Rückenschmerzen klage und im rechten Bein gehbehindert sei und er sie ihm zur weiteren Diagnostik und Behandlung schicken werde. Dr. van der Merwe bejahte mit nickender Kopfbewegung sein Anliegen und schritt durch die wachsende Menschentraube hindurch in einen separaten Raum, der für die Orthopädie reserviert war. Dr. Ferdinand folgte ihm und setzte sich neben seinen Kollegen an die linke Ecke eines kleineren Tisches, nahe dem geöffneten Fenster. Er sah eine Klimaanlage über dem Fenster, die jedoch seit Langem nicht mehr arbeitete. In diesem Raum saßen bereits ein junger Mann mit einem völlig verdreckten Rundgips am linken Bein und eine ältere Frau, die ihr Enkelkind, ein etwa dreijähriges Mädchen mit doppelseitigen Spitzfüßen, auf ihrem Schoß hielt. Der Patient mit dem Rundgips wurde in den Nebenraum zur Gipsentfernung beordert und eine anschließende Röntgenkontrolle angeordnet.
Dr. van der Merwe, assistiert von einer beleibten weiblichen Pflegekraft in den mittleren Jahren mit schwarzen Epauletten, deren linke infolge eines ausgerissenen Knopfes über dem Oberarm wedelte, wandte sich in der Zwischenzeit dem Mädchen mit den Spitzfüßen zu und untersuchte beide Beine auf weitere Missbildungen, die aber nicht vorlagen. Dann schaute er auf einen Kalender und teilte der Großmutter im Afrikaans mit, dass sie das Kind in fünf Wochen bringen solle, weil dann ein orthopädischer Spezialist aus Windhoek kommt, der die notwendige Operation vornehmen werde. Die Großmutter schaute die daneben stehende Schwester an, die ihr das Gesagte ins Oshivambo übertrug. Mit einem leisen „Baie dankie“ stand sie auf und band ihr Enkelkind mit dem traditionellen Tuch auf ihren Rücken, während die Schwester auf einem abgerissenen Papierstück das Datum vermerkte, wann sie wieder zu erscheinen habe, und ihr das Papier zusteckte. Beim Verlassen des Raumes wurde die alte Frau von der plötzlich nach innen aufgeschlagenen Tür fast umgeworfen, als ein junger Mann mit einem blutdurchtränkten Verband am rechten Oberschenkel auf einer Trage gebracht wurde. „Bringen Sie den Mann zum ,Outpatient theatre’“, wies Dr. van der Merwe die Schwester und die beiden Begleitpersonen an. Es war der übernächste Raum noch hinter dem Gipsraum, und Dr. Ferdinand half bei diesem Transport von Zimmer zu Zimmer durch Türen hindurch, die von wartenden Menschen umstellt waren. Dr. van der Merwe ging indessen zum Gipsraum, um beim ersten Patienten die Festigkeit des sechs Wochen alten Schienbeinbruches zu prüfen und den Mann auf einem Rollstuhl alten Baujahrs zur Röntgenkontrolle zu schicken.
Der junge Mann war bei der Feldarbeit mit einem Buschmesser, auch „Panga“ genannt, von einem anderen Mann verletzt worden. Dr. van der Merwe entfernte den Verband und fand eine tiefe, bis auf den Knochen gehende Wunde am rechten Oberschenkel vor, die sich von der Streckseite nach außen zog. Mit einem Instrumentarium, das an Dürftigkeit nichts zu wünschen übrig ließ, klemmte und unterband er die blutenden Gefäße in der Tiefe und nähte die Enden der klaffenden Muskelpartien fast anatomiegerecht zusammen. Der Eingriff wurde in Lokalanästhesie durchgeführt, wobei ihm eine junge Schwester instrumentierte als auch assistierte und die überstehenden Fadenenden nach Beendigung jeder Naht auf die erforderliche Kürze zurückschnitt. Die Operation dauerte bis zum Verband etwa vierzig Minuten, und der Patient wurde stationär aufgenommen. Er bekam ein Papier, auf dem die weiteren Anordnungen standen, wie das Tetanol zur Tetanusprophylaxe und ein Antibiotikum zur Vermeidung der Wundinfektion. Vor dem orthopädischen Untersuchungsraum hatte sich inzwischen eine längere Menschenschlange angesammelt, die bis an den Tisch mit dem seitwärts geschobenen Stuhl heranreichte, den Dr. van der Merwe zurechtrückte und darauf Platz nahm. Das waren Patienten, die mit neuen Röntgenaufnahmen zur Kontrolle einbestellt waren; andere hatten Verbände an Händen, Armen und Beinen. So verlief der Vormittag bis etwa ein Uhr, und nach einer Mittagspause ging es um zwei Uhr weiter mit Untersuchungen, Wundversorgungen und Einrenkungen von zwei Schultergelenken und einem Hüftgelenk bis in den späten Nachmittag hinein. Dr. Ferdinand, der aufgrund der noch fehlenden Arbeitserlaubnis zum bloßen Zuschauen verurteilt war und von seinem Stuhl aus das hektische Treiben in dem überhitzten Raum verfolgte, war beeindruckt vom Ausmaß der geleisteten Arbeit und den primitiven Bedingungen, die hier herrschten. Er verneinte es innerlich, dass je ein Krankenhausarzt in Deutschland ein solches Pensum unter derartigen Bedingungen schaffen würde; von denen wäre mit großer Wahrscheinlichkeit eine Arbeitsverweigerung zu erwarten oder im günstigsten Falle eine Forderung nach Stresszulage. Hier im afrikanischen Alltag eines Arztes war es so, dass das Pensum manchmal nicht ganz bewältigt werden konnte. Dann warteten die Patienten mit Geduld auf bessere Zeiten, legten sich neben den Haupteingang und übernachteten auf einer Decke, einer Pappe oder ausgelegtem Zeitungspapier, da mit Sonnenuntergang und Eintritt der Sperrstunde jede Bewegung auf offenen Straßen und Wegen untersagt war. Das Uniformhemd war über dem Rücken durchgeschwitzt, als Dr. van der Merwe gegen sechs Uhr den Orthopädieraum verließ und sich von Dr. Ferdinand mit dem Zusatz verabschiedete, dass er sich nun auf ein kaltes Bier freue. Dr. Witthuhn saß noch hinter seinem ausladenden Schreibtisch und setzte mit leicht vorgehaltener Stirn die Unterschriften in großen Zügen auf einige Schriftstücke in den hintereinander aufgeklappten Fächern der Schriftmappe. Dabei erwähnte er, dass von Pretoria keine Nachricht gekommen sei. „Wir werden abwarten“, meinte er. Dr. Ferdinand saß auf demselben Stuhl, den er während der Morgenbesprechung eingenommen hatte. Hinter seinem Schweigen lag Deutschland, das er vor zwei Wochen mit Schulden und einer Familie mit fünf Kindern im Alter von siebzehn bis vierundzwanzig Jahren verlassen hatte. Er kam mit einem Hundert-DM-Schein und drei Groschen ins Land und hatte sich fünfhundert südafrikanische Rand geliehen, die er von seinem ersten Gehalt zurückzahlen wollte, um unabhängig von anderen Menschen ein neues Leben zu beginnen. Da dieses Geld fast aufgebraucht war, drängte es ihn, so früh wie möglich tätig zu werden. „Mach dir jetzt keine Sorgen, du hast ein Bett und hast zu essen, wir werden das Kind schon schaukeln.“ Das war Dr. Witthuhn, da sprach sein Herz.
Es war der sechste Morgen im Norden Namibias. Die aufgehende Sonne erhob sich als glutroter Ball; ihr gleißendes Licht verfärbte die grün gestrichenen Wände mitsamt den schief übereinander gestapelten Kartons in ein feierliches Violett, das das Gemüt mit dem Gefühl der Trauer, der hilflosen Einsamkeit, aber auch mit der Erhabenheit eines unbekannten Schicksals umgab. Dr. Ferdinand hatte keine gute Nacht gehabt. Da gab es die Erinnerungen an Deutschland und seine Familie, die ihn nicht zur Ruhe kommen ließen, und um Mitternacht war es ein zwanzigminütiges Böllern schwerer Haubitzen, wobei seine Pritsche mit dem ganzen Drumherum in ein quietschendes Zittern geriet. Die wuchtigen, furchterregenden Geschossdetonationen in der Ferne mit den unfassbaren Wellen eines qualvollen und allmählich verstummenden Nachhalls über die wehrlosen Weiten der Angst und Hilflosigkeit erinnerten ihn an die Bombennächte seiner Kindheit und an das Heranrücken der russischen Panzer.
Dr. Witthuhn schien davon nicht sonderlich ergriffen, das Gesetz der Gewöhnung hatte ihn bereits eingenommen. Doch mit dem ersten Kaffee, den beide stehend in der Küche tranken, drückte er sein Mitleid mit den unschuldigen Menschen und besonders den völlig hilflosen Kindern aus, die durch den verheerenden Krieg verletzt und getötet wurden. „Lass uns hoffen, dass das bald zu einem Ende kommt. Die Menschen haben hier genug gelitten.“ Sie setzten sich in seinen BMW. Mehrere Startversuche waren nötig, um die Kolben des Motors ins Laufen zu bringen; dann fuhren sie über aufgewühlte Sandstraßen zum unweit gelegenen Hospital, wobei sie eine mit einer Schranke versehene Straßensperre zu passieren hatten. Die Wachhabenden, denen das Auto als auch sein Fahrer bekannt waren, hoben die Schranke mit einem freundlichen Gesicht und einem afrikaans gesprochenen „Guten Morgen“, ohne nach dem von der Militärbehörde ausgehändigten Ausweis zu fragen, dessen Vorzeigen an diesem Kontrollpunkt, der die Grenze zum Wohngebiet „For Whites Only“ markierte, zur Pflicht angeordnet war. Das Hospitalgelände war von einem zweieinhalb Meter hohen Maschendraht umzäunt. An der etwa sechs Meter breiten Einfahrt war der linke Torflügel völlig verbogen und unbeweglich und stand offen, während der rechte Flügel, der weniger verbogen war, ein so großes Loch im Maschendraht hatte, dass ein Erwachsener bequem durchsteigen konnte. Ein magerer, etwas älterer Ovambo mit zerrissener Hose öffnete dieses Tor nicht ganz ohne Anstrengung, indem er es mit beiden Händen in gebückter Haltung weit unten an der einst senkrechten Rahmenstange fasste und bewegte. Der Vorplatz war zur frühen Morgenstunde noch belagert von den Menschen, die hier übernachtet hatten und Wäschestücke zum Trocknen über das Geländer vor der Rezeption hängten oder auf einer freien Bodenstelle ausbreiteten. Mütter zogen ihre Brüste aus Kleidern und Tüchern hervor und führten sie an die Münder ihrer Säuglinge. Dazu belebten Neuankommende, die erkrankte Familienangehörige an Händen und Armen führten oder von einem Eselskarren mühsam herunterholten, in noch überschaubarer Weise den Platz.
Es war Routine zur morgendlichen Stunde, dass Dr. Witthuhn mit seinem Besucher, dem noch zur Untätigkeit verdammten Kollegen aus Deutschland, mit einem freundlichen Gruß zum Wärter durch das geöffnete Tor bis an die Südmauer mit den hoch liegenden schmalen Querfenstern des Ärztekasinos heranfuhr. Beim Gang zu seinem Büro begegneten ihm Menschen weißer und schwarzer Hautfarbe, die ihn in Gespräche über die letzten Vorkommnisse im Hospital und die Geschehnisse in den schwarzen Wohngebieten verwickelten. Dabei erfuhr er, dass einige SWAPO-Kämpfer Unterschlupf unweit des Dorfes gefunden hatten und ein Warenlager am westlichen Dorfausgang mit Säcken voller Mais und einem größeren Bestand an Mahangu niedergebrannt wurde.