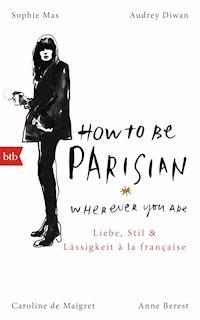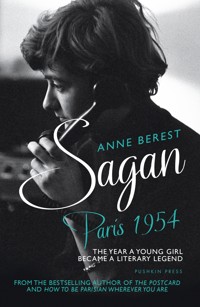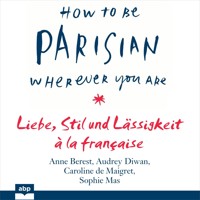15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe, Stil und Lässigkeit à la française - ein moderner Frauenroman von einer der aufregendsten Autorinnen Frankreichs
Für Emilienne ist ihre Nachbarin Julie das leuchtende Vorbild – all das, was sie, der nette Kumpeltyp, niemals sein wird: die perfekte Mutter, die perfekte Karrierefrau, die perfekte Ehefrau, die perfekte Gastgeberin… bis zum perfekten Zusammenbruch. An dem Tag beschließt Emilienne, dass es ihr mit all den an die Frauen herangetragenen Ansprüchen reicht. Gibt es das überhaupt, von dem alle sprechen und nach dem alle trachten: die perfekte Frau? Sie beschließt, sich auf die Suche zu machen.
Anne Berests neuer Roman ist ein gekonntes Spiel mit weiblichen Rollenbildern, Erwartungen und Tabubrüchen, lässig, sinnlich und sehr humorvoll.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über das Buch
Für Emilienne ist ihre Nachbarin Julie das leuchtende Vorbild – all das, was sie, der nette Kumpeltyp, niemals sein wird: die perfekte Mutter, die perfekte Karrierefrau, die perfekte Ehefrau, die perfekte Gastgeberin … bis zum perfekten Zusammenbruch. An dem Tag beschließt Emilienne, dass es ihr mit all den an die Frauen herangetragenen Ansprüchen reicht. Gibt es das überhaupt, von dem alle sprechen und nach dem alle trachten: die perfekte Frau? Sie beschließt, sich auf die Suche zu machen.
Anne Berest neuer Roman ist ein gekonntes Spiel mit weiblichen Rollenbildern, Erwartungen und Tabubrüchen, lässig, sinnlich und sehr humorvoll.
Über die Autorin:
Anne Berest, geboren 1979, ist Journalistin und Mitautorin des internationalen Bestsellers»How to be Parisian wherever you are«. Sie hat bereits drei Romane, u. a.überFrançoise Sagan, veröffentlicht und gilt als eine der interessantesten Personen in der literarischen Szene Frankreichs. Im Knaus Verlag erschien von ihr bisher»Traurig bin ich schon lange nicht mehr«.
Anne Berest
Emilienne oder die Suche nach
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Recherche femme parfaite« bei Bernard Grasset, Paris
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © Éditions Grasset et Fasquelle, 2015 Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe beim Albrecht Knaus Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlag: Sabine Kwauka unter Verwendung von shutterstock-Motiven
Für Tessa
Man könnte meinen, hier sei etwas Merkwürdiges passiert.
Pedro Almadóvar,Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs,
Julie
Julie Margani begriff nicht, wieso sie nicht schwanger wurde. Dabei hatte sie doch den Termin für die Empfängnis so genau geplant. Am Ende der großen Ferien würde sie entbinden, und im Januar – wenn ihr Unternehmen sie dringend brauchte – könnte sie wieder arbeiten. Aber ihr Körper wollte nicht gehorchen, und Monat für Monat kam ihre Regel. Julie war es nicht gewohnt, dass sich die Ordnung der Welt nicht nach ihren Wünschen richtete; immer häufiger bemerkte sie Anzeichen innerer Unruhe – Panikattacken in der Metro, Widerwillen gegen bestimmte Nahrungsmittel. Vor allem aber die Angst vor der Unordnung.
Als Julie in meinem Treppenhaus auftauchte, erkannte ich in ihrem hübschen Gesicht sofort die Züge des Kindes, das sie einmal gewesen war. Meine neue Nachbarin hatte zu der Kategorie mustergültiger kleiner Mädchen gehört, die nie ihre Schwimmsachen vergessen, deren Haarspangen in den immer ordentlich frisierten Haaren nie verrutschen und die sich die Beine nicht mit dem Rasierer des Vaters enthaaren. Ich war immer gern mit diesen anmutigen Wesen zusammen, die in ihrer eigenen, wohlgeordneten Welt heranwuchsen. Natürlich versuchte ich erst gar nicht, solchen Vorzeigemädchen ähnlich zu sein – bestimmte Kämpfe sind von vornherein verloren –, aber ich wurde ihre Freundin, ihre beste Freundin, ihr kleiner Schützling. Und ich fand rasch Geschmack an dem Leben als Lieblingsfreundin, denn ich wurde zu ihren Geburtstagsfeiern eingeladen, wo ich mindestens genauso viel Briefpapier, lustige Radiergummis und Hologramm-Aufkleber einheimste wie sie. Auf dem Pausenhof liehen sie mir ihre tollen My-Little-Pony – Püppchen, die so lecker nach Erdbeere rochen. Vor allem liebte ich ihre weichen Betten, in denen wir Kopf an Fuß schliefen; in ihren gebügelten Pyjamas vertrauten sie mir dort ihre Geheimnisse an und ließen mich an der Kosmogonie ihrer wunderbaren Kindheit teilhaben. Meine Liebe für sie wurde durch unseren Umgang nie geschmälert, ganz im Gegenteil – mustergültige Mädchen sind liebreizende Wesen von unerschütterlicher Freundschaft. Auch viele Jahre später noch bewunderte ich Frauen wie meine Nachbarin Julie unendlich; eine Frau, die mit ihren vierzig Jahren eine Firma leitet, die sich auf langfristige Kundenbetreuung für eine weltweit renommierte Unternehmensgruppe spezialisiert hat; eine Frau, die geschickt Kuchen in Hamburger-Form backen kann; eine Frau, die, nachdem sie ein Meeting geleitet hat, in einen engen Rock schlüpft, sich mit ihrem Mann in der Oper trifft und händchenhaltend bei MadameButterfly weint. Ich mag es, ihr Leben zu beobachten und ihren Alltag zu teilen – ganz ehrlich, ich bewundere sie. Ich selbst übernehme nicht gern Verantwortung, ich koche auch nicht gern, ich ergreife vor anderen nie das Wort, und ich kann mich ohne eine Spur von Selbstwertgefühl zu einem ersten Rendezvous begeben. Unnötig zu betonen, dass es zum Teil die Faszination dieser Unterschiede ist, auf denen unsere Freundschaft beruht. Ich profitiere von Julies tadelloser Organisiertheit – dafür bringe ich sie zum Lachen. Die Feststellung, dass unsere Gegensätze tief in unserer Kindheit wurzeln, ist gewiss banal, aber so ist es nun mal. Julies Eltern waren beide Logopäden und haben ihr Leben lang gemeinsam eine angesehene Praxis in Paris geführt. Auch meine Eltern waren Sprachkünstler – beide waren Komiker. Leider aber wurden sie nie berühmt.
Fast zwanzig Jahre lang waren mein Vater und meine Mutter ein Duo, zwischen 1981 und 1998 traten sie auf allen Bühnen Frankreichs auf. Komiker als Eltern zu haben, ist keine besonders lustige Erfahrung, vor allem wenn man die einzige Tochter ist. Julie hingegen hatte das Glück, mit drei Brüdern aufzuwachsen, was für das Leben einer Frau von großem Vorteil ist. Ich habe zum ersten Mal ein männliches Geschlechtsorgan gesehen, als ich meine Jungfräulichkeit verlor. Frauen, die von Kindesbeinen an mit dem anderen Geschlecht zu tun haben, trifft es nicht so unvorbereitet – sie wissen Bescheid über Männer. Ich dagegen kannte sämtliche Zimmertheater, Kabaretts, Gemeindesäle und Ausflugslokale auf der französischen Landkarte wie meine Westentasche, und wenn es darum geht, die Départements aufzuzählen, bin ich unschlagbar.
Julie schlief ihre ganze Kindheit über im selben Zimmer, im selben Bett, im zweiten Stock eines Haussmann-Baus. Achtzehn Jahre lang aß sie jeden Sonntagabend mit ihrer Familie in der Küche vom sogenannten »Kalten Büfett«. Ganz anders bei mir. Ich wurde in meiner Kindheit herumgeschleppt wie ein Koffer, von verrauchten Zimmern in improvisierte Garderoben. Und wenn ich sage »wie ein Koffer«, dann ist das wortwörtlich zu verstehen, denn meine Eltern hatten einen Sketch mit dem Titel Der Koffer im Programm.
Meine Mutter betrat die Bühne mit einem großen Koffer und rannte auf die Zuschauer zu, als wollte sie einen imaginären Zug erwischen, während mein Vater gemächlich hinter den Kulissen hervorkam. Pfeifend. In aller Seelenruhe. Hände in den Hosentaschen. An dieser Stelle begannen meine Eltern aus irgendeinem Grund zu zanken, und während des Streits kamen wie durch Zauberhand zwei kleine Beine aus dem Koffer hervor; er erhob sich vom Boden und ging ganz allein davon zu einem ruhigeren Platz. Als meine Eltern den Koffer nicht mehr sahen, dachten sie, er wäre gestohlen worden. Aufregung, Ohrfeigen, Geschrei. Erschreckt von dem Handgemenge, flüchtete sich der Koffer hinter die Kulissen und wurde so lebendig wie in einem Comic. Ein Gegenstand, der die Beine in die Hand nahm und wegrannte, löste Verblüffung im Saal aus, es folgten laute Lachsalven. Die Leute sprangen auf vor Freude, applaudierten und klatschten begeistert in die Hände. Mein Herz klopfte zum Zerspringen, denn – man konnte es sicherlich erraten – ich war diejenige im Koffer, ich, die kleine Emilienne. Von meinem achtzehnten Monat bis zu meinem vierten Lebensjahr war ich der Schlangenmensch für meine Eltern.
Doch eines Tages sprossen meine Arme und Beine unwiderruflich in alle Himmelsrichtungen. Ein paar Sommermonate, und ich passte nicht mehr in den Koffer. Mein Hintern erhielt plötzlich beträchtliche Bedeutung in meinem Leben. Schnell versuchten meine Eltern, ein anderes Baby zu bekommen, leider ohne Erfolg. Jahre später, als ich selbst Mutter war, schlugen sie mir vor, mein Kind zu engagieren, und träumten schon davon, wieder in ihre alten Bühnenkostüme zu schlüpfen. Aber ich war unbeugsam – mein Sohn würde nicht zur Requisite werden.
Ich muss dazusagen, dass ich mir aus dieser Zeit des vergänglichen Ruhms eine gewisse Klaustrophobie bewahrt habe sowie eine große Gelenkigkeit. Auch Julie ist sehr beweglich, aber sie hat es dem klassischen Ballett zu verdanken, bei dem sie ihren geschmeidigen Körper jahrelang in Übungen an der Stange trainiert hat. Ich stelle sie mir vor als kleines hübsches Mädchen im rosaroten Ballettröckchen, mit einem straffen, einwandfreien Dutt, bei ihrem Auftritt vor etlichen Reihen von VHS-Videokameras. Während Julie ihr Kostüm für den Jahresabschlussball nähte, zog ich durch die Straßen und verteilte auf den Schultern meiner Eltern Flyer für ihre »Off«-Aufführung im Rahmen des Festivals von Avignon.
Fünfundzwanzig Jahre später wurden Julie und ich Nachbarinnen.
Nach einiger Zeit kam die gute Nachricht – Julie war endlich schwanger. Ihre Schwangerschaft war vorbildlich. Mit der einen Hand cremte sie sich die Brüste mit straffender Hautlotion ein, mit der anderen blätterte sie durch sämtliche geburtsvorbereitende Literatur, so intensiv, dass sie sich Monat für Monat mehr Know-how in Sachen Säuglingspflege aneignete und zur professionellen Mutter wurde. Mit ihrem Liberty-Köfferchen passend zum blassrosa Nagellack brach sie zur Entbindungsstation auf.
Am darauffolgenden Samstag sah ich sie mit ihrem Baby in einer Weidenwiege heimkehren, so frisch und strahlend, als käme sie eben vom Markt zurück mit dem schönsten Stück des Fleischers in der Tasche. Noch vor dem Ende ihres Mutterschaftsurlaubs nahm sie ihre Arbeit wieder auf und auch die sexuelle Beziehung zu ihrem Mann, nachdem sie den Kurs zur beschleunigten Wiederherstellung ihres Perineums absolviert hatte.
Ich bewunderte Julie. Ohne Witz. Es war unglaublich, was sie an einem einzigen Tag bewerkstelligen konnte. Voller Liebenswürdigkeit und als ginge ihr alles mühelos von der Hand. Ohne zu klagen. Und mit einem Lächeln auf den Lippen, bitte schön!
Ich weiß, wovon ich spreche, ich bin Fotografin, mein Beruf besteht darin, Menschen zum Lächeln zu bringen – was gar nicht so einfach ist. Jahrelang habe ich ganze Klassen fotografiert, von der Kinderkrippe bis zur Abschlussklasse, hauptsächlich in Problemvierteln, sogenannten prioritären Bildungszonen der Départements Seine-et-Marne und Marne. Die Krux an Schulen ist, dass es von der Schulleitung gern gesehen wird, wenn man an den schulischen Veranstaltungen teilnimmt, außerdem muss man Weihnachtskarten schicken, damit die Leute im folgenden Jahr an einen denken. Ich würde sagen, die »Pflege der Kundenbeziehungen«, wie Julie es nennt, ist nicht meine vorrangige Stärke bei der Arbeit, deshalb hat Julie mich an eine Agentur vermittelt, die dies für mich übernimmt. Die Agentur bietet meine Dienste Unternehmen an, die für Seminare, Cocktailabende, Wohltätigkeitssoireen oder sportliche Aktivitäten ihre Angestellten am Arbeitsplatz fotografieren lassen möchten. Die Agentur druckt dann die Porträts lächelnder Arbeitnehmer, die glücklich bei der Arbeit und stolz auf ihre Firma sind, auf Becher, T-Shirts oder Magneten, die an Kühlschränken verstauben. Heute arbeite ich im Wesentlichen mit der Agentur, was mir auch den ganzen Schreibkram erspart. Außerdem musste ich mit den Hochzeiten aufhören, obwohl das eine sehr lukrative Sparte ist, zweifellos die einträglichste in unserem Beruf, vor allem aber eine nicht versiegende Quelle von Problemen. Nie habe ich Frischvermählte kennengelernt, die mit ihrem Hochzeitsalbum zufrieden waren. Am Ende sind sie immer enttäuscht. Da haben sie sich in märchenhafte Erinnerungen an den schönsten Tag ihres Lebens hineinfantasiert und werden mit der Realität der Bilder konfrontiert, mit der Hässlichkeit ihrer provinziellen Dekorationen, der geschmückten Büfetts und ihrer Festsäle. Die Frauen stellen fest, dass sie in ihren rauschenden weißen Kleidern aussehen wie Napfkuchen, und die Männer merken, wie lächerlich ihr babyrosa Anzug wirkt. Aber was soll ich da machen? Jedenfalls überschütten sie dich hinterher endlos mit Vorwürfen und erklären, das alles sei deine Schuld; dann knausern sie bei der Rechnung, weil du vergessen hast, die Verwandten aus Australien zu fotografieren; außerdem musst du die Negative der Bilder zerstören, auf denen Papas Hände sich selbstständig machen. Doch das eigentliche Problem ist, dass ich wegen der Einladung auf ein Glas Champagner hier und auf ein letztes Likörchen da nicht selten im Bett eines Gastes gelandet bin. Doch da der Beruf des Fotografen hauptsächlich auf Mundpropaganda beruht, muss man sich darauf verstehen, seinen Ruf zu wahren – auch das gehört nicht zu meinen großen Stärken.
Also mache ich eben einen Brotberuf. Dennoch versuche ich, mich auch als Künstlerin durchzuschlagen, natürlich unter einem anderen Namen. Auf meiner Wikipedia-Seite steht: »Emilienne Cramaut (*14. September 1984 in Limoges), auch unter dem Pseudonym Emilienne Valse bekannt, ist bildende Künstlerin und Fotografin in Frankreich.« Ich habe mir das Pseudonym Valse ausgesucht, weil ich Familiennamen, die von einem Verb abgeleitet sind, so gerne mag. Schon früh in meinem Leben habe ich begriffen, wie wichtig Familiennamen sind; das war Anfang der Neunzigerjahre, als ich mit Carole Courre in dieselbe Klasse ging. Ich war sieben Jahre alt. Meine Eltern hatten sich in dem Vorort Bourg-la-Reine im Süden von Paris niedergelassen, weil sie entschlossen waren, »ihr Glück in der Hauptstadt zu suchen«, indem sie an einem Abend in der Woche im Don Camilo auftraten, einem Kabarettlokal in der Rue des Saints-Pères – jeden Dienstag, wenn ich mich recht entsinne.
Sie meldeten mich in der Grundschule Olympe de Gouges an, ganz in der Nähe des Schnellbahnhofs der Linie B – was für mich eine tiefgreifende Veränderung bedeutete, denn bis dahin hatten mich meine Eltern selbst unterrichtet. Sie waren nicht gerade die Schlauesten, und ich träumte von einem Schulranzen, einem brandneuen Federmäppchen und vor allem von einem Spiralblock mit bunten Trennblättern. Ich erinnere mich an das Geräusch, das die Stühle machten, wenn sie beim Klingeln über den Boden schabten, an das Geräusch umgeblätterter Seiten, der Füllfederhalter, die über die Hefte glitten, und das Kindergeflüster. In diesem Lärm war ich das glücklichste Mädchen der Schule.
Carole Courre war die Beste in unserer Klasse, und ihre Schönheit übte eine geradezu erotische Anziehungskraft auf mich aus. Beim morgendlichen Aufrufen hörte ich direkt vor meinem Namen, »Emilienne Cramaut«, »Carole Courre«. In meinen Ohren klang die frappierende Alliteration wie ein Befehl. Als würde die Lehrerin ihr mit dem Imperativ des Verbs courrir zurufen: »Lauf, Carole, lauf!« Ihr Name wollte etwas sagen, er nahm Geschwindigkeit auf, tanzte im Wind, erhob sich in die Lüfte, während wir anderen armen Tröpfe Namen ohne Bedeutung hatten, ohne Bestimmung – Namen wie Emilienne Cramaut oder Dimitri Leroux fordern nicht zum Handeln auf oder dazu, irgendetwas Außergewöhnliches aus seinem Leben zu machen, allenfalls vielleicht, sich die Haare rot zu färben. Überdies, es klingt blöd, aber Carole Courre konnte sehr schnell rennen, als hätte ihr Name sie dazu prädestiniert, allen anderen weit voraus zu sein. Also habe ich ein Pseudonym gewählt, das sich vom Verb valser, »tanzen«, ableitet, in der Hoffnung, dieser Name würde wie ein Planet Einfluss nehmen auf die Bahn, die ich als Fotografin ziehen würde. Mit zwanzig Jahren wünschte ich mir, jeder Tag meines Daseins möge ein Tanz sein und mein Leben sollte eine wilde Schneise schlagen mitten durch all die gesellschaftlichen Verpflichtungen.
Zugegeben, im Moment ist noch nichts von alledem eingetreten. »Im Moment« sagen wir wohlweislich, denn in meinem langen Leben parallel zur Erfolgsspur ist es ja nicht gesagt, dass wir nie zusammenkämen – selbst gerade Linien treffen sich schlussendlich am Horizont. Im Gegensatz also zu dem, was in meinem Wikipedia-Eintrag steht, bin ich nicht bekannt, und ich würde hoch wetten, dass ihr noch nie von mir gehört habt. Dennoch bin ich überzeugt, dass mich ein paar meiner Fotos überleben werden – und ich vielleicht nach meinem Tod bekannt werde –, aber im Moment kann ich mit so viel Stolz wie Demut versichern, dass ich mich wie ein Müllsack fühle.
»Ein Müllsack zu sein« ist ein Ausdruck, den ich erfand, nachdem ich den Film Der Lauf der Dinge gesehen hatte, 1987 von den Schweizern Peter Fischli und David Weiss gedreht. Ein Experimentalfilm, der zeigt, wie Gegenstände nacheinander Bewegungsimpulse an die nächsten weitergeben – so wie bei diesen gigantischen Dominoeffekten, für die man in den Ländern des Ostens junge Leute organisiert, die monatelang ehrenamtlich kilometerlange Reihen von Dominosteinen aufstellen, nur um einen Weltrekord zu knacken. In dem Film von Fischli und Weiss sind es keine Dominosteine, sondern ein Sammelsurium verschiedenartiger Gegenstände aus einer Werkstatt, die durch Feuer, Wasser oder die Schwerkraft in Bewegung gesetzt werden.
Alles beginnt mit einem Müllsack, der einen Autoreifen anstupst.
Ein Müllsack streift einen stehenden Autoreifen, auf den eine Wasserflasche geklebt ist. Diese Berührung setzt den Reifen in Bewegung, und das Wasser läuft aus der Flasche in einen Plastikbecher, der an einem zweiten Reifen angebracht ist. Also rollt auch der langsam an und beschleunigt durch das Gewicht des Wassers. Daraufhin ergießt sich der Inhalt seiner eigenen Flasche in den Eimer an einem dritten Reifen aus schwarzem Gummi. Dieser Reifen ist kleiner und somit langsamer als die beiden ersten, doch er rollt zügig weiter zu einem vierten, sehr dicken Reifen, den er heftig anstößt und der, beschleunigt von seiner Masse, auf seinem Weg über eine Holzleiter rollt, deren Sprossen seine Bahn leicht behindern. Doch der vierte Reifen überwindet sie eine nach der anderen mit Müh und Not, und genau in dem Moment, wo er ernsthaft Geschwindigkeit verliert, stößt er einen fünften Reifen an. Der Aufprall verleiht dem Reifen die Kraft, die Sprossen der Leiter nacheinander leichter zu bewältigen, bis er einen sechsten Reifen streift, der auf einer anderen Leiter steht. Dieser Reifen wiederum setzt sich schwerfällig in Bewegung, bringt dennoch die Leiter hinter sich und rollt auf ein Holzbrett, wo er eine kleine Papprolle von etwa zehn Zentimetern Durchmesser anstößt, eine leichte Röhre von heller Farbe, die geradezu lässig wirkt im Vergleich zu den plumpen Reifen. Sie rollt mehr oder weniger ziellos weiter und fällt herunter. Im Fall stößt sie ein anderes Holzbrett an, das hin und her schwingt und dabei zwei weitere kleine Holzlatten mit sich reißt. Und so weiter.
Das ist die erste Minute des dreißigminütigen Films.
Als ich den Film zum ersten Mal sah, blieb mir die Luft weg. Ich hatte richtig Angst. Ein Nichts würde genügen, und die kleine Röhre rollt zwei Millimeter weiter nach rechts, verfehlt dadurch die Glasplatte und stoppt die Kettenreaktion … Aus dieser fiebrigen Erwartung erwuchs eine fast unerträgliche Spannung; ich war bis in die letzte Faser meines Wesens angespannt, als könnte eine Sekunde der Unachtsamkeit von mir den korrekten Ablauf des Prozesses hemmen – wie im Theater, wo ich die Luft anhalte, bis die Schauspielerin, die eine Erinnerungslücke hat, den Faden in ihrem Text wiederfindet. Mehr als alle Bücher, die in der Welt geschrieben, mehr als alle Filme, die gedreht wurden, mehr als alle philosophischen Abhandlungen stellte der Film Der Lauf der Dinge meiner Ansicht nach eine Theorie der Existenz auf – zumindest meiner Existenz –, denn »der Müllsack zu sein« steht für die Vorstellung, dass eine kleine Bewegung am Anfang einer großen Veränderung stehen kann. Die gespielt zufälligen Ereignisse können zusammen in Reihe ihr Schicksal erfüllen; das Schwierigste dabei ist, den ersten Impuls zu geben.
Auf diese Weise habe ich mein schönstes Foto geschossen, auf das ich mächtig stolz bin: Ich hatte Julie an jenem Tag gebeten, sich vor den Schrank in ihrem Schlafzimmer zu stellen. Ich wollte ihre Kleiderstapel als Bildhintergrund nehmen, ihre ordentlich aufgeräumten Fächer mit den Kleidungsstücken, die zusammengefaltet und nach Farbtönen geordnet sind wie im Kaufhaus. Vor dieser Kulisse stand Julie mit ihrem Baby im Arm. Das Kind öffnete den Mund an Julies Brust, die aus einer blütenweißen Bluse lugte. So stellte ich mir Julie vor, als veritable moderne Madonna. Während ich Blende und Belichtung einstellte, kam aus Julies Brust ein Strahl Milch, und auf ihrer perfekt gebügelten Bluse zeichnete sich ein grauer Ring ab. Als Julie es bemerkte, riss sie die Augen auf, zog eine Grimasse und hielt das Baby von sich weg. Das Ergebnis war ein verblüffendes Foto, auf dem man eine Mutter sieht, die fassungslos auf ihr Kind starrt, als hätte sie sich vor ihm erschrocken. Es ist völlig offen, ob sie im nächsten Moment anfangen wird zu schreien, ob sie das Kind fallen lassen oder im Gegenteil in Lachen ausbrechen wird. Das ist meine Arbeit. Ich gehöre nicht zu den Fotografen, die versuchen, neue Bilder zu konstruieren. Ich will den Betrachter weder erschüttern, noch will ich starke Gefühle in ihm wecken. Ich gehöre auch nicht zu den Dokumentarfotografen, ich gebe nicht vor, die Welt abzubilden, die mich umgibt. Ich möchte einen Schwebezustand festhalten, einen Zwischenmoment, möchte eine Art Spannung erzeugen.
Nachdem Julie an besagtem Nachmittag die Bluse gewechselt hatte, haben wir uns in die Küche gesetzt und geredet. Während sie von Hand ein Püree aus überreifem Gemüse zubereitete, erzählte ich ihr, dass mein Sohn Sylvain, als er so alt war wie ihr Baby, nur Cremepudding gegessen hat, die einzige Nahrung überhaupt, die er sich einflößen ließ. Auf einmal bekam ich Durst. Julie war auf ihr Püree konzentriert. Ich öffnete ihren Kühlschrank, einen Kühlschrank, der immer sauber und nach Zitrone roch. Hatte mir die Episode mit der Bluse Lust auf Milch gemacht? Jedenfalls sprang mir gleich eine schöne Glasflasche ins Auge, ganz weiß. Ich nahm sie heraus, um meinen Durst zu stillen. »Nein!«, schrie Julie – da hatte ich die Flasche mit großen Schlucken bereits zur Hälfte geleert.
»Das ist meine Milch!«, erklärte sie verzweifelt. »Ich bringe sie in die Klinik, um Müttern zu helfen, die Schwierigkeiten mit dem Stillen haben«, fügte sie hinzu. Das gab mir den Rest.
Und ich spuckte meinen gesamten Mageninhalt auf die Kühlschranktür, vor dem unruhigen Blick ihres Babys – das es mir nachmachte. Damit möchte ich nur sagen, dass Julie für mich zu jenen Frauen gehörte, die in den Freuden der Mutterschaft nur so schwelgen, wahrhaftige Füllhörner, denen man die eigenen Kinder anvertrauen würde, damit sie sich einer perfekten Erziehung erfreuen, und deren hübsche Konterfeis man anschließend auf Medaillen graviert mit der Inschrift: »Das dankbare Vaterland.«
Doch am folgenden Abend klingelte Julie bei mir, das Baby auf dem Arm, und fragte, ob es die Nacht über bei mir bleiben könne. »Er wird nicht mehr aufwachen, er ist viel zu müde«, sagte sie noch und sabberte ziemlich. Sie trug ein weites, schmutziges T-Shirt, murmelte kaum hörbar irgendwelches Kauderwelsch, und ihr Blick schwamm über die Dinge wie Algen am Rand einer Lagune. Ich war es gewöhnt, dass Julie das Kind hin und wieder für eine Stunde bei mir ließ, aber noch nie mitten in der Nacht und einfach so, ohne Vorankündigung. Als sie ihr Päckchen losgeworden war und sich umdrehte, um wieder in ihre Wohnung zu gehen, sah ich, dass sie keine Unterhose anhatte. Das war ein schlechtes Zeichen. Denn die letzte Person, die ich bei mir mit nacktem Hintern herumlaufen sah, war meine Urgroßmutter zu Beginn ihrer Alzheimererkrankung.
Ein paar Minuten später klingelte dann Julies Mann, brachte Windeln und bestätigte das Problem. Julie, stammelte er, sei seit ein paar Tagen ein bisschen krank, sie müsse schlafen. Deshalb brachte Thierry seine Frau zu ihren Eltern, wo sie übernachten sollte; er würde das Kind so bald wie möglich wieder abholen. Doch am nächsten Tag besuchte ich meine Freundin in der psychiatrischen Klinik Sainte-Anne. Der Hausarzt hatte bei Julie einen akuten postpartalen Erschöpfungszustand diagnostiziert und sie einweisen lassen.
»Dieses Problem trifft vor allem gut ausgebildete, beruflich sehr erfolgreiche Frauen, die versuchen, auch im familiären Umfeld die Perfektionsstandards zu erreichen, die sie aus ihrem Berufsleben kennen«, hatte der Arzt gesagt.
Diese Frauen, erläuterte er, sind psychischen Problemen ausgeliefert, die sie oft überspielen. Sie verwandeln ihre Verzweiflung in Lebensenergie. Sie sprühen vor Enthusiasmus, was für ihr Umfeld beeindruckend ist, tragen die Fahne einer erfüllten Mutterschaft vor sich her, empfinden sich als Galionsfiguren einer übermächtigen Weiblichkeit, und dann brechen sie eines Tages zusammen. Schlicht und ergreifend.
Julie konnte tatsächlich überhaupt nichts mehr tun. Nicht sprechen. Nicht aufstehen. Sich nicht bewegen. Sie war wie ausgelöscht. Die Psychiater hatten ihr ein paar Wochen Ruhe verordnet, weit weg von ihrem Kind, weit weg von allem, was sie an die Welt von Kleinkindern erinnerte, an diese verstörende Babywelt, die sie von nun an mit ihren Albträumen in Verbindung brachte. Als ich sie an jenem Tag im Hospital besuchte, wurde mir klar, dass meine Nachbarin im Lauf der Jahre meine engste Vertraute geworden war, dass Julie in meinem Leben einen Platz eingenommen hatte, der sehr viel bedeutender war, als ich gedacht hatte. Ihre stille Anwesenheit auf der anderen Seite des Hausgangs, ihre immer gleich gute Laune, ihr Rosenduft im Treppenhaus – all das war, ohne dass ich mir dessen bewusst gewesen wäre, zu einem wesentlichen Teil meines Alltags geworden.
In das Hospital Sainte-Anne gelangt man durch ein blaues Tor in einem monumentalen Portal mit Ziergiebel. Wenn man hindurchtritt, beschleicht einen sofort das Gefühl, das Tor könne sich für immer hinter einem schließen. Ich brauchte eine Weile, bis ich Julies Zimmer gefunden hatte. Sie erwartete mich mit aufgedunsenem, glänzendem Gesicht. Sie weinte viel, sagte, dass sie sich Vorwürfe mache, dass sie es nie schaffen werde, dass sie niemals so sein könne wie andere Frauen.
»Aber welche Frauen meinst du denn?«, fragte ich sie.
»Die anderen!«, schrie sie und spuckte mir Krümel eines Feigenkekses ins Gesicht.
Und dann fing Julie an zu flüstern, als müssten wir uns plötzlich vor der Außenwelt in Acht nehmen: »Man verlangt von uns Frauen, perfekt zu sein. Damit wir uns zu Tode schuften! In allen, allen Lebensbereichen sollen wir Heldentaten vollbringen.«
»Na ja …«, sagte ich überrascht, ich hatte Julie noch nie so wütend erlebt.
»Siehst du das denn nicht? Eine Armee von Frauen in Habtachtstellung wie Schweizer Messer hat sich in Marsch gesetzt und lässt sich davon terrorisieren, nicht aus der Reihe tanzen zu dürfen: immer jung, immer leistungsfähig, immer schön.«
Julie flüsterte nicht mehr, sie war nun nicht mehr zu bremsen und sprach hektisch.
»Unsere Mütter haben geglaubt, sie hätten die Welt verändert. Aber in Wahrheit haben sie uns an den Abgrund geführt – wie der Rattenfänger von Hameln! Jetzt müssen wir nicht mehr nur in allen Bereichen volle Leistung erbringen – Arbeit, Familie, Ehe –, wir müssen nicht nur alle Kompetenzen besitzen, wir müssen sie uns auch noch ad vitam aeternam bewahren! Der Unterschied zwischen einer fünfundzwanzigjährigen und einer sechzigjährigen Frau darf heutzutage weder in ihrem Aussehen noch in ihrer Art, sich zu kleiden, und auch nicht in ihrem Geschmack liegen, sondern in ihrer Kaufkraft, sprich, im Preis, den sie für ihre Tagescreme bezahlen kann. Dir ist das natürlich egal«, merkte Julie an, »du benutzt ja noch nicht einmal eine Spülung nach dem Haarewaschen.«
»Ich verstehe den Zusammenhang nicht«, sagte ich ein wenig gereizt.
»Der Zusammenhang besteht darin, dass du dich für eine freie Frau hältst. Du glaubst sogar, dass die Frau in der Geschichte der Menschheit noch nie so frei war wie heute. Aber sieh dich doch um!«
»Und?«, fragte ich, während ich reflexartig nach rechts und links blickte und etwas fassungslos war über die Wendung, die unser Gespräch genommen hatte.
»Die Stellung der Frau! Wir meinen, wir hätten den Höhepunkt unserer Freiheit erreicht, aber in Wirklichkeit markiert das 21. Jahrhundert den Gipfel unserer Versklavung. Wir sind zu Kamikazen geworden und gehen daran zugrunde.«
Dann brach Julie erschöpft auf dem Bett zusammen und bat mich, sie in Ruhe zu lassen. Im Gehen dachte ich, dass die meisten Leute Krankenhäuser ja nicht sehr mögen – mich hingegen beleben sie. Nie fühle ich mich gesünder, als wenn ich ein Hospital verlasse. Es ist dasselbe Gefühl der Erlösung wie am Ende eines Bühnenstücks, wenn man die Pforten des Theaters aufstößt, die frische Luft draußen einem die Lungen füllt, die Beine sich wieder in Bewegung setzen, man endlich wieder reden, sein Leben weiterleben kann, ein normales Leben, in dem die Menschen beim Sprechen nicht jede Silbe übertrieben betonen und einem dabei ihren Speichel auf die Jacke sprühen.
Ich machte mir Sorgen wegen der Auswirkungen, die eine Einrichtung wie Sainte-Anne auf meine Freundin Julie haben könnte, denn sie kam mir verstörter vor als bei ihrer Einweisung, vor allem wenn ich mir überlegte, dass sie gerade mal zwei Tage zuvor mit noch feuchten Haaren an meine Tür geklopft hatte, frisch wie ein Hauch Weichspüler, weil sie vom Schwimmbad gekommen war, wo sie dreitausend Meter mit Flossen geschwommen war – mit dem Plan, uns am »Tag der offenen Tür« der Stadtteilbücherei ehrenamtlich zu betätigen.
»Und was müssen wir da tun?«, hatte ich sie gefragt, im Pyjama, weil ich noch nicht geduscht hatte.
»Ganz einfach: Man klingelt bei den Leuten im Viertel, bittet sie um ein paar Bücher, und die schenkt man dann kleinen Mädchen in vietnamesischen Schulen.«
»Ach, du nervst«, hatte ich geseufzt, »da kriege ich bloß Lust, gleich wieder ins Bett zu gehen«, und die Tür wieder zugemacht.
»Prima!«, hatte sie im Treppenhaus gerufen und gut gelaunt hinzugefügt: »Wir werden Spaß haben!«
Da sieht man, wohin uns der Tag der offenen Tür geführt hat: in ein Krankenbett, wo Julie flammende Reden über die Lage der Frau im neuen Jahrtausend hält. All das war so gänzlich unerwartet gekommen. Doch es brachte mich auf einen Gedanken.
Im letzten September, nach der x-ten katastrophalen Hochzeit – die Braut hatte mir vorgeworfen, sie ausschließlich aus ungünstigen Blickwinkeln aufgenommen zu haben, allein mit der böswilligen Absicht, ihre Ehe zu ruinieren –, hatte ich mich bei einem Wettbewerb angemeldet, der für die Fotoausstellungen im Rahmen der Rencontres de la Photographie in Arles ausgeschrieben war. Der Preisträger darf über die gesamte Dauer dieses renommierten Festivals ausstellen und bekommt ein Preisgeld. Das Thema des Wettbewerbs war »Frauenporträt(s)«, eine Hommage an die Fotografin Julia Margaret Cameron, derer in diesem Jahr gedacht werden sollte. Selbstverständlich müsste ich mich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen, müsste eine interessante Perspektive finden, doch bislang hatte ich noch keine zündende Idee gehabt, die mich weiterbringen und mir den Gewinn sichern würde. Und nun hatte ich nur noch zwei Wochen Zeit, um meine Bilder vor Bewerbungsschluss einzureichen.
Doch das Gespräch mit Julie hatte mich wachgerüttelt: Mein Projekt bekäme den Titel Die perfekte Frau. Julie war der Ausgangspunkt, und in gewisser Weise würde ich ihre Geschichte erzählen. Ich würde bewundernswerte Frauen fotografieren, Heldinnen des Alltags, Frauen, die ihrem Umfeld als Vorbilder gelten. In all diesen unterschiedlichen Porträts würde sich das Bild abzeichnen, das die Frau von heute von sich hat, das Porträt der idealen Frau. Doch ich würde auch die Verwerfungen herausarbeiten, die Schwachstellen, die Brüche. Ich würde die Anzeichen von Wahnsinn in diesem unmöglichen Streben nach Perfektion aufspüren. Ich konnte das in zwei Wochen schaffen; das Wichtigste war, ein gutes Projekt zu haben, danach konnte alles passieren. Zuallererst musste ich Modelle finden. Ich konnte ja keine Zeitungsannonce aufgeben mit dem Text: »Perfekte Frau für Fotoprojekt gesucht.« Als ich Thierry im Treppenhaus traf, kam ich auf die Idee, ihn zu fragen, wer seiner Meinung nach in den Augen seiner Gattin die ideale Frau verkörpere.
»Julie Andrieu«, sagte er wie aus der Pistole geschossen. »Sie ist geradezu besessen von ihr.«
Thierry klärte mich auf, dass Julie Andrieu eine Fernsehmoderatorin sei, speziell für Kochsendungen. »Leider«, entgegnete ich, »wäre es für mich einfacher, Frauen anzusprechen, die nicht berühmt sind.«
»Dann ruf Marie Wagner an«, meinte Thierry, »sie ist Ärztin. Ihr Mann ist vor zwei Jahren gestorben, er war Pastor. Julie sagt immer: ›Diese Frau ist eine Heilige.‹«
Marie
Meine erste Fotoausstellung hatte ich 1999 im Foyer der Unterpräfektur der Gemeinde Antony. Ich nahm an einem Kunst-Workshop für Jugendliche des Départements Hauts-de-Seine teil, den die Region Île-de-France veranstaltete.
Bei der Vernissage baten meine Eltern Patrick Devedjian, der damals Bürgermeister des Ortes war, ihr neues Theaterensemble zu unterstützen. Dann absolvierten sie im Eiltempo die Ausstellung und sagten, bevor sie sich aufs Büfett stürzten: »Du solltest lieber hübsche Mädchen fotografieren, statt Thunfische abzulichten.«
»Stimmt, fürs Auge wäre das sicher angenehmer.«