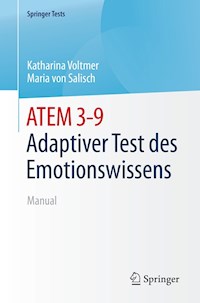Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Emotionally competent children and young adults are able to recognize emotions in themselves and others and articulate them verbally, expressing their feelings and, if necessary, regulating them. This is important both in social relationships and also for success in school. This book introduces what emotional competence means and how young adults can acquire it. On the child=s side, the influences of gender, temperament, executive functions, and language development are involved. In addition, parental upbringing and the influence of peers, social class and culture also play a part. Programs for supporting emotional competence are presented. For this second edition, the book has been fully revised and a chapter on diagnosis has been added.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
1 Einleitung
2 Emotionen und emotionale Kompetenz
2.1 Der Begriff »Emotion«
2.1.1 Inhaltliche Abgrenzungen
2.1.2 Struktur- und Ordnungssysteme von Emotionen
2.2 Emotionale Kompetenz: Modelle und Modellvergleich
2.2.1 Salovey und Mayers Konzept der emotionalen Intelligenz
2.2.2 Saarnis Konzept der emotionalen Kompetenz
2.2.3 Rose-Krasnors Konzept der sozialen Kompetenz
2.2.4 Halberstadt, Denham und Dunsmores Konzept der Affektiven Sozialen Kompetenz (ASK)
2.2.5 Vergleich der vier Modelle
3 Entwicklung emotionaler Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen
3.1 Entwicklung in der Kindheit
3.1.1 Emotionales Ausdrucksverhalten und Bewusstheit
3.1.2 Erkennen und Benennen von Emotionen
3.1.3 Situationen als emotionsauslösende Ereignisse
3.1.4 Wünsche als Auslöser für Emotionen
3.1.5 Emotionale Perspektivenübernahme (Theory of Mind)
3.1.6 Wahre und vorgetäuschte Emotionen
3.1.7 Gemischte und ambivalente Emotionen
3.1.8 Emotionsregulation
3.2 Entwicklung im Jugendalter
3.2.1 Emotionales Erleben
3.2.2 Emotionales Ausdrucksverhalten
3.2.3 Erkennen und Benennen von Emotionen
3.2.4 Emotionsregulation
4 Individuelle Einflussfaktoren auf die Entwicklung emotionaler Kompetenz
4.1 Kognitive Entwicklung: Sprache, Exekutive Funktionen und Intelligenz
4.1.1 Sprachliche Fähigkeiten
4.1.2 Aufmerksamkeit
4.1.3 Exekutive Funktionen
4.1.4 Nonverbale kognitive Fähigkeiten
4.2 Geschlecht
4.3 Temperament
5 Erziehungs- und Umwelteinflüsse auf die Entwicklung emotionaler Kompetenz
5.1 Der Einfluss der Erziehung
5.1.1 Das Drei-Teile-Modell der Emotionsregulation
5.1.2 Erziehungsverhalten: Über Gefühle sprechen
5.1.3 Erziehungsverhalten: Eltern-Reaktionen auf die Emotionen der Kinder
5.1.4 Emotionales Familienklima: Bindungsqualität und Qualität von Familienbeziehungen
5.2 Der Einfluss der Gleichaltrigen
5.2.1 Peer-Akzeptanz und emotionale Kompetenz
5.2.2 Freundschaft und emotionale Kompetenz
5.3 Der Einfluss des sozioökonomischen Status
5.4 Der Einfluss der Kultur
6 Diagnostik emotionaler Kompetenz
6.1 Diagnostik des Emotionsausdrucks
6.1.1 Diagnostik des Emotionsausdrucks bei Jugendlichen und Erwachsenen
6.1.2 Diagnostik des Emotionsausdrucks bei Kindern
6.2 Diagnostik des Emotionswissens
6.2.1 Diagnostik des Emotionswissens bei Jugendlichen und Erwachsenen
6.2.2 Diagnostik des Emotionswissens bei Kindern
6.3 Diagnostik der Emotionsregulation
6.3.1 Diagnostik der Emotionsregulation bei Jugendlichen und Erwachsenen
6.3.2 Diagnostik der Emotionsregulation bei Kindern
6.4 Schwierigkeiten und Empfehlungen zur Diagnostik emotionaler Kompetenz
7 Folgen für den Schulerfolg
7.1 Das Pyramidenmodell des sozial-emotionalen Lernens (SEL)
7.1.1 Die theoretische Ebene
7.1.2 Die Index-Ebene
7.1.3 Die Skills-Ebene
7.2 Emotionale Kompetenz und Schulerfolg
7.2.1 Emotionswissen, Emotionsregulation und Schulerfolg: Empirische Untersuchungen
7.2.2 Interventionsstudien: SEL beeinflusst den Schulerfolg
7.3 Emotionale Kompetenz und schulische Vorläuferfähigkeiten
7.3.1 Emotionale Kompetenz und schulische Vorläuferfähigkeiten: Empirische Untersuchungen
7.3.2 Interventionsstudien: Integrierte Förderung von emotionaler Kompetenz und schulischen Vorläuferfähigkeiten
8 Prävention: Programme zur Förderung emotionaler Kompetenz
8.1 Prävention vor Schulanfang
8.2 Folgen früher Prävention
8.3 Drei Präventionsprogramme im Kindergarten
8.3.1 Das Präventionsprogramm »Kindergarten plus«
8.3.2 Das Präventionsprogramm »Papilio«
8.3.3 Das Präventionsprogramm »Faustlos«
8.4 Vergleich der Inhalte der drei Programme
8.5 Evaluation der drei Präventionsprogramme
8.6 Zusammenfassung
9 Ausblick
9.1 Emotionale Kompetenz und psychische Probleme
9.2 Folgen emotionaler Kompetenz im Erwachsenenalter
Literatur
Stichwortverzeichnis
Die Autorinnen
Dr. Julie Klinkhammer ist Klinische Psychologin und war lange wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt »Emotionales Lernen ist fantastisch«. Sie arbeitet als Psychotherapeutin (Verhaltenstherapie).Dr. Katharina Voltmer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Entwicklungspsychologie an der Leuphana Universität Lüneburg.Prof. Dr. Maria von Salisch ist Professorin für Entwicklungspsychologie an der Leuphana Universität Lüneburg. Ihre Forschungsschwerpunkte sind emotionale Entwicklung, Freundschaften und Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen.
Julie KlinkhammerKatharina VoltmerMaria von Salisch
Emotionale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen
Entwicklung und Folgen
2., erweiterte und überarbeitete Auflage
Verlag W. Kohlhammer
In memoriam Carolyn Saarni,Pionierin der Erforschung emotionaler Kompetenz
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
2., erweiterte und überarbeitete Auflage 2022
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978 – 3 – 17-040696 – 4
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978 – 3 – 17-040697 – 1epub: ISBN 978 – 3 – 17-040698 – 8
1 Einleitung
Die beiden fünfjährigen Mädchen Isabell und Antonia und der gleichaltrige Philip sitzen nebeneinander auf einer Bank an einem Tisch. Vor ihnen liegen zwei weiße Blätter Papier und ein Mäppchen gefüllt mit bunten Stiften. Antonia sagt: »Ich möchte jetzt was malen«. Sie zieht sich eines der Blätter näher heran. Isabell entgegnet: »Oh ja, ich möchte auch malen! Philip, machst du auch mit? Wir können zusammen was malen«. Antonia wühlt im Stifte-Mäppchen und holt einen rosa Buntstift heraus, mit dem sie anfängt zu malen: »Ich fange hier an zu malen und ihr auf der anderen Seite, ok?«. Die anderen beiden nehmen sich ebenfalls Stifte und beginnen, auf demselben Papier wie Antonia zu zeichnen. Mehrfach wechseln sie die Stifte mit Kommentaren, was sie malen wollen, nämlich einen Garten mit Blumen und Bäumen. Die gebrauchten Stifte legen sie wieder zurück und suchen sich aus dem Federmäppchen andere heraus. Plötzlich fängt Isabell an zu weinen: »Ich wollte auch den roten Stift«, klagt sie unter Tränen. Während Antonia eifrig mit dem roten Stift malt, versucht Philip zu vermitteln: »Du musst doch deswegen nicht heulen! Dann nimmst du eben den orangen Stift. Blumen können doch auch orange sein«. Isabell: »Aber immer darf Antonia aussuchen!«, ruft sie wütend. Nun lenkt auch Antonia ein: »Ich male nur noch diese Blume fertig, dann bekommst du ihn, ok?«. Damit gibt sich Isabell zufrieden und hört auf zu weinen: »Na gut, aber du musst ihn mir dann wirklich geben, ok?«. Nach einem kurzen Moment reicht Antonia Isabell den roten Stift. Isabell lächelt, nimmt den Stift und beginnt, damit zu malen.
Diese Szene, die in einem Kindergarten beobachtet wurde, verdeutlicht, dass Kinder schon vor Schuleintritt in der Lage sind, Gefühle bei anderen Menschen differenziert wahrzunehmen, darüber zu sprechen und Strategien zur Emotionsregulation und zur Problemlösung einzusetzen, gelingt es den drei Kindern doch, am Ende einen Kompromiss zu finden, mit dem alle zufrieden sind. Gemessen an ihren Altersgenossen, die dieses häufig noch nicht schaffen, verhalten sie sich emotional kompetent.
Geringe oder zeitverzögert ausgebildete emotionale Kompetenz birgt für die betroffenen Kinder und Jugendlichen umgekehrt ein Risiko, weil sie die Emotionen ihrer Mitmenschen gar nicht, verzerrt oder nur in Bruchstücken wahrnehmen, oft fehlinterpretieren und daraufhin häufig auch weniger angemessen reagieren als ihre Altersgenossen. Dies wiederum hat oft zur Folge, dass die Heranwachsenden kaum Anschluss an gleichaltrige Spielgefährten, Klassenkameraden und Freundinnen und Freunde finden, die ihnen ihrerseits vielfältige Anregungen und Gelegenheiten zur Weiterentwicklung und zum »fine tuning« ihrer emotionalen Kompetenz bieten. Damit gehen ihnen motivierende »Anwendungs- und Übungsfelder« verloren, die die Ausbildung und die Verfeinerung der emotionalen Kompetenz bei ihren kompetenteren Altersgenossen unterstützen. Von den Gleichaltrigen dauerhaft ausgeschlossene Heranwachsende geraten auf diese Weise leicht in einen Teufelskreis, der ihnen sozial und emotional immer weiter zum Nachteil gereicht und oft mit geringen schulischen Erfolgen einhergeht.
Nach der bundesweit repräsentativen KiGGS Studie leiden seit mehr als einem Jahrzehnt etwa 20 % der Kinder und Jugendlichen zwischen 3 und 17 Jahren (ebenso wie ihr Umfeld) unter verschiedenen Arten von Problemverhalten, also unter Ängstlichkeit und emotionaler Labilität ebenso wie unter Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsproblemen oder aggressivem Störverhalten und Schwierigkeiten in Peer-Beziehungen. Hinzu kommen viele Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die durch den Wechsel zu einem inklusiven Bildungssystem überwiegend an Regelschulen unterrichtet werden und dort vielfach Verhaltensauffälligkeiten an den Tag legen. Pädagogische Fachkräfte in Kita, Schule, Hort und anderen pädagogischen Institutionen stehen insofern vor der Herausforderung, mit zunehmend heterogener zusammengesetzten Gruppen zu arbeiten. Diese beinhaltet zugleich jedoch auch die Chance, bewusst mit der Verschiedenartigkeit der Kinder und Jugendlichen umzugehen. Die Besonderheiten eines jeden Heranwachsenden gilt es zu beobachten, zu analysieren und möglichst gewinnbringend für alle – für die Einzelnen ebenso wie für die gesamte Gruppe – zu nutzen. Dies umfasst selbstredend auch die pädagogisch-psychologische Unterstützung bei der Ausbildung emotionaler Kompetenz, und zwar bei den »emotionalen Analphabeten« aller Art ebenso wie bei der gesamten Gruppe. Denn die emotionale Kompetenz der anderen Gruppenmitglieder ist gefragt, wenn sie die Emotionen herausfordernder Klassenkameraden erkennen und jeden Tag mehrere Stunden lang angemessen mit ihnen umgehen sollen. Emotionale Kompetenz ist insofern als ein Fundament für die Weiterentwicklung von Individuum und Gruppe im Sinne der Diversität zu verstehen.
Doch was ist emotionale Kompetenz genau? Wann und wie entsteht sie und welche Folgen hat sie? Gibt es eine Möglichkeit, Kinder und Jugendliche in diesem Entwicklungsprozess effektiv zu unterstützen? Diesen und anderen Fragen geht das vorliegende Buch nach. Um die Grundlagen zu legen, geht Kapitel 2 auf einige Emotionstheorien sowie auf verschiedene Modelle emotionaler Kompetenz ein. Kapitel 3 befasst sich mit dem Erwerb der einzelnen Komponenten einer solchen Kompetenz im Kindes- und Jugendalter, also mit der Ausbildung von emotionalem Ausdrucksverhalten, Emotionswahrnehmung, Emotionsverarbeitung, Emotionsvokabular und Emotionsregulation. Nicht jedes Kind bildet indessen emotionale Kompetenz im gleichen Maße aus, da sowohl individuelle Faktoren als auch Einflüsse aus Erziehung und Umwelt dabei eine Rolle spielen. Diese Faktoren sind Gegenstand von Kapitel 4 und 5. Wie emotionale Kompetenz zu messen ist, wird in Kapitel 6 zum Thema. Wie wir seit einigen Jahren wissen, wirkt sich die mehr oder weniger ausgeprägte emotionale Kompetenz verschiedener Heranwachsender nicht nur auf ihre Fähigkeiten zur Perspektivenübernahme und die Qualität ihrer zwischenmenschlichen Beziehungen aus, sondern sie birgt auch Folgen für ihren sozialen und akademischen Erfolg in der Schule. Inwiefern sich Emotionswissen und Emotionsregulation als Kernbestandteile emotionaler Kompetenz auf das Lernen und Leisten in der Schule niederschlagen, wird daher in Kapitel 7 erörtert. Da es nach all diesen Ausführungen ausgesprochen sinnvoll erscheint, die emotionale Kompetenz von Kindern weiterzuentwickeln, wurden verschiedene Präventionsprogramme entworfen und erprobt. Drei dieser Programme werden in Hinblick auf ihre Ziele, ihre Inhalte, ihre didaktische Umsetzung und ihre Evaluation in Kapitel 8 miteinander verglichen. Den Abschluss bildet ein kurzes Kapitel zu den Folgen emotionaler Kompetenz für die Entwicklung in der Lebensspanne. Wir haben uns bemüht, beide Geschlechter in unsere Formulierungen einzubeziehen, aber sollte dies einmal nicht gelungen sein, so ist es doch so gemeint.
Wir danken den Kita-Fachkräften und Kindern, die uns in der Studie »Emotionales Lernen ist fantastisch« (oder kurz »Elefant«) oft bis an die Grenze ihrer Geduld auf unsere Fragen Rede und Antwort gestanden haben und den Projektmitarbeiter*innen und studentischen Hilfskräften, die sie verlässlich gestellt haben, allen voran Martha Hänel. Natürlich sind wir auch unseren Förderern mit Dank verbunden, hier vor allem dem Niedersächsischen Forschungsverbund für frühkindliche Bildung und Entwicklung. Annika Thaer, Martha Jez, Paulina Buss und Lara Baerens sind wir für ihre Arbeit an der Literaturliste und Vivien Fabel, Nicole Plaas und Edith Schulz sind wir für ihre scharfen Augen beim Erkennen von Fehlern aller Arten dankbar.
Wir hoffen, dass wir mit diesem Überblick zur Entwicklung emotionaler Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen Studierende der Psychologie, der Bildungswissenschaften und der Lehramtsstudiengänge sowie Praktiker*innen mit Interesse an Entwicklung, Beratung und Pädagogischer Psychologie informieren können. Unser Anliegen ist, die disparat und meist im englischsprachigen Raum veröffentlichten Forschungsergebnisse zu sichten, zu komprimieren und dabei den Praxisbezug nicht aus den Augen zu verlieren. Nachdem das öffentliche Interesse viele Jahre vorrangig auf der Vermittlung von Fakten und Wissen in Kindergarten und Schule lag, scheint sich nun ein umfassenderer Blickwinkel auf die kindlichen Kompetenzen aufzutun, den wir mit diesem Buch gerne unterstützen möchten.
2 Emotionen und emotionale Kompetenz
2.1 Der Begriff »Emotion«
Aus freudiger wie aus leidvoller Erfahrung weiß jeder Mensch, dass Emotionen zentrale und häufig vorkommende Phänomene des Lebens sind (Meyer et al., 2001). Sie beeinflussen nicht nur unsere Wahrnehmung und unser Handeln, sondern spielen auch eine wichtige Rolle in unserer Gesundheit und unseren sozialen Interaktionen und Beziehungen zu anderen Menschen. Auf allgemeiner und abstrakter Ebene bezeichnen Emotionen aus transaktionaler Sicht das Verhältnis von Menschen zu ihrer (inneren und äußeren) Umwelt, die sie hervorgerufen haben (Saarni et al., 2006). Gleichwohl ist in der Wissenschaft umstritten, was genau Emotionen sind. Die unterschiedlichen Bemühungen um eine Begriffsbestimmung sind unter anderem beeinflusst von den Forschungsinhalten, den angenommenen Hypothesen, den verwendeten Methoden und den psychologischen Schulen der Forschenden. Otto et al. (2000b) unterscheiden in ihrem Lehrbuch »Emotionspsychologie« evolutionstheoretische, psychoanalytische, psychophysiologische, ausdrucktheoretische, kognitionstheoretische, attributionstheoretische, einschätzungstheoretische und sozial-konstruktivistische Ansätze. Eine Übersicht über Theorien zu Emotionen bieten Meyer et al. (2001) in ihrem dreibändigen Lehrbuch »Einführung in die Emotionspsychologie«. Im englischsprachigen Raum gibt das Sammelwerk von Mascolo und Griffin (1998) einen anschaulichen Überblick über verschiedene Perspektiven auf Emotionen.
Im Rahmen dieses Buches ist es unmöglich und auch nicht intendiert, auf alle bestehenden Definitionen von »Emotion« einzugehen. Vielmehr werden im Folgenden zwei Arbeitsdefinitionen beispielhaft vorgestellt, um einen Einblick in die Vielschichtigkeit dieses Begriffs zu vermitteln.
Die Definition von Bettina Janke (2007) zählt die verschiedenen Komponenten von Emotionen auf und lautet:
»Emotionen sind vorübergehende psychische Vorgänge, die durch äußere und innere Reize ausgelöst werden und durch eine spezifische Qualität und einen zeitlichen Verlauf gekennzeichnet sind. Sie manifestieren sich auf mehreren Ebenen: der des Ausdrucks (Stimme, Mimik, Gestik, Körperhaltung), der des Erlebens, der von Gedanken und Vorstellungen, der des Verhaltens und der der somatischen Vorgänge« (S. 347).
Der Emotionsbegriff von Gross und Thompson (2007) bettet Emotionen in die Transaktionen zwischen Menschen und ihrer Umwelt ein und beinhaltet zusätzlich Bewertungen sowie Aspekte der Regulation und Modulation von Emotionen. Nach Gross und Thompson (2007) ist eine Emotion:
»a person-situation transaction that compels attention, has particular meaning to an individual, and gives rise to a coordinated yet flexible multisystem response to the ongoing person-situation transaction« (S. 5).
Gross und Thompson (2007) nennen hierbei drei Kernelemente von Emotionen: 1) Emotionen entstehen, wenn ein Individuum eine äußere Situation oder sein inneres Erleben (z. B. mentale Repräsentationen) als relevant oder bedeutungsvoll für seine persönlichen Ziele ansieht (Bewertung), 2) Emotionen sind vielschichtig; sie betreffen das subjektive Erleben, das Verhalten (inklusive Ausdrucksverhalten) und die physiologischen Reaktionen und 3) Emotionen sind Reaktionstendenzen, die vom Individuum moduliert werden können. Dieser letzte Aspekt ist grundlegend für die Regulation des Ausdrucks von Emotionen. Beide Definitionen stimmen darin überein, dass sich Emotionen aus verschiedenen Komponenten und deren Zusammenspiel zusammensetzen.
Die Fülle der Herangehensweisen an den Emotionsbegriff erscheint unübersichtlich. Dies hatte in der Vergangenheit zur Folge, dass sich die Analysen und Beschreibungen des Emotionskonstrukts in den verschiedenen Emotionstheorien oft jeweils nur auf begrenzte Aspekte konzentrieren und »wesentliche Inhalte der (...) Phänomendefinition nicht zu erklären sind. In vielen Fällen stellen sie lediglich eine der Konstituenten des Emotionskonstrukts in den Mittelpunkt« und sind dadurch nur als »Teiltheorien« anzusehen (Zentner & Scherer, 2000, S. 151). So würden sich zum Beispiel dimensionale Theorien ausschließlich mit subjektiven Gefühlszuständen und ihren verbalen Etikettierungen oder Basisemotions-Modelle hauptsächlich mit dem Handlungssystem und Komponenten des motorischen Ausdrucks befassen. Zentner und Scherer (2000) sehen hierin die Gefahr einer »Zersplitterung des Emotionsvorgangs« (S. 151) und plädieren dafür, die unterschiedlichen multikomponentionalen Ansätze in ein integratives Modell (»Komponentialmodell«, S. 160) einzubeziehen, das »konkrete Vorhersagen über Auslösung und Differenzierung von Emotionsprozesse[n] als auch über die hierbei auftretenden Reaktionsmuster in den verschiedenen Komponenten machen« könnte (S. 157). Die verschiedenen Theorien und Ansätze, die im Laufe der Jahre zum Emotionsbegriff entwickelt wurden, zeichnen sich wie gesagt inhaltlich durch eine unterschiedliche Gewichtung der Emotionskomponenten aus. Nach exemplarischer Durchsicht und Skizzierung verschiedener Emotionstheorien erstellte Wertfein (2006) die in Tabelle 2.1 dargestellte Zuordnung der Emotionskomponenten zu den Erklärungsansätzen.
Forschungen zu einzelnen Komponenten von Emotionen haben ergeben, dass diese untereinander meist nur locker verknüpft sind – auch wenn sie oft gemeinsam auftreten. So kann zum Beispiel ein bestimmtes emotionales Ereignis manchmal mit körperlichen Reaktionen auftreten, ein anderes Mal hingegen nicht (Oatley & Jenkins, 1996). Otto et al. (2000a) schlagen vor, alle bisherigen Definitionsversuche als Arbeitsdefinitionen anzusehen, die »provisorischen und vorläufigen Charakter [haben] und (...) den aktuellen Erkenntnisstand und den theoretischen Ansatz« widerspiegeln. Eine »exakte Bestimmung würde voraussetzen, dass man das zu untersuchende Phänomen bereits in allen seinen Erscheinungsformen und Ausprägungen genau kennt« (S. 11). Letztendlich gibt es daher bis heute keine allgemein anerkannte Theorie der Emotion (Meyer et al., 2001).
Tab. 2.1:Zuordnung der Emotionskomponenten zu den Erklärungsansätzen (Wertfein, 2006, S. 11)
Erklärungsansatz
Emotionskomponente
Evolutionstheoretische Ansätze (z. B. Ekman, 1988; Fridlund, 2014; Izard, 1999)
Emotionsausdruck
Erlebnisphänomenologische Überlegungen (z. B. Pekrun, 1988)
Affektives Erleben
Psychophysiologische Ansätze (z. B. Schachter, 1964)
Körperliche Veränderungen
Behavioristisch-lerntheoretische Ansätze (z. B. Watson, 1930)
Auslösendes Ereignis
Kognitive Bewertungstheorien (z. B. K. R. Scherer, 2009)
Kognitive Bewertungsprozesse
2.1.1 Inhaltliche Abgrenzungen
In der Alltagssprache gibt es viele Begriffe, die als Synonyme von »Emotion« verwendet werden. Hierzu zählen zum Beispiel »Gefühl«, »Stimmung« oder »Affekt«. Doch nach welchen Kriterien unterscheiden sich diese Bezeichnungen? Während einige Autor*innen eine grundsätzliche inhaltliche Unterscheidung zwischen den Begriffen infrage stellen (Otto et al., 2000a), sehen andere die Forschung als hierfür noch nicht weit genug fortgeschritten an. Schönpflug (2000) stellte kritisch fest: »An Versuchen, den Begriffen feste Bedeutungen zuzuschreiben, hat es nicht gefehlt. Doch sind vorgeschlagene Definitionen teilweise auf Ablehnung gestoßen, teilweise nicht zur Kenntnis genommen worden, weshalb sie zu Vergleichen nur begrenzt taugen« (S. 19). Meyer et al. (2001) sind der Ansicht, dass eine Unterscheidung der Begrifflichkeiten »selbst eine zentrale Frage der Emotionspsychologie« (S. 22) ist.
Der Begriff »Affekt« hat nach Merten (2003) den »Beiklang des Heftigen und Unkontrollierbaren« (S. 11) und auch Otto et al. (2000a) verorten diesen Ausdruck »eher in der Psychiatrie zur Kennzeichnung kurzfristiger und besonders intensiver Emotionen, die oft mit einem Verlust der Handlungskontrolle einhergehen« (S. 13). Die Bezeichnung »Gefühl« beschreibe hingegen nur einen Aspekt einer Emotion, namentlich den des Fühlens oder Empfindens und rücke die »subjektive Erlebensqualität als ein Teil der Emotion« (Otto et al., 2000a, S. 13) in den Mittelpunkt. Dabei vernachlässige sie zum Beispiel den emotionalen Ausdruck oder die Handlungstendenzen (Merten, 2003). Der Ausdruck »Stimmung« beschreibt »eher mittel- und langfristige emotionale Veränderungen«, die nicht als Reaktion auf unmittelbare, spezifische Reize verstanden werden kann (Merten, 2003, S. 11). Davidson (1994) stellt die Vermutung auf, dass es einen funktionellen Unterschied gibt: »Emotions bias action, while moods bias cognition« (S. 54). Weitere Unterschiede werden von Ekman und Davidson (1994) diskutiert.
2.1.2 Struktur- und Ordnungssysteme von Emotionen
Aufgrund der Unübersichtlichkeit des Forschungsbereichs und der Schwierigkeit der Begrenzung (»fuzzy boundaries«) hat es viele Versuche gegeben, die verschiedenen Emotionen zu strukturieren und zu systematisieren.
Verschiedene Autor*innen haben die Idee verfolgt, einige wenige Grundemotionen oder primäre Emotionen festzulegen und aus diesen die anderen komplexen oder sekundären Emotionen herzuleiten. Allerdings unterscheiden sich die Annahmen, welche Emotionen zu den Grundemotionen gezählt werden und welche nicht. Die Ursache hierfür scheint wiederum in der mangelnden Übereinstimmung zu liegen, was generell unter einer Emotion zu verstehen ist (z. B. Ekman, 1994; Ortony & Turner, 1990).
Andere Autor*innen gehen davon aus, dass die »Basisemotionen« durch jeweils spezifische, über Kulturen hinweg universell vorliegende neurophysiologische Substrate, Ausdrucksmuster und phylogenetisch begründete Funktionen gekennzeichnet sind. Dies entspricht der evolutions-biologischen Sichtweise, die beinhaltet, dass angeborene motorische Programme für die Auslösung und Differenzierung einer begrenzten Anzahl diskreter Emotionen verantwortlich sind. Die emotionalen Ausdrucksformen der Basisemotionen sind demnach kulturunspezifisch, treten universell auf und werden auch auf der ganzen Welt wiedererkannt (z. B. Ekman, 1988, 1994). Basisemotionen beruhen weiterhin auf neurobiologischen Grundlagen (z. B. Ackerman et al., 1998; Panksepp et al., 1998). Umstritten ist, auf welche Weise die biologischen Prädispositionen mit den kulturellen Einflüssen bei Entstehung, Ausdruck und Erleben von Emotionen zusammenwirken (z. B. Friedlmeier & Holodynski, 1999; Gendron et al., 2014).
Fischer et al. (1990, S. 90) schlagen vor, Emotionskategorien hierarchisch in fünf »Emotions-Familien« bzw. in verschiedenen Ebenen anzuordnen (▶ Abb. 2.1). Im oberen Teil des Modells werden die Emotionen zunächst nur in »positiv« und »negativ« eingeteilt. Diese Unterscheidung entsteht durch Bewertungsprozesse und im Hinblick auf das Anliegen oder Ziel einer Person. In der darunter liegenden Stufe befinden sich die »basic emotions«. Hierzu zählen die Gefühle, die von fast allen Kulturen geteilt werden: Ärger, Trauer, Angst, Freude und Liebe. Die unteren Ebenen des Schemas werden komplexer und beinhalten auch sozial-konstruierte Emotionen wie zum Beispiel Bewunderung, Verachtung, Einsamkeit und Eifersucht. Diese können sich in ihrer Konstruktion zwischen den Kulturen unterscheiden. Die verschiedenen Komponenten des emotionalen Erlebens können gleichzeitig, aufeinanderfolgend sowie gemischt auftreten oder überlappen. Die Anzahl der existierenden Gefühle ist daher nicht genau ermittelbar. Ebenso erscheint es unmöglich, eine scharfe Grenze zwischen Gefühlen und Nicht-Gefühlen zu ziehen. Fischer et al. (1990) entnehmen dieser hierarchischen Struktur Hinweise zum Verlauf der emotionalen Entwicklung: »This general organization of emotions is present in rudimentary form at an early age, but all its components develop, becoming more complex and differentiated as well as more regulated« (S. 94). Auf diesen Entwicklungsaspekt geht Kapitel 3 näher ein.
Abb. 2.1:Vereinfachte Darstellung der Emotionshierarchie von Shaver et al. 1987; zit. nach Fischer et al., 1990, S. 90
2.2 Emotionale Kompetenz: Modelle und Modellvergleich
Nachdem wir jetzt wissen, was Emotionen in etwa sind, wie sie sich von verwandten Phänomenen abheben und wie sie sich ordnen lassen, geht es im Folgenden um interindividuelle Unterschiede zwischen Menschen bei den verschiedenen Komponenten von Emotionen. Diese Unterschiede werden oft unter dem Oberbegriff der emotionalen Kompetenz oder der emotionalen Intelligenz zusammengefasst. In den Modellen zur emotionalen Kompetenz wurden erstmals die vorher getrennt beforschten Bereiche des Emotionsausdrucks, der Emotionswahrnehmung und der Emotionsregulation zusammen gedacht. Auf den folgenden Seiten vergleichen wir vier Modellvorstellungen, die häufiger zur theoretischen Rahmung von Entwicklungen in Kindheit und Jugend eingesetzt wurden, nämlich Salovey und Mayers Konzept der emotionalen Intelligenz, Saarnis Konzept der emotionalen Kompetenz, Rose-Krasnors Konzept der sozialen Kompetenz sowie das Konzept von Halberstadt et al. der Affektiven Sozialen Kompetenz.
2.2.1 Salovey und Mayers Konzept der emotionalen Intelligenz
Salovey und Mayers Konzept der emotionalen Intelligenz baut auf Howard Gardners (1993) Vorstellung von multiplen Intelligenzen auf. Über die bisher vor allem erforschten kognitiven Grundfähigkeiten hinaus gibt es nach Gardner (1993) sechs weitere »Intelligenzen«. Darunter zählt die interpersonale Intelligenz, die als »Fähigkeit, andere Menschen zu verstehen« umrissen wird, sowie die entsprechende nach innen gerichtete Fähigkeit, nämlich die intrapersonale Intelligenz, die als die Fähigkeit verstanden wird, »ein zutreffendes, wahrheitsgemäßes Modell von sich selbst zu bilden und mit Hilfe dieses Modells erfolgreich im Leben aufzutreten« (Gardner, 1993, S. 9). Salovey und Mayer fassen diese beiden »Intelligenzen« zusammen. Der kognitiven Tradition folgend teilten Salovey und Mayer die »Emotionale Intelligenz« in die in Abbildung 2.2 veranschaulichten Bereiche (domains) ein.
Abb. 2.2:Das Konzept der emotionalen Intelligenz nach Salovey et al. (2001)
Nach diesem Modell von Salovey et al. (2001) wäre eine emotional intelligente Person in der Lage, Emotionen bei sich selbst und bei anderen Menschen korrekt wahrzunehmen, sie angemessen verbal und nonverbal auszudrücken und anderen Menschen gegenüber Empathie zu zeigen. Emotional intelligente Menschen sind darüber hinaus imstande, ihre eigenen Emotionen zu regulieren und gegebenenfalls die Gefühlszustände von anderen Personen herauf oder herunter zu regulieren. Ferner zeichnen sich emotional intelligente Menschen dadurch aus, dass sie ihre Emotionen gezielt einsetzen können, etwa um sich zu motivieren, ihre Aufmerksamkeit zu lenken, sich nicht festzubeißen, sondern bei der Planung flexibel zu bleiben und sich, wenn gewünscht, in eine kreative Stimmung zu versetzen.
Eine Stärke des Modells von Salovey et al. (2001) besteht darin, dass bisher getrennt erforschte Bereiche zusammengebracht wurden. Ausdrucksverhalten, das vorher vor allem in Ethologie (z. B. Hinde, 1988) und Sozialpsychologie (z. B. Ekman, 1988) vermessen wurde, wurde in Zusammenhang gebracht mit der Bewertung von Gefühlen, die bislang vor allem von der kognitiven Emotionsforschung (z. B. K. R. Scherer, 2009) untersucht wurde. Ein weiterer Punkt war die Emotionsregulation, die bisher vorrangig unter dem Begriff des »Coping« in allgemeiner und angewandter Psychologie beforscht wurde (z. B. Lazarus, 1991). Hinzugezogen wurden ferner Erkenntnisse zur Anwendung von Emotionen, die in der Stimmungsforschung in der Sozialpsychologie ihren Niederschlag gefunden haben (z. B. L. L. Martin & Clore, 2001). Mangel an umfassendem Denken ist diesem Modell sicher nicht vorzuwerfen.
In den letzten 20 Jahren wurden zwei Wege zur Erfassung emotionaler Intelligenz (EI) bei Jugendlichen und Erwachsenen entwickelt: zum einen Selbstberichte und zum anderen eine Messung der Performanz der Probanden bei »objektiven« Testaufgaben. Bekanntestes Beispiel dafür ist der »Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test« (MSCEIT; J. D. Mayer et al., 2003; deutsch: Steinmayr et al., 2011). Beispiele für Selbstbericht-Fragebögen sind die »Self-Rated Emotional Intelligence Scale« (SREIS; Brackett et al., 2006) und der »Bar-On Emotion Quotient Inventory« (EQ-i; Bar-On, 2002). Der EQ-i enthält 15 Unterskalen, die unter den folgenden fünf Primärskalen verortet sind: (1) Intrapersonal (self-regard, emotional self-awareness, assertiveness, independence, self-actualization), 2) Interpersonal (empathy, social responsibility, interpersonal relationship), 3) Adaptability (reality testing, flexibility, problem solving), 4) Stress Management (stress tolerance, impulse control) und 5) Allgemeine Stimmung (general mood, happiness, optimism) (Bar-On, 2002). Daher unterscheidet man zwischen Emotionaler Intelligenz (EI) als »objektiv« mit Testaufgaben zu messender Fähigkeit (ability EI oder performance EI) und EI als selbst berichteter Persönlichkeitseigenschaft (trait EI).
Empirische Studien stellten wiederholt fest, dass die Selbstbericht-Fragebögen und die Fähigkeits-Tests zu EI (MSCEIT) bei Erwachsenen höchstens in moderatem Umfang empirisch zusammenhingen (z. B. Joseph & Newman, 2010; Webb et al., 2013). Beide Arten der Messung korrelierten in unterschiedlicher Höhe mit Persönlichkeitseigenschaften und kognitiven Fähigkeiten der Probanden. Während der MSCEIT im Allgemeinen mit den kognitiven Fähigkeiten der Person einherging (z. B. MacCann et al., 2014), korrelierten die Selbstbericht-Fragebögen mit Persönlichkeitseigenschaften wie Extraversion und zum Teil mit Neurotizismus (EQ-i) oder Offenheit (SREIS). Beide Selbstbericht-Fragebögen wiesen zudem hohe Korrelationen mit depressiven Symptomen auf (Webb et al., 2013).
Vor allem zum MSCEIT liegt inzwischen eine Fülle von Studien vor, die das Konzept und die »objektive« Messung der EI unter die Lupe nehmen. Einige Befunde daraus sind:
·
Als schwierig gestaltete es sich, die einzelnen Bereiche der emotionalen Intelligenz konzeptuell und psychometrisch überzeugend zu messen. Gegen die Unterskala »Wahrnehmung« des MSCEIT ist einzuwenden, dass Landschaften und Muster als Dinge per se keine Emotionen ausdrücken können. Kontrovers diskutiert wird zudem, ob es zulässig ist, die Werte der Probanden mit den Modalwerten einer »Expertengruppe« zu vergleichen, die der objektiven Messung zugrunde liegt (Maul, 2012; J. D. Mayer et al., 2012). Eine Analyse der Antworten von 729 französisch-sprachigen Probanden des MSCEIT mit Hilfe der Item-Response Theorie erbrachte, dass viele Testitems im psychometrischen Sinne zu einfach waren, also kaum zwischen Personen mit hoher und niedriger EI differenzierten (Fiori et al., 2014).
·
Eine Meta-Analyse über die acht Unterskalen des MSCEIT bei einer großen Gruppe von Erwachsenen stellte fest, dass die Bereiche Wahrnehmung und Anwendung von Emotionen so hoch miteinander korrelierten, dass lediglich die drei Subskalen Wahrnehmung, Verständnis und Regulation von Emotionen als Faktoren in Erscheinung traten (Fan et al., 2010; MacCann et al., 2014). Emotionen zum Zwecke von Planung, kreativem Denken oder Motivation anzuwenden, kommt nicht nur aus statistischen, sondern auch aus konzeptuellen Gründen nicht als eigener Faktor in Frage, weil diese Anwendungsformen Spielarten der Emotionsregulation sind (Gross & Thompson, 2007).
·
Die drei Subskalen Wahrnehmung, Verständnis und Regulation wiesen in einem Sample von 671 Studierenden Zusammenhänge zu den Faktoren der kognitiven Intelligenz auf. Diese Subskalen der EI korrelierten untereinander so hoch, dass sie neben den kognitiven Fähigkeiten einen eigenen Faktor der Intelligenz auf der zweiten Ebene (second stratum) gleich unterhalb des Generalfaktors g bildeten (MacCann et al., 2014).
Hinzu kommen folgende konzeptuelle Einwände gegen Salovey und Mayers Modell der EI:
·
Die Auswahl der Bereiche erscheint willkürlich, denn theoretische oder empirische Gründe, warum gerade diese Bereiche ausgewählt wurden, werden nicht erwähnt.
·
Ebenso wie in der kognitiven Intelligenzforschung nehmen Salovey und Mayer an, dass es »richtige« und »falsche« Lösungen der Aufgaben gibt, die sie zur Operationalisierung ihres Konzeptes heranziehen. Dies ist bei manchen Fragen nicht entscheidbar, sodass es auf die Gestaltung der Antwortalternativen ankommt.
Fragt man nach der Entwicklung von emotionaler Intelligenz bei Kindern und Jugendlichen nach Salovey und Mayer, so kommt man ebenfalls nicht sehr viel weiter. Auch wenn das Modell von J. D. Mayer und Salovey (1997) in einem Buch zur emotionalen Entwicklung mit dem Anspruch antritt, die Entwicklung der emotionalen Intelligenz abzubilden, so kann es diesen Anspruch doch nicht einlösen. Denn auch in diesem Modell ist nicht zu verstehen, warum gerade die genannten vier Bereiche ausgewählt wurden, warum also die Bereiche »Wahrnehmung, Bewertung und Ausdruck von Emotionen«, »Emotionale Erleichterung des Denkens«, »Emotionen verstehen und analysieren, Emotionswissen anwenden« und »Reflexive Regulation von Emotionen, um emotionales und intellektuelles Wachstum zu stimulieren« gewählt wurden und nicht andere. Weiterhin sind die postulierten Entwicklungssequenzen zu hinterfragen. Fragwürdig ist ferner, dass Wahrnehmung, Bewertung und Ausdruck von Emotionen von J. D. Mayer und Salovey (1997) in einem Bereich zusammengefasst werden, obwohl diese Emotionskomponenten jeweils einer eigenen Entwicklungslogik folgen. So ist das emotionale Ausdrucksverhalten zumindest in rudimentärer Form schon ab der Geburt »einsatzbereit«, während emotionsbezogene Bewertungen sich erst im Laufe der Zeit und im Zusammenhang mit der kognitiven Entwicklung ausbilden und differenzieren (zusammenfassend von Salisch, 2000; ▶ Kap. 3). Nicht zuletzt ist auffällig, dass das gesamte Modell »kognitionslastig« ist.
2.2.2 Saarnis Konzept der emotionalen Kompetenz
Carolyn Saarnis (1999) Modell der emotionalen Kompetenz hat den Vorteil, dass es die emotionale Kompetenz kontextorientierter als Salovey und Mayer konzeptualisiert: Das Individuum ist, vereinfacht ausgedrückt, eingebettet in soziale Beziehungen und kulturelle Kontexte, in denen es die acht im nachfolgenden Kasten aufgeführten Fertigkeiten zur Selbstwahrnehmung, zum Gefühlsausdruck, zur Kommunikation über Emotionen (in Beziehungen), zur Regulation von Emotionen sowie zur »emotionalen Selbstwirksamkeit« ausbildet, übt und anwendet. In den Beziehungen zu Familienmitgliedern und Peers lernen Kinder die emotionalen Fertigkeiten, die in ihrer (Sub-)Kultur Gültigkeit haben. Eltern fungieren dabei als »Modellpersonen«, deren emotionale Bewertungen und Verhaltensweisen Kinder imitieren, als »Verstärker«, die mit Lob und Tadel operieren, als »Diskurspartner«, die mit ihren Kindern in einen (non-)verbalen Austausch über Gefühle eintreten sowie als »Manager«, deren eigenes emotionsbezogenes Verhalten mitunter im Widerspruch zu ihren Worten steht. Indem Heranwachsende diese acht emotionsbezogenen Fertigkeiten anwenden, bekräftigen sie sie.
Die acht Fertigkeiten der emotionalen Kompetenz nach Saarni (2002)
1.Bewusstheit über den eigenen emotionalen Zustand. Dies schließt die Möglichkeit ein, dass man mehrere Gefühle gleichzeitig erlebt und auf noch weiter fortgeschrittenem Niveau auch die Bewusstheit, dass man sich aufgrund einer unbewussten Dynamik oder selektiver Aufmerksamkeit seines Gefühlsempfindens nicht immer bewusst ist.
2.Die Fähigkeit, Emotionen anderer Menschen auf der Grundlage von Merkmalen der Situation und des Ausdrucksverhaltens zu erkennen, über die in der Kultur eine gewisse Übereinstimmung im Hinblick auf ihre emotionale Bedeutung besteht.
3.Die Fähigkeit, das Vokabular der Gefühle und die Ausdruckswörter zu benutzen, die in der eigenen (Sub-)Kultur gemeinhin verwendet werden. Auf weiter fortgeschrittenem Niveau bedeutet dies, kulturgebundene Skripte zu erwerben, die Emotionen mit sozialen Rollen verknüpfen.
4.Die Fähigkeit, empathisch auf das emotionale Erleben von anderen Menschen einzugehen.
5.Die Fähigkeit zu merken, dass ein innerlich erlebter emotionaler Zustand nicht notwendigerweise dem nach außen gezeigten Ausdrucksverhalten entspricht, und zwar sowohl bei einem selbst als auch bei anderen Menschen. Auf fortgeschrittenem Niveau kommt die Erkenntnis hinzu, dass das eigene emotionale Ausdrucksverhalten Andere beeinflussen kann und dies bei der eigenen Selbst-Präsentation zu berücksichtigen.
6.Die Fähigkeit, aversive oder belastende Emotionen und problematische Situationen in adaptiver Weise zu bewältigen, indem man selbstregulative Strategien benutzt, die Intensität oder zeitliche Dauer dieser emotionalen Zustände abmildern (z. B. »stress hardiness«), und indem man effektive Problemlösestrategien einsetzt.
7.Die Bewusstheit, dass die Struktur oder Natur von zwischenmenschlichen Beziehungen zum großen Teil dadurch bestimmt wird, wie Gefühle in ihnen kommuniziert werden, so zum Beispiel durch das Ausmaß der emotionalen Direktheit oder Echtheit des Ausdrucksverhaltens und durch das Ausmaß an emotionaler Reziprozität oder Symmetrie innerhalb der Beziehung; so ist zum Beispiel reife Intimität zum Teil durch den gegenseitigen Austausch von echten Emotionen gekennzeichnet, während der Austausch von echten Emotionen in der Eltern-Kind-Beziehung auch asymmetrisch verlaufen kann.
8.Die Fähigkeit zur emotionalen Selbstwirksamkeit; die Person ist der Ansicht, dass sie sich im Allgemeinen so fühlt, wie sie sich fühlen möchte. Emotionale Selbstwirksamkeit bedeutet, dass man sein eigenes emotionales Erleben akzeptiert, egal ob es einzigartig und exzentrisch oder in der eigenen Kultur als konventionell gilt. Diese Akzeptanz geht mit den Ansichten der Person darüber einher, was ein erstrebenswertes emotionales »Gleichgewicht« darstellt. Empfindet man emotionale Selbstwirksamkeit, dann lebt man also sowohl in Übereinstimmung mit seiner persönlichen Emotionstheorie* als auch mit seinen eigenen moralischen Werten.
* Die persönliche Emotionstheorie leitet sich aus einer konstruktivistischen Position ab. Diese geht davon aus, dass Menschen nach den Überzeugungen und Erwartungen leben, die ihren Erfahrungen Bedeutung geben und sie auf diese Weise formen. Eine persönliche Theorie der Emotionen ist das System eigener Anschauungen und Erklärungen darüber, wie Emotionen »funktionieren«. Man könnte es auch als internales Arbeitsmodell der Emotion ansehen (siehe auch verwandte Literatur zu den Ethnotheorien der Emotion, z. B. Lutz, 1987; Russell et al., 1996; Saarni, 1999).
Daher gibt es für Saarni (1999) auch keine richtigen oder falschen Emotionen (in einer bestimmten Situation), sondern nur solche, die im Selbst der Person verankert sind und mit deren Persönlichkeit, insbesondere deren Empfinden von Selbstwirksamkeit übereinstimmen oder eben nicht. Wie emotionales Empfinden und Ausdrucksverhalten bewertet wird, wird damit unter anderem zu einer Frage nach den Zielen eines Menschen. Welche Ziele jemand in einer gegebenen Situation wählt, hängt von seinen Werten ab, seinen (sicherlich kulturell geprägten) Regeln darüber, was eine integre Persönlichkeit ausmacht, und ist damit letztlich eine Frage seiner moralischen Disposition. Emotionale Kompetenz hängt daher nach Saarni (1999) eng mit moralisch positiv bewerteten Fähigkeiten wie Empathie, Selbstkontrolle, Gerechtigkeit und Reziprozität zusammen. Andernfalls könnten Fertigkeiten wie das korrekte Entziffern der Emotionen des Gegenübers auf der Grundlage des Ausdrucksverhaltens oder der Situation auch zu moralisch zweifelhaften Zwecken benutzt werden, etwa um diese Person zu übervorteilen oder um sie besonders heimtückisch zu quälen.
Für psychologisch und pädagogisch Tätige dürfte an Saarnis (1999) Modell besonders reizvoll sein, dass sie die interindividuellen und interkulturellen Unterschiede bei der Ausbildung emotionaler Kompetenz in den Mittelpunkt rückt, die in der Praxis so wichtig sind. Weitere Hinweise zur Erziehung finden sich in Saarni (2002). Für Entwicklungspsychologen ist Saarnis Übersicht über die Entwicklung der acht Fertigkeiten (skills) im Zusammenhang mit der kognitiven und der sozialen Entwicklung eine wahre Fundgrube, die zu weiteren Forschungsarbeiten in diesem Bereich anregt. Kritik an Saarnis (1999) Konzeptualisierung bezieht sich zum einen auf die Tatsache, dass sie die Auswahl der acht Fertigkeiten nicht begründet, sondern diese Sammlung als erweiterbar hinstellt. Zum anderen werden diese Komponenten in einer Liste vorgestellt, die weder nach übergeordneten theoretischen Konzepten noch nach dem empirischen Gesichtspunkt der Überprüfbarkeit geordnet ist.
2.2.3 Rose-Krasnors Konzept der sozialen Kompetenz
Hier setzt Linda Rose-Krasnors (1997) Konzept an. Ausgehend von einer Kritik gängiger Vorstellungen zur sozialen Kompetenz präsentierte Rose-Krasnor (1997) eine Definition, die sich (ähnlich wie Saarnis Beschreibung) an dem Begriff der Effektivität oder Wirksamkeit orientiert. Soziale Kompetenz, so Rose-Krasnor (1997), »is defined as effectiveness in interaction. Effectiveness is broadly conceptualized as the outcome of a system of behaviors, organized to meet short- and long-term developmental needs« both in the self and in others (S. 119). Rose-Krasnors Modell der sozialen Kompetenz (▶ Abb. 2.3) hat die Form einer Pyramide: Das Fundament der Pyramide besteht aus kognitiven und emotionalen Fertigkeiten sowie Werten und Zielen, die im Individuum lokalisiert und zum Teil kontextübergreifend kompetent sind. Ein Beispiel hierfür wäre die direkte konstruktive Kommunikation von Emotionen. Hinzu kommt die Motivation, diese Fertigkeiten auch wirklich im Verhalten einzusetzen. Diese Elemente bilden zusammen die Fertigkeitsebene. Darüber erhebt sich die Indexebene, die diese Fertigkeiten in die verschiedenen Lebenskontexte von Heranwachsenden einbettet, wie etwa in ihre Peer-Beziehungen, ihr Elternhaus oder ihre Schule, weil die gleichen emotionalen Reaktionen auf eine Situation in diesen Kontexten zum Teil unterschiedlich bewertet werden. Dass die Indexebene als sozial oder transaktional verstanden wird, zeigt sich darin, dass hier Urteile über die Qualität von Interaktionen, Beziehungen, Gruppenstatus oder Beurteilungen der eigenen sozialen Selbstwirksamkeit als Indikatoren für die soziale Kompetenz herangezogen werden. Außerdem werden auf der Indexebene »selbstbezogene« und »anderenbezogene« soziale Fertigkeiten voneinander abgegrenzt. Diese Zweiteilung spiegelt die Polarität zwischen »Autonomie« und »Verbundenheit mit Anderen«, die das ganze Leben durchzieht. Eine Folgerung daraus ist, dass effektives (also zielführendes) Verhalten auf unterschiedlichen Wegen realisiert werden kann, nämlich sowohl durch die Veränderung der eigenen Person als auch durch die Veränderung von Anderen.
Abb. 2.3:Rose-Krasnors (1997) Pyramidenmodell der sozialen Kompetenz
Die Spitze der Pyramide bildet die theoretische Ebene, die das Konzept der sozialen Kompetenz insgesamt umfasst. Auf dieser Ebene postuliert Rose-Krasnor (1997) (ebenso wie Saarni, 1999), dass soziale Kompetenz transaktional und kontextabhängig ist. Zugleich betont sie, dass sich soziale Kompetenz in Alltagssituationen zeigt und nicht unter Idealbedingungen, wo Fragen der Motivation keine Rolle spielen. Darüber hinaus ist soziale Kompetenz nach Rose-Krasnor (1997) nicht ein vorher zu bestimmendes (richtiges oder falsches) Verhalten, sondern relativ im Hinblick auf die Ziele der Person. Gefühls-Geheimnisse der Freundin anderen Klassenkameraden zu erzählen, mag zwar erfolgreich sein, wenn die Person darauf abzielt, Status in einer bestimmten Peer-Gruppe zu erwerben, aber das gleiche Verhalten dürfte wenig Erfolg versprechen, wenn sie das Ziel hat, die Freundschaft aufrechtzuerhalten.
Die hierarchische Struktur von Rose-Krasnors (1997) Modell ist theoretisch anspruchsvoll und erlaubt differenzierte Hypothesen zur Entwicklung der sozialen Kompetenz. Im Verlauf von Kindheit und Jugend bilden sich die einzelnen Fertigkeiten, Werte und Ziele (auf der untersten Ebene) aus, auch im Zusammenhang mit der kognitiven und der sprachlichen Entwicklung. Auf der Indexebene ändert sich im Verlauf der Entwicklung, welche Fertigkeiten für die soziale Kompetenz von Bedeutung sind, denn Beziehungspartner wie Eltern, Peers oder Freunde fordern und fördern im Laufe der Zeit immer differenzierteres und regulierteres (emotionales) Verhalten. So verlangen sich Freundespaare (erst) ab der Präadoleszenz ein emotionsbezogenes Verhalten ab, das nötig ist, um ihre intimen Freundschaften aufrechtzuerhalten, wie etwa gegenseitige emotionale Unterstützung oder Geheimhaltung von vertraulichen Informationen (von Salisch, 2001; von Salisch et al., 2014). Letztlich verändern sich auf der Indexebene auch die Anzahl und die Wertigkeit der einzelnen Kontexte; diese werden mit dem Alter mehr und sie werden zunehmend selbst gewählt. Auf der obersten Ebene der Theorie ändert sich am wenigsten, denn kompetentes Verhalten bleibt in jedem Alter »der effektive Gebrauch von Ressourcen, um Entwicklungsziele zu erreichen« (E. Waters & Sroufe, 1983, S. 81), auch wenn sich Erfolg oder Misserfolg bei diesem Bemühen nur in konkreten, altersangemessenen Aufgaben, Kontexten oder Fertigkeiten messen lässt.
2.2.4 Halberstadt, Denham und Dunsmores Konzept der Affektiven Sozialen Kompetenz (ASK)
Das Modell von Halberstadt, Denham und Dunsmore (2001) zur Affektiven Sozialen Kompetenz (▶ Abb. 2.4), das im Original die Form eines Windrades hat, ist zeitlich gesehen das jüngste Modell. Im Mittelpunkt dieses Modells steht nicht die Person (und ihre interindividuell unterschiedlich ausgeprägten emotionalen Fähigkeiten und Fertigkeiten), sondern die Interaktion zwischen (mindestens) zwei Beteiligten. Der Fokus auf die Kommunikation bedingt, dass das Modell aus drei großen Komponenten (oder Prozessen) besteht, nämlich aus »Senden«, »Empfangen« und »Erleben« von Gefühlen. Innerhalb dieser drei Komponenten sind jeweils vier Fertigkeiten angeordnet, nämlich
1.
Bewusstheit (über die »Notwendigkeit«, Gefühle zu senden, zu empfangen oder zu erleben),
2.
Identifizierung der beteiligten Emotion(en),
3.
Abstimmung mit dem (sozialen) Kontext, sowie
4.
die Fähigkeit, den jeweiligen Prozess im Hinblick auf parallele Bedürfnisse und Signale zu regulieren oder zu »managen«, also klare und normativ angemessene (emotionsbezogene) Botschaften zu beachten, irreführende Zeichen zu ignorieren und sich auf empfundene, relevante und in der Situation nützliche (Emotions-)Signale zu konzentrieren.
Im Mittelpunkt dieser drei Komponenten steht ein Selbst, das mit stabilen interindividuell unterschiedlich ausgeprägten Merkmalen wie Temperament, Selbstkonzept oder internalen Arbeitsmodellen ausgestattet ist. Dieses Selbst verfügt zudem über unterschiedliche Wissensbestände (etwa zur Notwendigkeit der emotionalen Ausdrucksmodulation durch Darbietungsregeln) und über ein Mehr oder Weniger an Motivation und Flexibilität in der Interaktion. Die konkrete Interaktion wird weiterhin beeinflusst von einem Kontext, der durch Zeitgeschichte, Kultur, Familie, zwischenmenschliche Beziehungen, körperliche und emotionale Bedürfnisse sowie Bedingungen geprägt ist. Sozial-affektiv kompetentes Verhalten besteht in der angemessenen Übereinstimmung zwischen dem Erleben, dem Senden und dem Empfangen von Emotionen und emotionsbezogenen Botschaften sowie in der Fähigkeit, den Fluss der Interaktion zwischen Sender und Empfänger aufrechtzuerhalten.
Ein Beispiel mag die prozessorientierte Natur dieser Konzeption affektiv-sozialer Kompetenz erhellen: Halberstadt et al. (2001) schildern als Beispiel, dass Kenya zum wiederholten Male von dem Haupt-Störenfried in ihrer 3. Klasse provoziert wird. Wir fassen zusammen: Was das Senden emotionaler Botschaften als erste Komponente betrifft, so muss Kenya – wenn sie sozial-affektiv kompetent ist – bewusst wahrnehmen, dass sie jetzt dem Stänkerer ein klares und deutliches emotionales Signal senden muss. Andernfalls, so weiß sie aus Erfahrung, dauert die Schikane den ganzen Tag an. Dann muss sie identifizieren, welches Gefühl am wirksamsten ist, um die Provokationen dauerhaft zu stoppen (bei anderen Zielen wären andere Emotionen hilfreicher). Nützlich ist, so merkt Kenya bald, Ärger und Zuversicht in dieser Situation zu vermitteln, auch wenn sie diese Gefühle im Moment gar nicht empfindet. Wichtig ist für sie ferner, den Kontext zu beachten, etwa in Gestalt der Schulregeln, die körperliche Auseinandersetzungen unter den Schülerinnen und Schülern bestrafen. Außerdem sollte sie wissen, dass sie sofort reagieren muss, denn jedes Zögern würde ihr Peiniger als Angst auslegen. Daher ist es für sie wichtig, den Ausdruck von Angst komplett zu unterdrücken. Vielleicht könnte sie auch Überraschung simulieren, um etwa vorzuspielen, dass die Lehrkraft gerade die Klasse betritt, denn das würde den Übergriff sofort beenden.
Bei der zweiten Komponente, dem Empfangen von emotionalen Botschaften, ist Kenya ebenfalls gefordert, überhaupt zu bemerken, dass der Störenfried sie provozieren will. Das heißt, sie muss seine Emotionen und seine Ziele korrekt identifizieren. Der Kontext ist auch beim Empfangen relevant: Kenya sollte wissen, dass Sticheleien, die ihr Peiniger in Anwesenheit der Lehrperson nur flüstert, ebenso ernst zu nehmen sind wie seine laut gebrüllten Drohungen auf dem Schulhof. Was das »Managen« des Empfangs angeht, so muss Kenya zwischen relevanten und irrelevanten Botschaften unterscheiden können. Ein Lächeln des Stänkerers darf sie nicht als dauerhaftes Friedensangebot missverstehen.
Abb. 2.4:Affektive soziale Kompetenz (nach Halberstadt, Denham & Dunsmore 2001)
Im Hinblick auf die dritte Komponente, dem emotionalen Erleben, muss Kenya erkennen, welche Gefühle sie gerade fühlt. Den Hintergrund (Kontext) zu Kenyas momentanen Empfindungen bilden ihre emotionalen Erlebnisse mit anderen Personen früher am Tage, die noch nachwirken, ihre Erfahrungen mit diesem Quälgeist in der Vergangenheit sowie ihre allgemeine (emotionale) Befindlichkeit an diesem Tag. Bei ihren Bemühungen, ihr Gefühlserleben zu regulieren, sollte Kenya darauf achten, empfundene, relevante und nützliche Gefühle, wie etwa ihren Ärger zu verstärken, um ihrem Peiniger Einhalt zu gebieten, auch wenn dies bedeutet, dass sie sich für eine Weile etwas weniger wohlfühlt. Irrelevante Empfindungen, wie ihre Aufregung wegen eines Streits mit ihrer Schwester am Morgen, sollte sie in dieser Situation besser ausblenden, damit sie sich besser auf die Abwehr des Stänkerers konzentrieren kann. Soweit das Beispiel.
Halberstadt et al. (2001) postulieren, dass sich die vier Fertigkeiten Bewusstheit, Identifikation, Kontextabstimmung und »Management« oder Regulierung in jeder der drei Komponenten in eben dieser Reihenfolge entwickeln. Sie argumentieren, dass die Bewusstheit, dass ein Gefühl (zum Senden, Empfangen oder Erleben) vorliegt, der (korrekten) Identifizierung dieses Gefühls entwicklungsmäßig vorgeordnet ist. Damit die nächsthöhere Fertigkeit erworben werden kann, so behaupten die drei Autorinnen, muss die vorausgehende zumindest in rudimentärer Form ausgebildet sein.
Zwischen den Fertigkeiten innerhalb der verschiedenen Komponenten bestehen Wechselbeziehungen: Je besser Menschen die emotionalen Botschaften von Anderen erkennen, desto genauer dürften sie auch ihre eigenen Gefühle wahrnehmen. Quantitative Veränderungen ergeben sich durch Erfahrung und Übung in den einzelnen Fertigkeiten, qualitative Umwälzungen erfolgen im Zusammenhang mit der kognitiven Entwicklung. In der Entwicklung verändert sich insofern auch das Selbst, das ein immer komplexeres Wissen über die Regeln der Modulation von Ausdruck und Erleben von Gefühlen erwirbt. Halberstadt et al. (2001) behaupten ferner, dass die Struktur ihres Modells der affektiven sozialen Kompetenz über die ganze Lebensspanne und über alle Kulturen gleich bleibt, während die Erscheinungsformen dieser Fertigkeiten auf der Ebene des Verhaltens in Abhängigkeit von Alter, Kultur und Zielen der Person unterschiedlich ausfallen.
Beim Modell von Halberstadt et al. (2001) drängt sich die Frage auf, inwiefern der Beitrag eines Individuums als sozial-emotional kompetent zu verstehen ist, wenn dieser doch von den Vorgaben des Interaktionspartners abhängt. Sendet das Gegenüber emotional ambivalente, unklare oder irrelevante Botschaften, dann hat das Individuum es schwerer, kompetent darauf zu antworten. Die sozial-affektive Kompetenz, die die Beteiligten von Moment zu Moment zeigen, ist somit eng miteinander verbunden.
2.2.5 Vergleich der vier Modelle
Auf den vorangegangenen Seiten wurden vier Modelle zur Entwicklung emotionaler (und sozialer) Kompetenz in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung vorgestellt: Zuerst wurde das Modell von Salovey und Mayer (1990) publiziert, etwa zeitgleich ein Vorläufer-Modell von Saarni (1990). Gegen Ende der neunziger Jahre folgte das Konzept von Rose-Krasnor (1997) und Anfang des neuen Jahrtausends das Windradmodell von Halberstadt und Kolleginnen (2001). Aus diesem historischen Blickwinkel wird deutlich, dass jedes Modell auf seinen Vorläufern aufbaut, manchmal explizit, manchmal implizit. Auf der Ebene der »Fertigkeiten« (der untersten Ebene in Rose-Krasnors Pyramidenmodell) lassen sich viele Gemeinsamkeiten zwischen ihnen finden. So lassen sich die von Salovey und Mayer (1990) proklamierten Bereiche emotionaler Intelligenz mit geringen Schwierigkeiten in die acht Fertigkeiten von Saarni (1990) überführen. Die »Bewusstheit über den emotionalen Zustand« (erste Fertigkeit bei Saarni) lässt sich beispielsweise als Teilfertigkeit unter »Bewertung (und Ausdruck) von Emotionen im Selbst« im Modell von Salovey et al. (2001) subsumieren. Diese Komponente der korrekten Selbstwahrnehmung der eigenen emotionalen Befindlichkeit findet sich unter dem Stichpunkt »Korrekte Identifizierung des eigenen Erlebens« auch bei Halberstadt et al. (2001).
Auch wenn sich die Komponenten in den Modellen überlappen, so unterscheidet sich doch der theoretische »Überbau«: Salovey und Mayer (1990) orientieren sich an der Intelligenzforschung, Saarni (1999) nimmt eine sozial-konstruktivistische Haltung ein, Rose-Krasnor (1997) gründet ihr Modell auf empirischen Forschungsergebnissen zur sozialen Entwicklung und Halberstadt et al. (2001) gehen von einem Kommunikationsmodell aus. Betrachtet man diese Unterschiede von einer übergeordneten Warte aus, so treten sie vor allem an folgenden vier Punkten zutage:
1.
Unterschiede bei der Begründung der Auswahl: Die historisch ältesten Modelle von Salovey und Mayer (1990) und von Saarni (1990, 1999) präsentieren jeweils Listen von einzelnen Fertigkeiten, deren Auswahl nicht weiter thematisiert wird. Vielmehr geht Saarni (1999) davon aus, dass sich die Liste der wünschenswerten Fertigkeiten noch verlängern ließe, je nach theoretischer Orientierung oder Genauigkeit der Darstellung. Problematisch an solchen Listen ist zum einen, dass die hier benannten »Tugenden« mitunter willkürlich und kulturspezifisch sind, oft vage formuliert und schwierig zu messen sind sowie z. T. empirisch nicht fundiert sind. Zum anderen schreiben solche Listen den Status quo fest, der optimales Verhalten zum Teil gar nicht enthält Rose-Krasnor (1997). Denn oft ist es einfacher, emotional inkompetentes Verhalten zu beschreiben als emotional kompetentes! Halberstadt et al. (2001) begründen zwar ihre Auswahl mit dem Hinweis auf ihr Kommunikationsmodell, schließen dadurch aber kognitive Repräsentationen, die über das unmittelbare (emotionale) Erleben hinausgehen, weitgehend aus (Saarni, 2001).
2.
Unterschiede beim Aufbau: Mehrere theoretisch begründete Gliederungsebenen weisen nur die Modelle von Rose-Krasnor (1997) und von Halberstadt et al. (2001) auf, die dadurch reichhaltiger und anspruchsvoller sind und differenziertere Vorhersagen erlauben.
3.