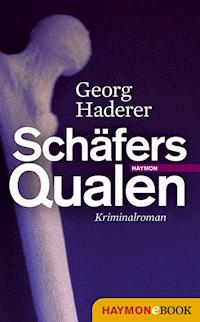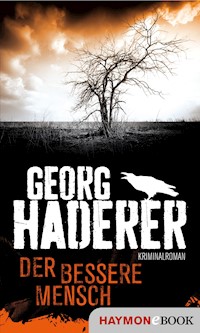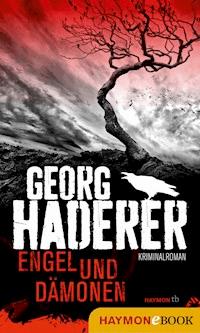
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Schäfer-Krimi
- Sprache: Deutsch
WO ZUM TEUFEL STECKT POLIZEIMAJOR SCHÄFER? Major Schäfer ist verschwunden, Chefinspektor Bergmann übernimmt das Ruder 23 Tage - und noch immer keine Spur von Major Schäfer. Dessen Assistent, Chefinspektor Bergmann, hat nicht viel Zeit, sich mit dem Verschwinden seines Vorgesetzten zu befassen: ein hingerichteter Prostituiertenmörder, ein unter seltsamen Umständen verstorbener Kroate und dann auch noch ein toter IT-Spezialist, der offenbar einen Bombenanschlag geplant hat. Die Spuren führen Bergmann zu einem obskuren Geheimbund - und bald deutet alles darauf hin, dass Schäfer in die Fänge dieser Männer geraten ist. Als der Chefinspektor schließlich einem Hinweis zweier Wanderer nachgeht, die den Major in einem Schweizer Gebirgswald gesehen haben wollen, pfeift er auf alle Regeln und macht sich auf den Weg in den Westen. Höllisch spannend und himmlisch humorvoll Georg Haderer ist "zweifellos einer der besten Krimiautoren Österreichs" (DER STANDARD, Ingeborg Sperl). In Engel und Dämonen trifft der harte Realismus der Polizeiarbeit auf surreale Heilsversprechen, die Wiener Unterwelt trifft auf Erzengelseminare im Waldviertel und ein Jahrhunderthochwasser trifft auf die Prophezeiungen einer Sekte. Höllisch spannend, himmlisch humorvoll, mit viel Herz und noch mehr Blut! ***Major Schäfer spielt in einer Liga mit Haas' Brenner und Raabs Metzger - spannend, satirisch und unglaublich unterhaltsam*** ********* "Georg Haderers Krimis kann man einzeln lesen, man kann sie hintereinander lesen, man kann sie durcheinander lesen, eines ist jedoch sicher: Hat man den ersten verschlungen, werden die weiteren bald folgen." "So klug, so ironisch, so wortwitzig: Haderer schreibt nicht nur spannende Plots, er hat auch einen genialen Humor!" ******** GEORG HADERERS KRIMINALROMANE UM MAJOR SCHÄFER * Schäfers Qualen * Ohnmachtsspiele * Der bessere Mensch * Engel und Dämonen * Es wird Tote geben * Sterben und sterben lassen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg Haderer
Engel und Dämonen
Kriminalroman
Kill all my demons, and my angels might die too.
Tennessee Williams
1.
In einem Wald zwischen Beaupain und Artillon liegt ein Mann. Seine Kleidung schmutzig, als wäre er immer wieder hingefallen oder gar gekrochen, Hose und Jacke feucht vom Morgentau, er liegt wohl schon seit einigen Stunden hier. In ein paar Metern Entfernung tippelt argwöhnisch ein Rabe umher – hin- und hergerissen zwischen dem Verlangen, vor der Konkurrenz in diesen Körper zu hacken, und der Gefahr, die von diesem Wesen noch ausgehen könnte. Ungeduldig schreit er in dessen Richtung. Entscheide dich endlich: tot oder lebendig. Wie zur Antwort beginnt im Wipfel einer Föhre ein Specht sein Tagwerk, zum Stakkato seines Schnabels fließt das Sonnenlicht über den Waldboden in Richtung des Mannes, der nun langsam den Kopf hebt, sich wie in einem tragischen Ballettstück auf seine Handflächen stützt und die Augen öffnet. Er reißt den Mund auf, als wolle er schreien, doch es kommt nur ein heiseres Stöhnen, ein schluchzendes Krächzen dann, worauf der Rabe aufflattert und sich in sicherer Entfernung auf einem Ast niederlässt. Mehr aus Neugier denn aus Hoffnung auf Beute verweilt er dort und sieht zu, wie sich der Mann aufrichtet und zwischen den Bäumen umhertorkelt. Dann bleibt er stehen, lässt sich auf die Knie fallen und presst seinen Mund auf einen Moospolster. Gierig saugt er ein, was das Moos an Flüssigkeit hergibt, bewegt sich auf allen vieren weiter, bis er die nächste kleine Oase gefunden hat. Den Raben langweilt dieses sich unzählige Male wiederholende Tun, er sucht das Weite, sieht nicht mehr, wie der Mann schließlich aufsteht und weiterirrt, bis er zu einem kleinen Bach kommt. Als er sich bückt und die Hände zu einer Schale formt, fällt ein Gegenstand aus seiner Jackentasche ins Wasser. Er greift danach, hält eine Pistole in der Hand, zögert einen Augenblick, lässt dann das Magazin aus dem Schaft gleiten. Sieben Patronen zählt er, zieht den Schlitten zurück, nimmt die verbliebene Patrone aus dem Lauf und drückt sie zu den anderen. Elf fehlen, elf fehlen, murmelt er, betrachtet die Waffe erneut und steckt sie schließlich hinten in den Hosenbund. Er hebt den Kopf, sieht in den Himmel, bewegt stumm den Mund, lässt sich wieder auf die Knie nieder und trinkt. Später sitzt er auf einem Baumstumpf, die Ellbogen auf den Knien, das Gesicht in die Hände gelegt. Immer wieder schüttelt er heftig den Kopf. Irgendwann blickt er auf, kneift die Augen zusammen wie ein Kurzsichtiger ohne Sehbehelf. Niemand hört, wie er sagt: Mein Name, mein Name, mein Name. Mein Name ist Johannes Schäfer, ich bin einundzwanzig Jahre alt und wohne in Innsbruck.
2.
Bergmann allein im Büro. Mit einem schwarzen Kugelschreiber zieht er die Striche auf der Schreibunterlage nach. Jeden Tag kommt ein neuer hinzu. Wie auf einer Zellenwand. Dreiundzwanzig sind es mittlerweile. Er legt den Kugelschreiber beiseite, nimmt die Handschellen vom Tisch, öffnet einen der Ringe und schlägt ihn mit einer schnellen Drehung des Handgelenks an den Fuß der Schreibtischlampe. Einhändiges Tempoachtern, in Gedanken geht er eine Realsituation dazu durch: Tritt in die Kniekehle, Fixieren der Person durch Druck des linken Unterarms in den Nacken beziehungsweise Griff in die Haare, Sichern des rechten Handgelenks mittels Handfessel, bei Gegenwehr Ellbogen oder Finger bis zur Bruchstelle belasten, zweiten Ring anbringen, Abkühlphase abwarten beziehungsweise Person in Gewahrsam der Kollegen geben. Klack, klack, klack, der Fuß der Lampe weist zwei Dellen mehr auf, an denen der Lack absplittert. Schäfers Lampe gegenüber ist nur am Schirm beschädigt, an der Außenseite, die zum Fenster zeigt, dessen Griff analoge Schlagspuren aufweist. Ein rituelles Dacapo, das sich Bergmann herbeisehnt: Sein Vorgesetzter kommt bei der Tür herein, sieht sich um, als hätte er sich im Zimmer geirrt, setzt sich, trommelt mit den Fingern auf die Tischoberfläche und schlägt dann mit dem Handrücken den Lampenschirm weg, der blechern gegen den Fenstergriff knallt. War die Lampe an, hieß das in den meisten Fällen: Licht aus.
Bergmann steht auf, dreht sich um und nimmt aus dem obersten Regal einen Karton mit Glühbirnen; eine Großpackung zu vierundzwanzig Stück, die er nun auf den Schreibtisch stellt und den Inhalt zählt. Sieben. Gekauft hat er die Packung vor einem halben Jahr … kurz vor Weihnachten, gewohntermaßen eine schwierige Zeit für seinen Chef: der Wind, der Wiener Nebel, kaum Tageslicht … Zwei Jahre zuvor hat Bergmann für Schäfer eine Tageslichtlampe gekauft, die dieser tatsächlich jeden Tag bei Arbeitsantritt einschaltete. Das grelle kühle Licht ließ das Büro von außen erscheinen wie das Treibhaus eines Marihuanazüchters. War Schäfer gut gelaunt, brummte er nach Einschalten der Lampe immer ein paar Minuten dieses Hank-Williams-Lied … I wandered so aimless, my life filled with sin, I wouldn’t let my dear saviour in. Then Jesus came like a stranger in the night, praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light … Jemand klopft an die Tür.
»Haben Sie gerade gesungen?«, fragte Kovacs grinsend, während sie einen Stuhl an den Schreibtisch stellte.
»Nein … was gibt’s?«
»Ist gerade gekommen«, Kovacs legte eine Akte auf den Tisch, die fast so dick war wie das Wiener Telefonbuch.
Bergmann schlug das Deckblatt zurück und überflog die ersten paar Seiten.
»Wiener Neustadt … liegt meines Wissens immer noch in Niederösterreich … Was geht uns das an?«
»Das ist der Fall von diesem Bürgermeister, der mit zwei Promille in ein Möbelhaus gekracht ist …«
»Ja … das war in Niederösterreich, das war ein Unfall, das ist ein halbes Jahr her, also: Was geht uns das an?«
»Ein Freund des Opfers hat den Unfallhergang noch einmal untersucht und …«
»Dieser wahnsinnige Richter?«
»Genau der … jedenfalls hat er offensichtlich ein paar Ungereimtheiten und polizeiliche Versäumnisse aufgedeckt und die Staatsanwaltschaft so lange bearbeitet, bis sie den Fall wieder aufgenommen hat … und aufgrund einer möglichen Befangenheit der Ermittler dort …«
»Die spinnen … der Alte ist hinüber, der gräbt in der Pension alte Akten aus und will nachweisen, dass Franz Fuchs ein Agent des Mossad war …«
Kovacs kicherte – kicherte dämlich, fand Bergmann –, sie nahm die Akte und legte sie aufgeschlagen zurück. Bergmann starrte auf ein Foto des Unfallwagens von Lady Diana, aufgenommen im berühmten Pariser Tunnel. Darunter zum Vergleich der Mercedes des verunglückten Bürgermeisters inmitten zerfetzter Sitzgarnituren.
»Nein, nicht mit mir«, sagte Bergmann, als wäre er ein Kind, das vor einem Teller Kohlgemüse sitzt.
»Schreyer?«, fragte Kovacs schelmisch.
Bergmann überlegte einen Augenblick. Schreyer. Schäfers Hofnarr. Ihr halbautistischer Inspektor, der sich zwar als wahres Recherchegenie etabliert hatte, aber in diesem Fall … nein, zu komplex … außerdem war der ohne seinen Herrn und Meister zu störanfällig.
»Sie machen das«, Bergmann packte die Akte und drückte sie Kovacs in die Hände, »filtern Sie aus, was kompletter Schwachsinn ist, und erstellen Sie mir eine Kurzfassung … maximal zehn Seiten … zwei Tage?«
Kovacs sah ihn verblüfft an. Offensichtlich hatte sie damit gerechnet, dass der Akt ein paar Wochen zur Belustigung im gesamten Dezernat rotierte und dann als krude Verschwörungsfantasie abgetan würde. Vielleicht meinte er das nur als Scherz. Nein, Bergmann machte in puncto Arbeit nie Scherze.
»Sonst noch was?«
»Ja … gibt’s …«
»Nein, es gibt nichts Neues«, erwiderte Bergmann, ohne ihr in die Augen zu sehen.
Jetzt blickt er auf die Wanduhr. Sieben nach elf. Drei Stunden, ohne eine Leistung erbracht zu haben, für die der Steuerzahler aufzukommen hat. So geht’s auch nicht. Er zieht einen Stapel Akten heran und legt sie nebeneinander auf die Tischplatte.
Alsdann: Obdachloser mit Bruststich, dafür ohne Erinnerung, aufgefunden am 7. Mai am Lerchenfelder Gürtel auf der Grünfläche zwischen Straße und U-Bahn. Tatzeit gegen vier Uhr früh, entdeckt um halb sechs von einem Morgenspaziergänger – Typus Hundausführer, der regelmäßig die medial verkündeten grausigen Funde macht. Anschließend Notoperation, eine Woche später lag der Mann schon wieder im Billigwein-Koma in verwahrlosten Hauseingängen und pflegte das langsamere Sterben. Ohne Zeugen oder Zufall würden sie den Täter nicht kriegen. Bergmann platziert die Akte links oben auf der Tischplatte – die Ecke, wo die Prioritäten so hoch sind wie seine momentane Motivation.
Fall zwei: Ein toter Kroate am Hernalser Gürtel, verblutet nach einer Schnittverletzung am Oberschenkel, die ihm die Arterie durchtrennt hatte. Da sie am Fundort weder Kampf- noch Blutspuren gefunden hatten, sah das Ganze nach einer Kofferraumfahrt mit anschließender Deponierung aus. Warum ausgerechnet an einer Stelle, wo auch in der Nacht der Verkehr relativ stark und zudem einige Nachtlokale in der Nähe waren, blieb unklar. Eine Warnung an irgendwen? Dazu fehlte dem Kroaten jede Verbindung zum Milieu. Keine Vorstrafen, Arbeitserlaubnis … Raubmord schied ebenfalls aus, da der Mann Uhr, Geld und Papiere bei sich getragen hatte … vielleicht eine Verwechslung … auch Koller, dem Gerichtsmediziner, gab der Fall Rätsel auf. Die Wunde war mit einer dünnen, sehr scharfen Klinge verursacht worden, am ehesten ein Rasiermesser; doch bei einem Angriff mit einem solchen gegen den Oberschenkel hätte sich der Mann gewehrt und ohne Zweifel Abwehrverletzungen erlitten. Was bei Gesamtbetrachtung immer wieder zu absurden fiktiven Tatverläufen führte, etwa, dass sich der Mann nach der Arbeit mit Kollegen besäuft, dann auf dem Nachhauseweg in einem Park einschläft, worauf ihm ein Verrückter mit einer Rasierklinge die Oberschenkelarterie durchtrennt, literweise Blut in irgendeinem Behältnis auffängt, den Toten dann in sein Auto packt, am Gürtel parkt und sein Opfer neben die Straße legt. Das verlangte im Moment zu viel an Denkarbeit, als dass sie genügend freie Gehirne dafür hätten; ab nach hinten, rechts neben den Obdachlosen.
Fall drei: Ein Ehepaar, das zwei Wochen zuvor erschossen im Vogelweidpark im 15. Bezirk aufgefunden worden war. Hier sprach alles für einen Doppelselbstmord beziehungsweise Tötung auf Verlangen. Die beiden waren aneinander gelehnt auf einer Parkbank gesessen, jeweils an der linken Schläfe ein Einschussloch, beide Schüsse aufgesetzt, Pulverrückstände an der rechten Hand und am Ärmel des Mannes. In der Manteltasche der Frau hatten sie einen Abschiedsbrief in ihrer Handschrift gefunden: schwer krank, können sich nicht mehr länger selbst um sich kümmern, wollen in kein Heim und schon gar nicht ohne den anderen leben, die Kinder mögen ihnen bitte verzeihen. Akte zu, Rosen auf die Särge, Asche zu Asche, zwei Menschen wandern ins Himmelreich und in die Vergessenheit – einen Augenblick bitte noch, was ist mit der Waffe, wo ist die hin? Sie war weg, höchstwahrscheinlich gestohlen; von irgendwelchen halbstarken Balkanjungs, die sich nach Einbruch der Dunkelheit ohne Einspruch der Eltern im Park herumtrieben; von einem der bulgarischen Kleinzuhälter, die sich zwischen den Besuchen im Wettbüro dort mit ihren Prostituierten zum Abkassieren trafen; von einem Drogendealer, der zwischen den Büschen seine Heroinpäckchen vergraben hat; möglicherweise auch von einem braven Bankangestellten, der die beiden Toten beim spätabendlichen Joggen entdeckt und sich gedacht hat, dass er eigentlich schon seit der Schulzeit, als er ständig drangsaliert worden war, eine Pistole haben wollte.
So oder so würde die Waffe früher oder später wieder auftauchen. Wie wohl, fragte sich Bergmann. Würde es die besorgte Mutter sein, die sie im Zimmer ihres Sohnes unter der Matratze fände und der Polizei übergäbe? Nur zwei Kugeln daraus im Oberkörper eines ausgeraubten Juweliers? Oder die alte Walther P1 in der kalten toten Hand eines Amokläufers, der mit den verbliebenen sechs Projektilen … wie auch immer, alle Details zur Waffe waren in den relevanten polizeilichen Datenbanken erfasst, viel mehr als abwarten konnten sie auch in diesem Fall nicht.
So, jetzt zum vierten Fall, dem beschissensten überhaupt: Suchen Sie den Mörder eines Mörders. 28. Mai, kurz nach Mitternacht: Ein Pärchen, das nach einem Lokalbesuch zur U4-Station Rossauer Lände geht, sieht auf der zum Donaukanal abfallenden Wiese einen menschlichen Körper liegen. Ungewöhnlich, aber wahr: Sie schauen nach, was es mit der Person auf sich hat, ob sie vielleicht Hilfe benötigt. Nein, jetzt nicht mehr, der Mann ist tot. Als Bergmann eintrifft – ohne Schäfer, der seit vier Tagen im Urlaub ist – und den Leichnam sieht, denkt er zuerst: nur gerecht. Dann: noch mehr Arbeit. Bei dem Toten handelt es sich um einen des mehrfachen Mordes verdächtigten Mann. Seit Anfang des Jahres soll er sieben Prostituierte stranguliert, erstochen, anschließend mit einem Brandbeschleuniger übergossen und angezündet haben, um allfällige Spuren zu verwischen. Bei seinem letzten Opfer kam ihm allerdings ein anderer Freier dazwischen, den er niederstach und den Tatort fluchtartig verließ. Gewebe- und Blutspuren unter den Fingernägeln der Toten sowie die Personenbeschreibung durch den Freier führten schnell zu einem Installateur, der wegen Körperverletzung vorbestraft war und bereits zwei Jahre in Haft verbracht hatte. Und damit auch erfahren genug war, um zu wissen, dass ihm nicht viel Zeit blieb, um unterzutauchen. Dass sie ihn jetzt in Wien fanden, erstaunte Bergmann. Der Mann hatte genug Zeit und Geld gehabt, um sich ins Ausland abzusetzen. Stattdessen treibt er sich auf der Lände herum und findet seinen Richter in stumpfer Gewalteinwirkung gegen den Hals. Wahrscheinlich ein Handkantenschlag, der ihm den Kehlkopf zerquetscht hat; möglicherweise eine der üblichen spätabendlichen Streitereien zwischen alkoholisierten Männern; allerdings hatte das Opfer sonst keine sichtbaren Verletzungen, was den Schluss nahelegte, dass der Angreifer überraschend zuschlug und kampferfahren war. Einer dieser jugendlichen Testosteronjugos, wie Schäfer sie nannte: frustrierte Schulabbrecher oder Arbeitslose, die ihr Zuviel an Zeit in suspekten Fitnessstudios verbrachten, wo ihnen das Zuschlagen ohne die Konsequenzen beigebracht wurde.
Selbstjustiz oder ein Racheakt waren natürlich ebenso wenig auszuschließen, dachte Bergmann und legte den Akt rechts neben den Obdachlosen.
Der restliche Stapel beinhaltete keine Tötungsdelikte. Und damit das, was den Einsatzbereich Leib und Leben tagtäglich am Laufen und Ermitteln hielt: Straßenschlägereien, Messerstechereien, Gewalt von Türstehern und gegen diese, prügelnde Ehemänner und Lebensgefährten, Pensionisten, die mit Luftpistolen auf lärmende Kinder schossen, Autofahrer, die sich wegen eines Parkplatzes an die Gurgel gingen, Pöbeleien unter Jugendlichen, die außer Kontrolle gerieten … dass die Aufklärungsquote trotz der Anzahl der Delikte und der Personalknappheit bei fast achtzig Prozent lag, erschien Bergmann immer wieder rätselhaft. Andererseits: Die Mehrzahl der Täter war betrunken, dumm, aktenkundig, so laut, dass es sofort Zeugen gab, stand vor einer Überwachungskamera – oder schlicht alles zusammen. Welchen Beruf hätte ich eigentlich, wenn alle Menschen gut wären, fragte sich Bergmann, lehnte sich zurück und legte umständlich die Füße auf den Tisch, nur ein paar Sekunden allerdings – er war nicht der new sheriff in town, der alte wäre hoffentlich bald wieder da, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich.
Am frühen Nachmittag – Bergmann hatte eben die Aussagen der Nachbarn eines krankenhausreif geschlagenen Reklamezustellers überprüft und deren Glaubwürdigkeit sowie Gewaltbereitschaft einzuschätzen versucht – rief Kamp ihn zu sich. Schon als er die Nummer des Obersts am Display sah, setzte in ihm der bekannte Widerstreit zwischen Hoffnung und Verzweiflung ein. Wir haben ihn gefunden. Tot oder lebendig? Doch Kamp wusste nicht mehr oder weniger als Bergmann selbst.
»Nichts Neues«, begann er das Gespräch und Bergmann erkannte nicht, ob es eine Frage oder Feststellung war.
»Nein … seine Mutter ruft jeden Tag zweimal an und fragt mich dasselbe … seine Nichte oder sein Bruder täglich … was soll ich ihnen sagen …«
Kamp schaute an die Decke und strich sich mit beiden Händen über die Wangen, als überprüfte er seinen Bartwuchs.
»Ich weiß, dass Sie den Fall gern übernehmen würden«, sagte er, als die Stille zu nichts mehr führte.
»Aber?«
»Sie kennen das Aber. Solange es keinen Hinweis auf ein Gewaltverbrechen gibt, suchen die Fahnder nach ihm, Kollege hin oder her … außerdem sind wir … sind Sie befangen … was soll ich machen …«
»Pervers … die einzige Möglichkeit, dass wir ihn offiziell suchen dürfen, ist, etwas zu finden, das beweist, dass er wahrscheinlich getötet worden ist …«
»So ist es eben … haben Sie was gefunden?«
»Ich ermittle ja gar nicht.«
»Lassen Sie das … also?«
»Nein … ich war dreimal in der Wohnung … ein Anzug fehlt … wenn er ihn nicht zur Caritas gebracht hat … Sportkleidung, Bergschuhe, sein Laptop … ohne Befangenheit würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Person abgesetzt hat, ist durchaus gegeben … zumal sein Verhalten in den letzten beiden Jahren sowie seine Aussagen … ich kann nicht glauben, dass er einfach so verschwindet. Ohne sich zu melden … zumindest bei seiner Familie … das würde Schäfer ihnen nicht antun …«
Sie sahen sich schweigend an, ihre Gedankenwege fanden zueinander, sahen an der Kreuzung das Wort Selbstmord und weigerten sich, es in Sprache zu wandeln.
»Wenn ich an den Fall Lopotka denke …«, sagte Kamp leise.
»Dann?«
»Da war unserem Major der Unterschied zwischen Finden und Erfinden herzlich egal … mir ja auch, aber ich lag damals im Krankenhaus …«
Bergmann schaute den Oberst einen Augenblick begriffsstutzig an. Dann lächelte er kurz.
»Verstehe … haben Sie da einen Anhaltspunkt …«
»Herr Chefinspektor«, sagte Kamp nun formell, »ab morgen heißt Ihr Team Gruppe Bergmann. Das war gottlob keine einfache Entscheidung, aber ich brauche jemanden, der die Führung und Verantwortung übernimmt … trauen Sie sich das zu?«
Bergmann fühlte sich überrumpelt. Und Schäfer? War diese Beförderung der erste Spatenstich zu dessen Grab?
»Ich weiß nicht … also arbeitsmäßig schon …«
»Vergessen Sie das andere einstweilen … Sie leiten die Gruppe und übernehmen damit auch die Verantwortung dafür, was Sie neben der Bearbeitung des Tagesgeschäfts so finden …«
»Also soll ich Schäfer jetzt doch suchen …«
»Zwischen den Zeilen lesen ist nicht so Ihre Stärke«, erwiderte Kamp. »Überlegen Sie es sich und geben Sie mir morgen früh Bescheid, dann informiere ich die Gruppe bei der Morgenbesprechung darüber.«
»Nein … also ja, ich mache es.«
»Gut … wurde ohnehin Zeit, dass Sie aus seinem Schatten treten …«
»Aber nicht so …«
»Werden Sie bitte nach Dienstschluss sentimental, Chefinspektor Bergmann … was ich jetzt brauche, ist eine kämpferische Truppe und einen starken Anführer.«
Nachdem Bergmann das Büro verlassen hatte, starrte Kamp minutenlang auf den leeren Sessel vor ihm. Dann schenkte er sich ein Glas Cognac ein, stand auf und stellte sich ans Fenster.
3.
Für acht Uhr war Bergmann mit seinem Freund verabredet – oder Exfreund oder wie immer man das Verhältnis nennen sollte, das sie die letzten Wochen geführt hatten. Eine Analyse dieses Zustands wollte sich Bergmann nicht antun, ebenso wenig wie Schuldzuweisungen, die es auch nicht besser machen würden. Mit Zunahme der Konflikte war sein Harmoniebedürfnis ohne die übliche Phase von Streit und Versöhnung in Gleichgültigkeit übergegangen. Da ließ sich nichts mehr retten; wozu also dieses Treffen? Es würde ihm nur Energie entziehen, von der er zurzeit ohnehin nicht zu viel hatte. Er hatte andere Sorgen, dachte er nun laut und räumte seinen Schreibtisch auf. Ab dem nächsten Morgen hatte er die Gruppe zu führen; stark und kämpferisch, wie Kamp gemeint hatte, dem offensichtlich keine treffenderen Worte eingefallen waren. Wie hatte er das gemeint mit dem Finden und Erfinden? Indizien fälschen? Dass Bergmann die Vorschriften und Gesetze wie ein Elastikband behandeln sollte und nicht mehr als klare Grenzen? Das war nicht seins, das musste Kamp doch wissen. Er hielt noch etwas darauf, sich nicht korrumpieren zu lassen, Zeugen nicht einzuschüchtern, Tatverdächtige nicht zu misshandeln. Das war seine Würde, sein Stolz und sein Schutz.
Nachdem er sich dagegen entschieden hatte, vor seinem Treffen nach Hause zu fahren, um zu duschen und sich umzuziehen, ging er um den Schreibtisch und setzte sich an Schäfers Platz. Zog die oberste Schublade von dessen Rollkasten heraus und stellte sie vor sich hin. Alles schön ordentlich – weil er die Lade schon dreimal durchsucht und wieder eingeräumt hatte; die ursprüngliche Unordnung wiederherstellen zu versuchen, wäre verlogen gewesen. Er nahm eine quadratische Schachtel heraus und leerte den Inhalt auf die Tischplatte: kleine goldene Schutzengel-Anhänger, Kupferarmreifen mit obskuren Magnetnieten, Christuskreuze in verschiedenen Größen und Ausprägungen, Amulette, Heilsteine, eine Traumfänger-Miniatur – wer daran zweifelte, dass auch Polizisten einen Fanclub haben konnten, musste sich nur Schäfers Schachtel-Schrein ansehen, in dem er die Talismane und Dankesgeschenke lagerte, die in unregelmäßigem Abstand mit der Post eintrafen. Eine Flasche Wein wäre mir eigentlich lieber, hatte er ein paar Wochen zuvor bemerkt, als er einem Paket einen faustgroßen Rosenquarz entnahm, der ihn vor bösen Strahlungen oder Rheuma oder sonst was beschützen sollte. Gedankenverloren ließ Bergmann vor seinen Augen ein Lederband mit einem metallenen Amulett pendeln, auf das ein ihm unbekanntes Symbol geprägt war: ein auf dem Kopf stehendes Dreieck, durch dessen Spitze zwei Wellenlinien zogen. Das Ding wog schwer, was war das, Blei? Esoterisches Glumpert auf jeden Fall, nutzloser Plunder, dessen Wirksamkeit nun offiziell widerlegt war. Bergmann warf die Sachen zurück in die Schachtel und nahm sich zum wiederholten Mal den Rest des Schrankinhalts vor: Stifte, Zettel, Blöcke, steinhartes Studentenfutter, ein Taschenmesser, ein paar Muscheln, ein Fremdwörterbuch, tja, haha, und die quasi nur mehr verdeckt eingesetzte Kaffeetasse, die Schäfer zu Weihnachten 2006 in zehnfacher Ausführung in einem Souvenirladen als Geschenk für sie hatte anfertigen lassen: »Ich sehe tote Menschen« stand groß drauf, darunter »EB Leib & Leben – Gruppe Schäfer«. Einen Monat nach dieser gelungenen Bescherung mussten sie auf Anweisung von oben die Tassen aus den Büros entfernen: zynisch, rücksichtslos, es galt doch zu bedenken, dass auch polizeifremde Personen, möglicherweise Angehörige von Opfern et cetera. Verklärt lächelnd nahm Bergmann die Tasse zum Waschbecken mit, wusch sie aus, bereitete sich einen Tee und setzte sich wieder an Schäfers Platz.
Um viertel vor acht gab er auf – wenn wer in diesem belanglosen Bürokram ein Indiz finden konnte, dass Schäfer einem Verbrechen zum Opfer gefallen war, dann Schäfer, Punkt.
Mit fünfzehnminütiger Verspätung betrat er das Lokal im 5. Bezirk. Martin hatte bereits einen Tisch besetzt, sein Bierglas war mehr als halbleer, er blätterte in einem Magazin, zu schnell, als dass er etwas vom Inhalt mitbekommen konnte. Er hatte Bergmanns Eintreffen bemerkt, ließ sich jedoch nichts anmerken, bis dieser sich ihm gegenübersetzte und vorerst nichts, gar nichts zu sagen wusste.
»Nette Begrüßung …«
»Hallo …«
»Grüß dich … willst du was essen?«
»Ja, warum nicht …«
»Zwingen tu ich dich nicht.«
»Hast du schon was bestellt?«
»Nein, ich habe auf dich gewartet …«
Sie blätterten schweigend in der Karte, deren Gerichte nicht halb so einfallsreich waren wie die Namen dafür.
»Ich glaub, ich nehm die Tagliatelle … sollen wir eine Flasche Wein bestellen?«
»Mir reicht ein Glas … aber wenn du …«
Der Kellner trat an den Tisch, sie bestellten, warteten, bis der Wein kam, von dem Bergmann hoffte, dass er die Stimmung zumindest ein wenig lockern würde.
»Und? Habt ihr ihn schon gefunden, deinen …«
»Nein. Können wir über etwas anderes reden, bitte …«
»Nur zu gern …«
»Wie war dein Tag?«
»Ts … Stress, wie immer … jetzt haben wir auch noch das Projekt in Oberwart gewonnen, das Einkaufszentrum …«
»Gratuliere … war das dein Entwurf?«
»Vom Team … wundert mich eh, dass die sich an so was rantrauen …«
»Am Land sind sie doch inzwischen wesentlich progressiver als in der Stadt … zumindest, was die Architektur angeht …«
»Ja … wir beide bräuchten nicht aufs Land zu ziehen«, Martin lächelte und versuchte Bergmanns Hand zu nehmen, die dieser rasch zurückzog.
»Okay … so weit ist es schon.«
»Entschuldigung … es ist nicht … es ist nur … Scheiße …«
»Das kannst du laut sagen … also was, was denkst du?«
Bergmann starrte durch seinen Freund hindurch. Er hasste diese Frage. Mit siebzehn, als er noch glaubte, auf Frauen zu stehen, hatte er eine Freundin aus dem Nachbardorf. Immer, wenn sie irgendwo allein waren und er ein paar Minuten schwieg, fragte sie ihn: Was denkst du denn? Und »nichts« als Antwort war natürlich genauso unzureichend wie das Ausweichen hin zu »dass du schön bist« oder ähnlichen Banalitäten.
»Dass es mir momentan alles ein bisschen zu viel ist«, bemühte er sich um die Wahrheit.
»Und was genau?«
»Die Arbeit … unsere Streitereien …«
»Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass das vielleicht zusammenhängt … die Sorge um dein Schäferlein und …«
»Halt die Klappe!«
»Ah, da wird der Herr Chefinspektor plötzlich emotional … gut zu wissen …«
Bergmann war danach, aufzustehen und zu gehen. Diese beschissene Eifersucht und diese dummen Sticheleien und dieses zwanghafte Umkreisen der immer gleichen Themen – als ob man auf einem zugefrorenen See mit Schlittschuhen so lange exakt dieselbe Runde lief, bis die Kufen das Eis durchbrachen. Er mochte darauf wetten, dass innerhalb der folgenden Stunde das Gespräch erneut auf diesen Samstag Anfang Mai käme, wo er mit Schäfer zum Ikea gefahren war. Martin wollte mit ihm das Wochenende verbringen, doch Bergmann war danach, zwei Tage für sich zu sein, ein paar Sachen für die Wohnung zu kaufen, aufzuräumen und nichts zu tun. Und dann ruft am Vormittag Schäfer an: »Was machen Sie heute, gehen wir spazieren in den Wienerwald? … Zum Ikea? Ah, da komme ich mit, ich brauche eh einen neuen Duschschlauch. Holen Sie mich ab?« Was hätte er denn sagen sollen? Nein, lassen Sie mich in Frieden mit Ihrer Mir-fällt-die-Decke-auf-den-Kopf-Panik? Ja, etwas in der Richtung hätte er erwidern können, zumal er genau wusste, was Schäfer von Einkaufszentren hielt, dass es ihm nicht um den Duschschlauch ging, dass er sich an den Rockzipfel seines Untergebenen hängen wollte, weil ihm sonst die Leere seines Wochenendes unerträglich würde. Und natürlich überschritt hier das Berufliche die Grenze zum Privaten, hatte der Major die Befehlskette aus dem Büro mitgenommen und schepperte seinem Chefinspektor damit ins Telefon, aber das würde er nicht tun, wenn er Bergmanns Gesellschaft nicht als angenehm empfinden würde, und genau das war der Punkt, an dem Martins Eifersucht zumindest teilweise berechtigt war.
»Wir arbeiten seit zehn Jahren zusammen«, sagte Bergmann trotzig, »ich habe mehr Zeit mit ihm verbracht als mit sonst einem Menschen … wie würdest denn du an meiner Stelle reagieren?«
»Ich weiß, wo mein Beruf aufhört und das Privatleben anfängt …«
»Ja … weil dich auch niemand um Mitternacht anruft und sagt, dass da ein Mann auf der Straße liegt, dem die Eingeweide heraushängen …«
Der Kellner trat an den Tisch, stellte die Teller ab und erklärte ihnen, was sie zu essen im Begriff waren.
»Guten Appetit.«
»Ja, dir auch.«
Als Bergmann das Lokal um kurz vor zwölf verließ – nach dem so finalen wie peinlichen Satz, dass sie sich vielleicht einmal zwei Wochen nicht sehen sollten, um Abstand zu gewinnen, bla, bla, bla –, hatte er einen Schwips. Drei Gläser Wein in knapp vier Stunden, da putzte Schäfer zwei Flaschen weg, murmelte er, als er in sein Auto stieg. Ich sollte mich einmal so richtig volllaufen lassen, in eine dieser verrauchten Spelunken im Zweiten gehen und saufen, bis die Funkstreife kommt. Doch allein beim Gedanken daran zog sich sein Magen zusammen. Dankbar muss ich sein, dass ich nicht so bin, jetzt redete er in Gesprächslautstärke, entgeht mir irgendwas, wenn ich darauf verzichte, am Vormittag zwei Stunden auf ein Glas zu starren, in dem sich eine Alka-Seltzer-Tablette nach der anderen auflöst? Sicher nicht.
Ein heftiger Knall riss ihn aus seinen Gedanken. Wie war das denn möglich? Er hatte die Einfahrt zur Tiefgarage bestimmt schon tausendmal genommen, da fand er rückwärts und blind hinein, das konnte nur an dem Wagen liegen, dessen Kotflügel er zerstört hatte, der stand bestimmt einen Meter über die Begrenzungslinie hinaus. Er stellte den Motor ab, stieg aus und betrachtete den Schaden. Tja, da würde einer die nächsten Tage die Öffentlichen oder einen Leihwagen brauchen. Und die Schuldfrage war eindeutig zu beantworten, der beschädigte Wagen stand keinen Zentimeter über den zugewiesenen Parkplatz hinaus.
Bergmann nahm sein Handy, suchte die Nummer eines Kollegen von der Sicherheitswache und bestellte einen Streifenwagen inklusive Alkoholmessgerät.
»Wo ist er denn?«, war die erste Frage des Beamten, als er selbstbewusst auf Bergmann zuging.
»Vor Ihnen.«
»Sie? Sie schauen mir aber nicht sehr betrunken aus … das da der Schaden?«
»Ja … überprüfen Sie bitte meinen Atemalkohol und nehmen Sie einen Bericht auf …«
»Ist das Ihr Ernst?«
»Ja, wieso?«
»Stecken Sie ihm eine Visitenkarte unter den Scheibenwischer und die Sache ist geregelt.«
»Nein … was ist jetzt mit dem Alkomaten …«
»Wenn Sie meinen … und wenn Sie drüber sind?«
»Muss ich Ihnen jetzt das Gesetz erklären …«
»Nein … aber blöd wäre es halt, wegen dem Führerschein …«
0,6 Promille – im Aufzug lächelte Bergmann kopfschüttelnd sein Spiegelbild an; seinen Führerschein war er nicht los, dennoch schämte er sich. Betrunken Auto zu fahren fiel für ihn in die Kategorie Fahrlässige Körperverletzung; dieses Verhalten verachtete er zutiefst, nicht erst seit dem Mädchen, dessen Gehirnmasse auf diesem Zebrastreifen im 19. Bezirk allzu deutlich zu sehen gewesen war. Er schloss die Tür auf, ging direkt ins Badezimmer, duschte und setzte sich danach an den Esstisch. Vier Wochen würde er den Wagen jetzt nur mehr für Dienstfahrten verwenden, sagte er sich, irgendwo im Keller stand ja noch sein verstaubtes Fahrrad.
4.
Der Mann, der sich für den einundzwanzigjährigen Johannes Schäfer – gebürtig in Kitzbühel, wohnhaft in Innsbruck – hielt, saß an eine alte Buche gelehnt und atmete schwer. Krämpfe quälten seinen Magen. In den vergangenen Stunden war er durch den Wald gegangen, den Blick auf den Boden gerichtet, und hatte alles verzehrt, was ihm an Genießbarem untergekommen war. Großteils waren es Pilze gewesen – Goldröhrlinge, Eierschwämme, Trichterlinge, Trompetenpfifferlinge, Maronen, Steinpilze –, dazwischen immer wieder Klee, den er kniend in sich hineingestopft hatte, einmal eine bescheidene Ansammlung von Blaubeersträuchern, deren Früchte jedoch noch nicht reif genug waren. Dass er sich, kurz nachdem er eine Handvoll der Beeren ausgespuckt hatte, anhielt, den Platz nicht zu vergessen, um später die reifen Früchte ernten zu können, erschien ihm erst Minuten später widersinnig. Wie lange hatte er denn vor, hier auszuharren? Dieser Gedanke beendete vorübergehend seine animalische Futtersuche und ließ ihn an einen dicken Buchenstamm sinken. Wie lange noch, quousque tandem?, spazierte eine lateinische Floskel durch sein Gehirn, er haschte nach ihr, weil sie ihm gesicherte Erinnerung versprach, Lateinunterricht, ihr Lehrer mit dem Spitznamen Colonel Kurtz, er sah sein Bild, den feisten haarlosen Schädel, wuff, war er verschwunden, jetzt tauchte ein anderer Mann hinter seinen Augen auf: Conny? Ja, das war Konrad Mayer, ihr Pfadfinderführer. Der sie die Hälfte der wöchentlichen Treffen mit seinen öden Vorträgen gelangweilt hatte, zwei Dutzend Acht- bis Sechzehnjährige, mit den Füßen schabend wie eine Herde junger Stiere, im abgedunkelten Vereinsraum des Kolpinghauses, an der Wand vor ihnen die Bilder eines surrenden Overheadprojektors, Speisepilze, Beeren und andere essbare Wald- und Wiesenschätze, das letzte Chart: Achtung, Verwechslungsgefahr!, doch da war ihr Auffassungsvermögen von der Größe einer Pipette längst schon am Überlaufen, Fausthiebe, Papierkugelwürfe und erste Neckereien zwischen den Pubertierenden beendeten den Theorieunterricht meist vorzeitig, Ritalin gab es damals noch nicht, ADS bekämpfte man mit Völkerball und Orientierungslauf; und jetzt hatte dieses Wissen ihm vermutlich das Leben gerettet; wahrscheinlich, ein, zwei Stunden galt es noch den Bauchkrämpfen zu widerstehen, der Angst, dass doch ein Giftpilz dabei gewesen war, wenn nicht: danke, Conny!, puff, schloss sich vor dem sich verbeugenden Pfadfinderführer der Vorhang, der den Zuseherraum von der Erkenntnis trennte, dunkel wurde es wieder und trostlos; wenn nur die Fragen lange genug blieben, um sie zu verstehen; nicht der Schmerz im Hinterkopf war es, der ihn am meisten quälte, sondern die Unfähigkeit, in die Tätigkeit seines Gehirns ordnend einzugreifen; er begann zu weinen; das weichte die Mauer ein wenig auf, ein paar Menschen traten durch einen schmalen Spalt, er wusste, dass er sie kannte, dass sie ihm vertraut und geliebt waren, doch mehr blieb nicht. Dann kam ein Mann geradewegs auf ihn zu, milde lächelnd, im Gehen veränderte sich sein Alter, aus der Ferne hatte er ihn auf dreißig geschätzt, dann wurde er älter, und als er vor ihm stand, war er bestimmt Anfang siebzig, er trug kirchliches Ornat, grün und golden, Johannes, sagte er und ging vor ihm in die Hocke, Johannes, nicht einschlafen. Und er schlug die Augen auf, streckte seinen Rücken durch und begann zu singen:
Dich liebt, o Gott, mein ganzes Herz
Und dies ist mir der größte Schmerz
Dass ich erzürnt Dich, höchstes Gut
Ach, wasch mich rein in Jesu Blut
Dass ich gesündigt, ist mir leid
Zu bessern mich bin ich bereit
Mein Gott und Herr, mir doch verzeih
Nie mehr zu fallen Gnad’ verleih
O Gott, schließ mir Dein Herz nicht zu
Bei Dir allein ist wahre Ruh
Lass nie mich von der Gnade Dein,
von Deiner Lieb’ geschieden sein!
Nimm hin mein Herz, Herr Jesus Christ
Dein Herz für mich durchstochen ist
Ich bitt’ durchs Blut des Herzens Dein
Mach mein und aller Herzen rein
Lass nie in Sünd’ mehr fallen mich
Von ganzem Herzen lieben Dich
O heil’ger Geist, o höchstes Gut
Fach an in mir der Liebe Glut
O Gott mein Ziel, Dein werd ich sein
Mit Leib und Seel’ auf ewig Dein
Tu nur mit mir zu jeder Zeit
Herr, wie Du willst, ich bin bereit
5.
Bergmanns Beförderung zum Gruppenleiter war der erste Punkt der Morgenbesprechung. Keiner der anwesenden Beamten zeigte sich wirklich überrascht oder äußerte sich dazu, doch die Spannung, die alle nicht gestellten Fragen im Raum erzeugten, veranlasste Kamp, gegen seinen ursprünglichen Willen auf das Thema Schäfer einzugehen. Ermittlungstechnisch gab es keine Fortschritte: Die letzte gesicherte Begegnung hatte am 26. Mai mit dem Nachbarn, Peter Wedekind, stattgefunden. Danach war Schäfer offensichtlich nicht mehr in seiner Wohnung gewesen oder hatte sich bei ihnen bekannten Personen gemeldet. Bankomat- und Kreditkarten waren nach diesem Tag nicht mehr belastet worden, das Mobiltelefon außer Betrieb. Es gab keine Ticketbuchungen bei Luftlinien, keine Aufnahme in Krankenhäusern unter Schäfers Namen und zum Glück auch noch keine nicht identifizierten Leichen aus dem EU-Raum, die Ähnlichkeiten aufwiesen. Insgesamt ein Status, der ein Verbrechen nahelegte und das Eingreifen ihrer Dienststelle rechtfertigen würde – also, weshalb zögerten sie noch? Vielleicht, weil Schäfer offensichtlich einiges an Gepäck mitgenommen hatte; weil er ein Mensch war, der seine Gedanken und Vorhaben oft genug vor seinen Kollegen und Freunden verborgen hatte; weil es ihm zuzutrauen war, dass er aus einer psychisch instabilen Verfassung heraus beschlossen hatte, nach Südamerika oder Südostasien zu verschwinden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Vielleicht hatte Kamp es mit einer entsprechenden Weisung aber auch deshalb nicht eilig, weil er die mörderische Logik fürchtete, die ihrem Beruf immanent war: Indizien, die eine Ermittlung rechtfertigten, waren schon allein wegen des mangelnden Personals sehr nahe an einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Anders gesagt: Wenn sie eine Leiche suchten, fanden sie meistens eine oder zumindest Teile davon.
Deshalb überraschte es Bergmann auch, als Kamp nach den üblichen Phrasen von unter Beweis gestellter Kollegialität, Professionalität und Führungsvermögen ihr Gespräch vom Vortag in sehr freier Interpretation wiedergab.
»Wie ich gestern mit Chefinspektor Bergmann besprochen habe, werden Sie alle unter seiner Führung die Ihnen zugeteilten Aufgaben in gewohnter Weise erledigen … im operativen Ablauf sollten wir allerdings einige Änderungen einführen: Ermittlungsschritte, die nicht unbedingt sein Mitwirken erfordern, werden in zunehmendem Maße ohne ihn durchgeführt … muss ja nicht sein, dass er jede Befragung im Außendienst wahrnimmt, wie das Major Schäfer gern praktiziert hat … das will ich auf keinen Fall als Kritik an dessen Vorgehen verstanden wissen, das – wie Sie alle wissen – in den meisten Fällen erfolgreich war … doch in puncto Organisation sollten Sie in Zukunft so funktionieren wie andere Ermittlungsgruppen auch … das erfordert ein höheres Maß an Eigenverantwortung und professioneller Delegation, was ich Ihnen allen und vor allem Chefinspektor Bergmann ohne Weiteres zutraue … und es sollte Ihrem Vorgesetzten auch mehr Spielraum geben, um die Fahnder bei der Suche nach Major Schäfer zu unterstützen … ja, wenn sich das als Zeitverschwendung herausstellen sollte und Schäfer in den nächsten Tagen auftaucht, dann trete ich ihm persönlich in den Arsch, das verspreche ich Ihnen … aber wir sind es ihm auch schuldig, dass … nun gut, an die Arbeit …«
Zurück im Büro, ordnete Bergmann gedankenverloren seine Unterlagen und begann ein Organigramm zu erstellen, in dem er die Aufgaben seiner Mitarbeiter eintrug – solch eines als Vorlage in Schäfers Computer zu suchen, kam ihm erst gar nicht in den Sinn.
Jetzt war er also Gruppenleiter. Eine Position, die in seiner Karriereplanung ohnehin vorkam. Doch unter diesen Umständen … er bezweifelte, dass irgendwer im Haus ihn heute fragen würde, ob sie am Abend die Beförderung feiern wollten. Irgendwie fühlte er sich als Lückenfüller … wie ein Übergangspapst nach dem Giftmord am alten … plötzlich kam ihm der Gedanke, dass nach dieser Beförderung irgendein Spinner glauben könnte, dass er selbst Schäfer weggeschafft hatte … ein leichtes Spiel: er als die wichtigste Bezugsperson seines Vorgesetzten, vertraut mit all seinen Gewohnheiten und Eigenheiten, sogar mit einem Schlüssel für dessen Wohnung ausgestattet … nichts leichter, als ihn unter einem Vorwand irgendwohin zu locken, zu töten und spurlos zu beseitigen … wem, wenn nicht ihm als Freund und gleichzeitig Beamten der Kriminalpolizei könnte so ein Verbrechen besser gelingen? Hatte er sich nicht oft genug mit ihm gestritten und seine Methoden kritisiert? Hatte er ihn nicht sogar vor einem Jahr in Gegenwart von Kovacs geohrfeigt und beschimpft? Er lächelte bitter und schrieb auf das A2-Papier, das er an die Wand gepinnt hatte, unter Motiv: Bergmann, Karriere, event. Affekt.
Bis in den späten Nachmittag hinein fasste er alle Informationen, die er von der Fahndung bekommen hatte, gemeinsam mit seinem eigenen Wissen und dem wenigen, was ihm Schäfers Familie und seine paar Freunde mitteilen konnten, mithilfe eines Analyseprogramms zusammen. Jetzt war Schäfer also ein Fall; sein Fall. Wie armselig, dass ich das nicht schon vorige Woche gemacht habe, sagte er sich. Dass ich darauf warten muss, dass Herrchen Kamp »Hol das Stöckchen« sagt. Eigenverantwortung sah anders aus. Kein Wunder, dass er von ein paar missgünstigen Kollegen hinterrücks Schäfers Pudel genannt worden war; dann sogar in seinem Beisein; bis er einem dieser Macho-Deppen nach einer Rempelei am Schießplatz die Schulter ausgekegelt hatte; dann war Schluss mit dem Gespött gewesen und Schäfer hatte ihm eine Flasche Wein geschenkt, die zu trinken Bergmann sich aufgrund ihres Preises bis heute nicht getraut hatte. Das wäre wohl ein perfekter Wiedersehens-Tropfen … Mögliche Verdächtige, tippte er in den Computer, öffnete die Dateien mit den Fällen, die sie im vergangenen Jahr bearbeitet hatten, und suchte die Täter aus, die er für fähig hielt, sich an Schäfer rächen zu wollen, und die zugleich über genug Beziehungen außerhalb der jeweiligen Strafanstalt verfügten, um eine derartige Aktion überhaupt durchführen zu können. Kurz vor fünf kam Kovacs zu ihm.
»Bitteschön«, sie hielt ihm eine Klarsichtfolie hin.
»Der Bürgermeister?«
»Genau … Sie wollten ja nur zehn Seiten, aber …«
»Aber?«, er legte den Stapel, der mindestens das Doppelte umfasste, vor sich hin.
»Ich habe es nicht geschafft, so viel wegzulassen … außerdem sollte ich es bis morgen machen …«
»Was soll ich dann heute damit, wenn es noch nicht fertig ist?«
»Durchsehen und mir dann sagen, was Sie für unwichtig erachten«, sie klang genervt.
»Gut, mache ich … was ist Ihr Gefühl?«
»Zu dem Unfall? … Pff … es ist verrückt … wenn Sie nur den Bericht der Kollegen lesen, gibt’s keine Zweifel … aber nach den Sachen, die dieser Richter da erzählt … ich weiß es nicht … ich will mich ja auch nicht blamieren und sagen, dass er recht hat, aber …«
»Das ist das Wunderliche an diesen Verschwörungstheorien, dass sie oft so glaubhaft sind … Sie glauben also, dass es möglich ist, dass der Mann einem Anschlag zum Opfer gefallen ist …«
»Ja.«
»Ist es wahrscheinlich?«
»Ich …«, sagte Kovacs zögerlich, »keine Ahnung, der redet da dauernd von Politik und Finanzgeheimnissen, irgend so einem BOG-Verein und dem britischen Geheimdienst …«
»Das überfordert Ihr Wissen und Ihre Erfahrung.«
»Ja … von mir aus … wenn Sie es so sagen wollen …« Sie setzte sich und ließ die Arme hängen.
»Das zugeben zu können erfordert Stärke«, sagte Bergmann und ging zur Kaffeemaschine. »Auch einen?«
»Nein, danke …«
»Also, was ich sagen wollte: Man muss sich nicht schämen, wenn …«
»Ich schäme mich ja gar nicht«, unterbrach sie ihn, »deswegen bin ich ja heute schon gekommen, weil ich nicht weiter gewusst habe …«
»Ach so, ja«, erwiderte Bergmann irritiert, »stimmt. Ich wollte Ihnen nur grundsätzlich sagen, dass es … also keinen Grund gibt, sich nicht an mich zu wenden, wenn Sie etwas brauchen oder …« Mein Gott, diese sechsundzwanzigjährige energiegeladene Jungamazone irritierte ihn noch mehr, seitdem er ihr direkter Vorgesetzter war. Vielleicht sollte er es einfach mit Schäfers Sonnenkönig-Methode versuchen: anschreien oder -schweigen, bis sie zerbrochen waren oder gekrochen kamen.
»Ich bin diese Rolle nicht gewohnt«, sagte er ohne Umschweife.
»Ja, verstehe ich … ist ja für uns alle nicht leicht … «
»Was macht Schreyer eigentlich gerade?« Ja, er wollte ablenken.
»Jetzt zu Ihnen als neuem Chef oder altem Kollegen?«
»Was er macht, will ich wissen, Sie freches Luder!« Gut, sie brachte ihn zum Lachen.
»Er hat einen Haufen Münzen vor sich liegen und schiebt sie über den Tisch wie ein Kartenorakel …«
»O Gott«, stöhnte Bergmann, dem dieses Imitieren von Schäfers seltsam systemischer Verdächtigenaufstellung mithilfe von Münzen aus persönlichen Versuchen sehr geläufig war. Er sah auf die Uhr. »Auch schon egal … aber wenn er morgen so weitermacht, geben Sie mir Bescheid …«
»Sicher … kommen Sie weiter?«, sie sah auf die Charts an der Wand. Jetzt hatte sie die Grenze überschritten.
»Wenn ich Ihre Hilfe bei dem benötige, was ich gerade tue, dann melde ich mich.«
»Okay … gern … schönen Abend …«
»Ihnen auch.«
Ein paar Minuten, nachdem er die Wohnungstür hinter sich ins Schloss gedrückt hatte, begann Bergmann seinen Fernseher zu vermissen. Der war vier Wochen zuvor ohne Vorwarnung erloschen, während der nächtlichen Wiederholung der Barbara Karlich Show; sensibles Gerät, hatte Schäfer gemeint, was Bergmann damals wie nun in Gedanken daran ein schmales Lächeln entlockte; sensibel war wohl der falsche Ausdruck für einen fast neuen Flat Screen, der nicht einmal den Ablauf der Garantie abgewartet hatte, um den Geist aufzugeben; wirkliche Sensibilität würde sich wohl auch darin äußern, zu erkennen, dass der Mensch manchmal gerade das Stumpfe braucht, um der Wirklichkeit die bedrohliche Schärfe oder die schneidende Einsamkeit zu nehmen. Dem widersprechend fiel ein fast täglich stattfindender Dialog zwischen Bergmann und Leitner so aus:
»Hast du gestern XY gesehen?«
»Nein, ich habe keinen Fernseher …«
»Noch immer nicht?«
»Nein … kommt eh nur Mist.«
Dieser Mist, der ihm jetzt abging; der Stumpfsinn als Zusatzausstattung des modernen Menschen, als evolutionäre Modifikation, die einen wahlweise an die nächste Bar oder vor den Fernseher trieb, sinnierte Bergmann, während er auf einem Hocker in der Wohnküche saß und darauf wartete, dass das Telefon läutete. Eigentlich wäre Lisa dran im Zirkelsystem der abendlichen Schäfer’schen Familienanrufe. Punkt acht war es so weit.
»Bergmann … Hallo Lisa … Mir geht’s gut, danke … Nein, leider nicht … Doch, ich würde es dir sagen, keine Sorge, aber wir haben wirklich nichts … Wo? … Am Klopeiner See … Aha … glaubst du ihm? … Wann soll das gewesen sein? … Und was war das genau? … Zur Erweiterung der spirituellen Wahrnehmungsfähigkeit … klingt nicht gerade nach deinem Onkel … Ich werde mich darum kümmern … Versprochen … Ja, melde dich, dann treffen wir uns auf einen Kaffee, gern … Dir auch …«
Er legte das Telefon beiseite, ging zum Kühlschrank und nahm ein Fertiggericht aus dem Eisfach. Mit Lisa, Schäfers Nichte, telefonierte er am liebsten; sie hatte nicht diesen mütterlichen Tonfall, der zwischen Verzweiflung, Demut und unausgesprochenem Vorwurf oszillierte, sie wollte wissen, ob es etwas Neues über ihren Onkel gab, und übermittelte Bergmann jede noch so kleine Information, von der sie glaubte, dass sie ihm nützlich sein könnte bei Schäfers Auffindung. Ein Seminar in Kärnten, bei dem es um spirituellen Zugewinn gegangen wäre, hätte Schäfer laut eines ebenfalls anwesenden Freundes von Lisa im April besucht. Er würde es überprüfen; wie all die bruchstückhaften Informationen, die bei Vermisstenfällen oder unaufgeklärten Verbrechen eingingen. Sie hatten noch keine Pressemitteilung herausgegeben, hatten die Medien gebeten, noch ein paar Tage stillzuhalten; vorerst war der abgängige Major Schäfer nur in der Fahndungsliste auf der Website des Bundeskriminalamts publik – ein Tummelplatz für Hobbydetektive und Verbrechens-Groupies, die sich an den Bildern nicht identifizierter Leichen aufgeilten. Dementsprechend niedrig war auch die Informationsdichte der Hinweise, die über diesen Kanal eintrafen – sie glich den Tauben, die sich tagsüber auf das Fenstersims vor ihrem Büro setzten, den schmutzigen Viechern, unter denen vielleicht einmal im Monat eine nützliche Brieftaube war. Wenn man Zeit und Lust hatte, konnte man ja jeden Taubenfuß einer genauen Betrachtung unterziehen, viel Spaß dabei.
6.
Soll ich dir zürnen für das, was du mir genommen? Oder dankbar sein für das, was mir geblieben? Eine kurze Phase spontaner Heiterkeit folgte dem Morgengebet, das er zu Sonnenaufgang begonnen und fast eine Stunde fortgesetzt hatte. Tief eingeprägte Muster waren dabei zum Vorschein gekommen: Vater unser, der du bist im Himmel … Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt … doch sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Erst noch stockend, dann mit zunehmender Sicherheit betete er die Mantras ab, die er als Ministrant unzählige Male wiederholt hatte. Damals wie in Trance, das Ende der Messe herbei betend (wann kommt endlich »Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch«), doch jetzt war es ihm ein Geländer, die einzige Spur, die sich nicht sofort verflüchtigte, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Am Vortag hatte er am Fuße eines Felshangs eine wuchtige Lärche entdeckt, deren tiefste Äste nicht einmal einen Meter über dem Boden wuchsen, einen Radius von fast zwei Metern einnahmen und so rund um den Stamm einen Hohlraum bildeten, der als sicherer und halbwegs bequemer Schlafplatz erschien. Als die Nacht hereinbrach, schlug er mit der Waffe, die er immer noch bei sich trug, eine Kerbe in den Stamm der Lärche. Er wollte sicher sein, wie viele Tage und Nächte er in diesem Wald verbrachte. Drei bisher, meinte er zu wissen. Doch schon der vorige bestand nur noch aus Fragmenten, aus den Gerüchen von Pilzen und moosigem Wasser, aus Erinnerungsblitzen vermischt mit nebulösen Traumstücken, aus einem unkontrollierten Ineinanderfließen all dessen, sodass er keinem Ereignis oder Gefühl Zeit oder Ort zuzuschreiben imstande war. Schlimmer noch als diese Geistesverwirrung empfand er jedoch, dass der Körper, den er an sich wahrnahm, nicht zu der Person passte, die er zu sein glaubte. Seine Handrücken waren behaart, ebenso sein Oberkörper, auf dem er vom Brustbein bis hinab zum Schambein einen dichten Haarteppich in Form einer Sanduhr wahrnahm. Und wenn es ihm ein paar Sekunden gelang, aus einem angespannten Gedanken einen logischen Schluss für diesen Sachverhalt zu ziehen, löste er sich auf, noch bevor er ihn seinem Verstand einschreiben konnte. Ich habe meinen Verstand verloren, sagte er sich, ohne zu wissen, was das bedeutete; er gab wieder auf und ließ sich in den Strom der ungeordneten Assoziationen und Bilder fallen, die wovon auch immer ausgelöst wurden. Deshalb auch das Beten, in das er regelmäßig verfiel. Wenn er über einer kleinen Oase aus Sauerklee kniete, hielt er inne und rezitierte einen Psalm. Dann tauchte das Bild von Pfarrer Danninger auf, dazu der Geruch von modrigem Marmor, Weihrauch und brennenden Kerzen, kurz entstand so eine friedvolle und angstfreie Stille, in die er sich schmiegte wie ein müdes Baby an die Brust seiner Mutter.
7.
Natürlich war Schäfers Therapeut nicht begeistert, als Bergmann kurz nach sieben anrief und ihn ersuchte, noch vor der Arbeit auf ein kurzes Gespräch vorbeikommen zu dürfen. Aber »ungelegen« war kein Argument, das der Chefinspektor auch nur eine Sekunde lang ernst nehmen konnte – dagegen musste er auf der Klaviatur seiner Überredungskünste gerade einmal den kleinen Finger einsetzen, den sanften Gewissenskitzler für die gesetzestreuen Bürger, der sie daran erinnerte, dass wohl jeder, der um das Engagement des Majors im Dienste der Republik Bescheid wusste, nur allzu bereitwillig et cetera. Den schon zuckenden Zeigefinger, der den Therapeuten darauf stoßen würde, dass er in einem begehrten Vertragsverhältnis mit dem Innenministerium zur Unterstützung von Exekutivbeamten in Belastungssituationen stünde, brauchte Bergmann gar nicht mehr.
Also war er um halb acht in der Praxis des Therapeuten, setzte sich in den Stuhl, in dem Schäfer Woche für Woche seine Verzweiflung durchgegangen war, und schlug sein Notizbuch auf.
»Das ist ganz ungewohnt … dass hier jemand mitschreibt.«
»Wollen wir Platz tauschen?«
»Nein, nein«, der Arzt lachte, »über mich werden Sie ja wohl nichts wissen wollen …«
»Ach, das weiß man im Vorhinein nie«, erwiderte Bergmann, ohne sein Gegenüber anzusehen.
»Wie meinen Sie das?«
»Nur, dass man vorher nie weiß, wo ein Gespräch hinführt … wir könnten uns zum Beispiel über den Stress unterhalten, den unsere Berufe verursachen, und dann sagen Sie wie nebenbei, dass Sie zum Glück ein kleines Häuschen am Attersee haben, wo Sie entspannen können …«
»Dafür reicht es leider nicht ganz …«
»Na ja, wem sagen Sie das … aber wissen wollte ich eigentlich, ob Major Schäfer einmal mit Ihnen von so einem Entspannungsort gesprochen hat, wo er gern wäre …«
»Hm … allgemein gehalten, ja: Natur, Sommer, Wasser, sanfte Berge, Stille …«
»Tirol, meinen Sie …«
»Nicht unbedingt … nein, Heimweh hatte … Sie wissen schon, dass ich über meine Patienten nicht reden darf, oder?«
»Natürlich … wir reden ja nicht über Major Schäfer, sondern allgemein über jemanden in einer Situation, die einer Ihrer Fallgeschichten entspricht …«
»Verstehe … ich habe da einen Freund, der Potenzprobleme hat …«
»Was?«
»Vergessen Sie’s … also, Ihr Bekannter … ich mag so etwas nicht … fragen Sie mich geradeheraus, was Sie wissen wollen, und ich werde mich bemühen, im Rahmen des Vertrauensverhältnisses zu antworten.«
»Haben Sie irgendeinen Hinweis über den momentanen Aufenthaltsort von Major Schäfer?«
»Nein.«
»Hat er sich Ihnen gegenüber einmal dahingehend geäußert, dass er einfach alles hinschmeißen und abhauen will?«
»Möglich … aber eher in einer Weise, die …«
Beide schwiegen für einen Augenblick.
»Sie glauben nicht, dass er noch lebt«, fuhr Bergmann schließlich fort.
»Aus meiner Erfahrung … also wenn jemand mit einer dementsprechenden psychischen Konstellation einfach verschwindet und … ein Suizid ist in so einem Fall keine Seltenheit … aber Sie kennen Herrn Schäfer besser als ich … als sein bester Freund ist Ihnen bestimmt nicht entgangen …«
»Als was?«
»Sein bester Freund, so hat er Sie bezeichnet …«
»Sehr schön, aber auch nur Ihnen gegenüber … also dass er zeitweise depressiv war, ist mir nicht entgangen, nein … aber mit den Medikamenten, die Sie ihm verschrieben haben, ist das wirklich schnell besser geworden …«
»Ja … er war zweifelsohne ein schneller Responder … aber im Gesamten … als Mutter hätte ich ihn wohl als ewiges Sorgenkind bezeichnet …«
»Können wir bitte im Präsens von ihm sprechen? Nur der Form halber …«
»Natürlich, entschuldigen Sie, das war …«
»Schon gut … also: Was hat Ihnen solche Sorgen bereitet?«
»Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er nicht daran glaubt … er ist zwar fast immer pünktlich erschienen, hat die Medikamente genommen, aber manchmal hab ich mir schon gedacht, das macht er mir zuliebe … damit ich ein Erfolgserlebnis habe …«
»Sieht ihm gar nicht ähnlich …«
»Ha ja, Sie haben da andere Erfahrungen …«
»Welche denn?«
»Na ja, mit seinen Wutausbrüchen und …«
»Er hat mit Ihnen über mich geredet?«
»Natürlich … Sie als sein ‚Lebensmensch‘ … pardon, das hat er einmal im Scherz gesagt …«
»Ach, lustig … und sonst? … Wovor hatte er Angst?«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen …«
»Nicht können oder nicht dürfen?«
»Wohl beides«, der Therapeut sah unauffällig auf seine Armbanduhr, was Bergmann nicht entging.
»Als er zum letzten Mal hier war … in welcher Verfassung war er da? … Hat er irgendetwas gesagt, das uns einen Hinweis geben könnte …«
»Das ist jetzt, glaube ich, fast vier Monate her … ich denke …«
»Er ist seit fast vier Monaten nicht mehr bei Ihnen gewesen? Warum haben Sie das nicht gesagt?«, Bergmann sah sein Gegenüber scharf an.
»Warum … ich meine … ich kann meine Patienten nicht zwingen, zu mir zu kommen … er hat die vorgeschriebenen Stunden absolviert und …«
»Und von wem hat er dann die Medikamente bekommen?«
»Das weiß ich nicht, vielleicht ist er zu einem Kollegen gegangen …«, sagte der Arzt nervös. »Hat er die Medikamente denn weiter genommen?«
»Bin ich sein Arzt?«
»Nein, aber … also bei einem erwachsenen Menschen …«
»Sorgenkind haben Sie ihn gerade noch genannt«, Bergmann stand auf, »finden Sie heraus, ob er bei einem anderen Therapeuten war.«
»Wie bitte?«
»Wenn er nach Ihnen noch in Therapie war oder Medikamente verschrieben bekommen hat, will ich wissen, von wem.«
»Aber da wäre es leichter, bei der Versicherung nachzufragen … wegen der Medikamente zumindest …«
»Gut, mache ich … und Sie finden mir den Arzt«, Bergmann drückte dem Therapeuten kräftig die Hand und verabschiedete sich.
Auf dem Weg ins Kommissariat hatte er kurz ein schlechtes Gewissen, weil er dem Arzt gegenüber so angriffig geworden war. Was konnte er ihm denn vorwerfen? Dass er keine Zwangseinweisung veranlasst hatte? Nein, der Mann hatte schon recht mit dem Begriff Sorgenkind. Zu einem Mordverdächtigen ohne Unterstützung zu fahren, mit diesem eine gute Stunde Tee zu trinken und ihn dann per U-Bahn in die Sicherheitsdirektion zu bringen, fiel für manche vielleicht unter lebensmüde, aber bei Schäfer, der sich diese Aktion zwei Jahre zuvor geleistet hatte, schüttelte man eben wieder einmal mit dem Kopf, atmete tief durch und klopfte auf Holz, dass die nächste Verhaftung ebenso glimpflich ablaufen würde. War das passiert? Hatte Schäfer einen Verdächtigen ausfindig gemacht, ihn festnehmen wollen, die Situation war außer Kontrolle geraten … aber in welchem Fall? Der Mörder des Installateurs?
»Herr Bergmann«, Kovacs’ Stimme aus ihrem Büro, an dem er eben vorbeiging.
»Bei mir«, erwiderte er, »fünfzehn Minuten.«
Er hängte sein Jackett an den Bügel, füllte den Wasserkocher und bereitete sich eine Kanne Kräutertee. Dann fuhr er den Computer hoch und ergänzte den Akt Schäfer um die Informationen, die ihm der Therapeut gegeben hatte. Sich ein paar Tage ausschließlich und ungestört darum zu kümmern, darauf hatte er jetzt Lust. Das wäre allerdings kein guter Start als Gruppenleiter, gestand er sich ein und hörte schon das Getuschel der anderen: Jetzt macht er schon auf Schäfer, kocht sein eigenes Süppchen und wir dürfen seiner Majestät nach Belieben dienen. Nein, er konnte nicht das machen, was er seinem Vorgesetzten oft genug übel genommen hatte: dieses Unstrukturierte, Chaotische, dieses Zufällige, in dem zumeist nur Schäfer selbst eine Art von Ordnung erkannte. Und wer hatte das System am Laufen gehalten? Wer, wer? Eigentlich bin ich schon längst Gruppenleiter, sagte Bergmann laut und streckte seinen Rücken durch. Klopf, klopf, Kovacs.
»War was los in der Nacht?«, wollte er wissen.
»Ja, leider«, sie legte ihm einen einseitigen Bericht und ein paar Bilder hin, »Mergim Dushku … zwei Schüsse, einer in den Kopf, einer in die Brust, beide aufgesetzt … war sofort tot …«
»Ist das am Gürtel?«, Bergmann beugte sich über die Tatortfotos, ohne sie in die Hand zu nehmen.
»Ja … vor dem Senor …«
»Ah, Freund Müller wieder einmal«, sagte Bergmann, der den Besitzer des Nachtclubs schon zur Stammkundschaft zählte. Eigentlich hieß Müller Radkovic, hatte seinen kroatischen Namen allerdings aus geschäftlichen Überlegungen aufgegeben, was ihm tatsächlich dabei geholfen hatte, sich als Fixgröße im Rotlichtmilieu zu etablieren. So absurd es war: Auch wenn alle, die mit ihm zu tun hatten, wussten, dass er aus einem Dorf in der Nähe von Dubrovnik stammte, wurde er dank seines neuen Namens als Österreicher akzeptiert und hatte gleichzeitig den Vorteil einer Muttersprache, die seine Beziehungen zur postjugoslawischen Unterwelt stärkte. Milieugemäß hatte er durch seine Tätigkeit immer eine Hand in der Schelle und einen Fuß in der Zelle. Die Branche war seit der Ostöffnung verstärkt in Umbruch geraten – die Russen drängten in den Prostitutionsmarkt, die Nigerianer wollten ihren Löwenanteil vom Drogenkuchen, an dem die Albaner und Serben auch gern mitnaschten, bulgarische und rumänische Roma versuchten ihren Kleinstrich zu etablieren, den sie mit weiblichen Verwandten besetzten – und wo früher ein Stich ins Gesäß als kollegialer Hinweis zur Reviereinhaltung gegolten hatte, gehörten mittlerweile automatische Waffen zu jeder Großrazziabeute. Ohne Erpressung, Drohung, Körperverletzung und andere Delikte konnte jemand wie Müller seine Position nicht behaupten – die Gesetze des freien Marktes gingen hier wie anderswo nicht ohne Gesetzesübertretungen ab, das wussten sie auf beiden Seiten.
Doch auch wenn der diesbezüglich eher unbedarfte Innenminister immer wieder von zero tolerance sprach, hatte man sich auf den unteren Ebenen mit dem Kompromiss des geringeren Übels abgefunden. Solange Müller keine Kinder zur Prostitution zwang, seine Huren nicht über das übliche Maß hinaus misshandelte, solange er keinen offenen Krieg anzettelte, der über mediale Aufmerksamkeit das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung beeinträchtigte, hielten sie eine Pattstellung, die darauf hinauslief, der anderen Seite nicht zu viel Ärger zu machen. Eine Hinrichtung vor einem von Müllers Nachtclubs brachte diese Stellung aber gehörig ins Wanken.
»Mergim … Albaner?«
»Kosovare … hatte Aufenthaltsverbot wegen Schlepperei …«
»Irgendwelche Zeugen?«
»Genug, als wir hingekommen sind … eigentlich müsste der Türsteher etwas gesehen haben …«
»Aber der war gerade pinkeln …«
»Richtig …«
»Gibt’s Kameras?«
»Ja … das Opfer ist beim Verlassen des Lokals drauf … der Mord muss allerdings im toten Winkel stattgefunden haben …«
»Sagt Müller etwas dazu?«
»Der ist in Monaco, kommt heute Abend …«
»Gesunde Bevölkerungsentwicklung …«, dachte Bergmann laut, während er den kurzen Bericht überflog.
»Wie bitte?«
»Ach, nichts … nur ein Bonmot von unserem Meisterzyniker, als letztes Jahr die beiden Tschetschenen erschossen worden sind …«
»Verstehe«, sagte Kovacs sichtlich angewidert.
»Das ist nicht meine Meinung … also: Projektile so schnell wie möglich in die Ballistik, Verwandte und Bekannte ausfindig machen, einvernehmen, wenn die in Wien leben … Schlepperei, haben Sie gesagt … dann sprechen Sie sich mit Beranek ab, der kennt sich da aus … Müller nehme ich mir dann selbst vor … da nehme ich Leitner mit …«
»Okay«, erwiderte Kovacs, ohne ihre Enttäuschung verbergen zu können.
»Sie werden noch genug Gelegenheit haben, ihn kennenzulernen … je später, desto besser, glauben Sie mir … ich werde übrigens zu Mittag nach Wiener Neustadt fahren, mir den Unfallwagen des Bürgermeisters ansehen … dann schauen wir, dass wir das so schnell wie möglich ad acta legen …«
»Haben Sie den Bericht durchgelesen?«
»Ja, gestern noch … so wie Sie gesagt haben: möglich, aber nicht wahrscheinlich … wenn man über den Bericht hinausschaut, verliert allerdings alles an Glaubwürdigkeit …«
»Warum?«
»Weil es nicht in der Natur des Menschen liegt, Geheimnisse zu bewahren … wie viele Menschen müssten laut unserem Richter an diesem Attentat beteiligt gewesen sein … zehn, zwanzig, mehr?«
»So was in der Art, ja …«
»Und von denen hat keiner ein schlechtes Gewissen, verplappert sich im Suff, will vor einer Frau angeben, braucht Geld und verkauft die Geschichte einer Zeitung …? Einer allein, von mir aus, eine ganze Gruppe, nein.«
»Da haben Sie wahrscheinlich recht … na dann, viel Spaß«, sie nahm die Akte wieder an sich, winkte kurz damit und verließ das Büro.
Er hatte gelogen. Den Unfallbericht und die Unterlagen des Richters hatte er nicht einmal nach Hause mitgenommen. Die Idee mit der Fahrt nach Wiener Neustadt war ihm spontan gekommen. Wenn er sein selbst auferlegtes Autoverbot ernst nahm, müsste er den Zug nehmen. Dort könnte er in Ruhe nachdenken; über das, was der Therapeut gesagt hatte, über die weiteren Ermittlungsschritte; bevor er zu Müller, dem Schwein, musste. Ich stehle mich davon, sagte er zu sich und lächelte. Das war eine Freiheit, die er sich schon ewig nicht, wenn überhaupt einmal genommen hatte. Stand davor noch an, die Gruppe zusammenzurufen, mit dem neuen Fall vertraut zu machen und neu einzuteilen. Den Obdachlosen mit Bauchstich würden sie wohl oder übel einstweilen vernachlässigen – so wie es die gesamte Gesellschaft mit ihm machte, musste sich Bergmann eingestehen und fragte sich kurz, ob es einen Ausweg aus dieser Form pragmatischer Ignoranz gab. Er öffnete den Webbrowser und suchte nach einer Zugverbindung nach Wiener Neustadt; im Gegensatz zu Schäfer, der das öffentliche Verkehrsnetz so gut kannte wie Rain Man ein gerade gelesenes Telefonbuch, war Bergmann diesbezüglich geradezu hilflos. Eine Viertelstunde zum Bahnhof Meidling; da plante er lieber eine halbe ein. Müsste er kurz vor eins aus dem Haus. Was für eine kindische Freude ihm das bereitete. Er hob den Hörer ab und bestellte alle Anwesenden zur Morgenbesprechung.
Als er um drei viertel eins das Gebäude verließ und zur U-Bahn ging, liefen ihm Kovacs und Schreyer über den Weg, die wohl gerade vom Essen kamen.
»Wo ist Ihr Auto?«, wollte Kovacs wissen.
»In der Garage, ich nehme den Zug …«
»Sie? … Ah, verstehe, what would Schäfer do …«
»Wie bitte?«, Bergmann sah Kovacs fragend an und dann auf seine Uhr.
»Na, was würde Schäfer tun …«
»Danke, so weit reicht mein Englisch noch. Nur, was Sie mir damit sagen wollen, kapiere ich nicht.«
Kovacs sah ihn unsicher an, ob sie vielleicht wieder zu weit gegangen war. Dumme Rollen-Neuverteilung.
»Na weil es da so Armbänder gibt … bei den Amis haben das viele … WWJD … what would Jesus do … also, wenn man in ausweglosen Situationen ist und sich fragt, was man tun soll … und ich hab gedacht …«
Schreyer, der sah, dass sich seine Kollegin unweigerlich in ein Fettnäpfchen manövrierte, wandte sich ab, um sein glucksendes Kichern zu verbergen.
»Vielen Dank für die Aufklärung, Frau Kollegin … aber ich darf wohl auch einmal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein, ohne gleich den Geist des Majors herbeizubeschwören«, er sah abermals auf die Uhr, drehte sich um und winkte über die Schulter, hörte nur noch, wie Schreyer Au! schrie, wahrscheinlich weil Kovacs ihm in die Seite geboxt hatte.