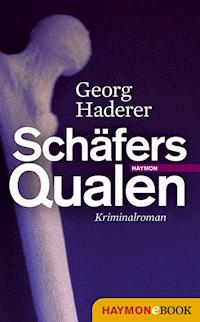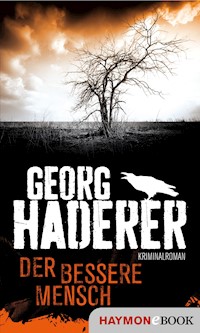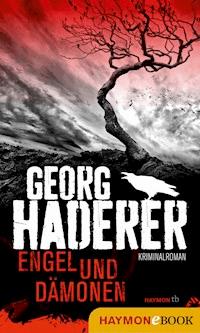Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Schäfer-Krimi
- Sprache: Deutsch
Dreharbeiten in Major Schäfers neuem Revier … und plötzlich sind die Leichen echt. EIN FILMREIFER FALL FÜR MAJOR SCHÄFER Kann Major Schäfer endlich seinen Frieden finden? Die Voraussetzungen sind gut: Nachdem er aufs Land versetzt worden ist, macht er Dienst nach Vorschrift und sitzt abends gemütlich am Lagerfeuer. Doch dann wird die Ruhe durch ein deutsches Filmteam gestört. Ausgerechnet in Schäfers idyllischem Revier möchte die Crew eine Krimiserie drehen. Kurz darauf kommt eine Schülerin unter höchst rätselhaften Umständen zu Tode. Und schon spielt Schäfer die Hauptrolle in einem bösen Fall, zu dessen Aufklärung ihm ausgerechnet ein Drehbuchautor mit ausufernder Fantasie verhelfen will. ERMITTLUNGEN ZWISCHEN WALD UND WIRTSHAUS In seinem neuesten Roman treibt Georg Haderer ein so spannendes wie satirisches Spiel mit Fakten und Fiktion. Kuriose Provinzdelikte, eiskalte Verbrecher und jede Menge Verdächtige treffen sich zwischen Wald und Wirtshaus und jagen gemeinsam einem filmreifen Showdown entgegen. MAJOR SCHÄFER - EIN BESONDERER ERMITTLER Major Schäfer hat längst Kultstatus unter Krimi-Fans. Der immer wieder von Ängsten und depressiven Verstimmungen geplagte, dem Wein durchaus zugetane Kriminalpolizist lässt sich trotz allem vom Leben nicht unterkriegen, er nimmt es mit einer gehörigen Portion Ironie. Ursprünglich stammt Schäfer aus Tirol - so mischt sich erdiger Humor mit galligem Wiener Schmäh. ***************** "Haderer in Bestform! Sehnlichst erwartet, sofort gekauft, in einem Zug durchgelesen - das ist der sechste Schäfer-Krimi." "Major Schäfer ist mit Abstand mein Lieblingsermittler. Er ist sympathisch, verschroben, eigen - und im Inneren ein wirklich guter Mensch, deshalb ist er auch Polizist geworden. Außerdem liebe ich seinen bissigen Humor."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg Haderer
Es wird Tote geben
Kriminalroman
Drei Monate vorher
Verwackelte Handkamera. Im Bild ein Mädchen um die achtzehn, sie wirkt unsicher, verängstigt, bewegt den Kopf hin und her, als müsste sie sich in ihrer Umgebung erst zurechtfinden. In den Verkehrslärm hinein spricht eine Stimme ohne Gesicht:
»Alles okay?«
»Ich weiß nicht … mir ist … irgendwie so komisch … es ist so laut da … ist da ein Flughafen in der Nähe?«
»Nein, das sind nur die Autos … sei ganz ruhig … du hast den See gesehen, oder? Wie schön er ist … das Wasser ist ganz warm, man landet ganz weich …«
»Bist du sicher?«
»So oft wie ich schon hineingesprungen bin … ja, du kannst mir vertrauen.«
»Kannst du nicht kurz die Kamera wegtun? Ich sehe dein Gesicht gar nicht.«
»So besser?«
»Ja … so ist es besser … wo sind wir?«
»Auf der Brücke, über dem See …«
»Wo ist denn die Frau hin … die war doch gerade noch mit uns … da war doch jemand, oder?«
»Ja … die ist inzwischen auf der anderen Seite hinunter … sie wartet unten beim Wasser.«
»Sie ist nett … hast du was mit ihr?«
»Nein … ich habe nur dich.«
»Und wenn mir was passiert, bist du da, oder?«
»Natürlich … ich hab doch versprochen, dass ich die ganze Zeit bei dir bleibe.«
»Ich fühle mich gut, wenn du bei mir bist … stark ist das Zeug schon, oder? Stärker als das letzte Mal …«
»Es ist jedes Mal anders … aber jedes Mal gut, oder?«
»Ja … gut ist es immer … zeigst du mir jetzt den See?«
»Schau hinunter, siehst du ihn?«
»Ja, jetzt sehe ich ihn … er ist weit weg … er ist grün, ganz grün wie eine Wiese, ganz glatt … wenn mir etwas passiert, bist du da, oder?«
»Natürlich … ich komme gleich nach dir … hab keine Angst, Corina …«
1.
»Du bist ein Büffel«, murmelt er und fängt zu laufen an. »Wenn die Stechmücken zu lästig werden, rennst du blind drauflos. Diese beschissene Schwermut beim Aufstehen, dieses blutsaugende Biest!«
Außer Atem bleibt er stehen. Dreht sich langsam im Kreis. Blick über Äcker, Mohnfelder, sanfte Hügel und Wälder. Schaching, seine neue … sein neues … sein neuer Standort. Wie zum Teufel ist er hierhergelangt? Gestern noch Gruppenleiter bei der Mordkommission in Wien, heute Postenkommandant in diesem Niemandsland. Doch gestern ist Monate her. Und die Zeit dazwischen ein finsteres Tal. Er geht weiter.
Von seinem Weg zweigt zur Rechten eine Forststraße ab. Wo sie im nahen Wald verschwindet und ein Schranken unbefugtes Befahren verhindert, stehen zwei Kleinbusse. Er bleibt stehen, erkennt deutsche Kennzeichen und macht ein paar Schritte in Richtung der Fahrzeuge – was von der Norm abweicht, erscheint ihm berufsbedingt verdächtig. Dann hält er inne und dreht sich um, weil das Surren der Gleise einen herannahenden Zug ankündigt. Warum er diesen nicht einfach vorbeifahren lässt – nie einen Zug vorbeifahren lässt, ohne ihm seine Aufmerksamkeit zu widmen –, kann er sich nicht erklären. Was erwartet er denn zu sehen? Kinder auf dem Weg in die Sommerfrische, die ihm freudig zuwinken? Kriegsheimkehrer, die von ihren am Bahnhof ausharrenden Frauen nicht erkannt werden? Mittlerweile weiß er doch, welcher Zug um diese Zeit vorbeifährt und wer drinnen sitzt: schlaftrunkene Schüler, teilnahmslose Pendler, ein paar zornige und in ihrer Ehre gekränkte Männer, die dazu verdammt sind, die verhassten öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, weil er – der neue Scheiß-Wiener-Schweinebulle – ihnen den Führerschein abgenommen hat.
Als der letzte Waggon vorüber ist, wendet er sich wieder den beiden Fahrzeugen zu. Auf ihren Seitenwänden ist der Schriftzug Fifi TV Productions zu lesen, darunter eine skizzierte Kamera, in deren Objektiv ein Fadenkreuz gezeichnet ist. Er geht zum Seitenfenster eines der Busse und hält sich die Hand an die Stirn, um einen Blick ins Innere werfen zu können. Als in seinem Rücken mehrmals ein Pfeifsignal ertönt und fast gleichzeitig ein metallisches Kreischen eine Notbremsung verrät. Erschrocken dreht er sich um, sieht die fernen Rücklichter des Regionalexpresses. Die Schallwellen sind längst über ihn hinweggerast, sie scheinen alle noch so kleinen Geräusche von vorhin mitgerissen zu haben, so still ist es plötzlich. Doch der Friede ist dahin. Er blickt zu Boden – als ob im feinen Schotter seine wirren Gedanken entziffert liegen könnten. Er läuft los.
Auf Höhe des hintersten Waggons läutet sein Handy. Er sieht aufs Display, drückt den Empfangsknopf, hört ein paar Sekunden zu und sagt: »Ich bin schon da.« Er schiebt das Telefon in die Jackentasche und holt eine Sonnenbrille heraus. Eigenartiges Modell. Eigentlich eine Brille für Drachenflieger, auf die er in einem Sportfachgeschäft gestoßen ist, wo ihm der beflissene Fachverkäufer erklärt hat, dass die Gläser einen speziellen Rotfilter hätten, der diesen Farbanteil des Sonnenlichts filtere und so weiter.
Durch die Brille sieht er jetzt das entrötete Blut an den Fetzen eines gelben Sweaters, der zwischen Radsatz und Drehgestell der Lok hängt. Der abgetrennte Arm auf der Böschung – wie dekoriert in einem Ensemble von Lupinen – lässt sich erst auf den zweiten Blick einem eben noch lebendigen Menschen zuordnen.
»Kopf?«, fragt er eine junge Polizistin, die blass und mit Schweißtropfen auf der Stirn zu ihm tritt. Über ihren streng gezogenen Scheitel hinweg sieht er, wie der Lokführer mit einem weiteren Uniformierten auf den Streifenwagen zugeht.
»Ja, haben wir … der Arm, der …«
»Was hat er gesagt?«, er deutet mit dem Kopf in Richtung des blassen und zittrigen Mannes, der in der offenen Tür des Streifenwagens sitzt und raucht.
»Dass sie auf dem Gleis gesessen ist … mit dem Gesicht zu ihm … ich kenne die … das war …«, hier blendet er die Stimme der Inspektorin aus und sieht in den Himmel. Vielleicht täuschst du dich, Major Schäfer. Vielleicht hältst du dich selbst nur in Bewegung, damit die Erde dich nicht so leicht abschütteln kann.
2.
Diese Scheibe war eine Zumutung. Ein Idiot der Architekt, der sich diese Raumtrennung ausgedacht hatte. Auf seinen Einreichungsunterlagen – falls der Umbau des Polizeipostens offiziell ausgeschrieben gewesen war – standen wohl abstrakte Dummheiten wie: Transparenz, Bürgernähe und ähnliches Gewäsch. Kopiert von der Homepage des Innenministeriums, um den Vorgaben eines modernen Polizeiapparats auch in bautechnischer Hinsicht zu entsprechen. Entstanden war ein peinlicher Kompromiss aus Vollverglasung und altmodischer Küchendurchreiche. Wobei sich die Scheibe, die Schäfers Büro von den anderen Räumen trennte, nicht einmal öffnen ließ und damit auch keine verbale Kommunikation zuließ. Ein Ärgernis für beide Seiten: für seine Mitarbeiter, die sich zeit seiner Anwesenheit in ständiger Überwachung wähnen mussten. Und für ihn erst recht, zumal er sich wie in einem Terrarium fühlte, wie ein manisch-depressives Reptil, das sich während der Besuchszeiten keinem seiner Zustände zwanglos hingeben konnte. Und die Jalousie? Warum zog Schäfer nicht einfach die Jalousie herunter? Weil es die eben nur auf seiner Seite gab und er die Verwendung dieser Einseitigkeit als herablassend ansah. Als etwas, das ein Gefälle zwischen ihm und seinen Mitarbeitern in Szene setzte. Das Teil trug wohl nicht umsonst den französischen Namen für Eifersucht. Himmel, mit welchen Problemen man sich herumschlägt, wenn sonst nichts passiert.
In den seltenen Stunden, in denen Schäfer sich allein am Posten befand, warf er den marillengroßen Gummiball, den er seit ein paar Wochen bei sich trug, wuchtig gegen die Scheibe, um sie mürbe zu machen und irgendwann zum Aufgeben und Zerbröseln zu zwingen. »Gib’s ihr!«, feuerte er den Ball an, »mach sie fertig!« Wobei er nicht einmal wusste, wie das Wurfobjekt hieß, das er wie einen Glücksbringer bewahrte. Hüpfball? Nein, das waren diese Rieseneuter, auf die sich Kinder setzten und sich dabei an den Zitzen festhielten. Springball, Stressball, Wurfball? Keiner der Begriffe, die Schäfer gegoogelt hatte, um seinen Begleiter benennen zu können, brachte ein Ergebnis. Wusste überhaupt jemand, wie dieses Objekt hieß, das er im Zuge einer belanglosen Amtshandlung erstanden hatte?
Zeit für eine Rückblende, weil immer noch nichts passierte: An einem Samstagvormittag waren Schäfer und Inspektor Plank zu einer Siedlung ein paar Kilometer außerhalb des Ortszentrums gefahren. Zu den Einfamilienhäusern, die sich gerade noch nicht Villen nennen durften, wo sich laut einer hysterischen Anruferin ein verdächtiges Subjekt herumtrieb. Selbiges stellte sich als ein ungefähr sechzigjähriger Mann heraus – vollbärtig ergraut, bloßfüßig und etwas verwahrlost –, der aus einem Altpapiercontainer Zeitungen und Magazine holte, sie auf dem Gehsteig stapelte und dabei aus sicherem Abstand von drei Frauen und einem dickleibigen Mann mit einem Wagenheber in der Hand beobachtet wurde. Harmlos, konstatierte Schäfer nach zehn Sekunden und überließ die Befragung des Mannes seinem Kollegen, während er sich an den Wagen lehnte und die Anrainer musterte. Diesen schwitzenden Fettwanst mit dem Werkzeug, den könnte er bestimmt zu einem Widerstand gegen die Staatsgewalt provozieren, überlegte er. Um sich nicht von seinen Emotionen hinreißen zu lassen, drehte er sich um und – sah ihn: einen Kaugummiautomaten. Dunkelrot mit zahlreichen Rostflecken, die Plexiglasscheibe gelöchert von den Feuerzeugen jugendlicher Tunichtgute, wie er mutmaßte. Dieses Fossil hing an einem heruntergekommenen Gebäude, einem kleinen Haus mit unverhältnismäßig großem Garten, das provozierend andeutete, dass sein Besitzer aus dem winzigen Fenster im ersten Stock schon seit langem auf die Häupter und Geldkoffer der anläutenden Immobilienmakler spuckte, die sich in der Gegend um Wochenend- oder Alterswohnsitze für wohlhabende und erschöpfte Städter umschauten.
Der Automat war leergeräumt. Fast leergeräumt, wie Schäfer konstatierte, als er sein Gesicht an die verschmorte Front führte, als gäbe es hier noch Spuren dieses banalen Deliktes zu sichern. Doch statt Haut- oder Stofffetzen, die die Täter am Plastik zurückgelassen hatten, als sie mit langen Fingern und verdrehten Händen ins Innere des Automaten gefasst hatten, sah Schäfer in dessen Dunkel ein schwaches Glitzern wie von ein paar winzigen müden Sternen. Er griff in seine Taschen und fand kein Kleingeld. Nachdem weder sein Kollege noch das verdächtige Subjekt mit einer Fünfzig-Cent-Münze dienen konnten, ging er auf die Anrainer zu, die sich mittlerweile um zwei mit Gartenkralle und Heckenschere bewaffnete Männer verstärkt hatten.
»Bekommen Sie zurück, wenn Sie am Posten vorbeischauen«, sagte Schäfer zum Wagenheber-Mann, der ihm leicht verunsichert die Münze übergeben hatte. Dann ging er zum Automaten, holte ein paar Einweghandschuhe aus der Innentasche seiner Uniformjacke, streifte sie für alle Beobachter gut sichtbar über, warf die Münze ein und drehte langsam den Riegel. In seinem Rücken spürte er die neugierigen Blicke der gerechten Bürger. Ponk!, rumpelte ein Gegenstand aus dem Inneren des Automaten.
»Beweismitteltasche!«, rief Schäfer seinem Kollegen zu, ohne sich umzudrehen. Nachdem er sie erhalten hatte, öffnete er die Klappe am Ausgabeschacht, nahm das zu sichernde Objekt heraus und ließ es mit gespreizten Fingern behutsam in das Plastiksäckchen fallen. Er ging zum Wagen zurück, forderte den alten Mann auf einzusteigen und salutierte beim Wegfahren aus dem offenen Fenster in Richtung der ratlosen Anrainer.
»Eine kleine Lektion in Sachen Lebenserleichterung«, meinte er, nachdem sie den alten Mann im Krankenhaus abgeliefert hatten und der junge Inspektor sich offensichtlich nicht traute, nach dem rätselhaften Gegenstand zu fragen. Schäfer nahm die Beweismitteltasche, fingerte den Gummiball heraus und drehte ihn bewundernd in der rechten Hand: durchsichtig, mit türkisen und azurblauen Schlieren durchzogen, dazwischen glitzernde Metallpartikel.
»Wenn Sie solche Deppen immer ernst nehmen, werden Sie irgendwann selber so … statt dass sie dem alten Spinner einen Tee kochen oder was zu essen geben … Faschistenschweine … die hält man auf Dauer nur aus, wenn man ein paar Kunststückchen parat hat.«
»Aber … wie fällt Ihnen so was ein?«, fragte Plank in einer Mischung aus ein wenig Bewunderung und viel Skepsis. Nur verständlich: ein männlicher Landbewohner Anfang dreißig, der sich wegen einer Mehlallergie vom Bäcker über eine Zwischenstation als Webdesigner zum Polizisten hatte umschulen lassen. Der musste bei einem Vorgesetzten wie Schäfer – gleichwohl hochdekorierter Major – unweigerlich an Nervenheilanstalten oder die Möglichkeit außerirdischen Lebens denken.
»Hm«, machte Schäfer, mehr fiel ihm dazu im Moment nicht ein.
Dafür hatte er einen Hüpf-, Spring-, Spiel-, Wie-auch-immer-Ball gewonnen, den er seitdem so gut wie immer bei sich trug. Mit dem er Kunststücke einübte, wenn er sich auf der Straße unbeobachtet wähnte, indem er ihn im schrägen Winkel auf den Asphalt warf, gegen eine Hauswand prallen ließ und dann wieder auffing. Den er in seinem Büro in besagten Augenblicken gegen die verhasste Scheibe aufhetzte oder auf den Boden fallen und in seine Hand zurückschnellen ließ, was ihn nach spätestens zehn Minuten in einen Zustand gelassener Entrückung versetzte. Aus der holte ihn jetzt Revierinspektor Hornig in die Wirklichkeit zurück, der auf der anderen Seite der Scheibe eine Frau zu seinem Schreibtisch führte, sie sanft in den Besuchersessel drückte und sich selbst niederließ.
Die Person, mit der Hornig nun zu reden begann: Schäfer kannte sie. Mindestens dreimal war sie ihm auf seinen Spaziergängen begegnet – und allein dadurch zu einer Besonderheit in einem bislang eher homogenen Umfeld geworden, dessen Bewohner kaum Wert darauf legten, frühmorgens oder am Abend in unwirtlichen Gegenden herumzustreunen. Ihre erste Begegnung hatte rein akustisch begonnen. Schäfer war durch den Wald geschlendert und vor einem Ahorn stehen geblieben, den er aufgrund der Dicke des Stammes auf mindestens dreihundert Jahre schätzte. »Unglaublich«, murmelte er, während er seine Finger über die grobe Borke gleiten ließ, »was du schon alles überdauert hast.« »Sascha! Sascha!«, schreckte eine weibliche Stimme ihn auf, worauf er sich hinter den Ahorn stellte und in die Richtung lugte, aus der die Rufe kamen. Er sah eine Frau, die langsam durch den Wald schritt, das Gesicht dem Boden zugewandt, in der Hand einen Ast, mit dem sie Blätter, Äste oder Bucheckern aus dem Weg stupste. Ungefähr alle zwanzig Meter wiederholte sie den Namen Sascha – manchmal so laut, dass ein schwaches Echo aus dem Wald zurückkam, dann wieder als behutsames Flüstern, als könnte sie den Gesuchten dadurch eher aus seinem Versteck locken. Schäfer konnte sich keinen Reim darauf machen. Wenn die Frau ihren Hund vermisste, würde sie doch rufen und gleichzeitig mit den Augen die Gegend absuchen. Und wenn sie einen Schlüssel oder einen anderen Gegenstand verloren hatte, den sie mit ihrem Stock am Waldboden aufzustöbern hoffte: dann brachte es höchstens etwas, den heiligen Antonius anzurufen, so wie Schäfers Großmutter es manchmal getan hatte.
Als er ihr das zweite Mal begegnete – auf einem verwucherten Pfad am Rande eines Mohnfelds –, brachte er die Frau zuerst nicht mit jenem Erlebnis in Verbindung. (Aus seinem Versteck heraus hatte er ihr Gesicht nicht genau gesehen und bis auf die seltsamen Rufe auch sonst keine Eigenheit bemerkt, die ein Wiedererkennen ermöglicht hätte.) So wunderte er sich kurz, murmelte en passant einen Gruß und wollte seinen Weg schon fortsetzen, als sie ihn fragte, ob er ihren Sascha gesehen hätte. Ihren Sascha, diese Formulierung war in seinem Gedächtnis geblieben. Zumal sie gemeinsam mit dem abwesenden Blick und ihrer leisen Stimme, in der weder Aufregung noch Verzweiflung, noch Hoffnung lagen, den Schluss nahelegte, dass die Frau plemplem war. Diese Vermutung wurde dadurch erhärtet, dass sie einfach weiterging, ohne eine Antwort abzuwarten.
Jetzt saß sie an Hornigs Schreibtisch, hatte die Hände in den Schoß gelegt wie ein schüchternes Mädchen und hörte dem Polizisten zu. Nicht dass Schäfer Lippen lesen konnte, aber aus der Bewegung von Hornigs Gesichtszügen und dessen Gesten vermochte er zu erkennen, dass dieser mit der Frau zwar sympathisierte, sie aber keinesfalls ernst nahm. Eine Verrückte, sah Schäfer sich in seinem Verdacht bestätigt; eine einsame Frau, deren Hund entweder davongelaufen oder vor Jahren eingegangen ist. Die seitdem die Gegend absucht und zwischendurch die Polizei anfleht, ihren Fall nur ja nicht aufzugeben. Nun, wir alle suchen etwas, sagte sich Schäfer und wandte seinen Blick von den beiden ab. Doch wenn es nur ein verlorener Hund ist, bleibt man zumindest am Boden. Nicht wie der Herr Major, der … Um sich nicht abermals in Erinnerungen an seine verkorkste Vergangenheit zu verlieren, nahm er den Ermittlungsbericht zum Selbstmord des jungen Mädchens zur Hand.
Yvonne Raab, siebzehn, Schülerin des Gymnasiums im Nachbarort. Laut Angaben von Lehrern und Mitschülern gut integriert, allseits beliebt, gute Noten, intaktes Elternhaus, keine Hinweise auf familiäre Gewalt, keine offiziellen gesundheitlichen Probleme et cetera. Welches siebzehnjährige Mädchen ohne Probleme setzt sich denn aufs Gleis und wartet darauf, dass der Regionalexpress über sie fährt? Wo war überhaupt der Obduktionsbericht von der Gerichtsmedizin? Schäfer griff zum Telefon, drückte drei Tasten und legte wieder auf. Ach ja, es gab keinen Doktor Koller mehr, mit dem er im eingespielten gegenseitigen Beflegeln über die Tragik der Umstände hinwegreden, dem Tod ins Gesicht grinsen konnte. Jetzt waren die Salzburger für ihn zuständig. Und er würde bestimmt einen Sachverständigen in aufklärungsbedürftigen Ablebensfällen ans Telefon bekommen. Der ihn mit Computerstimme bat, kurz in der Leitung zu bleiben, um dann Leben und Sterben der Yvonne R. aus medizinischer Sicht zu präsentieren wie das Rezept für Omas Schmorbraten.
Vielleicht auch nicht, musste Schäfer sich eingestehen und schleuderte seinen Wunderball so heftig gegen die Glaswand, dass Hornig und Auer von ihren Schreibtischen aufsahen. Schließlich hatte er seit seiner nicht ganz freiwilligen Versetzung noch nie mit einem der leitenden Ärzte der Gerichtsmedizin Salzburg persönlich gesprochen. Er wollte abwarten, bis er sich gefestigt hatte. Bis er seinen Status als Postenkommandant auch mit einer selbstsicheren Stimme präsentieren konnte. Bis dahin hieß es, nicht mehr neue Kontakte als nötig aufzunehmen, geschweige denn zu vertiefen. Seine neue Arbeitsstelle kam ihm dabei entgegen: die üblichen Verkehrstoten – einmal mehr, einmal weniger betrunken, die üblichen Schlägereien – meist sehr betrunken, die Fälle häuslicher Gewalt – meist einseitig betrunken. Dazu die Einbrüche in Ferienhäuser, Sportkantinen, Gewerbegebäude, die Diebstähle von Werkzeug, Edelmetallen und Fahrzeugen, ein paar Drogendelikte. In Schaching gab es das meiste von dem, was es auch in Wien gegeben hatte. Viel weniger, aber dafür war er jetzt quasi für alles zuständig.
Das Team, das ihm dabei zur Seite stand, hätte wesentlich schlechter besetzt sein können. Plank, Anfang dreißig, war nicht sehr scharfsinnig, dafür trug er seine Uniform mit Stolz und ohne Überheblichkeit, hielt seinen Schreibtisch aufgeräumt und achtete darauf, vor jedem Arbeitstag zeitig ins Bett zu kommen – zumindest hatte Schäfer ihn noch nie mit dunklen Augenringen oder gähnen gesehen.
Friedmann war in Schäfers Alter und tat seit zwanzig Jahren Dienst in Schaching. Er hatte die Gelassenheit und Statur eines Hufschmieds, und so wie dieser nach getaner Arbeit den Hammer in der Werkstatt lässt, beherrschte auch Friedmann die Kunst, den Dienst mit der Uniform abzustreifen. Er ging nach Hause, rief als Erstes den Namen seiner Frau und rieb sich freudig die Hände, wenn es aus der Küche nach Braten duftete. Sich mit diesem gerechten Koloss anzulegen, erlaubten sich nur seine beiden Teenager-Töchter. Bei jedem anderen erwachsenen Einheimischen fiel es unter Blasphemie.
Hornig? Gut, so wie jedes Stück des hiesigen Bauerntheaters einen Tölpel mit wenig Text und vielen Grimassen brauchte, mussten sich auch in den Polizeiinspektionen Männer vom Schlage Hornigs finden. Deren Widersacher waren weniger Gesetzesbrecher als die Umstellung von Schreibmaschine auf Computer oder die Vorschrift, sich nach Dienstende nicht in Uniform zu besaufen. Das anfänglich angespannte Verhältnis zwischen Schäfer und Hornig war wohl ebendiesen zahlreichen weißweinträchtigen Stunden nach Feierabend geschuldet. In denen sich Hornig als künftiger Postenkommandant von Schaching gesehen hatte – ein Traum, den ihm der Major aus Wien zerstört hatte, der zwar aus Wien, aber eben Major war.
Dann die beiden Iron Cops. Zwei Muskelmaschinen Mitte zwanzig mit Sechs-Millimeter-Haarschnitt, die auftraten, als könnten sie jeden Moment nach Afghanistan abberufen werden, um den Außenminister aus der Geiselhaft zu befreien. Dabei war jedem am Posten klar, dass die wahre Macht von ihren beiden Ehefrauen ausging, die ihren Männern allein schon wegen des bald zu erwartenden Nachwuchses keinen gefährlicheren Beruf erlaubten.
Und schließlich Auer. Eine ländliche Neubesetzung von Schäfers ehemaliger Mitarbeiterin Kovacs: durchtrainiert, klug, ehrgeizig. Obendrein sehr attraktiv, was schon einige Beifahrerinnen von männlichen Fahrzeuglenkern nach der Verkehrskontrolle zum mürrischen oder neckischen Kommentar bewogen hatte: Seit wann bist du denn zu Polizisten so nett?
Auch Schäfer verstand sich gut mit ihr. Und die paar Mal, als er ihr vorwitziges Hinterfragen eines Befehls (»Aber warum …«) ohne Diskussion beendete (»Weil ich Ihr Vorgesetzter bin«), hatten auf keiner Seite zu einer längeren Verstimmung geführt.
Er rief Auer an und trug ihr auf, in der Gerichtsmedizin nach dem Obduktionsbericht zu fragen. Dann trank er ein Glas Wasser in einem Zug, legte das Holster an und ging auf Streife.
3.
An der Uniform erkannt zu werden als jemand, der offiziell für Sicherheit und Wohlergehen der Menschen zuständig war: das fühlte sich auch nach fast drei Monaten in Schaching noch seltsam an. Major Schäfer, Hüter der Lebensqualität, Gott behüte, sagte er zu sich selbst. Wobei das Patrouillieren durch den kleinen Ort weniger seiner Pflicht als vielmehr seinem Bewegungsdrang geschuldet war. Gehen. Einen freundlichen Gruß an die Besitzerin der Modeboutique schicken, die gerade ihre Auslage dekoriert. Mit den orange leuchtenden Arbeitern der Müllabfuhr ein paar beruhigende Sätze über einen Einbruch oder Verkehrsunfall wechseln. Dann ein paar Kinder ermahnen, den Ball nicht über den Zaun des Spielplatzes hinauszuschießen. Schließlich würde das unweigerlich dazu führen, dass sie ihm nachliefen, nicht auf den Verkehr achteten und … gut, diese Szene hatte sich bislang nur in seinen Gedanken abgespielt, die oft dazu neigten, seine nunmehrige Tätigkeit zu idealisieren. Ihn auf paradoxe Weise in eine Welt zu versetzen, wo es selbstverständlich war, Kinder auf die Gefahren des Lebens hinzuweisen; wo es gar nicht vorstellbar war, dass sie unter die Räder eines angetrunkenen Autofahrers kamen, weil es solche in dieser Idealwelt nicht gab, da jeder genau wusste, dass Kinder so wertvolle wie unachtsame Existenzen waren, die es unter allen Umständen zu schützen galt, zumal … Major Schäfer, im Ranking der abgedrehtesten Bullen des Landes bist du immer noch vorne mit dabei.
Als er an der Kirche vorbeikam, sah er durch das Friedhofstor eine Gruppe schwarz gekleideter Menschen. Gemessenen Schrittes, wie es sich gehörte, ein paar Männer schon leise miteinander sprechend, zwei verhalten fröhliche Gesichter. (Wer sollte es ihnen übel nehmen, für sie war es ja noch einmal gut gegangen.) Ein schlanker, groß gewachsener Mann seines Alters nickte Schäfer freundlich zu. Herbert, Herbert Irgendwas, kam es ihm in den Sinn, Einkaufsleiter in einem Baumarkt, seit sieben Monaten trocken. Woher er das wusste? Drei Wochen zuvor war er nach langer Zeit wieder einmal zu einem Treffen der Anonymen gegangen. Nicht dass er sich als Alkoholiker betrachtete – schließlich gelang es ihm durchaus, ein paar Tage gänzlich ohne Wein auszukommen, oder? Doch er hatte eine schwierige Phase hinter sich, steckte vielleicht auch noch mittendrin, das ließ sich nicht immer genau beurteilen; jedenfalls fand er es eines Morgens bedenklich, dass auf seinem Küchentisch zwei leere Weinflaschen und nur ein Glas standen. Wo einem Mann seiner Intelligenz und seines immer noch passablen Äußeren eigentlich zwei Gläser und eine leere Flasche zustünden. Besser eine noch halbvolle, die zu leeren die leidenschaftlich sich Begehrenden nicht mehr geschafft hatten, zumal das brennende Verlangen sie ins Schlafzimmer getrieben hatte. Seinen mitunter erhöhten Alkoholkonsum auf die Abwesenheit einer liebenden Gefährtin zu schieben, kam ihm dennoch nicht in den Sinn. Das wäre, als würde man einen Ziegelstein in einen Brunnen werfen, nur um zu sehen, ob er möglicherweise die dunkle Leere ausfüllen konnte.
Zurück auf dem Posten, fand er in seinem Postfach einen Brief des Bürgermeisters und den vorläufigen Obduktionsbericht von Yvonne Raab. Auf den ersten Blick nichts Auffälliges. Blieben die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung, doch die würden bestimmt erst in ein paar Tagen eintreffen.
Schäfer öffnete das Kuvert aus dem Rathaus. Die Ahnung, wieder einmal zu einer unerträglich langweiligen Veranstaltung eingeladen respektive verpflichtet zu werden, wich bald einem heiteren Staunen. Seit dem Wochenende befände sich die deutsche Filmproduktion Fifi TV Productions vor Ort. Zurzeit würden ein paar Mitarbeiter die Gegend nach geeigneten Drehorten durchforsten – jetzt ging Schäfer auch auf, was es mit den beiden Kleinbussen am Waldrand auf sich gehabt hatte –, doch stünde es so gut wie fest, dass demnächst die Dreharbeiten für den Pilotfilm einer Krimiserie begännen. Weshalb alle Mitarbeiter der örtlichen Exekutive – und Schäfer als ihr Vorgesetzter in besonderem Maße – angehalten wären, die Mitwirkenden nach besten Kräften zu unterstützen. Schließlich böte die mediale Wiedergabe der Schönheit der Gemeinde auf unzähligen Bildschirmen, auf dem gesamten deutschen Markt (!), eine unbezahlbare Chance für die touristische Entwicklung. Was gerade in Zeiten wie diesen, bla bla, und umso mehr, wenn die Produktion tatsächlich in Serie ginge, weshalb er, der Bürgermeister, noch einmal betonen wolle, wie wichtig, bla bla bla.
Ungläubig las Schäfer den Brief ein zweites Mal. Schönheit der Gemeinde? Touristische Entwicklung? Höchstens, wenn die Gäste selbst ein paar Leichen im Wald suchen durften. Bürgermeister König … der sollte diese Wichtigtuer doch selbst in der Gegend herumchauffieren. Andererseits: Was gab es einzuwenden gegen ein wenig Abwechslung zu diesem monotonen Dasein? Zu diesen banalen Ereignissen, der Eintönigkeit und Vorhersehbarkeit, die Schäfers Kriminalinstinkt langsam, aber sicher einschläferten. (Bis aus ihm ein weinselig grinsender oder menschenfeindlich pensionsabwartender Provinzgendarm würde, der im Garten saß und seine Katze auf weiße Mäuse hetzte.) Warum den Ort nicht für ein paar Wochen zum Schauplatz einer haarsträubenden Verbrechensserie machen? Herbei mit den Knallchargen und Komparsen! Zudem, hurra die Gams, scharwenzelten doch im Tross solcher Filmproduktionen bekanntlich jede Menge Frauen, die sich an einem fremden Ort gewiss leichter damit taten, beengende Moralvorstellungen abzulegen. Hm, das hatte etwas für sich, grübelte Schäfer. Mit seinem aktuellen Liebesleben konnte er nämlich höchstens einem Priester etwas beibringen – und das war in Zeiten wie diesen schon sehr ungewiss.
Er ließ Inspektorin Auer in sein Büro kommen.
»Dieses Filmteam, das seit dem Wochenende hier ist …«
»Ja?«
»Dort, wo sich dieses Mädchen aufs Gleis gelegt hat, sind zwei Busse von denen gestanden … Finden Sie heraus, wo die wohnen, fahren Sie mit Friedmann hin und fragen Sie nach, ob die irgendwas bemerkt haben.«
»Ja … zu diesem Mädchen, da wollte ich Sie sowieso noch etwas fragen.« Auer setzte sich zögerlich. »Das ist am 6.6. passiert … kurz nach sechs Uhr morgens …«
»Und?« Schäfer rückte an den Schreibtisch heran und stützte die Ellbogen auf.
»Ja … kann ja Zufall sein, aber ich habe mir die Selbstmorde weiblicher Personen in den vergangenen Monaten in der näheren Umgebung angesehen und …«
»Kommt da noch was?«, wollte Schäfer wissen, nachdem Auer offensichtlich der Mut verlassen hatte.
»Ja … zwei Mädchen … die eine ist in die Donau gegangen … am 1. 1. kurz nach eins… die andere ist am 4. 4. von einer Autobahnbrücke gesprungen, kurz nach vier.«
»Sonst noch irgendwelche Gemeinsamkeiten?«
»Sie meinen …«
»Wissen Sie, wie viele Menschen in Österreich jährlich den Freitod wählen?«, fragte Schäfer und wunderte sich selbst über diese Wortwahl.
»Achtzehn Komma vier Personen auf Hunderttausend.«
»Ja … jeden Tag ungefähr drei, soweit ich weiß …«
»Aber bei weiblichen Personen zwischen fünfzehn und zwanzig ist die Rate signifikant niedriger.«
»Signifikant«, wiederholte Schäfer, »also: Gibt es sonst noch Gemeinsamkeiten?«
»Ich weiß es noch nicht.«
»Haben Sie Zeit für so was?«
Auer öffnete den Mund. Und schwieg.
»Ich meine das nicht vorwurfsvoll«, fuhr Schäfer fort, »wenn Sie während der Bürozeiten nichts zu tun haben, nur zu … aber Dienstanweisung bekommen Sie keine dafür … und bevor Sie irgendwen zu dieser … Hypothese befragen, kommen Sie zu mir … klar?«
»Klar«, erwiderte Auer, stand auf und ging zur Tür, während Schäfer meinte, ihr glucksendes Herz zu hören.
Mit einem Seufzen lehnte er sich in seinem Sessel zurück, schloss die Augen und legte die Hände übers Gesicht. Er brauchte sich nicht zu wundern, dass Auer ihn mit solchen Theorien in Beschlag nahm. Schließlich war sein Ruf bestimmt schon ein, zwei Wochen vor ihm hierherübersiedelt. Mitsamt einer riesigen Kiste, in der Fakten, Halbwahrheiten und Gerüchte ohne klare Beschriftung durcheinanderpurzelten. Ein Major vom Bundeskriminalamt! Die Gruppe mit der höchsten Aufklärungsquote hat er geleitet. Unglaubliche Fälle gelöst. Serienmörder dingfest gemacht! Man weiß nicht genau, warum er hierherversetzt worden ist, irgendwas mit seinem letzten Fall, mit diesen Terroristen. Dass er selbst schwer verletzt worden ist, ein halbes Jahr in der Klinik. Auf der Baumgartner Höhe habe ich gehört. In der Nervenklinik?
Solche Geschichten voller Erfindungen und Übertreibungen deuteten Polizisten wie Auer wohl als Versprechen auf Abwechslung und aufregende Abenteuer – ähnlich wie einer besonders attraktiven Person die Verantwortung für guten Sex aufgeladen wird. Und inmitten dieses banalen Alltags, dieser Wochen, Monate und Jahre ohne kriminalistische Herausforderungen – da bot sich in Schäfer offenbar ein vielversprechender Katalysator, in den Auer nur genug abstruse Fakten stopfen musste, und schon würden Fälle herauspuffen, die sie zu einer ebenso ruhmreichen Erscheinung machen würden. Als ob sich eine Laufbahn wie die seine an irgendeiner beliebigen Stelle betreten ließe. Als ob auf dem Weg dorthin nicht hunderte – waren es vielleicht sogar schon tausende? – Menschen ganz unspektakulär zu Tode gekommen wären. Das Blut, das nur in seine Erinnerung und in sonst keine Geschichte eingeflossen war. Die banalen Tragödien, die niemand erwähnte, wenn seine großen Fälle zur Sprache kamen. Den Menschen, den niemand sehen wollte, sobald er aus dem Scheinwerferlicht trat. Einer, der sich öfter für seine Taten schämte, als dass er stolz auf sie war, und es anderen überließ (der Presseabteilung, freundlichen Medien, wohlgesonnenen Kollegen), ihn so darzustellen, wie das Publikum ihn sich wünschte. Keinen desperaten Zyniker. Keine trunkene Heulsuse. Keinen zornig Depressiven, der sein Leben oft genug aufs Spiel gesetzt hatte, als läge ihm ohnehin nichts mehr daran. Also: Wie sollte er dieser jungen Polizistin in ein paar Sätzen erklären, welchen Preis er für die Orden gezahlt hatte, deren Glanz sie anhimmelte? Warum er hier gelandet, hier gestrandet war, am Abstellgleis. Endstation, weil seine Sehnsüchte die Weichen falsch gestellt hatten.
Oh, Schäfer! Blieb hier eine bittere Note nach dem so sauber inszenierten Abgang? Ein unreines Bukett von Pulverschmauch und Verwesung, das beim letzten Schluck aus dem Abschiedskelch die Zunge pelzig machte? Leckt mich doch alle, nicht eure Schuld, sagte er sich. Außerdem: Ging es ihm hier so schlecht? Er hatte ein Haus mit Garten, wo er Radieschen, Mangold und Erdbeeren züchten könnte. Ein Grundstück, groß genug, um ein Lagerfeuer zu machen, ohne dass der Funkenflug die Pieper der brandgeilen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr auslöste. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er sogar ein eigenes Auto – einen alten Saab, der laut Typenschein 122 PS, dem Röhren des Motors und seinem Abzug entsprechend jedoch bestimmt 200 hatte. Was Schäfer jedes Mal, wenn er die Kupplung losließ, schmunzelnd an seinen Vorgänger denken ließ: Chefinspektor Stark, der ihm neben dem Haus in Staatsbesitz auch diesen halblegalen Bullenboliden hinterlassen hatte, als er sich gleich nach der Pensionierung nach Barbados abgesetzt hatte.
4.
»Was macht die Katze mit dem Raben?«, fragte Bergmann perplex, als Schäfer in den Garten zurückkam.
»Das geht schon seit ein paar Wochen so.« Schäfer stellte einen Krug mit Hollersaft sowie zwei Gläser auf den Tisch und setzte sich neben Bergmann. Ein paar Minuten betrachteten sie schweigend das seltsame Schauspiel, das die beiden Tiere aufführten: Die Katze setzte sich in die Wiese, hob den Kopf und schloss die Augen, als wäre sie ganz in Betrachtung ihres Selbst versunken. Worauf der Rabe sich hüpfend von hinten näherte und ihr in den Schwanz hackte. Daraufhin fuhr die Katze blitzartig herum, stürzte sich auf ihn und rang ihn mit den Vorderpfoten zu Boden. Wo der Vogel wie tot auf dem Rücken liegen blieb und die Krallen von sich streckte. Anschließend drehte die Katze stolz zwei Runden um den so einfach besiegten Gegner und widmete sich wieder ihrer Meditation. Dann wiederholte sich das Spektakel, allerdings mit umgekehrtem Ausgang: Der Rabe hackte der Katze im Zweikampf zweimal behutsam in die Brust, worauf sie am Rücken liegen blieb und er triumphal krächzend im Kreis um sie herumhüpfte.
»Woher haben Sie die beiden?«, wollte Bergmann wissen.
»Was woher?«
»Na, Sie werden sie ja nicht selbst dressiert haben, oder?«
»Wieso dressiert? Seit wann dressiere ich Kleintiere?«
»Was weiß ich … vielleicht ein neues Hobby.«
»So weit kommt’s noch.«
»Aber … normal ist das nicht.«
»Wenn Sie meinen …«
Schäfer zündete sich eine Zigarette an und fragte sich, wer von den beiden zuerst da gewesen war: Katze oder Rabe? Er wusste es nicht. Krähen und Raben gab es in der Gegend zuhauf. Sie saßen in den Feldern, pickten die Saat auf, bis einer ihrer Kameraden in der wütenden Schrotsalve eines Bauern zu einem Federball explodierte. Dann zogen sie sich für einen Andachts- oder Gewinn-Verlust-Rechnungs-Moment zurück, um alsbald wiederzukehren. Ein paar Einzelgänger wagten sich in die Gärten vor. Stolzierten über den Rasen, schnappten sich die Wursthäute vom letzten Grillabend, inspizierten den Komposthaufen oder freuten sich über die Mülltonne, die der Hausherr in der Hektik offen gelassen hatte, weil er fürchtete, die zweite Halbzeit könnte ohne ihn beginnen.
Schäfer hatte einmal mit dem Jagdgewehr, das Stark zurückgelassen hatte, auf einen Raben gezielt, der in der Krone des Kirschbaums gesessen war und so schauderlich gekrächzt hatte, als wollte er Hendrix’ Woodstock-Version von Star-Spangled Banner imitieren. »Drei Sekunden hast du noch«, hatte Schäfer gemurmelt – verdammt, es war zwei Uhr morgens! Als der so Bedrohte innehielt, mit dem Schnabel kurz in seine Flügel pickte und davonflog. War es dieses einsame und lebensmüde Krähentier, das aus seiner Verzweiflung die Gesellschaft der Katze gesucht hatte? Woher sollte Schäfer das wissen – diese Viecher waren für ihn genauso wenig zu unterscheiden wie Säuglinge oder Koreaner.
Die Katze hingegen – von ihr wusste Schäfer genau, wann sie in sein bewusstes Wahrnehmungsfeld getreten war: etwa eine Woche nach seinem Einzug. Nach dem Ausmalen der Küche, dem ein giftiges Abflämmen der alten Kunststofffarbe vorhergegangen war, sank er erschöpft auf die warmen Pflastersteine an der Außenmauer. Ein Glas Weißwein in der Hand. Viel zu warm, weil er übersehen hatte, ihn nach dem Einkaufen in den Kühlschrank zu stellen. Er nippte müde daran und erblickte zwei leuchtende Augen, die inmitten des Quittenstrauchs auftauchten. Noch ehe er sich seiner Wahrnehmung versichern konnte, waren sie verschwunden – dafür lag am nächsten Tag eine tote Maus vor der Terrassentür.
Gleichgültig hatte er den Mäusekadaver am Schwanz gepackt, über die Hecke in den Acker geschleudert und sich einem Frühstück gewidmet. (Pumpernickel, eine Dose Leberstreichwurst und ein Glas Apfelmus – alles Importware aus seiner Wiener Wohnung.) Danach füllte er in der lazarettmäßigen Küche boilerheißes Wasser in eine Tasse mit löslichem Kaffee, zündete sich eine Zigarette an und inspizierte den Garten. Unter dem Holunderstrauch lag eine Katze und schleckte sich die Pfoten. Später fragte er sich, warum ihm das Tier sofort sympathisch gewesen war. Wahrscheinlich aus Mitleid über ihr Aussehen: schwarz grundiert, mit grauen Flecken, die aussahen wie Schimmelbefall. Am Rücken unregelmäßige rostfarbene Streifen, als ob sich in ihren Stammbaum eine Hyäne geschlichen hätte. Auch ihr Kopf war seltsam geraten, die Nase zu tief oder die Augen zu nah beieinander, Schäfer konnte nicht genau bestimmen, was eigentlich bei diesem Tier schiefgegangen war … ein göttlicher Ausrutscher, wofür sie als ausgleichende Gerechtigkeit wahrscheinlich imstande war, einen Atomkrieg zu überleben.
»Du kannst dir alles abschlecken, was du hast, hässliches Viech«, sprach er sie offiziersmäßig an und richtete den Zeigefinger auf sie, »du kannst hier patrouillieren, Mäuse fangen, Vögel zerfledern … aber wenn du ins Haus gehst, mir irgendwo hinpisst oder hinkackst, dann werde ich zum Kampfhund, verstanden?«
Die Katze hatte ihre Pfoten fertig gereinigt, zu ihm aufgeblickt und das schiefe Maul zu einem Gähnen geöffnet.
»Zum Kampfhund, kapiert?«, hatte Schäfer wiederholt und die Katze ihrer Morgenwäsche überlassen.
Ein paar Wochen später war der Rabe aufgetaucht und die beiden hatten angefangen, ihre widernatürliche Choreografie einzustudieren. Worüber sich vielleicht ein Steuerberater gewundert hätte, der im vierten Jahrzehnt seines gemaßregelten Lebens ein Einfamilienhaus auf dem Land erstanden hatte. Doch Schäfer, der – nur als Beispiel – den Besitzer einer Vierzimmerwohnung auf alle deren Räume verteilt gesehen hatte, Schäfer war das ziemlich egal.
»Was tut sich in Wien?«, wandte er sich nun an Bergmann, um ihn aus seiner Faszination für den Schäfer’schen Kleintierzirkus zu reißen.
»Was? … Als ob Sie das nicht wüssten«, erwiderte Bergmann leicht genervt. Wohl weil er mit keinem einzigen auch nur halbwegs spannenden Fall aufwarten konnte. Normalerweise störte ihn das nicht, zumal seine Gruppe mit dem routinemäßigen Abarbeiten der alltäglichen Gewalt ausgelastet war; und geistige Drahtseilakte, wie sie Schäfer regelmäßig aufgeführt hatte, waren ohnehin nicht sein Ding. Aber hier, neben dem legendären Major der Mordkommission, der sein Vorgesetzter und Ausbildner gewesen war – da hätte er doch gerne mit ein paar außertourlichen Leistungen aufgetrumpft. Aber wie denn, wenn sich mit Schäfers Abschied offenbar auch die mysteriösen Verbrechen verzogen hatten.
»Wissen Sie, was ich mich letztens gefragt habe?«, lenkte er von seinem aufkommenden Ärger ab.
»Ob Sie sich um eine Versetzung hierher bemühen sollten?«
»Genau, ein verrücktes Paar auf dem Land … Nein … ob nicht vielleicht Sie mit Ihrer Arbeitsweise ein Energiefeld geschaffen haben, wo die Kriminellen sich besonders angestrengt haben, um Sie nicht mit allzu banalen Straftaten zu reizen … also dass die Komplexität Ihrer Fälle eher …«
Schäfer drehte sich zu Bergmann hin und fuchtelte mit der Hand vor seiner Stirn hin und her.
»Sonst geht’s Ihnen aber noch gut, oder? … Erstens habe ich von Einbruch über Versicherungsbetrug bis zum organisierten Autodiebstahl alles gemacht, was einen guten …«
»Jaja … schon gut«, wehrte Bergmann ab.
»Außerdem!«, Schäfer hob dozierend den Zeigefinger, »wenn an Ihrer hirnrissigen Energiefeld-Theorie etwas dran ist, könnten ja genauso gut Sie dafür verantwortlich sein … wenn ich mich recht erinnere, ist nämlich nach meinem Wechsel in die Königsdisziplin der Kriminalarbeit bald einmal ein heillos überforderter Inspektor an meinem Rockzipfel gehangen, der …«
»Jaja!«, Bergmann machte eine wegwerfende Handbewegung, stand auf und ging ein paar Schritte in den Garten hinaus, um den auftrumpfenden Major seine Überlegenheit allein genießen zu lassen. Was für ein sinnloses Unterfangen, diesem in seinem eigenen Revier die Show stehlen zu wollen.
»Und zu Ihrer Beruhigung«, rief Schäfer ihm nach, »das hier ist nicht die Baker Street, sondern ein ödes Kaff, wo jede zweite Straftat von einem begangen wird, der so besoffen ist, dass wir ihn eine Stunde später in einem Umkreis von fünfhundert Metern finden … von wegen nicht banal … noch ein Jahr hier ohne Kapitalverbrechen und das ist das letzte Kapitel von Kriminalgenie Schäfer.«
»Kovacs hat mir erzählt, dass sich letzte Woche in der Nähe ein junges Mädchen aufs Gleis gelegt hat«, meinte Bergmann, nachdem er sich wieder an den Gartentisch gesetzt hatte.
»Ja … scheiße … siebzehn … wenn ich fünf Minuten früher aufgestanden wäre, hätte ich sie herunterholen können.«
»Wieso das?«
»Weil ich meine Morgenrunde am Bahndamm gemacht habe … Ich habe den Zug vorbeifahren sehen … Gleich darauf ist es passiert.«
»Tut mir leid … Was haben die Eltern gesagt?«
»Ich habe sie noch nicht befragt … Am liebsten würde ich die Sache unter den Tisch kehren … oder heißt es Teppich?«
»Ja, Teppich … unter den Tisch fallen lassen.«
Sie schwiegen eine Zeit lang, ohne jede Verlegenheit, schauten nach Westen, wo die Sonne als Abschiedsgruß den über dem Horizont hängenden Wolken einen strahlenden Rahmen gab.
»Nehmen Sie eigentlich wieder diese Medikamente … die Antidepressiva?«
»Nein, will ich nicht mehr«, antwortete Schäfer, »nur so homöopathische Sachen … afrikanische Schwarzbohne, Johanniskraut, Sonnenhut und noch irgendwas …«
»Dass Sie sich der Homöopathie anvertrauen, erstaunt mich jetzt direkt.«
»Tu ich auch nicht … aber an den Placeboeffekt glaube ich.«
»Hm«, machte Bergmann. Er war sich sicher, dass an dieser Gleichung etwas nicht stimmte – nur was genau, wusste er im Augenblick nicht.
»Wir haben seit letzter Woche ein Filmteam in der Gegend, das eine Krimiserie drehen will«, wechselte Schäfer das ihm nicht sehr angenehme Thema.
»Wirklich? Ich wette um hundert Euro, dass bald einer von denen einen tödlichen ‚Unfall‘ hat, der sich bei näherer Betrachtung durch Major Schäfer als Mord herausstellt, worauf …« Bergmann grinste und duckte sich weg, um einem Klaps auf den Hinterkopf auszuweichen.
»Wenn das passiert, verhöre ich Sie vierundzwanzig Stunden, egal ob Sie ein Alibi haben oder nicht.«
»So sehr vermissen Sie mich?«
»Ich mache uns was zu essen«, Schäfer stand auf und schaltete die Außenbeleuchtung ein, »wollen Sie inzwischen eine Zeitung oder was anderes zum Lesen?«
»Nein … kann ich ein Feuer machen?«
»Von mir aus … aber nehmen Sie die zersägten Bretter bei der Hütte und nicht das gute Buchenholz … das brauche ich für den Kamin.«
»Kamin, ts … womit Sie das verdient haben, frage ich mich«, maulte Bergmann, was Schäfer jedoch nicht mehr hörte.
5.
»Sie haben bei uns den Vortrag gehalten …«
»Ja, möglich«, erwiderte Schäfer, der gerade in der Betrachtung seines Gummiballs versank. Würde der ihm vielleicht die Zukunft verraten? Die kleinen silbernen Sterne als Wegweiser für ein glückliches Leben?
»In der Schule … vor drei Wochen!«, ergänzte das Mädchen. Verdammt, Aufmerksamkeitsdefizitstörung war doch ein Privileg ihrer Generation.
»Stimmt, da war ich.« Schäfer ließ das Gesicht der Schülerin durch eine schnelle Rasterfahndung in seinem Gehirn laufen. Nein, die war nicht gespeichert. Dafür der Vortrag im Gymnasium: Stundenlang hatte er sich darauf vorbereitet, ein Referat erstellt, das nicht nur die zentralen Aussagen verständlich machen, sondern auch durch Humor, Spannung, persönliche Anekdoten und ein paar interaktive Elemente – Selbstverteidigung für Mädchen – bestechen sollte. Kurzum: ein wichtiger Beitrag, um die Unreifen auf die Gefahren des Lebens vorzubereiten. Hatte er zumindest gedacht, denn zur Aufführung dieser ersten Fassung war es nie gekommen.
Als Schäfer am Tag vor dem Schulbesuch spätabends seine Aufzeichnungen durchging und im Stehen eine stumme Generalprobe aufführte, hatte er plötzlich ein sehr lebendiges Bild der Schulklasse vor Augen, die ihn am folgenden Tag erwarten würde. Ein einseitiges Bild, das sich in erster Linie aus persönlichen Erfahrungen der üblen Natur speiste: Schüler, die einen Jüngeren halbtot schlugen und den gefilmten Gewaltexzess ins Internet stellten. Dreizehnjährige Burschen, die eine Neunjährige in den Keller lockten. Ein Lungenstich wegen ein paar falscher Worte, eine Schädelfraktur wegen eines Handys, Luftpistolen, Springmesser und Schlagringe in den Schultaschen … Wie wollte er, der Bulle, der Feind, diese verlorene Jugend denn mit einem Vortrag bekehren? In weiterer Folge versuchte er, seine Erregung und zunehmende Nervosität mit einem Glas Wein zu lindern. Gegen zwei Uhr früh schlief er über seinen Aufzeichnungen ein, an den Rand eines Zettels hatte er notiert: Ihr haltet euch wahrscheinlich für unsterblich. Seid ihr nicht. Am Ende seid ihr alle tot. Also versucht bis dahin, brav zu bleiben.
Auf dem Weg zur Schule hatte er sich entschieden, diese Aussage ein wenig abzuschwächen und je nach Verhalten der Schüler doch ein paar Elemente aus der Guter-Bulle-Fassung einzubringen. Und war so letztendlich zwei Stunden lang durch ein selbst geschaffenes Dickicht geirrt, in dem sich banale Sicherheitstipps (Immer gut zusperren!) und umstrittene Thesen zur Entstehung des Bösen im Gehirn mit einem Worst-of selbst erlebter Tatorte verstrickten (Stichwort Verwesung). Dass jemand, der diesem Wahnsinn beigewohnt hatte, nun seine Nähe suchte, verwunderte ihn. Offenbar war selbst die vorhersehbarste Welt für Überraschungen gut.
»Sie müssen uns helfen«, sagte das Mädchen bestimmt.
»Muss ich … aha, und wobei?«
»Meine Schwester … die war … da ist der Haidegger, diese Drecksau, und der ist außerdem ein Freund von meinem Vater … deswegen ist es ja noch viel beschissener.«
»Bitte um Mäßigung in der Wortwahl«, meinte Schäfer.
»Ja, ’tschuldigung, ist aber so … sonst könnten wir ja zu ihm gehen, also zu meinem Vater, aber dann sagt ihm der Haidegger …«
»Die Drecksau.«
»Was?«
»Der Haidegger ist die Drecksau«, brachte Schäfer ein. »Jetzt möchte ich gerne wissen, was ihn zu dieser Drecksau macht, und wenn das strafrechtlich … also wenn der Haidegger auch laut Gesetz eine Drecksau ist, machen wir den nächsten Schritt.«
»Und was ist der?«
»Eine. Anzeige. Aufnehmen.« Schäfer drehte den Bildschirm zu sich. Tat, als würde er irgendeine Vorlage abrufen und ein paar Eckdaten eintragen, schaltete in Wahrheit jedoch die digitale Stimmaufzeichnung ein.
»Nein, das geht nicht«, erwiderte sie erwartungsgemäß, »deswegen bin ich ja zu Ihnen gekommen, weil das nicht geht.«
»Wie heißt du überhaupt?«
»Carola … Windreiter.«
»Also, Carola … du willst in irgendeiner Sache, die der Haidegger gemacht hat und die deine Schwester betrifft, keine Anzeige erstatten, sondern eine andere Lösung … und deswegen kommst du zu mir …«
»Genau.«
»Zu einem Polizisten.«
»Ja.«
»Der dazu da ist, Anzeigen aufzunehmen, um gegen allfällige Täter vorgehen zu können und allfällige Opfer oder gefährdete Personen zu schützen …«
»Wahrscheinlich, ja … aber Sie sind eben anders, weil Sie doch in Wien so ein …«
»Also«, Schäfer stieß einen Altherren-Seufzer aus, der ihm sofort peinlich war, »was hat dieser Haidegger getan?«
»Die Nadja … also meine Schwester, die war bei so einer Party … und als sie heimgegangen ist, ist der Haidegger vorbeigefahren und hat sie mitgenommen.« Schäfer wusste, was jetzt kam, nur noch nicht, in welcher Intensität.
»Und irgendwann war seine Hose offen …«
»Ja … woher …«, fragte sie.
»War er bereits erregt oder noch nicht?«
»Wie?«
»Hat er einen Steifen gehabt oder nicht?«
»Weiß ich nicht … wieso?« Sie starrte ihn halb wütend, halb verzweifelt an.
»Hat dir deine Schwester das nicht erzählt?«, fuhr Schäfer fort und sah an ihr vorbei, ohne sie aus den Augen zu lassen.
»Nein … sie hat gesagt, dass er zuerst so komisch herumgerückt ist, dass sie geglaubt hat, er muss furzen, deshalb hat sie weggeschaut, und dann hat er ihn plötzlich draußen gehabt und an sich herumgefummelt.«
»Während der Fahrt?«
»Zuerst … ja … dann ist er stehen geblieben und hat gesagt, dass sie ihm doch … weil er so nett war, sie mitzunehmen und … diese Drecksau …«
»Wo hat er angehalten?«
»Bei dem Parkplatz an der Hauptstraße … wo der Hofer und der Billa sind.«
»Wo davor der Kreisverkehr ist.«
»Ja«, meinte sie nach einem Moment des Nachdenkens.
»Okay … der Haidegger ist also stehen geblieben und hat deine Schwester aufgefordert, an ihm sexuelle Handlungen vorzunehmen«, sagte Schäfer ruhig, »was genau denn?«
»Wie was genau?« Sie starrte ihn erschrocken an.
»Du bist hier, weil du mir etwas erzählen willst, das meine Kollegen nicht wissen sollen«, unterbrach er sie forsch, »also gib mir eine Antwort: Was wollte er von ihr?«
»Zuerst hat er gemeint, dass sie das Top hinaufziehen soll, damit … Das hat sie getan, weil … sie hat halt Angst gehabt … und dann hat er gesagt, dass sie ihn angreifen soll und … dann hat sie kotzen müssen.«
»Sie hat sich in seinem Wagen übergeben? Auf ihn?« Schäfer zwang sich, ein Grinsen zu unterdrücken.
»Einmal auf ihn und dann ist sie eh ausgestiegen.«
»War deine Schwester alkoholisiert?«
»Nein … doch, wahrscheinlich schon.«
»Stark?«
»Nein, bestimmt nicht.«
»Bis jetzt glaube ich dir, was du gesagt hast … Wenn du jetzt zu lügen anfängst, kannst du gleich hinausspazieren … also: Was hat sie geschluckt?
»Ein E … und dann später noch eins.«
»Ein Ecstasy vor der Party, eins zwischendrin … und vielleicht noch ein bisschen Gras und was weiß ich«, schlussfolgerte Schäfer.
»Ja … aber das …«
»Aber das dürfen eure Eltern auf keinen Fall erfahren, weil sonst, bla bla bla … und das war auch dem Haidegger klar, der deiner Schwester angesehen hat, dass sie völlig breit ist.«