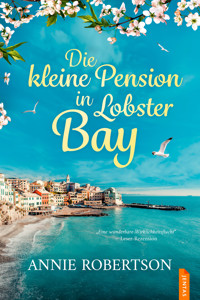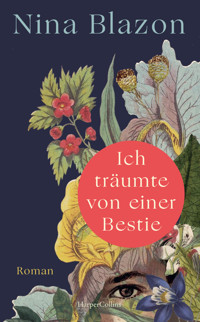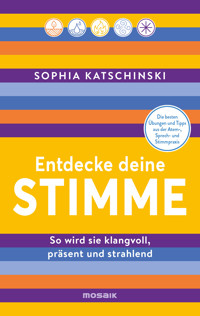
12,99 €
Mehr erfahren.
Den eigenen Ton finden, sich selber entdecken und eine klangvolle Stimme entwickeln
Die Stimmtherapeutin Sophia Katschinski zeigt, wie wir unsere Stimme (und uns selber) in allen Facetten entdecken und erklingen lassen.
Die Stimme ist zutiefst persönlich – und dabei absolut öffentlich. Sobald Sie auch nur einen kleinen Seufzer von jemandem hören, wissen Sie – wenn auch unbewusst – schon sehr viel über diesen Menschen. In der Stimme schwingt die gesamte innere Haltung mit, wie Stress, Gelassenheit, Sympathie, Kompetenz und Unsicherheit. Sie ist ein umfassender Ausdruck der einzigartigen und vielschichtigen Persönlichkeit eines Menschen. Wenn die Stimme mit dem Gesamteindruck einer Person übereinstimmt, wirkt sie authentisch, aber wenn sie nicht zur Person oder zur Situation passt, kann dies Irritationen hervorrufen.
Die Atem-, Sprech- und Stimmtherapeutin Sophia Katschinski zeigt, wie unsere Stimme klangvoller, präsenter und strahlender wird und hilft Schritt für Schritt, die gesamte Palette des eigenen Ausdrucks zu entwickeln. Die »fünf Elemente« (Feuer, Erde, Wasser, Luft und Äther) sind dabei eine Landkarte, die uns einen einmaligen Zugang zu den verschiedenen Aspekten unserer Persönlichkeit bietet und den Stimmklang in seinen unterschiedlichsten Facetten hörbar macht. Die spezifischen Eigenheiten der Elemente sind in vielen sprachlichen Bildern schon enthalten. Halten Sie eine wichtige Präsentation vor dem neuen Kunden? Um überzeugend zu sein, hilft sicher ein bisschen Feuer in Ihrer Rede! Sie wollen einen Kompromiss in einer diffizilen Angelegenheit finden? Gut geerdet gehen Sie in jede Verhandlung. Wenn wir lernen, die fünf Elemente bewusst wahrzunehmen, dienen Sie als eine geniale Landkarte. Auf ihr erkennen wir unsere Stärken und auch unsere Schwächen oder blinde Flecken. Wir haben die Möglichkeit, uns über die vertrauten und oft gegangenen Wege dieser Landkarte vorzuwagen auf noch unbekannte Pfade und unentdecktes Gelände. Wir können, unterstützt von unserer starken Stimme und ausgehend von vertrautem Terrain, neu Facetten entdecken, mit denen wir uns noch vollständiger ausdrücken können. Mit denen wir tatsächlich gehört werden. Und mit denen wir beginnen, eine echte Kommunikation zu führen: Ein Treffen, das sowohl uns, als auch unser Gegenüber, in diesem Moment miteinander verbindet.
So verändert sich mit der Stimme auch Ihre Wirkung, Ihr Ausdruck und Ihre Wirksamkeit. Probieren Sie es aus, es lohnt sich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Die Stimme ist zutiefst persönlich – und dabei absolut öffentlich. Sobald Sie auch nur einen kleinen Seufzer von jemandem hören, wissen Sie – wenn auch unbewusst – schon sehr viel über diesen Menschen. Die Stimmtherapeutin Sophia Katschinski zeigt, wie unsere Stimme klangvoller, präsenter und strahlender wird, und hilft Schritt für Schritt, die gesamte Palette des eigenen Ausdrucks zu entwickeln. Die »fünf Elemente« (Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther) sind dabei eine Landkarte, die uns einen einmaligen Zugang zu den verschiedenen Aspekten unserer Persönlichkeit bietet und den Stimmklang in seinen unterschiedlichsten Facetten hörbar macht.
Autorin
Sophia Katschinski ist staatlich geprüfte Atem-, Sprech- und Stimmtherapeutin sowie Kundalini-Yoga-Lehrerin. Seit über 25 Jahren unterstützt sie ihre Klientinnen und Klienten darin, ihre authentische Stimme zu finden und deren Kraft zu nutzen. Außerdem gibt Sophia Katschinski Yogakurse sowie Yoga & Chanting Workshops und leitet das Stimmtraining in verschiedenen Yogalehrer-Ausbildungen in Berlin und Bayern.
Sophia Katschinski
Entdecke deine Stimme
So wird sie klangvoll, präsent und strahlend
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden von der Autorin und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung der Autorin beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe Mai 2024
Copyright © 2024: Mosaik Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag: Sabine Kwauka
Illustrationen: Roland Krieger
Redaktion: Birthe Vogelmann
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
CH · IH
ISBN 978-3-641-31126-1V001
www.mosaik-verlag.de
Inhalt
Vorwort
Teil 1 Ihre Stimme ist Ihr Potenzial
Ihr eigener Ton – stimmig oder nicht?
Physiologie, Funktion und Parameter der Stimme
Die Verwandlung des Atems in Klang
Die Stimmlippen-Positionen
Was wirkt alles auf den Stimmklang ein?
Die organischen Faktoren
Die funktionellen Faktoren
Die emotionalen Faktoren
Die situativen Faktoren
Teil 2 Die fünf Elemente aus dem Yoga und ihre Verbindung zur Stimme
Die Lehre der fünf Elemente im Yoga
Wie unterstützen die fünf Elemente das Entdecken Ihrer Stimme?
Networking nach innen und außen
Welche Elemente sind in Ihrer Stimme präsent?
Typisch Erde
Typisch Wasser
Typisch Feuer
Typisch Luft
Typisch Äther
Im gleichen Element sprechen
Die gesamte Landkarte der Elemente
Eine Tür in jedes Element
Tür zur Erde
Tür zum Wasser
Tür zum Feuer
Tür zur Luft
Teil 3 Die Werkzeugkiste für die wichtigsten Herausforderungen
Antworten auf häufige Fragen zu Stimme und Sprechen: Was tun, wenn …
… ich beim Sprechen nicht genug Luft habe?
… ich meine eigene Stimme nicht mag?
… ich so undeutlich spreche, dass ich oft nicht verstanden werde?
… ich beim Sprechen ein Kloßgefühl im Hals habe?
… meine Stimme auf andere emotionslos und unpersönlich wirkt?
… ich bei Stress eine schrille Stimme bekomme?
… ich häufig gebeten werde, etwas leiser zu sprechen?
… ich Angst davor habe, vor Publikum zu sprechen?
… ich mich nicht gehört fühle?
Was Sie nicht tun sollten – eine Ermutigung!
Bonustrack 1: Das kleine Stimmpflege-Set
Bonustrack 2: Das kleine Präsentations-Set
Dank
Anmerkungen
Register
Vorwort
Dieses Buch ist für Sie, wenn Sie Ihre eigene Stimme entdecken möchten. Es ist für Sie, wenn Sie sich zu viel anstrengen beim Sprechen. Oder wenn Sie das Gefühl haben, nicht wirklich gehört zu werden. Aber auch, wenn Sie im immer gleichen Ton sprechen und gerne auch andere Facetten von sich ausdrücken würden, nur noch nicht wissen, wie.
Das Buch ist auch für Sie, wenn Sie sich nicht so recht trauen, Ihre Stimme kraftvoll einzusetzen, weil Sie sie nicht als schön, stark oder laut genug empfinden.
Für Sie alle ist dieses Buch. Sie sind mit Ihrer einzigartigen Stimme genau richtig. Also los, gehen Sie auf Entdeckungsreise und finden Sie heraus, wie Sie diese Einzigartigkeit in Ihrer Stimme klangvoll und präsent zum Strahlen bringen können.
Keinem der in diesem Buch beschriebenen Menschen bin ich tatsächlich im realen Leben begegnet. Jede einzelne Person, die Sie beim Lesen kennenlernen, ist meiner Fantasie und der Schatzkiste meiner fast 30-jährigen Unterrichtserfahrung entsprungen. Ich habe die Geschichten dieser Menschen so lebensnah kreiert, um Sie unterhaltsam und mit einer gewissen Leichtigkeit an die unterschiedlichen stimmlichen Themen heranführen zu können. Sollten Sie dennoch das Gefühl haben, sich in einer Person wiederzuerkennen, nehmen Sie es als eine liebevolle Erinnerung daran, dass Sie zwar absolut einzigartig sind, dass aber Ihre menschlichen und damit auch stimmlichen Herausforderungen und die Situationen, in denen sie Ihnen begegnen, für alle Menschen universell sind.
Ich verwende weibliche und männliche Formen möglichst ausgewogen und abwechselnd, damit alle sich gleichermaßen angesprochen fühlen können und der Lesefluss aufrechterhalten bleibt.
Ihnen nun ganz viel Freude, Inspiration und neue Erfahrungen beim Lesen und Ausprobieren!
Teil 1Ihre Stimme ist Ihr Potenzial
Ihr eigener Ton – stimmig oder nicht?
Die Stimme ist zutiefst persönlich – und gleichzeitig absolut öffentlich. Viele persönliche Merkmale kann man gut verstecken oder wenigstens kaschieren. Aber sobald Sie auch nur einen kleinen Seufzer oder ein gedankenverlorenes »Mmhhh« von jemandem hören, wissen Sie – wenn auch unbewusst – schon sehr viel über diesen Menschen. Wenn jemand mit Ihnen spricht, können Sie nicht nur den Atem, die Körperspannung, die Stimmung oder die Gedanken wahrnehmen. In der Stimme schwingt die gesamte innere Haltung mit, wie zum Beispiel Stress und Anstrengung oder Gelassenheit und Sympathie, Kompetenz und Selbstbewusstsein oder Angst und Unsicherheit. Die Stimme entspricht also nicht nur der so oft gebrauchten Metapher einer Visitenkarte, sondern sie ist noch viel mehr: Sie ist ein umfassender Ausdruck der einzigartigen und vielschichtigen Persönlichkeit eines Menschen.
Wenn die Stimme mit dem Gesamteindruck übereinstimmt, wirkt ein Mensch sofort angenehm authentisch in seinem Ausdruck. Passt die Stimme aber auf irgendeine Art und Weise nicht zu der Person oder in die Situation, löst das direkt eine Irritation aus. Mir geht es zum Beispiel mit der netten Kassiererin in einem nahegelegenen Supermarkt so. Sie hat eigentlich eine sehr freundliche Art zu kommunizieren, aber ihre hohe, schrille Stimme führt dennoch zur sofortigen Ausschüttung von Stresshormonen in meinem System. Sie kennen diese zwiespältigen Erfahrungen sicher selbst aus Ihrem Alltag. Der neue Nachbar, der ziemlich attraktiv wirkt – aber nur solange, bis er Sie leiernd-nasal nach dem Päckchen fragt, das der Paketbote bei Ihnen deponiert hat. Oder die Vertretungslehrerin aus Ihrem Yogakurs, die angenehm einfühlsam spricht – dies aber geradezu stoisch beibehält und selbst bei der schweißtreibendsten Übung um keinen Preis ihre sanfte Zen-Meditationsstimme aufgibt.
Die Stimme wirkt unmittelbar und hinterlässt einen stärkeren Eindruck als die Worte oder das Äußere der Person. Die Reaktion auf diesen Klang ist – ähnlich wie die Wahrnehmung von starken Gerüchen – nicht mental steuerbar. Wir hören eine Stimme und entscheiden instinktiv, ob sie angenehm oder unangenehm für uns ist. Ob authentisch oder nicht. Ob bedrohlich oder ungefährlich. Manchmal gehen wir über den ersten Eindruck hinweg und vielleicht gewöhnen wir uns auch irgendwann an eine gewisse Unstimmigkeit. So wie wir einen seltsamen Geruch, den wir immer wieder riechen, vielleicht auch irgendwann zumindest tolerieren können.
Wenn Sie aber die Wahl hätten, einer Person mit einer angenehm klangvollen Stimme oder jemandem mit einer unangenehm heiseren Sprechweise zuzuhören – wem wenden Sie sich unwillkürlich zu? Wessen Gedanken und Ideen können Sie leichter folgen? Wem vertrauen Sie mehr und wem trauen Sie mehr zu?
Die Antwort ist ziemlich klar: Ein schöner, resonanzreicher und kraftvoller Stimmklang überzeugt, führt und verführt uns schneller als eine angestrengte, klangarme Stimme mit wenig Ausstrahlung. Natürlich haben wir alle individuelle Vorlieben, die sich voneinander unterscheiden – der eine genießt den warmen, tiefen Sound, der so wohlig im Magen kitzelt, und die andere liebt die hellen, kristallklaren Töne, die wie ein Gute-Laune-Booster wirken. Aber dennoch gibt es dieses universelle Erleben einer schönen Stimme. Denken Sie an berühmte Schauspielerinnen, Moderatoren, Sängerinnen oder auch Podcaster. Den meisten von ihnen lauschen wir sehr gerne. Sie klingen interessant, aufregend, unterhaltsam, erotisch oder wenigstens angenehm. Denn sie haben diese besondere Stimme, bei der Sie sich fragen, ob es wirklich sein kann, dass genau SIE persönlich gemeint sind.
Diese universell als schön und besonders stimmig empfundenen Stimmen sind manchmal einfach ein Geschenk der Natur. Manchmal erstrahlen sie aber erst durch intensives Üben und bewusste Klangentfaltung in diesem kraftvollen Ausdruck.
Und hier ist die gute Nachricht: In den meisten Fällen spielt beides – Natur und Übung – eine Rolle. Auch wenn Ihnen bisher weder die Natur noch eine professionelle Stimmausbildung dieses klangvolle Strahlen mitgegeben hat, können Sie an und mit Ihrer Stimme arbeiten. Sie können entdecken, wo sie präsent und wo sie zurückhaltend ist und mit diesem Wissen die gesamten Facetten ihres Ausdrucks entwickeln! Ich nehme Sie mit diesem Buch an die Hand und begleite Sie auf dem Weg zu Ihrem gesamten stimmlichen Klangfächer und Ihrem ganz eigenen Ton.
Ich begleite Sie Schritt für Schritt – die Arbeit an und mit Ihrer Stimme können jedoch nur Sie selbst tun. Denn ihr Klang verändert sich nicht beim Lesen oder beim Darübernachdenken, sondern er entwickelt sich einzig und allein im Tun. Indem Sie sich bewusst Ihren persönlichen stimmlichen Herausforderungen stellen und mutig neue Klänge ausprobieren. Dann verändert sich mit der Stimme auch Ihre Wirkung, Ihr Ausdruck und Ihre Wirksamkeit. Probieren Sie es aus, es lohnt sich!
Physiologie, Funktion und Parameter der Stimme
Die Verwandlung des Atems in Klang
Der Klang Ihrer Stimme entsteht dadurch, dass die ausströmende Atemluft Ihre Stimmlippen in Schwingung versetzt und sich im Kehlkopf so in einen Ton verwandelt. Dieser Ton füllt Ihre Worte, Ihre Melodien und selbst Ihre unwillkürlichen Jauchzer und Seufzer. Um ihn zu generieren, müssen jedoch alle organischen, funktionellen und sogar emotionalen Faktoren stimmen.
Um sich den Vorgang der Entstehung von Stimmklang zu verdeutlichen, machen Sie gern dieses kleine Experiment: Legen Sie zwei Blätter Papier oder zwei etwas breitere Grashalme eng aneinander. Versuchen Sie dann, die beiden Blätter oder Gräser in der Mitte auseinanderzupusten. Nur wenn der Anblasedruck an den Lippen, die Spannung und Position der Blätter und vielleicht sogar der Grad Ihrer Freude daran zueinanderpassen, entsteht überhaupt ein Ton. Und vermutlich ist es Ihnen erst mit etwas Übung möglich, einen Ton gezielt anzusteuern oder sogar eine kleine Melodie zu bilden.
Wie auch immer Ihr Klangergebnis bei diesem kleinen Experiment sein mag, Sie erleben dabei ganz konkret das physikalische Phänomen der Verwandlung von Luft in Klang. In Ihrem Kehlkopf geschieht genau das Gleiche mit Ihrem Ausatem. Hier entsteht ein ganz besonders einzigartiger Ton: der Klang Ihrer eigenen Stimme!
Primärfunktion des Kehlkopfs: Vor der Stimme kommen der Atem …
Nichts in unserem Körper ist zufällig, alle physiologischen Funktionen dienen immer zuallererst unserem (Über-)Leben. So stehen die Stimme und das Sprechen auch erst an zweiter Stelle in der Funktionshierarchie des Kehlkopfs. Bevor wir menschheitsgeschichtlich das Sprechen gelernt haben, hatte der Kehlkopf schon eine lebenswichtige Bedeutung für die Atmung. Diese erste Primärfunktion des Kehlkopfs ist der Schutz vor dem Ersticken durch Speichel oder Nahrung. Luft- und Speiseröhre liegen nämlich unmittelbar hintereinander, und wenn der Kehldeckel sich beim Schlucken nicht automatisch über die Luftröhre legen würde, könnte jeder Schluck und jeder Bissen für uns lebensbedrohlich sein. Nur weil die Luftröhre an Ihrem Eingang im Kehlkopf beim Schlucken reflektorisch verschlossen wird, können wir ohne größere Erstickungsgefahr alle Köstlichkeiten genießen.
… und der Körper!
Eine weitere Primärfunktion des Kehlkopfs besteht in seiner sogenannten Doppelventilfunktion. Durch einen kurzzeitigen Verschluss von Stimmlippen oder Taschenfalten1 baut sich in der Lunge ein Über- oder Unterdruck auf, der den Körper bei kraftvollen Bewegungen stabilisiert. Die in Folge erhöhte Muskelspannung gibt dem gesamten Rumpf mehr Halt und sorgt dafür, dass er nicht durch den eigenen heftigen Impuls kollabiert.
Dieser Effekt wird in den traditionellen asiatischen Kampfkünsten auch noch durch den Kiai2, den klassischen Kampfruf, verstärkt. Für alle Schiebe-, Stoß-, Tritt- oder ähnlichen Bewegungen vom Körper weg entsteht für kurze Zeit ein Überdruck gegenüber der Außenluft in den luftgefüllten Räumen der Lunge. Wenn das Ventil in der Kehle sich dann öffnet, schießt die gestaute Energie mit voller Kraft in die Bewegung und über den Klang der Stimme nach draußen.
Diese beeindruckende Erfahrung einer spürbar größeren muskulären Schlagkraft bei der Bündelung von Bewegungs- und Stimmimpuls habe ich selbst einmal in einem Taekwondo-Kurs gemacht. Nach anfänglicher Zurückhaltung wurde ich von Woche zu Woche mutiger darin, meine Schläge und Tritte gegen das Schlagpolster mit einem kraftvollen »Kyyy-ap!«-Ausruf zu unterstützen. Diese konzentrierte Koordination von Aktion und lautem Kampfschrei hat mir nicht nur das Gefühl von unglaublicher Stärke gegeben, sondern war auch extrem befreiend für meine Stimme. Falls Sie selten Gelegenheit haben, die ursprüngliche Power Ihrer Stimme zu erleben, ist ein Kurs in traditioneller Kampfkunst eine echte Option!
Aber natürlich ist die Doppelventilfunktion Ihres Kehlkopfes auch – jenseits aller Kampfkünste – unverzichtbar für jeglichen Körpereinsatz, für den Sie eine bestimmte Menge an stabilisierendem Druck benötigen. Ohne diese wichtige Primärfunktion wären Sie zum Beispiel gar nicht in der Lage, aus eigener Kraft Fremdkörper abzuhusten, zu niesen oder Ihren Darm zu entleeren. Und ohne den nötigen Druckaufbau wäre auch eine natürliche Geburt überhaupt nicht möglich. Kurzzeitiger Unterdruck unterstützt außerdem alle muskulären Bewegungen, die die Spannung zum Körper hinführen. Er entsteht zum Beispiel unwillkürlich, während Sie eine schwere Kiste zu sich heranziehen, klettern oder Klimmzüge trainieren.
Am Quell des Klangs – die Reise zur Schallquelle
Der Kehlkopf besteht aus Knorpeln, Bändern und Muskeln und sitzt direkt oberhalb der Luftröhre im Hals. Er ist nur muskulär mit den umliegenden Strukturen verbunden und damit recht beweglich. Sie können es vorsichtig ausprobieren, indem Sie versuchen, den Schildknorpel vorne am Hals mit zwei Fingern zu greifen und leicht hin und her zu bewegen.
Unmittelbar über dem Kehlkopf liegt der Kehldeckel, der sich beim Schlucken absenkt und somit verhindert, dass Speis und Trank in die Luftröhre gelangen.
Wenn wir uns doch einmal verschlucken und ein kleines Stück vom Essen unglücklicherweise am Eingang oder gar in der Luftröhre landet, bleibt uns nur noch der rettende Hustenreflex, um den Bissen schnellstmöglich wieder nach oben zu befördern.
Nach vorne zum Hals hin wird das Innere des Kehlkopfs durch eine schildförmig gebogene Knorpelplatte, den Schildknorpel, geschützt.
Im Zentrum des Kehlkopfs, gut geschützt durch die Knorpelplatte, Bänder und Muskeln, liegen die nur etwa 2 – 2,5 cm langen Stimmlippen.
Die Stimmlippen setzen sich zusammen aus den Stimmmuskeln, den Stimmbändern und der Schleimhaut, die alles umhüllt und sogar selbst als Randkantenschwingung an der Tonerzeugung beteiligt ist.
Die vorderen Ansätze der Stimmlippen sind am Schildknorpel unmittelbar nebeneinander befestigt. Hinten können sie über zwei kleine Stellknorpel, die Aryknorpel, zu einem Dreieck geöffnet werden. Der Raum zwischen den Stimmlippen wird Stimmritze oder auch Glottis genannt. Hier befindet sich die primäre Quelle des Klangs: In der Glottis entscheidet sich, ob und auf welche Art die Luft in Klang verwandelt wird.
Der Kehlkopf
Die Stimmlippen-Positionen
In der Respirationsstellung, also beim geräuschlosen Atmen, sind die Stimmlippen wie ein gleichschenkliges Dreieck weit geöffnet. Die Luft kann lautlos ein- und ausströmen.
In der Phonationsstellung, also bei der Stimmgebung, liegen die Stimmlippen wie die zwei Grashalme aus dem Experiment ganz eng aneinander, sodass die ausströmende Luft sie in Schwingungen versetzen kann. Auch die hinteren Ansätze der Stimmlippen liegen hier durch die geschlossenen Stellknorpel eng aneinander, während der mittlere Teil sich in einem für das bloße Auge unsichtbaren Tempo von etwa 100 – 400 Hz, also 100 – 400 Schwingungen pro Sekunde, öffnet und schließt. Tiefe Töne erzeugen dabei die langsameren Amplituden, die hohen die schnelleren. Auf Frequenzen bis zu 400 Hz in der Stimme kommen aber normalerweise nur Kleinkinder.
Es gibt auch noch das sogenannte Flüsterdreieck. Beim Flüstern entsteht kein Klang, weil die Stimmlippen durch den muskulär aufgebauten Druck im Kehlkopf zu etwa zwei Dritteln fest aneinandergepresst werden. Die Atemluft entweicht nur durch das letzte Drittel im hinteren Bereich der Glottis und diese Engstelle erzeugt das typische Geräusch der Flüsterstimme.
Die drei Stimmlippen-Positionen
Was wirkt alles auf den Stimmklang ein?
Die organischen Faktoren
Die strukturelle Einheit des Kehlkopfs verbindet den oberen Abschluss der Luftröhre mit dem Ansatz des Rachenraums. Seine spezifische Form, die Größe und die individuelle Beschaffenheit beeinflussen auf natürliche Weise die Funktionsweise des Stimmorgans und prägen infolgedessen auch seinen jeweils charakteristischen Klang.
Die Stimmlage
So, wie wir alle einen einzigartigen Körper haben, so hat jeder Mensch auch eine ganz individuelle Stimmlage. Besonders die Größe des Kehlkopfs und direkt damit verbunden die Länge und der Umfang der Stimmlippen entscheiden darüber, in welcher Lage Ihre Stimme beim Sprechen und Singen mühelos klingt.
Es kommt auch auf die Größe an
Um zu verstehen, warum die Größe eines Kehlkopfs (auch) mit über die Stimmlage entscheidet, stellen Sie sich am besten die sechs Saiten einer Gitarre vor.
Die oberste ist am dicksten und produziert den tiefsten Klang. Nach unten hin nimmt bei der Gitarre dann mit jeder Saite die Materialstärke ab und die Spannung zu. Je feiner die Saiten werden, umso schneller schwingen sie und umso höher ist ihr Grundton.
In etwa vergleichbar damit produzieren auch im menschlichen Kehlkopf längere Stimmlippen mit größerer Masse die tieferen Töne. Je größer der Kehlkopf ist, umso länger sind normalerweise auch die Stimmlippen.
Deutlich wird diese enge Verbindung von der Größe der Stimmlippen mit der Stimmlage, wenn Sie an den Stimmbruch von Jungen in der Pubertät denken. Für alle Jugendlichen ist diese Zeit geprägt von immensen persönlichen Veränderungen.
Bei jungen Männern wird dieser hormonelle, körperliche und mentale Umbau aber nicht nur äußerlich sichtbar, sondern zusätzlich auch noch beim Sprechen hörbar. Zeitgleich mit einem allgemeinen körperlichen Wachstumsschub wächst bei ihnen auch der Kehlkopf, und damit die Stimmlippen, besonders schnell. Sie legen dann sowohl an Länge (ca. einen Zentimeter) als auch in gleicher Relation an Umfang zu. Dieses ziemlich sprunghafte und dadurch oft ungleichmäßige Wachstum kann zu dem für den Stimmbruch typischen Kieksen oder Wegkippen der Stimme führen.
Erst wenn die intensive Wachstumsphase abgeschlossen ist, kann sich das gesamte stimmgebende System in den neuen Dimensionen einrichten und die Stimme ihre ausgewogene Spannung wiederfinden. Aus der helleren Kinderstimme ist dann in der Regel eine um etwa eine Oktave tiefere, erwachsene Stimme mit unverwechselbarem Klang geworden.
Auch bei Mädchen wächst natürlich in der Pubertät der Kehlkopf, allerdings meist in viel geringerem Umfang, nur um etwa ein bis drei Millimeter, sodass der Stimmwechsel in die Erwachsenenstimme bei ihnen weniger auffällig ist. Die weibliche Stimme vertieft sich nach dem Stimmwechsel um etwa eine Terz und entwickelt damit ebenfalls ihre unverwechselbare Klangfarbe.
Die Klangfarbe
Für die spezifische Resonanz Ihrer Stimme sind also sowohl Länge und Umfang als auch Art und Weise der Schwingungsbewegung Ihrer Stimmlippen wichtig. Über Ihre Klangfarbe entscheiden außerdem noch zu einem sehr großen Teil die gesamten luftgefüllten Räume in Ihrem Körper. Dazu gehören der Mund- und Rachenraum, die Nase mit allen Neben- und Stirnhöhlen und natürlich die Lunge. Hier setzen sich die Schallwellen aus dem Kehlkopf fort und bringen den Körper wie einen großen Klangkörper in Schwingung. Bis zu einem gewissen Grad und bei entsprechender Durchlässigkeit schwingen natürlich auch alle Organe, Knochen, Muskeln und Bänder mit. Das geschieht aber eher subtil und fein und ist für Sie vielleicht kaum spürbar. All diese resonierenden Räume bilden in Verbindung mit der spezifischen Art und Weise, in der Ihr Atem die Stimmlippen zum Schwingen bringt, ihren ganz individuellen Ton.
Einzigartigkeit
Die Bewegung der Stimmbänder generiert also im Ansatzraum einen spezifischen Klang, der sich in die luftgefüllten Räume des Körpers fortsetzt und hier die individuelle Körperresonanz entwickelt. Das ist vergleichbar mit einem Instrument, bei dem die Form und Schwingungsfähigkeit des Materials den ganz eigenen Klang dieses Instruments bestimmt. Wenn Sie einmal den Sound einer akustischen Gitarre kennengelernt haben, können Sie ihn immer wieder heraushören. Genauso sind Sie in der Lage, eine Person nur über die Stimme zu identifizieren, wenn Sie sie schon einmal sprechen gehört haben. Durch die Stimme und Sprechweise wird jeder Mensch ziemlich eindeutig wiedererkennbar. Vermutlich haben Sie es auch schon mehr als einmal erlebt, dass Sie auf der Straße, beim Bäcker oder auf Reisen unverhofft eine sehr vertraute Stimme hinter sich gehört haben. In Sekundenbruchteilen ist klar, dass Sie die Person von irgendwoher kennen: vielleicht aus dem Radio, einem Podcast oder der letzten Lesung im Literaturcafé?
Die funktionellen Faktoren
Die Stimmfunktion habe ich in schematischer Form weiter vorne schon beschrieben. Für ein besseres Verständnis der wichtigsten funktionellen Parameter beschreibe ich hier noch einmal etwas detaillierter den Atem und seine Beziehung zur Klangerzeugung an den Stimmlippen.
Der Atem
Der Atem hat die große Besonderheit, dass er einerseits ohne unser aktives Zutun einfach unwillkürlich geschieht – und dass wir ihn andererseits auch ganz bewusst und willkürlich steuern können. Wenn Sie glücklicherweise keine deutlich spürbaren Atemprobleme wie chronisches Asthma oder eine akute Bronchitis haben (und nicht gerade in einem Yoga- oder Achtsamkeitskurs waren), werden Sie Ihren Atem bis zu diesem Augenblick vielleicht auch nur eher beiläufig registriert haben. Erst wenn Sie sich bewusst Ihrem Atem zuwenden, beginnen Sie wirklich wahrzunehmen, wie er sich in diesem Moment anfühlt.
Das zu spüren, ist ohne Übung allerdings gar nicht so leicht. Wenn ich jemanden im Stimmtraining nach seinem Atem frage, lautet die Antwort meist: »Alles gut!«
Es ist schwierig, differenziertere Beschreibungen zu bekommen. Manche Menschen können auf Nachfrage noch berichten, dass die Nasenatmung nicht immer leicht ist – wegen einer Allergie oder einer schief stehenden Nasenscheidewand. Aber die wenigsten können auf Anhieb sagen, ob sie tendenziell eher tief oder flach atmen, mehr durch die Nase oder durch den Mund. Sie kennen ihren Atemrhythmus nicht und auch nicht die Länge und Intensität von Ein- und Ausatem oder deren Relation zueinander. Typische Anamnesegespräche verlaufen zu Beginn eines Trainings dann ungefähr so:
»Spüren Sie Ihre Atempausen?« – »Hmmm, ich weiß nicht genau …«
»Wo bewegt sich Ihr Atem im Körper?« – »Oh, vielleicht hier oben …?«
»Haben Sie genug Luft beim Sprechen?« – »Manchmal wird es eng …«
Diese zögerlichen Antworten machen deutlich, wie wenig der Atem für die meisten Menschen im Alltag präsent ist, solange er keine großen Auffälligkeiten zeigt.
Wann sprechen Sie?
Die meisten Menschen machen sich niemals tiefere Gedanken darüber, wie der Atem eigentlich im Zusammenhang mit ihrer Stimme und dem Sprechen steht. Fragen Sie doch mal versuchshalber ein paar Ihrer Freunde, was sie denken: ob sie beim Einatmen oder beim Ausatmen sprechen? – Vermutlich müssen die meisten erst einmal kurz nachdenken. Viele Menschen nutzen ihre Stimme so selbstverständlich, dass sie noch nie realisiert haben, dass sie tatsächlich immer nur beim Ausatmen sprechen. Stimme entsteht also nur »auf« der ausströmenden Atemluft. Ja, es stimmt, man kann auch beim Einatmen sprechen. Das klingt allerdings sehr speziell! Probieren Sie es gerne aus, aber verschlucken Sie sich dabei bitte nicht.
Der autonome Atem
Der Atem funktioniert also normalerweise sehr gut, ohne dass wir uns darüber bewusst sind. Woran das liegt? Ein kurzer Blick in unser Zentrales Nervensystem: Unser unwillkürlicher, automatischer und daher auch oft unbewusster Atem wird aus dem Atemzentrum im Gehirn gesteuert, das Teil des autonomen (auch vegetativ genannten) Nervensystems ist.
Das Atemzentrum liegt im verlängerten Rückenmark, der Medulla oblongata, und ist keine einheitliche anatomische Struktur, sondern vereint unterschiedliche Nervenzellen zu einer funktionellen Einheit. Verschiedene Gruppen von Nervenzellen senden abwechselnd Impulse für Einatmung oder Ausatmung und steuern so den Atemrhythmus und die Atemtiefe, entsprechend den aktuellen körperlichen Anforderungen. Dabei reagieren sie vor allem auf zentrale chemische Rezeptoren, die den Anstieg des Blutgehalts von Kohlendioxid oder einen Abfall des pH-Werts oder des Sauerstoffgehalts messen. Eine Aktivierung des Atemzentrums kann aber genauso über Rezeptoren in der Körpermuskulatur und durch Schmerzrezeptoren erfolgen und natürlich auch hormonell, wie zum Beispiel durch Adrenalin.
Diese verschiedenen Rezeptoren leiten die Reize ans Atemzentrum weiter, sodass jede körperliche Bewegung oder Berührung, aber auch jeder emotionale Moment wie Freude oder Gefahr, eine unwillkürliche Veränderung des Atems auslösen. Manchmal stoppt der Atem sogar für einen kurzen Augenblick komplett, zum Beispiel als Reaktion auf eine plötzliche und völlig überraschende oder schockierende Situation. Gerade dann ist es besonders wichtig, nach dem instinktiven Luftanhalten ganz bewusst wieder in den eigenen Atemrhythmus und natürlichen Atemfluss zurückzukehren.
Atem-Snack
Ihr Atem antwortet normalerweise ganz selbstverständlich mit einer vertieften Bewegung auf kurze körperliche Impulse – vorausgesetzt, Sie erlauben sich regelmäßig diese belebenden Momente. Wenn Sie sich nach stundenlangem Sitzen am Schreibtisch erst einmal ausgiebig dehnen und strecken, kann Ihr Atem sich dabei mit einem herzhaften Gähnen erfrischen. Oder wenn Sie im Urlaub zum ersten Mal bewusst die frische und würzige Luft am Meer oder in den Bergen riechen, äußert sich die pure Lust am Atmen unwillkürlich mit einem wohligen Seufzer. Nach solch einem natürlichen Impuls findet Ihr Atem leichter zurück in seinen eigenen Rhythmus.
Es reicht allerdings nicht, wenn Sie Ihrem Atem diese Möglichkeit der Regeneration nur einmal am Tag anbieten. Bauen Sie diese kurzen Atempausen mehrmals täglich in Ihren Alltag ein und versetzen sich gedanklich regelmäßig, vielleicht sogar am geöffneten Fenster, an Ihren Lieblingsort. Dann dehnen, gähnen und seufzen Sie nach Herzenslust, bis Sie spüren, dass Sie tiefer ein-, länger aus- oder insgesamt vollständiger im gesamten Körper atmen.
Übrigens: Es kann sein, dass Sie in den ersten Wochen Ihrer neuen Gewohnheit erst einmal ganz viel gähnen müssen. Vermutlich hat Ihr Körper dann einen gewissen Nachholbedarf. Aber keine Sorge, es reguliert sich normalerweise von selbst und nach kurzer Zeit fühlen Sie sich nach jedem kleinen Atem-Snack schnell erfrischt und wohl in Ihrem eigenen Atemrhythmus.
Ein ganzer Atemzug
In Ruhe verläuft Ihr Atem optimalerweise in drei Phasen: dem Einatem, dem Ausatem und der kleinen Pause, in der der nächste Einatemimpuls aus dem Atemzentrum entstehen kann.
Ein kompletter Atemzug in Ihrem eigenen Rhythmus läuft ungefähr so ab:
Einatem: Aus den Informationen der verschiedenen zentralen, chemischen, physikalischen, mechanischen und hormonellen Rezeptoren in Ihrem Körper leitet das Atemzentrum den Impuls für den Beginn eines neuen Einatems ab.
Das Zwerchfell kontrahiert und zieht sich abflachend nach unten in den Bauchraum, während die äußere Zwischenrippenmuskulatur aktiv den Abstand zwischen den Rippenbögen vergrößert und so den Brustkorb anhebt.
Die Lunge, die über das sie umgebende Lungenfell beweglich an Zwerch- und Rippenfellen anliegt, folgt passiv dieser aktiven Ausdehnung von Brustwandmuskeln und Zwerchfell. Das Lungenvolumen vergrößert sich und der dadurch in der Lunge entstehende Unterdruck lässt unmittelbar frische Außenluft einströmen. Diese sauerstoffreiche Luft strömt durch die Nase oder den Mund in den Körper ein, fließt durch den Rachen, den Kehlkopf und die Luftröhre, weiter durch beide Hauptbronchien in den linken und rechten Lungenflügel und verteilt sich bis in die kleinsten Lungenbläschen. Hier findet die innere Atmung statt, also der Gasaustausch, bei dem der Sauerstoff in den Blutkreislauf gelangt und das Kohlendioxid aus dem Blut in die Lunge abgegeben wird. Das physiologische Ziel der Einatmung ist hiermit erreicht.
Ausatem: Wenn das Atemzentrum aufgrund der erreichten Kohlendioxid-Sättigung im Blut das Signal zum Ausatmen gibt, entspannt das Zwerchfell und steigt kuppelförmig in Richtung Lunge und Herz nach oben, während die Rippenbögen und damit der gesamte Brustkorb sich wieder absenken. In Verbindung mit den eigenen Rückstellkräften der Lunge verkleinert sich also das Lungenvolumen und der so entstehende Überdruck bringt die sauerstoffärmere, dafür mit mehr Kohlendioxid angereicherte Luft nach draußen.
In der Ruheatmung, also wenn der Atem keiner besonderen Belastung unterliegt, entsteht hier, ganz am Ende des Ausatems, eine kleine Pause. In dieser Pause, die sich auch wie ein Moment der Leere oder in der Schwebe anfühlen kann, entsteht der neue Einatem-Impuls, und ein neuer Atemzug beginnt.
Die Lunge entleert sich übrigens selbst beim längsten Ausatem niemals komplett. Aber gerade deshalb, weil also immer ein Restvolumen an Atemluft in der Lunge bleibt, ist es besonders wichtig, den im Alltag oft eher flachen Atem regelmäßig mit bewusst langen und tiefen Atemzügen zu intensivieren, damit der Luftaustausch in den Lungenbläschen immer möglichst umfassend geschieht. Dieser umfassende, tiefe und vollständige Atem bewegt im Optimalfall Ihren gesamten Oberkörper mit Brustkorb, Bauch und Flanken in alle Richtungen.
Wie oft und wie viel atmen Sie?
In Ruhe atmen erwachsene Menschen mit einer durchschnittlichen Frequenz von etwa 12- bis 20-mal pro Minute ein Volumen von jeweils ungefähr einem halben Liter Luft ein und aus.
Diese Werte sind nur ein Anhaltspunkt, denn sie verändern sich natürlich ständig, abhängig von der aktuellen Situation, dem individuellen Trainingszustand und der momentanen Aktivität einer Person.
In einer ruhigen Meditation können Geübte Ihren Atem zum Beispiel problemlos auf nur ein oder zwei Atemzüge pro Minute verlangsamen. Eine untrainierte Person schnappt bei intensiver körperlicher Aktivität in 60 Sekunden hingegen locker bis zu über 40-mal nach Luft. Da das für das gesamte menschliche System extrem energieaufwendig ist, arbeiten professionelle Sportler unter anderem ständig daran, ihre Herz- und Lungenkapazitäten auszubauen. Ein starkes Herz sorgt für eine gut durchblutete Muskulatur auch bei hoher körperlicher Leistung. Und zusammen mit dem größeren Lungenvolumen erreichen die Profis dadurch auch bei größter Anstrengung eine bessere Sauerstoffversorgung der Zellen, ohne dass ihre Atemfrequenz allzu sehr ansteigt. Was wir als Nichtprofis daraus lernen können, ist, dass eine regelmäßige körperliche Aktivität unseren Atem und damit auch die Stimmkraft stärken kann.
Wenn es um die Stimme geht, interessiert uns die ausströmende Luft besonders, da »auf« ihr der Stimmklang gebildet wird. Ein gut geführter, langer Ausatem schenkt den Stimmlippen mehr Energie und genug Zeit, um eine ausgewogene Schwingung für den passenden Stimmklang zu entwickeln. Ein langer Atembogen macht es leichter, einen Gedanken beim Sprechen in Ruhe zu entwickeln und ganz zu Ende zu führen. Das sichere Gefühl, ausreichend Luft zu haben für den gesamten Satz, ermöglicht Ihnen erst wirklich einen freien und damit authentischen Ausdruck. Denn die Dynamik des Atems passt sich automatisch viel besser an Ihre innere Dynamik an, und der Rhythmus des Atems unterstützt so Ihre individuelle Prosodie (den Sprechrhythmus, Ihr Tempo, die Betonungen, Pausen sowie alle anderen Akzentuierungen in Ihrem Sprechen oder Singen).
Die Fähigkeit, den Atem bewusst und willkürlich zu steuern, können Sie einsetzen, um Ihr Atemvolumen zu vergrößern und Ihren Atembogen zu verlängern. Mit gezielten Atemübungen unterstützen Sie eine Verlangsamung und Vertiefung der Bewegung des Zwerchfells. Dadurch werden Ihre Stimme und Ihr Sprechen oder Singen mit mehr Energie versorgt, die auch noch effektiver ausgenutzt werden kann.
Eine vertiefte Atembewegung stärkt zudem auch ein gesundes und vitales Körpergefühl: Jede intensive Bewegung des Zwerchfells »massiert« die gesamten darunter liegenden Bauchorgane. Oberhalb des Zwerchfells wird durch die Atembewegung auch das Herz leicht mitbewegt, das sich als einziges Organ – neben der Lunge – im oberen Brustkorb befindet. Wenn sich mit dem Einatemimpuls die Muskel-Sehnen-Einheit des Zwerchfells in die Tiefe des Bauchraums absenkt, dehnt sich infolge des sanften Drucks auf die Bauchorgane die Körpermitte etwas aus. Das in vielen Köpfen immer noch unbewusst geltende Credo »Bauch rein, Brust raus!« führt unglücklicherweise oft zum »paradoxen Atem«. Dabei wird der Bauchbereich beim Einatmen schmaler statt weiter und äußerlich geschieht scheinbar genau das Gegenteil der natürlichen Zwerchfellbewegung.