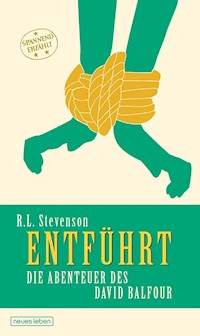
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neues Leben
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Spannend erzählt
- Sprache: Deutsch
Der siebzehnjährige David Balfour kommt nach dem Tod seiner Eltern in das Haus seines Onkels Ebenezer Balfour of Shaws. Zu spät bemerkt er, dass sein Onkel ihn, den rechtmäßigen Erben, aus dem Weg schaffen will. Sein Schicksal, als Sklave nach Amerika verkauft zu werden, scheint besiegelt, als ihm die Flucht gelingt. Doch im schottischen Hochland, wo er in die Verwicklungen verfeindeter Clans gerät, warten neue Prüfungen auf ihn. Vor dem Hintergrund des schottischen Aufstandes von 1745 gegen die englische Krone schildert Stevenson (1850 - 1894) in den beiden Romanen "Entführt" und "Catriona" die spannenden "Abenteuer des David Balfour".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
ISBN eBook 978-3-355-50006-7
ISBN Print 978-3-355-01718-3
Titel der englischen Originalausgabe: Kidnapped
Ins Deutsche übertragen von Ruth Gerull-Kardas
© 2006 Neues Leben Verlags GmbH & Co. KG
Neue Grünstr. 18, 10179 Berlin
Umschlagentwurf: Verlag
Die Bücher des Verlags Neues Leben
erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.
www.eulenspiegel-verlagsgruppe.de
Robert Louis Stevenson
Entführt
Die Abenteuer des David Balfour
I. Ich begebe mich auf die Reise zum Hause der Shaws
Der Bericht meiner Abenteuer soll mit einem bestimmten Morgen zu Anfang des Monats Juni im Jahre des Heils 1751 beginnen.
Zum letztenmal verschloß ich die Tür meines Vaterhauses und zog den Schlüssel heraus.
Während ich die Dorfstraße entlangging, fielen die ersten Sonnenstrahlen auf die Berggipfel, und als ich dann zum Pfarrhaus kam, begannen die Schwarzdrosseln in den Fliederbüschen der Gärten zu flöten, und die Frühnebel, die im Tal hingen, stiegen und zerteilten sich allmählich.
Mr. Campbell, der Pfarrer von Essendean, erwartete mich am Gartentor. Der freundliche Mann fragte mich, ob ich schon gefrühstückt habe, und als er erfuhr, daß es mir an nichts fehle, ergriff er mit einer gütigen Bewegung meine Hand, zog sie durch seinen Arm und sagte: »Dann, Davie, mein Junge, werde ich dich bis zur Furt begleiten, um dich auf den richtigen Weg zu bringen.«
Stumm schritten wir nebeneinanderher; nach einer Weile fragte er: »Gehst du ungern von Essendean fort?«
»Ach, Sir«, erwiderte ich, »wenn ich wüßte, wohin es gehen und was aus mir werden soll, könnte ich eine ehrlichere Antwort darauf geben. Essendean ist kein unrechter Ort, und ich war hier sehr glücklich, aber ich kenne ja auch nichts anderes. Da mein Vater und meine Mutter tot sind, werde ich ihnen in Essendean nicht näher sein als beispielsweise im Königreich Ungarn. Ja, ehrlich gesagt, wenn ich glauben könnte, daß es mir dort, wo ich hin will, besser gehen wird, dann würde ich mich mit Freuden auf den Weg machen.«
»Nun, David«, sagte Mr. Campbell, »dann ist es wohl an mir, vorauszusagen, was dir die Zukunft bringen kann, wenigstens soweit ich das vermag. Als deine Mutter gestorben war und dein Vater, der wackere fromme Christ, zu kränkeln anfing und sein Ende nahen fühlte, hat er mir einen Brief anvertraut, von dem er meinte, er stelle sozusagen deine Erbschaft dar: ›Wenn ich nicht mehr dasein werde‹, hatte er gesagt, ›wenn das Haus bestellt und über den Besitz verfügt worden ist‹, was du ja inzwischen erledigt hast, David, ›dann gebt meinem Sohn dieses Schreiben und bringt ihn auf den Weg zum Hause der Shaws, das nicht weit von Cramond gelegen ist. Das ist meine Heimat, und es ist nur recht und billig, daß mein Sohn dorthin zurückkehrt. Er ist ein vernünftiger Junge‹, sagte dein Vater noch, ›er wird es schon richtig machen, und ich zweifle auch nicht, daß es ihm dort gut gehen und daß man ihn gern haben wird‹.«
»Das Haus der Shaws?« rief ich erstaunt. »Was hat mein Vater mit dem Haus der Shaws zu schaffen gehabt?«
»Je nun«, meinte Mr. Campbell, »wer kann das mit Bestimmtheit sagen, David, aber der Name der Familie dort ist der gleiche, den auch du trägst – Balfour of Shaws, ein uraltes, ehrenhaftes und ruhmreiches Geschlecht, vielleicht in letzter Zeit ein wenig heruntergekommen. Auch verfügte dein Vater über ein seinem vornehmen Herkommen entsprechendes reiches Wissen. Kein Lehrer hat je so guten Unterricht erteilt wie er. Auch seine ganze Art und seine Ausdrucksweise waren nicht die eines gewöhnlichen Schulmeisters. Nun, du wirst dich erinnern, mit welchem Vergnügen ich ihn im Pfarrhaus mit den Honoratioren dieser Gegend zusammenbrachte, und meine Angehörigen aus der Familie Campbell of Kilrennet, Campbell of Dunswire, Campbell of Minch und wie sie alle heißen – lauter gelehrte Herren –, hatten Freude an seiner Gesellschaft. Doch damit du alle Einzelheiten dieser Angelegenheit erfährst, nimm jetzt das letzte Schreiben deines heimgegangenen Vaters; er hat es eigenhändig adressiert.«
Er gab mir den Brief, der die Aufschrift trug: Auszuhändigen an Ebenezer Balfour, Herr auf Shaws, im Hause der Shaws, abzuliefern durch meinen Sohn David Balfour.
Mein Herz klopfte laut und stürmisch, als sich vor mir siebzehnjährigem Burschen diese Aussichten eröffneten, vor mir, dem Sohn des armen Dorfschulmeisters im Waldgebiet von Ettrick.
»Mr. Campbell«, stammelte ich, »würdet Ihr an meiner Stelle denn dort hingehen?«
»Aber gewiß doch«, sagte der Geistliche, »das würde ich sicherlich tun, und zwar unverzüglich; ein flinker Bursche wie du sollte höchstens zwei Tage bis Cramond brauchen; es liegt nicht weit von Edinburgh. Sollte das Schlimmste zum Schlimmen kommen und sollten deine vornehmen Verwandten – denn ich kann nur annehmen, daß es sich um Verwandtschaft handelt – dich wieder an die frische Luft setzen, dann brauchst du nur den Zweitagemarsch hierher zurückzumachen und an die Tür des Pfarrhauses zu pochen. Ich möchte allerdings hoffen, daß du gut aufgenommen wirst; denn wie dein lieber Vater es vorhergesagt hat und so, wie ich dich kenne, hast du das Zeug, eines Tages ein bedeutender Mann zu werden. Und jetzt, Davie, Junge«, fuhr der Pfarrer fort, »halte ich es für meine Pflicht, und mein Gewissen treibt mich dazu, dich, ehe wir uns trennen, vor den Gefahren dieser Welt zu warnen.«
Während er sprach, sah er sich nach einer bequemen Sitzgelegenheit um. Sein Blick fiel auf einen flachen glatten Felsblock unter einer Birke neben dem Fahrweg. Er setzte sich und bekam ein ernstes, nachdenkliches Gesicht.
Zwischen zwei Baumwipfeln strahlte die Sonne auf uns herab; Mr. Campbell legte das Taschentuch schützend über seinen Dreispitz. Mit erhobenem Zeigefinger warnte er mich nun zuerst vor allerlei Irrlehren und Ketzereien, die mich aber in keiner Weise verlockt hätten. Dann beschwor er mich, ja mein tägliches Gebet und das Lesen in der Bibel nicht zu versäumen. Danach entwarf er ein Bild des großen und vornehmen Hauses, das mich aufnehmen würde, und wies mich an, wie ich mich seinen Bewohnern gegenüber verhalten sollte.
»In nebensächlichen Dingen sei nachgiebig, Davie«, sagte er. »Vergiß nie, daß du, obwohl adlig geboren, einfach und ländlich erzogen wurdest. Mach uns keine Schande, Davie, mach uns ja keine Schande. In dem großen und feinen Hause mit seinen vielen Bediensteten, höheren und niederen, mußt du so willig, so umsichtig, so flink und so schweigsam wie möglich sein. Und was den Gutsherren selber anbelangt, bedenke, er ist der Laird1. Mehr brauche ich dir nicht zu sagen Ehre, wem Ehre gebührt. Einem Gutsherrn zu gehorchen ist eine Freude oder sollte es wenigstens für junge Leute sein.«
»Nun, Sir«, sagte ich, »das ist gewiß richtig, und ich verspreche Euch, es auch so zu halten.«
»Brav so, Junge«, rief Mr. Campbell erfreut, »und jetzt zu dem Wesentlichen oder, besser, zum Unwesentlichen. Hier habe ich ein Päckchen, das vier Dinge enthält.«
Während er sprach, zerrte er es mit einiger Mühe aus der Tasche seines Überrocks und fuhrt fort: »Erstens enthält es das, was dir von Rechts wegen zukommt: einen Sparpfennig aus dem Erlös für die Bücher und den Hausrat deines Vaters, Dinge, die ich zuerst erstanden habe und die ich mit einigem Gewinn an den neuen Schulmeister weitergeben würde. Das übrige sind kleine Gaben, die meine Frau und ich dir zugedacht haben; wir würden uns freuen, wenn du sie annehmen wolltest. Das eine ist rund, und es wird dir wohl auf den ersten Blick am besten gefallen. Ach, Davie, Junge, es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein; es wird dir einen Schritt weiterhelfen und dann vergehen wie ein schöner Morgen. Das – zweite es ist flach und viereckig, und darauf steht etwas Geschriebenes – soll dir das ganze Leben hindurch helfend beistehen wie ein Stecken auf der Wanderschaft, und es möge dir in Krankheitstagen ein weiches Ruhekissen sein. Und dann das dritte – es ist würfelförmig, und es soll dich, wie ich wünsche und hoffe, in ein besseres Jenseits führen.«
Nach diesen Worten stand Mr. Campbell auf, nahm den Hut ab und sprach laut ein inniges Gebet für einen jungen Menschen, der im Begriff steht, in die Welt hinauszuziehen. Plötzlich zog er mich in seine Arme, preßte mich fest an sich, hielt mich dann auf Armeslänge von sich ab und musterte mich kummervoll, während es in seinen Zügen heftig arbeitete. Darauf wandte er sich hastig um, rief mir ein Lebewohl zu und entfernte sich rasch auf dem Wege, den wir eben gemeinsam gekommen waren; er ging nicht, er rannte fast. Ein anderer hätte das vielleicht als lächerlich empfunden, aber mir war nicht nach Lachen zumute. Ich blickte ihm nach, solange er zu sehen war. Er trabte unbeirrt weiter und sah sich nicht ein einziges Mal nach mir um. Da wurde mir klar, wie traurig er über mein Fortgehen sein mußte, und ich bekam arge Gewissensbisse, weil ich so erleichtert war, aus diesem langweiligen ländlichen Nest herauszukommen, mit der Aussicht, ein Heim in einem großen lebhaften Hause zu finden, unter reichen, vornehmen und geachteten Leuten, die meinen Namen trugen und meines Blutes waren.
Davie, Davie, dachte ich, hat man je so schwarzen Undank erlebt? Wie kannst du nur deine alten Freunde und ihre Wohltaten so im Handumdrehen vergessen, nur weil ein gewisser Name gefallen ist? Pfui, schäme dich doch.
Ich nahm auf dem Stein Platz, auf dem eben noch der Geistliche gesessen hatte, und öffnete das Päckchen, um mir seine Gaben anzusehen. Das, was er als würfelförmig bezeichnet hatte, war, wie ich mir schon gedacht, eine kleine Bibel, die man im Mantelsack stets bei sich tragen konnte. Das, was er rund genannt hatte, war eine Münze, ein blanker Shilling, und das, was mir in gesunden und kranken Tagen eine stete Hilfe sein sollte, war ein kleines gelbliches Stück Papier, auf dem in roter Tinte geschrieben stand:
»Wie man aus Maiglöckchen ein Destillat brauen kann.
Nimm Maiglöckchenblüten, presse sie in einem Säckchen aus und trinke nach Bedarf ein oder zwei Löffel voll davon. Menschen, denen der Schlagfluß die Sprache verschlagen hat, werden sie dadurch wiederfinden. Es hilft auch gegen Gicht; es beruhigt das Herz und kräftigt das Denkvermögen. Die Blüten, in eine Flasche getan, die man einen Monat lang in einen Ameisenhaufen stellt und die dann fest verkorkt wird, ergeben eine Flüssigkeit, die sich, in einer Phiole aufbewahrt, lange Zeit hält und die für Gesunde und Kranke, für Männer und Frauen heilsam ist.«
In seiner Handschrift hatte der Geistliche hinzugefügt: »Auch bei Verrenkungen zum Einreiben verwendbar und bei Koliken jede Stunde einen Löffel voll einzunehmen.«
Natürlich lachte ich darüber, aber es war kein herzhaftes Lachen, und ich mußte die Tränen zurückhalten. Ich war froh, als ich mein Bündel an dem Stock befestigt und es geschultert hatte; dann ging’s durch die Furt und auf der gegenüberliegenden Seite einen Hügel hinan. Als ich zu dem breiten grasbewachsenen Fahrweg zwischen dem Heidekraut kam, warf ich noch einen letzten Blick auf das Kirchspiel von Essendean, auf die Bäume, die mir das Pfarrhaus verbargen, und auf die hohen Ebereschen des Friedhofes, auf dem mein Vater und meine Mutter begraben waren.
1 Laird – schottische Bezeichnung für einen Großgrundbesitzer
II. Die grosse Reise geht ihrem Ende entgegen
Als ich am Vormittag des zweiten Tages den Gipfel eines Berges erreichte, sah ich vor mir die sanft abfallende Ebene, die sich bis zum Meeresstrand hinabsenkte. Auf halbem Wege, bergab, lag die Stadt Edinburgh, die wie ein Kohlenmeiler rauchte. Auf dem Schloßturm wehte eine Fahne, und in der Bucht Firth of Forth lagen Schiffe vor Anker oder fuhren ein und aus. Das alles konnte ich, obwohl die Entfernung groß war, deutlich erkennen; und mein Herz, das Herz einer Landratte, schlug höher.
Bald darauf kam ich an einem Hause vorbei, in dem ein Hirte wohnte, und von ihm ließ ich mir den Weg nach Cramond so ungefähr beschreiben. Ich fragte mich durch und gelangte in westlicher Richtung über die Ortschaft Colinton bis zu der nach Glasgow führenden Landstraße. Dort erblickte ich zu meiner großen Freude ein Hochländerregiment, das zu den Klängen der Querpfeifen im Takt marschierte. Ein alter General mit stark gerötetem Gesicht ritt auf einem grauen Pferd voran, hinterdrein kam eine Abteilung Grenadiere; ihre hohen Mützen sahen aus wie Mitren. Beim Anblick der Rotröcke und beim Klang der munteren Weisen wurde ich ganz stolz und hochgemut.
Noch ein Stückchen weiter, und schon hieß es, ich sei hier bereits im Kirchspiel von Cramond. Wenn ich mich jetzt nach dem Weg erkundigte, begann ich nach dem Hause der Shaws zu fragen. Die Nennung dieses Namens schien die Befragten zu befremden. Zuerst dachte ich, meine schlichte ländliche Kleidung, die zudem über und über mit Straßenstaub bedeckt war, passe schlecht zu dem großartigen Herrenhaus, dem ich zustrebte. Doch nachdem mich zwei oder auch drei Leute auf die gleiche erstaunliche Weise gemustert und ebenso zögernd geantwortet hatten, kam mir in den Sinn, es müsse mit den Shaws irgend etwas nicht stimmen.
Um mir Gewißheit zu verschaffen, beschloß ich, meine Frage anders zu stellen. Als ich daher einen anständig aussehenden Burschen mit seinem Gespann, auf der Deichsel reitend, herankommen sah, fragte ich ihn, ob er wohl von einem Haus gehört habe, das das Haus der Shaws genannt werde.
»O ja, weshalb willst du das wissen?« forschte er.
»Ist es ein großes Haus?« fragte ich.
»Ja, das ist es, ohne Zweifel ist es ein großes Haus, aber es ist verwahrlost«, lautete die Antwort.
»Nun gut, und die Leute, die darin wohnen?«
»Leute?« wiederholte er. »Du bist wohl närrisch, Leute gibt es in dem Hause nicht – wenigstens nicht das, was man sonst darunter versteht.«
»Wie meint Ihr das?« fragte ich erstaunt, »lebt dort nicht Mr. Ebenezer?«
»Ja gewiß«, sagte der Mann. »Der Laird wohnt dort, wenn du den meinst. Was willst du denn von ihm, Kleiner?«
»Man hat mir gesagt«, erwiderte ich und versuchte recht bescheiden auszusehen, »ich könnte bei ihm eine Stellung finden.«
»Was willst du?« rief der Fuhrmann mit so scharfer Stimme, daß sein Gaul erschrak und einen großen Satz machte. Dann fügte er jedoch begütigend hinzu: »Nun, Bürschlein, mich geht’s nichts an; du siehst aber rechtschaffen aus, und wenn du einen Rat von mir haben willst, dann laß die Finger von den Shaws.«
Der nächste, der mir über den Weg lief, war ein adrett gekleideter kleiner Mann mit einer weißen Perücke. Er mochte wohl der Barbier des Ortes sein, denn vor seinem Laden baumelten runde Messingschalen. Da ich wußte, daß Barbiere meist schwatzhafte Leute sind, fragte ich ihn unverblümt, was für ein Mensch Mr. Balfour of Shaws eigentlich sei.
»Pfui Deibel«, schrie er, »der ist überhaupt kein Mensch, muß ich Euch sagen«, und dann fragte er mich ziemlich verschmitzt, was ich denn mit dem Haus der Shaws im Sinn hätte. Aber ich war ihm mehr als gewachsen, und er wandte sich seinem Kunden zu, ohne viel schlauer zu sein als vorher.
Es läßt sich kaum beschreiben, wie schwer mich dieser Schlag traf und wie er meine Hoffnungen zerstörte. Je unklarer die Anschuldigungen waren, desto stärker beunruhigten sie mich, weil sie der Einbildung zuviel Spielraum gaben. Was für ein Herrenhaus war das, daß jeder im Kirchspiel, der danach gefragt wurde, erschrak und mich so seltsam anstarrte? Was für ein Mensch war dieser Gutsherr, daß jeder Vorübergehende seinen schlechten Ruf zu kennen schien?
Hätte der Weg nach Essendean nur eine Stunde gedauert, so hätte ich auf der Stelle meine Abenteuerlust begraben und wäre zu Mr. Campbell zurückgekehrt. Da ich aber von so weit hergekommen war, schämte ich mich, die Sache einfach aufzugeben, ohne ihr vorher auf den Grund gegangen zu sein. Meine Selbstachtung gebot mir standzuhalten, und so wenig mir das, was ich gehört hatte, gefallen wollte und so zögernd ich auch weiterging, ich fragte doch immer wieder nach dem Weg und schritt unbeirrt vorwärts.
Die Sonne begann schon unterzugehen, da begegnete ich einer dicken, grämlich aussehenden schwarzhaarigen Frau, die sich mühselig den Berg herunterschleppte. Als ich ihr die üblichen Fragen stellte, fuhr sie auf dem Absatz herum, zog mich mit sich zu dem Gipfel hinauf, von dem sie eben gekommen war, und wies von dort auf ein massiges Bauwerk, das an einer baumlosen Stelle in der Talsenke aus den Wiesen aufragte. Die weitere Umgebung, mit niedrigen bewaldeten Hügeln und von Wasserläufen durchzogen, war recht anmutig. Soweit ich das beurteilen konnte, versprachen die Äcker ringsum eine gute Ernte. Aber das Haus sah eher wie eine Ruine aus. Es schien auch kein Weg zu dem Gebäude zu führen, und aus den Schornsteinen stieg kein Rauch auf. Nichts war zu entdecken, das wie ein Garten ausgesehen hätte.
Das Herz fiel mir in die Hosen.
»Das ist das Haus der Shaws?« rief ich.
Das Gesicht der Frau bekam einen boshaften Ausdruck.
»Ja, das ist das Haus der Shaws«, erwiderte sie. »Mit Blut wurde es aufgebaut. Blut hat den Bau unterbrochen, und Blut soll es in Trümmer legen. Ich spucke darauf. Ich verfluche es. Wenn du den Laird siehst, wiederhole ihm, was ich dir sage: Zum zwölfhundertundneunzehnten Male hat Jennet Clouston ihn verflucht, ihn und sein Haus, seine Scheuern, seine Ställe, sein Vieh, sein Weib, seine Kinder. Furchtbar, furchtbar soll ihr Ende sein!«
Und das Weib, dessen Stimme zu einem unheimlichen Haßgesang angeschwollen war, wandte sich plötzlich von mir ab und war ebenso plötzlich verschwunden. Ich blieb mit gesträubten Haaren zurück.
Damals glaubten die Menschen noch an Hexen und fürchteten solche Verwünschungen. Die lästerlichen Worte des alten Weibes hatten mich in diesem Augenblick wie ein böses Vorzeichen getroffen. Ich blieb unschlüssig stehen und merkte, wie mir die Knie weich wurden.
Schließlich setzte ich mich und blickte ins Tal hinab auf das Haus der Shaws. Je länger ich Umschau hielt, desto freundlicher erschien mir die Umgebung. Überall auf den Feldern leuchteten blühende Weißdornbüsche. Wie kleine helle Punkte bewegten sich ungezählte Schafe über die Wiesen. Ein Schwarm Saatkrähen flatterte darüber hin. Das alles waren Anzeichen für fruchtbares Land unter einem günstigen Himmelsstrich. Nur die Ruine inmitten dieser lieblichen Landschaft wollte mir nicht gefallen.
Während ich dort am Waldrand saß, kamen von den Feldern her Bauern vorüber, doch ich hatte nicht einmal mehr den Mut, ihnen einen guten Abend zu wünschen.
Endlich ging die Sonne unter, und nun sah ich gegen den gelbgetönten Himmel eine Rauchsäule aus einem der Schornsteine des Herrenhauses aufsteigen, so dünn und so schwach wie von einer schwelenden Kerze. Und doch bedeutete sie ein Feuer, Wärme, eine Mahlzeit und einen lebenden Menschen, der das Feuer angezündet haben mußte. Das war ein Herzenstrost.
Ich stand auf und ging auf einem schmalen, kaum ausgetretenen Pfad in der Richtung auf das Haus weiter. Der Weg war nur schwer zu erkennen, aber einen anderen gab es anscheinend nicht.
Schließlich gelangte ich zu zwei hohen Steinquadern – daneben stand ein Pförtnerhaus, eine Hütte ohne Dach, über der Tür ein Wappenschild. Offenbar war dies das Hauptportal, aber es war halbfertig. An Stelle der üblichen schmiedeeisernen Tore erblickte ich hier nur ein mit Strohseilen unordentlich befestigtes Holzgatter. Es gab auch kein Parkgitter und keine Auffahrt, nichts als den Pfad, auf dem ich gekommen war. Er führte rechts an den Säulen vorbei. Ich ging weiter auf das Haus zu.
Je näher ich herankam, desto trostloser erschien es mir. Es sah aus wie der Flügel eines Hauses, das nie zu Ende gebaut worden ist, mit Stufen, Treppen und unvollendetem Gemäuer. Viele Fenster hatten keine Scheiben, und die Fledermäuse flogen ein und aus wie die Tauben aus ihrem Schlag.
Es dunkelte schon stark, als ich dicht vor dem Hause stand. Durch drei untere, ziemlich hoch gelegene, sehr schmale und vergitterte Fenster konnte man drinnen ein unruhig flackerndes Feuer sehen.
Sollte das der Palast sein, den zu erreichen ich von so weit her gekommen war? Sollte ich in diesem trostlosen Gemäuer neue Freunde und ein künftiges Glück finden? Ach, in meinem Vaterhaus waren von der Wasserseite Feuer und Kerzenschein aus einer Meile Entfernung zu sehen gewesen, und die Tür wurde jedesmal gastlich geöffnet, wenn auch nur ein Bettler anpochte.
Behutsam tastete ich mich weiter und lauschte dabei angestrengt in das Dunkel. Ich vernahm, wie von Zeit zu Zeit jemand trocken hüstelte und mit Geschirr klapperte. Ich hörte aber niemand sprechen; es bellte nicht einmal ein Hund.
Die Tür war, soweit ich das im Finstern erkennen konnte, aus rohem Holz und über und über mit Nägeln beschlagen. Zögernd hob ich die Hand und klopfte ein einziges Mal an. Dann wartete ich. Im Hause blieb alles totenstill. Wohl eine Minute verging, in der sich nichts rührte, nur die Fledermäuse über meinem Kopf raschelten. Wieder klopfte ich, und wieder lauschte ich. Nach und nach hatten sich meine Ohren so an die Stille gewöhnt, daß ich von drinnen das Ticken einer Uhr hören konnte. Sekunde um Sekunde verrann; aber wer es auch gewesen sein mochte, der vorhin in dem Hause rumort hatte, jetzt verhielt er sich mäuschenstill, ja, er mußte den Atem angehalten haben.
Ich war mir nicht im klaren, ob ich weglaufen sollte; doch der Zorn gewann die Oberhand, und ich trommelte mit Fäusten und Füßen gegen die Tür und schrie laut nach Mr. Balfour.
Noch war ich im schönsten Ansturm, als ich hörte, wie über mir jemand hüstelte. Zurückspringend sah ich in einem Fenster des ersten Stockwerkes den Kopf eines Mannes mit einer riesigen Nachthaube auftauchen und daneben die Mündung einer auf mich gerichteten Donnerbüchse.
»Achtung, sie ist geladen«, rief eine Stimme von oben.
»Ich bringe einen Brief«, sagte ich, »an Mr. Ebenezer Balfour of Shaws. Ist er hier?«
»Von wem ist der Brief?« fragte der Mann mit der Donnerbüchse.
»Darum geht es nicht«, erwiderte ich, denn ich wurde immer ärgerlicher.
»Schön«, sagte der Mann, »du kannst ihn auf die Türschwelle legen und machen, daß du fortkommst.«
»Fällt mir gar nicht ein«, gab ich zurück, »ich werde den Brief nur Mr. Balfour selber in die Hand geben, wie es der Schreiber gewünscht hat; es ist ein Empfehlungsbrief.«
»Ein was?« wurde grob zurückgefragt.
Ich wiederholte: »Ein Empfehlungsbrief!«
»Und du, wer bist du?« wurde ich nach längerer Pause gefragt.
»Ich schäme mich meines Namens nicht«, erwiderte ich, »ich heiße David Balfour.«
Bei diesen Worten war, wie ich merkte, der Mann am Fenster heftig zusammengefahren, denn der Lauf der Donnerbüchse klirrte gegen das Sims. Nach einer wiederum sehr langen Pause kam mit merkwürdig veränderter Stimme die nächste Frage: »Lebt dein Vater nicht mehr?«
Ich war so verblüfft über diese plötzliche Wandlung, daß ich nicht gleich antworten konnte, sondern nur erstaunt in die Höhe starrte.
»Na, was denn? Vermutlich ist er tot, und deswegen stehst du da und polterst gegen meine Tür!«
Wieder entstand eine Pause. Und dann: »Schön, mein Junge, ich lasse dich herein.«
Und der Kopf im Fensterrahmen verschwand.
III. Ich lerne meinen Oheim kennen
Gleich darauf rasselten hinter der Tür Ketten und Riegel; vorsichtig wurde sie geöffnet und – kaum, daß ich drinnen war – wieder geschlossen.
»Geh in die Küche, aber fasse nichts an«, sagte eine Stimme aus dem Dunkel, und während die Tür verriegelt und mit Ketten gesichert wurde, tastete ich mich im Finstern bis zur Küche vor.
Das hellflackernde Kaminfeuer beleuchtete den kahlsten Raum, den ich jemals gesehen habe. Auf Wandborden stand ein halbes Dutzend Teller, auf dem Tisch war eine Schale mit Hafersuppe zum Abendessen bereitgestellt, davor ein Krug mit Dünnbier, daneben lag ein Hornlöffel. Außerdem gab es in dem großen leeren Steingewölbe nur noch an der Wand ein paar festverschlossene Truhen und einen Eckschrank mit einem dicken Vorhängeschloß .
Sobald der Mann, der mich hereingelassen hatte, mit dem Verschließen der Tür fertig war, kam er zu mir in die Küche. Seine schmalschultrige Gestalt war unansehnlich; er ging gebückt, und sein Gesicht hatte eine schmutziggraue Färbung. Es war schwer, sein Alter zu schätzen; es mochte zwischen fünfzig und siebzig liegen. Die Nachtmütze war aus Flanell, ebenso der Schlafrock, den er an Stelle von Rock und Weste über das zerlumpte Hemd gezogen hatte. Er mußte sich schon lange nicht mehr rasiert haben. Was mich aber am meisten störte und sogar einschüchterte, war die Art, wie er mich zwar unverwandt anstarrte, mir aber nicht direkt ins Gesicht blickte. Es ließ sich schwer sagen, was der Beruf und die Herkunft dieses Menschen sein mochten. Am wahrscheinlichsten schien es mir, daß er ein alter, ausgedienter Knecht war, der hier, mit einer Rente zurückgelassen, das Herrenhaus hüten sollte.
»Bist du hungrig?« fragte er mich, und dabei sah er mir auf die Knie. »Du kannst die Hafersuppe aufessen.«
Ich wandte ein, daß das doch wohl sein Abendessen sei.
»Ach«, sagte er, »ich kann gern darauf verzichten. Das Bier werde ich trinken, es feuchtet die Kehle an und nimmt mir den Hustenreiz.«
Er trank den Becher zur Hälfte leer und starrte mich dabei weiter unverwandt von der Seite an. Plötzlich streckte er die Hand aus: »Laß sehen den Brief!« sagte er.
Ich erwiderte, der Brief sei nicht an ihn, sondern an Mr. Balfour gerichtet.
»Für wen hältst du mich?« fragte er. »Gib mir Alexanders Brief!«
»Ihr wißt ja, wie mein Vater heißt«, rief ich erstaunt.
»Es wäre komisch, wenn ich das nicht wüßte«, erwiderte der Mann, »denn er war mein leiblicher Bruder, und sowenig du mich, mein Haus oder meine gute Hafersuppe auch zu schätzen scheinst, ich bin dein leiblicher Onkel, und du bist mein leiblicher Neffe. Also gib schon den Brief her, Davie. Dann setz dich und fülle dir den Wanst.«
Wäre ich ein paar Jahre jünger gewesen, hätte ich bestimmt aus Scham, Müdigkeit und Enttäuschung laut losgeheult. So fand ich kein Wort der Erwiderung, weder im Guten noch im Bösen, sondern gab ihm den Brief und setzte mich, so unlustig wie wohl kaum ein junger Mensch nach so langer Wanderschaft, vor den Teller mit Hafersuppe.
Indessen hatte mein Oheim am Kamin Platz genommen und drehte, etwas vorgeneigt, das Schreiben in den Händen hin und her.
»Weißt du, was in dem Briefe steht?« fragte er unvermittelt.
»Ihr seht doch selber, Sir, das Siegel ist unverletzt.«
»Richtig«, meinte er, »aber was hat dich hierhergeführt?«
»Der Auftrag, Euch den Brief zu bringen.«
»Nein«, sagte er lauernd, »du machst dir gewiß irgendwelche Hoffnungen.«
»Ich gebe zu, Sir, als ich hörte, daß ich wohlhabende Verwandte habe, hoffte ich, sie würden mir im Leben vielleicht ein wenig weiterhelfen. Aber ich bin kein Bettler und brauche von Euch keine Wohltaten; ich will auch keine, die nicht von Herzen kommen, denn wenn ich auch arm bin, so habe ich doch Freunde, die mir gern beistehen werden.«
»Ach, Schnickschnack«, sagte Ohm Ebenezer, »rege dich nicht auf, Freundchen. Wir werden uns schon einigen. Wenn du satt bist, David, mein Junge, werde ich den Rest Hafersuppe aufessen.«
Sobald er mich beiseite geschoben und mir den Löffel aus der Hand genommen hatte, fuhr er fort: »Hafersuppe ist gesund und schmeckt auch gut.«
Er murmelte etwas wie ein Tischgebet und machte sich über die Schüssel her.
»Ich kann mich besinnen«, sagte er, »daß dein Vater nie genug kriegen konnte – ein richtiger Nimmersatt. Ich hingegen habe stets nur in den Speisen herumgestochert.«
Er trank einen Schluck Dünnbier, dabei erinnerte er sich anscheinend seiner Pflichten als Gastgeber, denn er sagte: »Wenn du Durst hast, ein Kübel mit Wasser steht hier gleich hinter der Tür.«
Darauf antwortete ich gar nicht. Ich stand stocksteif da und musterte meinen Oheim mit Grimm im Herzen. Er hingegen aß wie ein Mensch, der keine Zeit hat, und warf hin und wieder ein Auge auf meine Schuhe und meine derben Strümpfe aus daheim gesponnener Wolle. Nur einmal, als er es wagte hochzusehen, begegneten sich unsere Blicke. Kein Dieb, der mit der Hand in eines anderen Tasche ertappt wird, hätte schuldbewußter aussehen können als Ohm Ebenezer. Das machte mich stutzig. Kam sein scheues Wesen etwa von einer zu langen Entwöhnung im Umgang mit Menschen, und würde er vielleicht, wenn ich mich um ihn bemühte, aufgeschlossener, ja, ein ganz anderer Mensch werden? Seine scharfe Stimme schreckte mich aus diesen Überlegungen auf.
»Ist dein Vater schon lange tot?« fragte er.
»Seit drei Wochen, Sir«, antwortete ich.
»Er war ein verschlossener Mensch, mein Bruder Alexander, ein verschwiegener, stiller Mensch. Schon als Kind hat er sich kaum gemuckst. Von mir hat er wohl nicht oft gesprochen?«
»Bis vorhin, als Ihr es mir mitteiltet, Sir, wußte ich überhaupt nicht, daß er einen Bruder hatte.«
»Was du nicht sagst! Von den Shaws hast du wohl auch nichts gewußt, he?«
»Nicht einmal den Namen, Sir.«
»Na so was«, sagte er, »ein komischer Mann, dein Vater.«
Bei alledem schien er über das eben Gehörte merkwürdig befriedigt. Ich wußte nicht, ob seine Zufriedenheit nur der Schweigsamkeit meines verstorbenen Vaters galt oder ob sonst etwas dahintersteckte. Offensichtlich legte sich seine anfängliche Abneigung gegen mich, die er mir so unverhohlen gezeigt hatte, sehr rasch. Er sprang auf, kam auf mich zu und gab mir einen herzhaften Klaps auf die Schulter.
»Wir werden uns schon prächtig vertragen, Davie«, rief er. »Ich bin direkt froh, daß ich dich ins Haus gelassen habe. Und jetzt komm, ich zeige dir, wo du schlafen kannst.«
Zu meiner Verwunderung zündete er weder eine Lampe noch eine Kerze an, sondern ging voraus, einen dunklen Gang entlang; schweratmend tastete er sich vorwärts, ein paar Stufen hinauf, und machte dann vor einer Tür halt, die er aufschloß. Ich folgte ihm auf den Fersen, denn ich war, so gut es ging, hinterdreingestolpert. Er ließ mich eintreten. Das sei mein Zimmer, sagte er. Ich tat, wie er geheißen, blieb aber nach ein paar Schritten stehen und bat um eine Kerze.
»Ach Schnickschnack«, sagte Ohm Ebenezer, »der Mond scheint hell genug.«
»Ich sehe weder Mond noch Sterne, es ist stockfinster, und ich kann nicht erkennen, wo das Bett steht«, widersprach ich.
»Schnickschnack«, wiederholte er. »Ich schätze es nicht, wenn im Hause Licht angezündet wird, es könnte leicht Feuer ausbrechen, Davie, und davor habe ich große Angst.«
Und ehe ich Zeit gehabt hatte, auf meiner Bitte zu beharren, hatte er die Tür von draußen hinter sich zugezogen, und ich hörte, wie er sie wieder verschloß.
Ich wußte wahrhaftig nicht, ob ich darüber lachen oder weinen sollte. In der Stube war es feucht und finster wie in einem Brunnenschacht. Und das Bett, das ich schließlich doch fand, war so naß wie Torfmoor. Zum Glück hatte ich mein Bündel mitgenommen und konnte mich jetzt in mein Wollplaid einrollen. Im Windschutz der großen Bettstelle legte ich mich auf den Fußboden nieder und war rasch eingeschlafen.
Beim ersten Tagesschein öffnete ich die Augen und entdeckte, daß ich in einem großen Raum lag, dessen Wände mit gepreßtem Leder tapeziert waren und in dem schöne Möbel mit gestickten Bezügen standen. Das Frühlicht flutete durch drei große Fenster herein. Vor zehn oder zwanzig Jahren mußte es denkbar angenehm gewesen sein, in diesem Zimmer zur Ruhe zu gehen oder darin aufzuwachen. Aber die Feuchtigkeit, der Schmutz, Mäuse und Spinnen und ständige Vernachlässigung hatten gründliche Arbeit geleistet. Von den Fensterscheiben waren viele zerbrochen, wie übrigens fast alle im Hause: mein Oheim mußte offenbar irgendwann von seinen erbosten Nachbarn belagert worden sein – vielleicht war Jennet Clouston die Anführerin gewesen. –
Draußen war inzwischen die Sonne aufgegangen, und da es in dem verwahrlosten Zimmer sehr kalt war, hämmerte ich gegen die Tür und schrie, bis mein Gefängniswärter kam und mich herausließ. Er führte mich zum rückwärtigen Teil des Hauses, zu einem Ziehbrunnen im Hof und forderte mich auf, mir das Gesicht zu waschen, wenn ich Lust dazu hätte. Nachdem ich das getan, suchte ich, so gut es ging, den Weg zurück in die Küche, wo der Hausherr inzwischen Feuer gemacht und die Hafersuppe gekocht hatte. Auf dem Tisch standen zwei Näpfe, und daneben lagen zwei Hornlöffel, aber nur ein Becher Dünnbier stand bereit. Ruhte nun mein Blick besonders erstaunt darauf, oder bemerkte es mein Oheim, denn mit seinen nächsten Worten schien er meine Gedanken zu beantworten; er fragte mich, ob ich auch Bier trinken wolle.
Das sei ich allerdings so gewohnt, meinte ich, er solle sich aber keine Umstände machen.
»Doch, doch«, sagte er, »ich gönne dir alles, was rechtens ist.«
Er holte ein zweites Trinkgefäß vom Wandbord, und dann goß er zu meiner großen Verwunderung, anstatt mehr Bier abzuzapfen, genau die Hälfte seines Getränks in meinen Becher. Er tat das mit einer Würde, die mir den Atem benahm. Mein Oheim war zweifellos ein Geizhals, aber einer von der Sorte, die durch ihre Gründlichkeit dieses Laster nahezu in eine Tugend verwandeln.
Sobald wir unseren Morgenimbiß beendet hatten, schloß Oheim Ebenezer eine Schublade auf, brachte eine Tonpfeife und ein wenig Tabak zum Vorschein, schnitt ein Eckchen davon ab, tat den Rest zurück und verschloß die Lade wieder. Dann setzte er sich an eines der Fenster in die Sonne und schmauchte stumm seine Pfeife. Von Zeit zu Zeit wanderten seine Blicke zu mir, und er stellte kurze Fragen. Einmal wollte er wissen: »Was ist mit deiner Mutter?«
Und als ich ihm erwiderte, sie sei ebenfalls gestorben, bemerkte er: »Ach, sie war ein braves Ding.«
Dann wieder nach längerer Pause: »Was für Freunde sind das, von denen du mir erzählt hast?«
Ich berichtete, es seien zwei Herren namens Campbell, obwohl ja nur der Geistliche dieses Namens sich je um mich gekümmert hatte. Aber ich meinte, mein Oheim glaube mich von aller Welt verlassen, und jetzt, wo ich ihm allein ausgeliefert war, sollte er mich nicht für ganz hilflos halten.
Er schien über meine Antwort nachzusinnen. Dann sagte er: »Davie, mein Junge, du hast recht getan, deinen Oheim Ebenezer aufzusuchen. Die Familie bedeutet mir allerhand, und ich bin entschlossen, an dir meine Pflicht zu tun. Aber wenn ich mir jetzt überlege, welcher Beruf der beste für dich wäre, der des Advokaten oder der Geistlichenstand, vielleicht auch der Heeresdienst, den junges Volk wohl am meisten liebt, möchte ich doch nicht, daß ein Balfour sich vor den Hochland-Campbells erniedrigt. Darum laß dir gesagt sein, lerne den Mund halten. Keine Briefe, keine Botschaften, keine Verbindung, mit wem es auch sei, sonst ... da ist die Tür!«
»Ohm Ebenezer«, rief ich, »ich habe keinen Grund anzunehmen, daß Ihr es, nicht gut mit mir meint, aber Ihr sollt dennoch wissen, daß ich auch meinen Stolz habe. Es war nicht mein Wille, Euch aufzusuchen, und wenn Ihr mir die Tür weist, gut, dann gehe ich wieder.«
Nun schien er sehr aufgebracht.
»Schnickschnack, Schnickschnack«, schrie er, »hüte dich, Bursche, ich bin kein Hexenmeister und kann dir deine Zukunft nicht aus dem Breinapf weissagen, kann dir auch keinen Schatz herbeizaubern. Laß mir ein, zwei Tage Zeit, sprich mit keinem Menschen, und so gewiß, wie ich hier vor dir sitze, wird das Richtige mir schon einfallen.«
»Gut«, sagte ich, »genug der Worte, wenn Ihr mir beistehen wollt, freue ich mich sehr und werde Euch gewiß dankbar sein.«
Es schien mir – leider, wie ich bald merken sollte, etwas verfrüht –, daß ich mit meinem Oheim ganz gut fertig würde. Als nächstes sagte ich zu ihm, meine Betten müßten gelüftet und zum Trocknen in die Sonne gelegt werden, denn in einer solchen Pökellake könne ich nicht schlafen.
»Ist dies mein Haus oder deines?« fragte er barsch, stockte aber ganz plötzlich. »Nein, nein«, fuhr er fort, »so habe ich das nicht gemeint. Was mein ist, ist auch dein, Davie, mein Sohn, was mir gehört, gehört auch dir. Blut ist dicker als Wasser, und das Geschlecht der Balfour ruht auf unseren vier Augen.«
Dann schwatzte er weiter über unsere Familie und ihren früheren Glanz. Er erzählte, wie sein Vater das Haus habe vergrößern wollen und wie er dann selber den Bau wieder eingestellt und mit der sündhaften Verschwendung Schluß gemacht habe. Das brachte mich auf den Einfall, ihm Jennet Cloustons Botschaft auszurichten.
»Die alte Vettel«, schrie er erbost, »zwölfhundertundneunzehnmal verwünscht hat sie mich. Das wäre also jeden Tag, seitdem ich ihr Eigentum habe pfänden und versteigern lassen. Hörst du, David, die lasse ich noch auf dem Rost braten, wenn sie keine Ruhe gibt. Eine Hexe ist das, eine ausgemachte Hexe. Wart nur, ich gehe gleich zum Gerichtsschreiber.«
Und kaum hatte er ausgesprochen, da öffnete er eine Truhe, nahm einen alten, aber sehr gut erhaltenen Überrock und die dazugehörige Weste sowie eine recht anständige Kopfbedeckung aus Biberpelz heraus, alles ganz schlicht und ohne jede Verzierung. Hastig kleidete er sich an, verschloß die Truhe wieder und wollte forteilen, als ihm etwas einfiel.
»Ich kann dich nicht allein im Hause lassen«, sagte er »ich muß dich aussperren und zuschließen.«
Das Blut stieg mir in die Wangen.
»Wenn Ihr mich vor die Tür setzt«, sagte ich, »habt Ihr mich zum letztenmal gesehen, und es ist aus mit unserer Freundschaft.«
Er wurde sehr blaß und biß sich auf die Lippen.
»Auf diese Weise«, sagte er und blickte grimmig zu Boden, »auf diese Weise, David, kannst du bei mir nichts werden und wirst dir nur meine Gunst verscherzen.«
»Sir«, sagte ich, »mit aller gebührenden Achtung vor Eurem Alter und mit Rücksicht auf unsere Verwandtschaft, aber auf Eure Gunst pfeife ich. Mir ist Selbstachtung beigebracht worden, und wenn Ihr zehnmal der einzige Oheim, der einzige Blutsverwandte wäret, den ich auf der Welt habe, um einen solchen Preis will ich mir Eure Gunst nicht erkaufen.«
Ohm Ebenezer dreht sich um, trat ans Fenster und blickte angelegentlich hinaus. Ich merkte aber, daß er am ganzen Leibe bebte und zuckte, als hätte ihn der Schlag getroffen. Als er sich mir dann wieder zuwandte, lächelte er etwas gezwungen.
»Schön«, sagte er, »schön, Davie, wir müssen uns aufeinander einstellen, ich werde nicht weggehen, und Schluß damit.«
»Ohm Ebenezer«, erwiderte ich, »das alles ist mir unverständlich. Ihr behandelt mich wie einen Dieb. Der Gedanke, mich im Hause zu haben, ist Euch verhaßt; das laßt Ihr mich mit jedem Blick und jedem Wort fühlen. Ihr mögt mich also gewiß nicht leiden. Ich habe mit Euch gesprochen wie bisher noch mit keinem Menschen. Wenn es nun einmal so ist, weshalb versucht Ihr, mich bei Euch zu behalten? Laßt mich fort – laßt mich zu meinen Freunden zurückkehren, die mich gern haben.«
»Nein, nein, nein«, sagte er sehr nachdrücklich. »Ich habe dich auch gern, und wir werden uns mit der Zeit besser verstehen. Es ginge gegen die Ehre dieses Hauses, dich wieder dahin zurückzuschicken, woher du gekommen bist. Bleibe ruhig hier, warte ab wie ein braver Junge, und du wirst sehen, daß wir uns noch prächtig verstehen werden.«
Nachdem ich stumm eine Weile überlegt hatte, sagte ich: »Also gut, Sir, ich will noch kurze Zeit hierbleiben. Es ist nur recht und billig, daß ein Blutsverwandter für mich sorgt und nicht fremde Leute. Ich will mein Bestes tun, damit wir gut miteinander auskommen. Meine Schuld soll es nicht sein, wenn es schiefgeht.«
IV. Ich gerate im Hause der Shaws in grosse Gefahr
Dafür, daß der Tag so schlecht angefangen hatte, endete er leidlich gut. Zum Mittagessen gab es kalten Haferbrei und zum Nachtmahl eine heiße Hafersuppe. Mein Oheim lebte offenbar von Haferbrei und Dünnbier. Er sprach nur wenig mit mir und nicht anders als vorher. Jedesmal nach längerem Schweigen kam, wie aus der Pistole geschossen, irgendeine Frage. Wenn ich aber das Gespräch auf meine Zukunft bringen wollte, wich er sogleich aus.
In einem Raum neben der Küche, den zu betreten er mir erlaubt hatte, fand ich zahllose Bücher in lateinischer und englischer Sprache; damit unterhielt ich mich den ganzen Nachmittag. In so guter Gesellschaft verging die Zeit wirklich erstaunlich rasch und angenehm, und ich söhnte mich fast mit meinem Aufenthalt im Hause der Shaws aus. Nur wenn mein Blick auf meinen Oheim fiel und unsere Augen sich verstohlen begegneten, erwachte mein Mißtrauen wieder.
Eine bestimmte Entdeckung, die ich gemacht hatte, ließ erneut Zweifel in mir aufkommen. Es war eine Eintragung auf dem Vorsatzblatt eines Lesebuchs von Patrik Walker, unverkennbar in der Handschrift meines verstorbenen Vaters. Sie lautete: »Meinem Bruder Ebenezer zu seinem fünften Geburtstag.« Was mir zu denken gab, war dies: Da mein Vater der jüngere von beiden gewesen war, mußte ihm entweder ein seltsamer Irrtum unterlaufen sein, oder aber er mußte als noch nicht Fünfjähriger eine ungewöhnlich klare, fast männliche Handschrift gehabt haben.
Ich versuchte, mir den Gedanken daran aus dem Kopfe zu schlagen, aber so viele interessante Bücher aus alter und neuerer Zeit ich auch von den Regalen nahm – Geschichtswerke, Gedichte, Erzählungen –, immer wieder kamen mir die von meinem Vater geschriebenen Zeilen in den Sinn, und als ich schließlich in die Küche zurückging, wo mein Oheim mir Haferbrei und Dünnbier vorsetzte, war meine erste Frage, ob mein Vater sich wohl früh mit Schreiben und Lesen beschäftigt habe.
»Alexander? Aber nein«, lautete die prompte Antwort. »Ich war als Kind viel aufgeweckter als er und habe gleichzeitig mit ihm lesen gelernt.«
Diese Auskunft verwirrte mich noch mehr. Mir kam ein Einfall, und ich fragte, ob er und mein Vater wohl Zwillinge gewesen seien.
Ohm Ebenezer sprang so heftig auf, daß sein Hornlöffel zu Boden fiel.
»Wie kommst du darauf? Was soll die Frage?« schrie er und packte mich beim Rockaufschlag. Dabei sah er mich scharf an. Seine kleinen blanken Vogelaugen blitzten und funkelten böse.
»Wie meint Ihr das?« fragte ich sehr ruhig, denn ich war viel kräftiger als er und fürchtete mich auch nicht leicht. »Laßt meine Jacke los! Was ist das für ein Benehmen!«
Es kostete meinen Oheim offenbar große Mühe, sich zu beherrschen.
»Mann Gottes, David«, rief er, »du solltest mit mir nicht von deinem Vater reden. Das ist ein Fehler. Er war mein einziger Bruder.«
Eine Weile saß er stumm da, starrte blinzelnd auf seinen Teller, und ich bemerkte, daß der Oheim zitterte.
Dieser ganze Vorfall, daß er Hand an mich gelegt hatte und plötzlich vorgab, meinen toten Vater geliebt zu haben, ging über mein Fassungsvermögen und machte mich zugleich ängstlich und zuversichtlich. Einerseits überlegte ich, mein Oheim sei vielleicht geisteskrank und könne gefährlich werden, andererseits kam mir, völlig unbeabsichtigt – ja, ich wehrte mich dagegen –, eine lange spannende Geschichte in den Sinn von einem armen Jungen, dem ein böser Anverwandter sein rechtmäßiges Erbe vorenthalten und ihm das Eigentum geraubt hatte. Weshalb sollte mein Oheim einem Neffen, der fast wie ein Bettler bei ihm um Einlaß gebeten hatte, wohl eine solche Komödie vorspielen, wenn er nicht im Grunde seines Herzens Veranlassung hatte, ihn zu fürchten?
Mit dieser Schlußfolgerung, die ich mir zwar nicht recht eingestehen wollte, die sich aber eisern in meinem Kopfe festsetzte, fing ich an, ihn jetzt auch mit verstohlenen Blicken zu belauern. Wir saßen uns am Tisch gegenüber wie Katz und Maus, und einer beobachtete heimlich den anderen. Er hatte anscheinend nichts mehr zu sagen, weder im Guten noch im Bösen, aber er grübelte insgeheim, und je länger wir so dasaßen, je genauer ich ihn betrachtete, um so klarer wurde mir, daß er etwas Schlimmes gegen mich im Schilde führte.
Nachdem er das Geschirr weggeräumt hatte, nahm er sich, wie am Morgen, eine Pfeife voll Tabak, rückte seinen Sessel an den Kamin und kehrte mir, seine Pfeife schmauchend, den Rücken zu. Erst nach geraumer Weile begann er zu sprechen.
»Davie«, sagte er, »ich habe mir etwas überlegt.«
Er machte eine Pause und wiederholte dann, was er eben gesagt hatte.
»Da ist eine kleine Geldsumme, die ich dir noch vor deiner Geburt zugedacht hatte – deinem Vater habe ich’s versprochen«, unterbrach er sich. »Nichts Gesetzliches, verstehst du, nur so, was Männer bei einem Glase Wein besprechen. Nun, ich habe das Geld für dich aufbewahrt; es ist mir nicht leichtgefallen, aber versprochen ist versprochen. Die Summe ist im Laufe der Jahre mit Zins und Zinseszins angewachsen und beträgt jetzt insgesamt genau. ...« Er machte eine Pause und fuhr dann stockend fort: »genau vierzig Pfund.«
Während er diese letzten Worte hervorstieß, warf er mir über die Schulter einen schrägen Blick zu und erläuterte dann fast schreiend: »Schottische Pfunde natürlich!«
Da das schottische Pfund einem englischen Shilling entsprach, war der Unterschied, den sein Nachsatz bewirkte, recht erheblich. Ich hatte ohnehin schon gemerkt, daß die ganze Geschichte erlogen war – erfunden, mit einer bestimmten Absicht, die ich brennend gern erraten hätte. Ich machte auch, als ich antwortete, keinen Versuch, meinen Spott zu verbergen.
»Überlegt es Euch noch einmal, Sir, es sind doch gewiß Pfund Sterling gewesen.«
»Natürlich, das sagte ich ja«, erwiderte mein Oheim rasch, »Pfund Sterling, gewiß, und wenn du mal einen Augenblick vor die Tür gehen und nach dem Wetter sehen willst, werde ich sie vorsuchen und dich dann wieder hereinrufen.«
Ich gehorchte dieser Aufforderung bereitwillig, lächelte aber verächtlich in mich hinein bei dem Gedanken, daß er annehmen könnte, ich sei so leicht zu betrügen.
Es war eine finstere Nacht mit nur wenigen Sternen tief am Firmament. Während ich vor der Haustür stand, hörte ich, wie der Wind in der Ferne leise klagend über die Hügel fegte. Und doch kam es mir schwül und drückend vor wie beim Herannahen eines Gewitters. Noch ahnte ich nicht, was das alles, ehe der Abend zu Ende gegangen war, für mich bedeuten sollte.
Nachdem Ohm Ebenezer mich wieder hereingerufen hatte, zählte er mir siebenunddreißig goldene Guineen vor; den Rest der Summe hielt er in kleineren Gold- und Silbermünzen in der Hand. Aber nun verließ ihn der Mut, und er stopfte das Kleingeld hastig wieder in seine Tasche.
»Siehst du«, sagte er, »das mag dir eine Lehre sein. Ich habe meine Eigenheiten und bin Fremden gegenüber sehr zurückhaltend, aber ein gegebenes Versprechen erfülle ich, das habe ich dir eben bewiesen.«
Ich hielt meinen Oheim für so geizig, daß mir diese unerwartete Freigebigkeit zuerst einmal die Sprache verschlug, und ich fand keine rechten Worte, mich zu bedanken.
Beschwichtigend meinte er: »Laß nur, ich will keinen Dank. Ich tat nur meine Pflicht. Damit will ich nicht sagen, daß jeder andere ebenso gehandelt hätte, aber ich für meine Person – obgleich ich in Geldsachen sehr genau bin – freue mich, dem Sohn meines Bruders etwas zukommen zu lassen, und ich freue mich auch, daß wir uns jetzt so gut verstehen werden, wie sich das für so nahe Blutsverwandte gehört.«
Ich antwortete ihm darauf so artig, wie ich nur konnte, überlegte aber die ganze Zeit, was wohl als nächstes kommen würde und weshalb er sich von seinen kostbaren Guineen getrennt haben mochte. Den Grund, den er angegeben hatte, würde ihm nicht einmal ein kleines Kind geglaubt haben.
Er sah mich jetzt wieder von der Seite an und sagte: »Du weißt doch, Davie, eine Hand wäscht die andere.«
Ich erklärte mich bereit, ihm meine Dankbarkeit auf jede vernünftige Weise zu bezeigen, erwartete aber irgendein ungeheuerliches Ansinnen.
Als er sich dann schließlich ein Herz faßte und zu sprechen anfing, geschah das nur, um mir ganz vernünftig, wie mir schien, mitzuteilen, daß er alt und gebrechlich sei und hoffe, ich werde ihm in Haus und Garten etwas zur Hand gehen.
Ich bestätigte, daß ich ihm gern helfen wolle.
»Schön«, sagte er, »du kannst gleich damit anfangen.«
Und er zog einen rostigen Schlüssel aus der Tasche.
»Da«, sagte er, »ist der Schlüssel zur Turmtreppe am anderen Ende des Hauses. Man kann nur von außen hineingelangen, weil der Teil des Hauses nicht fertig geworden ist. Geh dorthin, steige die Stufen hinauf und bringe mir die Truhe herunter, die oben steht; es sind wichtige Dokumente darin.«
»Kann ich eine Kerze bekommen, Sir?«
»Nein«, erwiderte er listig. »Du weißt, bei mir im Haus wird kein Licht gebrannt.«
»Gut, Sir«, antwortete ich, »ist die Treppe in Ordnung?«
»Bestens in Ordnung«, sagte er, und als ich mich zum Gehen anschickte, rief er mir nach: »Bleibe dicht an der Wand; es ist kein Geländer da, aber die Stufen sind fest.«
Ich ging hinaus in die Nacht. In der Ferne klagte noch immer der Wind, obgleich hier, in der Nähe des Herrenhauses, kein Luftzug zu spüren war. Es schien mir womöglich noch finsterer als zuvor. Ich war froh, daß ich mich an der Hausmauer entlangtasten konnte, bis ich zu der Turmtür am Ende des unvollendeten Flügels gelangte.
Eben hatte ich den Schlüssel in das Schloß gesteckt und ihn gerade herumgedreht, als ohne einen Windstoß oder begleitenden Donnerschlag der ganze Himmel von einem Blitzstrahl wie von einem lodernden Feuerschein erhellt wurde. Gleich darauf herrschte wieder tiefste Dunkelheit. Ich mußte meine Augen mit der Hand schützen, um mich zurechtzufinden, denn als ich den Turm betrat, war ich von dem grellen Lichtschein immer noch wie geblendet.
Drinnen war es so dunkel, daß einem buchstäblich der Atem stockte, aber ich fühlte mich mit Füßen und Händen vor und fand schließlich mit der Hand die Mauer und mit der Fußspitze die erste Treppenstufe. Ich bemerkte, daß die Turmwände aus festgefügten behauenen Steinen und auch die ziemlich schmalen, steilen und glatten Stufen eben und fest waren. Eingedenk der Warnung meines Oheims, daß kein Geländer da sei, hielt ich mich dicht an der Mauer und tastete mich in der pechschwarzen Umgebung langsam aufwärts; dabei klopfte mir das Herz bis in den Hals.
Das Haus der Shaws hatte fünf Stockwerke, wobei das Dachgeschoß nicht mitgerechnet war. Während ich hinaufstieg, empfand ich die Luft als weniger stickig, und es schien auch etwas heller zu werden. Ich wunderte mich, woher diese Veränderung kommen mochte, bis ein zweites Wetterleuchten aufzuckte und ebenso plötzlich wieder verlosch.
Wenn ich nicht laut aufgeschrien habe, lag es wohl daran, daß mir die Kehle vor Angst wie zugeschnürt war. Daß ich nicht abstürzte, war weniger mein Verdienst als die barmherzige Hilfe des Himmels. Der grelle Schein des Blitzstrahls war nicht nur durch die klaffenden Mauerlücken zu allen Seiten des Turmes hereingedrungen, die so groß waren, daß ich gleichsam auf einem Gerüst hochkletterte, ich hatte überdies in dem flüchtigen Lichtschein gesehen, daß die Stufen ungleich lang waren und daß die Stelle, auf der ich jetzt stand, nur zwei Zoll von dem Abgrund entfernt war.





























