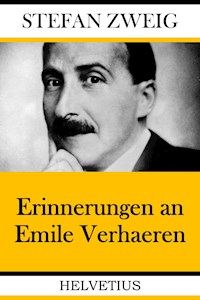
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Emile Adolphe Gustave Verhaeren (1855-1916) war ein belgischer Dichter, der in französischer Sprache schrieb. Verhaeren wandte sich in den 1890er Jahren vermehrt sozialen Fragen und sozialistischen Theorien zu und verarbeitete die Atmosphäre der Großstadt und deren Gegensatz zum Landleben in seinen Gedichten. Durch diese Gedichte wurde er berühmt, und sein Werk wurde weltweit übersetzt und besprochen. Er selbst reiste für Lesungen und Vorträge durch große Teile Europas. Viele Künstler und Schriftsteller wie Auguste Rodin, Edgar Degas, Maurice Maeterlinck, André Gide, Rainer Maria Rilke und Stefan Zweig bewunderten ihn, korrespondierten mit ihm, suchten seine Nähe und übersetzten seine Werke. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach und das neutrale Belgien von deutschen Truppen besetzt wurde, stand Verhaeren auch in Deutschland auf der Spitze seines Ruhms. Während des Krieges schrieb er pazifistische Gedichte. Sein Glauben an eine bessere Zukunft wurde während des Krieges von zunehmender Resignation überschattet. Nach einem dieser Vorträge in der französischen Stadt Rouen starb er durch einen Unfall, als er beim Besteigen eines abfahrenden Zuges ausrutschte und überrollt wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erinnerungen an Emile Verhaeren
Erinnerungen an Emile VerhaerenImpressumErinnerungen an Emile Verhaeren
Im dritten Jahre des Krieges, einer im tausendfältigen Tode, ist Emile Verhaeren dahingegangen, von den Maschinen, deren Schönheit er gesungen, zerrissen wie Orpheus von den Mänaden. Fern zu sein dieser Stunde und jener anderen seines Heimgangs, hat das Geschick mich gezwungen, das unsinnige und unselige Geschick einer Zeit, da die Sprache mit einemmal zwischen den Völkern eine Grenze ward und die Heimat ein Gefängnis, Anteil ein Verbrechen und Menschen einander Feinde nennen sollten, deren Leben verbunden war mit allen Adern geistiger und freundschaftlicher Vertrautheit. Alle Gefühle außer jenem des Hasses waren staatlich verboten und verpönt, doch die Trauer, sie, die im Tiefsten und Unzugänglichsten der Seele wohnt, wer kann sie verjagen, und die Erinnerung, wer vermag ihre heilige Flut zu dämmen, die das Herz mit warmer Welle überströmt! Die Gegenwart, sie konnte eine sinnlose Welt uns zerstören, die Zukunft vielleicht noch verdüstern und verschatten. Aber die Vergangenheit, sie ist jedem unantastbar, und ihre schönsten Tage strahlen, lichte Kerzen, in das Dunkel unserer Tage und auf diese Blätter, die ich für Verhaeren niederschreibe, ihm zum Gedächtnis und mir selber zum Trost.
Nur mir selbst schreibe ich diese Blätter, und von den Freunden sind nur jene gewählt, die ihn selbst kannten und liebten. Was er für die Welt war als Dichter und literarische Erscheinung, habe ich früher in meinem großen biographischen Werke zu sagen versucht. Es ist jedem zugänglich, der es in deutscher, französischer oder englischer Sprache lesen will. Für diese Erinnerungen aber, die persönliche sind, will ich nicht Anteil fordern von einer Nation, als deren Feind er sich in den entscheidenden Stunden seines Lebens empfand, sondern einzig von jener klaren Gemeinschaft des Geistes, für die Feindschaft ein Gefühl der Verirrung, für die Haß ein unsinniges Empfinden bedeutet. Für mich nur und diese Nächsten erwecke ich heute das Bild eines Menschen, der so innig meinem Leben verbunden ist, daß ich das seine nicht darzustellen vermag, ohne mein eigenes Leben darin mitgestaltet zu fühlen. Und ich weiß: mit der Erinnerung an den großen verlorenen Freund erzähle ich meine eigene Jugend.
Ich war etwa zwanzig Jahre alt, als ich ihn kennenlernte, und er war der erste große Dichter, den ich menschlich erlebte. In mir selbst war damals schon der Anbeginn dichterischen Werkes, aber unsicher noch wie Wetterleuchten auf dem Himmel der Seele: noch war ich nicht gewiß, ob ich selbst ein Berufener des Wortes sei oder bloß es zu werden begehrte, und meine tiefste Sehnsucht verlangte, einem jener wirklichen Dichter endlich zu begegnen, Angesicht zu Angesicht, Seele zu Seele, der mir Beispiel sein könnte und Entscheidung. Ich liebte die Dichter aus den Büchern: sie waren dort schön durch die Ferne und den Tod; ich kannte einige Dichter aus unserer Zeit: sie waren enttäuschend durch ihre Nähe und die oft abstoßende Art ihrer Existenz. Keiner war mir damals nah, dessen Leben mir Lehrbild sein konnte, dessen Erfahrung mich führte, dessen Einklang zwischen Wesen und Werk mir innerlich zur Bindung der noch unsicheren Kräfte verhalf. In Biographien fand ich Vorbilder und Beispiel dichterisch-menschlichen Einklangs, aber schon wußte mein Gefühl, daß jedes Lebensgesetz, jede innere Gestaltung nur vom Lebendigen ausgeht, von erlebter Erfahrung und geschautem Beispiel.
Erfahrung, dafür war ich zu jung, Beispiele, ich suchte sie unbewußt mehr als bewußt. Freilich, es gingen und kamen Dichter unserer Zeit in unsere Stadt, schon damals in mein Leben! Liliencron erlebte ich einen Abend in Wien, umdrängt von Freunden, umrauscht von Beifall und dann an einem Tisch zwischen Menschen und vielen Worten, darin sich das seine verlor, ich haschte Dehmels Hand einmal im Gedränge, fing einen Gruß von diesem und jenem. Niemals aber war ich einem nahe. Manchen freilich hätte ich besser kennenlernen können, aber mich ihnen anzudrängen bewahrte mich eine Scheu, die ich später als geheimes und glückliches Gesetz meiner Existenz erkannte: daß ich nichts suchen dürfe und mir alles zur richtigen Zeit einst gegeben sei. Was mich formte, kam nie aus meinem Wunsch, aus meinem tätigen Willen, sondern immer von Gnade und Geschick: und so auch dieser wundervolle Mensch, der plötzlich und zur rechten Stunde in mein Leben trat und dann das geistige Sternbild meiner Jugend wurde.
Ich weiß heute, wieviel ich ihm danke, und weiß nur nicht, ob ich vermag, diese Dankbarkeit im Worte zu erhärten. Keineswegs meine ich aber mit diesem Gefühl der Verpflichtung den literarischen Einfluß Verhaerens auf meine Verse, sondern diese Dankbarkeit gilt immer nur jenem Meister des Lebens, der meiner Jugend die erste Prägung wahrhaftig menschlicher Werte gab, der mich in jeder Stunde seiner Existenz lehrte, daß nur ein vollkommener Mensch ein großer Dichter sein kann, und so mit dem Enthusiasmus für die Kunst auch einen unverlöschlichen Glauben an die große menschliche Reinheit des Dichters zurückschenkte. Nehme ich die brüderlich geliebte Gestalt Romain Rollands aus, so haben alle meine späteren Tage mir keine schönere Wesenheit des Dichters, keine reinere Einheit von Wesen und Wert gegeben als ihn, den als Lebendigen zu lieben meine innigste Freude und den als Toten zu verehren meine zwingendste Pflicht geblieben ist.
Das Werk Verhaerens war früh in meine Hände gekommen. Durch bloßen Zufall, meinte ich vorerst, weiß aber längst, daß ich diese Begegnung einem jener Zufälle danke, die in allen menschlichen Entscheidungen eines Lebens die wahren und vielleicht eingeborenen Notwendigkeiten sind. Ich war damals noch im Gymnasium, hatte eben mein Französisch gelernt und übte in Übersetzungen zugleich die Sprache und die noch unbeholfene poetische Bildungskraft. Damals hatte ich irgendwo eines der ersten Bücher Verhaerens aufgetrieben, das bei Lacomblez in Brüssel in bloß dreihundert Exemplaren erschienen war, heute längst schon eine Rarität für Bibliophile. Es war eines der ersten Bücher des belgischen Dichters und dieser belgische Dichter selbst ein noch in den weitesten Kreisen Unbekannter. Immer und immer wieder muß ich, um den Zufall, den schöpferischen, jener Zeit ganz würdigen zu können, mich daran erinnern, daß von dem wirklichen Werke Verhaerens damals kaum der Anfang geschaffen war und es gewissermaßen eine mystische, durch nichts Wirkliches begründete Neigung war, die mich diesem unbekannten Dichter entgegentrieb. Einige Gedichte reizten mich an, ich versuchte die noch ungelenke Wortkraft an ihnen und schrieb, ein Siebzehnjähriger, einen Brief um die Erlaubnis der Veröffentlichung an den Dichter. Die zustimmende Antwort, die ich heute noch bewahre, kam von Paris, ihre Postmarke, die längst außer Kurs gesetzte, bezeugt die Ferne der Zeit. Nichts band mich dann mehr an ihn, nur den Namen behielt ich und den Brief, den ich selbst erstaunt nach Jahren wiederfand und der mir bewies, daß, was ich später mit klarer Kraft versuchte, ein halbes Jahrzehnt vorher schon knabenhaft unbewußt angebahnt und begonnen war.
In Wien war damals um die Jahrhundertwende eine große und rege Zeit. Ich war zu jung, um sie schon von der Schulbank aus tätig mitzuerleben, doch ist sie mir unauslöschlich im Gedächtnis als eine Epoche der Erneuerung, wo plötzlich, wie von unsichtbarem Wind hergetragen, Duft und Ahnung fremder großer Kunst, die Botschaft ungesehener Länder in unsere altvaterische Stadt einbrach. Die Sezession hatte ihre großen Jahre der Regsamkeit und blühte, auf ihren Ausstellungen waren es die Belgier, Constantin Meunier, Charles van der Stappen, Fernand Knopff, Laermans, die mit ihren gewaltigen Formen den an engere Maße gewohnten Blick faszinierten. Belgien, das kleine Land zwischen den Sprachen, übte dadurch eine magische Anziehung auf meine Phantasie; ich begann, mich mit seiner Literatur zu beschäftigen, Charles de Coster zu lieben, dessen Uilenspiegel ich vergeblich durch zehn Jahre allen deutschen Verlegern empfahl, und kaum der Schulbank entronnen, die rubenskräftigen, lebensstarken und heute zu Unrecht verschollenen Romane Lemonniers. Meine erste freie Ferienreise brachte mich hin, ich sah das Meer, sah die Städte und wollte womöglich auch die Menschen sehen, für deren Werk ich soviel innere Hingabe bereit hatte. Aber es war Sommer, ein heißer August im Jahre 1902, die Menschen aus Brüssel geflohen, auf dessen Asphalt die Sonne brünstig brannte, keinen traf ich an von all denen, die ich suchte, einzig Lemonnier, den herrlichen hilfsbereiten Menschen, dessen Gedächtnis ich liebend und dankbar bewahre. Nicht genug, mir seine Gegenwart, die strömende und belebende, gegeben zu haben, bot er mir Empfehlungen an all die Künstler an, die mir lieb waren, aber wie diese nutzen, wie sie finden? Von Verhaeren, dessen Nähe ich vor allem begehrte, war wie gewöhnlich der Aufenthalt unbekannt, Maeterlinck hatte längst sich seiner Heimat entwandt, niemand, niemand war zur Stelle! Aber Lemonnier ließ nicht nach; er wollte, daß ich wenigstens Meunier inmitten seines Werkes sähe, seinen väterlichen Freund, und van der Stappen, seinen brüderlichen Genossen. Erst heute weiß ich, wieviel mir sein milder Zwang damals gegeben, denn die Stunde bei Meunier ist unvergänglichster Besitz und die bei van der Stappen eine der bedeutsamsten meines Lebens. Ich werde diesen Tag bei van der Stappen nicht vergessen. Ein Tagebuch von damals ist mir verhängnisvollerweise abhanden gekommen, aber für diese Stunden kann ich es entbehren: sie sind mit jener diamantenen Schärfe in mein Gedächtnis geritzt, wie sie nur das Unvergeßliche besitzt.
An einem Vormittag pilgerte ich hinaus in die Rue de la joyeuse entrée, draußen beim Cinquantenaire, und fand van der Stappen, den kleinen freundlichen Flamen mit seiner großen holländischen Frau, deren natürliche Gastlichkeit ein Freundesbrief Lemonniers womöglich noch gesteigert hatte. Ich wanderte mit dem Meister in den steinernen Wald seiner Werke hinein. Wunderbar groß stand in seiner Mitte das ›Denkmal der ewigen Güte‹, daran er seit Jahren schuf und das er niemals vollenden sollte, und rings darum in starrem Kreise einzelne Gruppen, leuchtender Marmor, dunkles Erz, feuchter Lehm und geschliffenes Elfenbein. Hell war die freundliche Vormittagsstunde, und sie ward immer heiterer und belebter im gesprochenen Wort. Von Kunst und Literatur, von Belgien und Wien ward viel geredet, die lebendige Güte dieser beiden Menschen nahm mir bald jede Scheu. Unverhohlen sagte ich ihnen meinen Schmerz und meine Enttäuschung, daß ich hier in Belgien gerade denjenigen versäumte, den ich von allen französischen Dichtern am meisten verehrte, Verhaeren, und daß ich selbst eine neue Reise nicht scheuen würde, um ihn endlich kennenzulernen. Aber niemand wisse, wo er sich aufhalte, von Paris sei er abgereist, in Brüssel noch nicht angekommen, keiner könne mir sagen, wo er zu finden wäre. Und ich bekannte offen mein Bedauern, wieder heimfahren zu müssen mit meiner Verehrung, die bestimmt sei, weiterhin bloß Wort und Ferne zu bleiben.
Van der Stappen lächelte ein kleines verdecktes Lächeln, als ich dies sagte, seine Frau lächelte auch, und sie sahen einander an. Ich fühlte ein geheimes Einverständnis zwischen ihnen an meinem Worte erregt. Zuerst war ich ungewiß und ein wenig befangen, vielleicht etwas gesagt zu haben, das sie verstimmte. Aber bald empfand ich, daß sie nicht ungehalten waren; wir sprachen weiter. Wieder floß eine Stunde heiter dahin, kaum daß ich's merkte, und als ich endlich, meines überlangen Weilens gewahr, eilen wollte, Abschied zu nehmen, wehrten sie beide ab, ich solle bleiben, ich müsse zu Tisch bleiben, ich müsse bleiben unter jeder Bedingung. Und wieder ging das seltsame Lächeln von Augenstern zu Augenstern. Ich fühlte, daß, wenn es hier ein Geheimnis gäbe, dies ein mildes war, ließ gerne meine beabsichtigte Fahrt nach Waterloo und blieb im hellen, freundlichen, gastlichen Haus.
Es ward rasch Mittag. Wir saßen schon im Speisezimmer zu ebener Erde lag es wie in allen diesen kleinen belgischen Häusern, und man sah vom Gemach aus durch die farbigen Scheiben auf die Straße –, als plötzlich ein Schatten scharf vor dem Fenster stehen blieb. Ein Finger pochte an das bunte Glas, schroff schlug zugleich die Glocke an. »Voilà lui!« sagte Frau van der Stappen und stand auf. Ich wußte nicht, was sie meinte. Aber schon ging die Tür auf und er trat ein, starken, schweren Schritts, van der Stappen brüderlich umfangend: Verhaeren. Auf den ersten Blick erkannte ich von Bildern und Photographien sein unvergleichliches Gesicht. Nun ihr freundliches Geheimnis offenbar war, lächelten sie beide nicht mehr, van der Stappen und seine Frau, übermütig gaben sie es in herzlicher Heiterkeit preis, wie Kinder sich freuend der gelungenen List. Wie so oft war Verhaeren auch diesmal gerade bei ihnen Hausgast, und als sie hörten, daß ich ihn in der ganzen Gegend vergeblich gesucht, hatten sich beide mit raschem Blick verständigt, mir nichts davon zu sagen, sondern mich mit seiner Gegenwart zu überraschen.
Und nun stand er mir gegenüber, lächelnd über den gelungenen Streich, den er vernahm. Zum erstenmal fühlte ich den festen Griff seiner nervigen Hand, zum erstenmal faßte ich seinen klaren, gütigen Blick. Er kam – wie immer – gleichsam geladen mit Erlebnis und Enthusiasmus ins Haus. Noch während er fest zupackte beim Essen, erzählte er schon. Er war bei Freunden gewesen und in einer Galerie und flammte noch ganz von dieser Stunde. Immer kam er so heim, von überall und von allem gesteigert am zufälligen Erlebnis, und diese Begeisterung war ihm eine heilige Gewohnheit geworden; wie eine Flamme schlug sie immer und immer von den Lippen und wunderbar wußte er mit scharfen Gesten das Wort nachzuzeichnen, das Geschaute in Rhythmus und Gestalt sprechend aufzulösen. Mit dem ersten Wort griff er in die Menschen hinein, weil er ganz auf getan war, zugänglich jedem Neuen, nichts ablehnend, jedem einzelnen bereit. Er warf sich gewissermaßen gleich mit seinem ganzen Wesen aus sich heraus einem entgegen, und wie in dieser ersten Stunde selbst habe ich hundert- und hundertmal diesen stürmischen, überwältigenden Anprall seines Wesens an andern Menschen beglückt miterlebt. Noch wußte er nichts von mir, und schon war er voll Dankbarkeit nur für meinen Willen, schon bot er mir Vertrauen, bloß weil er hörte, daß ich seinem Werke verbunden war. Und unwillkürlich zerbrach vor dem vollen stürmischen Stoß seines Wesens jede Schüchternheit in mir. Ich fühlte mich frei wie noch nie bisher vor diesem fremden, offenen Menschen. Sein Blick, stark, stählern und klar, entriegelte das Herz.
Rasch ging das Essen hin. Noch heute, nach Jahr und Tag, sehe ich die drei Menschen so beisammen, wie mein Blick, aufschauend, sie damals umfing, van der Stappen, klein, rotbackig, üppig, wie ein Bacchus des Jordaens, Madame van der Stappen, groß und mütterlich, froh an der Freude der andern, und dann ihn, mit Wolfshunger einhauend und dazwischen sprechend mit seinen prachtvollen Gestikulationen und dadurch das Lebendige seiner Erzählung noch steigernd; ich sehe diese drei vergangenen Menschen, die sich brüderlich liebten und in deren Wort eine restlose Unbesorgtheit war. Nie hatte ich in Wien vorher eine Sphäre so tief innerlicher und reifer Heiterkeit gekannt wie an diesem kleinen Tisch, und ich fühlte, wie die Begeisterung, die ich niederzwang, mir innen fast schmerzlich wurde. Dann klangen die Gläser noch einmal, man rückte die Sessel weg, scherzend umarmten sich Verhaeren und van der Stappen. Es war vorbei.
Ich wollte mich nun verabschieden, so schön die Stunde war. Aber van der Stappen hielt mich zurück und verriet mir zum ersten Geheimnis das zweite. Er war eben am Werke, sich und Verhaeren einen alten Wunsch zu erfüllen und eine Büste des Dichters zu schaffen. Sie war schon weit gediehen; gerade heute sollte sie vollendet werden: zu dieser Vollendung nun wurde ich von allen aufs herzlichste eingeladen. Meine Gegenwart war van der Stappen, so sagte er, eine freundliche Gabe des Geschicks, denn er benötigte jemanden, der mit Verhaeren, dem allzu Unruhigen, spräche, während er ihm Modell sitze, damit sich die Starre des Gesichts belebe und die rasche Ermüdung gehemmt sei. Ich sollte Verhaeren erzählen von meinen Absichten, von Wien, von Belgien, von – was ich wollte, erzählen und erzählen, bis das Werk vollendet sei. Und dann sollten wir diese Vollendung gemeinsam feiern. Muß ich sagen, daß ich glücklich war, gegenwärtig sein zu dürfen, während ein großer Meister das Bildnis eines großen Menschen schuf?
Die Arbeit begann. Van der Stappen verschwand. Der elegante Redingote, mit dem (und seinem dazugehörigen Embonpoint) er seltsam an den Präsidenten Fallières gemahnte, war fort, als er zurückkam. Vor uns stand im weißen Kittel ein Arbeiter, die Ärmel hoch aufgestrafft, mit Muskeln wie ein Schlächter. Die bourgeoise Heiterkeit war von seinen Zügen abgefallen, wie der Schmiedegott Vulkan, rotleuchtend von der Glut seines Willens, trat er voran, unruhig zur Arbeit drängend, und führte uns ins Atelier. Tief und hell war der Raum, den ich schon früher im Gespräch mit ihm durchschritten. Ernster schienen nun seine Gestalten, und die weißen Marmorfiguren schwiegen wie versteinerte Gedanken in dem Raum. Vorne stand auf einem Sockel ein verhüllter Block. Van der Stappen löste die feuchten Tücher von dem Lehm. Verhaerens Antlitz tauchte heraus, an seinen gewaltsamen, eckigen Formen schon erkenntlich, aber noch fremd im letzten, gleichsam nur aus einer Erinnerung gestaltet. Van der Stappen trat vor, sah sein Werk und dann Verhaeren an, minutenlang wanderte sein Blick von einem zum andern. Dann trat er entschlossen zurück. Sein Auge stählte, seine Muskeln strafften sich. Die Arbeit begann.
Goethe hat einmal zu Zelter gesagt, die großen Kunstwerke kenne man nicht ganz, wenn man sie nicht auch im Werden gesehen. Und so, meine ich, kennt man auch ein menschliches Gesicht nicht gleich vom erstmaligen Begegnen. Man muß es entweder haben wachsen gesehen, aus seiner Kindheit in die Mannesjahre hinein oder wieder zurückfallen in sein Alter. Oder man muß es noch einmal in der Nachbildung sich haben formen gesehen, wo sich das einmal Gefestigte nochmals auflöst in seine Bestandteile, die Formen in ihre Proportionen, muß vergleichend Linie um Linie, Zug um Zug in ihrer wachsenden Existenz, ihren Neubau in der Kunst verfolgt haben. In diesen zwei Stunden bei van der Stappen hat sich das Antlitz Verhaerens mir gleichsam innen hinein in die Seele gemeißelt, und ich habe sein Gesicht so inne seitdem, als hätte ich es aus meinem Blute erschaffen. Von hundert und hundert Begegnungen sehe ich ihn zunächst immer so, wie ich ihn damals sah in dieser schöpferischen Stunde vor vielen Jahren, die hohe Stirn schon siebenfach durchpflügt von Falten böser Jahre, und darüber rostbraun den Sturz des schweren Gelocks. Knochig hart das Gefüge des Gesichts, streng umspannt von bräunlicher, männlicher, windgegerbter Haut, hart und felsig vorstoßend das Kinn, gewaltsam und groß, bedrohlich und fast böse der hängende Vercingetorix-Schnurrbart, die schmale Lippe mit tragischer Melancholie verschattend. Aber all diese harte Männlichkeit, wie wundervoll sanft war sie wieder aufgelöst von dem stahlgrauen Blick – couleur de mer –, der offen und blank vorbrach, wissend und alles Wissens froh, funkelnd im Widerschein des geliebten Lichts! Die Nervosität, sie saß in den Händen, in diesen schmalen, griffigen, feinen und doch kräftigen Händen, wo die Adern stark unter dem dünnen Fleisch pochten. Die ganze Wucht seines Willens aber stemmte sich vor in den breiten bäurischen Schultern, für die der kleine, nervige knochige Kopf fast zu klein schien: erst wenn er ausschritt, sah man seine Kraft. Wenn ich heute die Büste anblicke – nie ist van der Stappen Besseres gelungen als das Werk jener Stunde –, so weiß ich erst, wie wahr sie ist und wie voll sie sein Wesen faßt. Sie hat das Gebeugte dieses Hauptes, das doch nicht Müdigkeit war, sondern ein tiefes Lauschen, eine Gebeugtheit nicht durch Leben, sondern vor dem Leben, im tiefsten Wissen festgehalten. Wenn ich sie anblicke, weiß ich, dies war nicht mehr Bild, sondern schon Denkmal, ist Dokument einer dichterischen Größe, das Monument einer unvergänglichen Kraft. Damals aber, in jener seltsamen Stunde, war dies noch nichts als weicher, feuchter Ton, den die Spachtel schlug und der Finger glättete, war dies Werk nur Ahnung, Einschätzung und Vergleich, damals war er noch der Lebendige, in den Pausen strahlte von ihm der Atem des Gesprächs, und er lauschte mit jener tiefen Kraft seiner unversiegbaren Anteilnahme. Ohne daß wir es wußten, wurde es Abend, aber Meister van der Stappen ermüdete nicht. Immer öfter trat er zurück von seiner Plastik, ließ den Blick wandern von dem Lebendigen zum Gestalteten, das selbst nun ein Lebendiges zu werden begann, immer seltener rührten mehr die Hände an das Geschaffene. Allmählich heiterte sich sein gespannter Blick auf, verlor sein Auge die Unruhe, die flackernde, einmal noch griff er vergleichend hinüber und herüber. Dann band er die Schürze ab, stöhnte tief, und mit einem leichten Bedauern – ein Seufzer mehr als ein Wort – atmete er: » Fini .« Verhaeren stand auf. Er schlug dem kleinen stämmigen Mann, der keuchend und atemlos und doch lächelnd vor seinem Werk stand und nun wieder nicht mehr dem Vulkan in der Schmiede glich, sondern eher dem feisten Bohnenkönig des Jordaëns, beifällig auf die Schulter, sie lachten einander an und umarmten sich. Eine Herzlichkeit wie zwischen Knaben sprang nun auf zwischen diesen Männern, denen beiden schon ein wenig Schnee aus Bart und Haaren glänzte. Zum erstenmal fühlte ich hier eine hellere, freiere Menschlichkeit, als ich sie vordem zwischen Künstlern gekannt, die ich alle nur immer in Besorgtheit und eifernder Geschäftigkeit gesehen, und geheimnisvoll flog mich Sehnsucht an, diese Sicherheit und Freiheit des Lebens inmitten der Kunst mir selbst für mein Leben zu gewinnen. Noch band mir Ehrfurcht die Kehle, noch fühlte ich mich fern. Aber irgendein Teil meines Wesens war diesem Dichter schon gebunden und verfallen, als ich seine Hände, die herzlich gegebenen, zum Abschied und zum Versprechen baldiger erneuter Begegnung nahm. Ich wußte schon, es war Geschenk und große Gabe, solchen Menschen dienen zu dürfen, und wußte auch schon aus dunklem Gefühl, daß Wille und Bestimmung mich seinem Werke zugedacht. Dankbar nahm ich noch van der Stappens Hand und ging.
Es war schon dunkel im hohen Räume. Als ich mich an der Türe zurückwandte, sah ich im Schatten nur mehr weiß und hoch das Denkmal der ewigen Güte und Verhaeren davor, die Hand angeschmiegt an den hellen Stein. Erst später, viel später wußte ich, daß dieses Werk, dem zu seiner Vollendung einzig noch die große tragende Mittelfigur fehlte, in dieser einen Minute wahrhaft vollendet war, als Verhaeren an dem Sockel des Werkes der großen menschlichen Güte lehnte und für meinen Blick gleichsam unbewußt als Symbol mit seinem Sinn verschmolz.





























