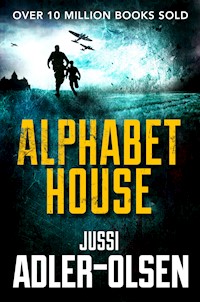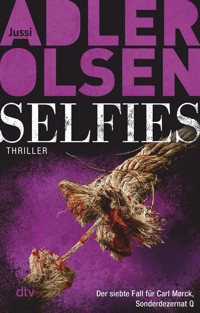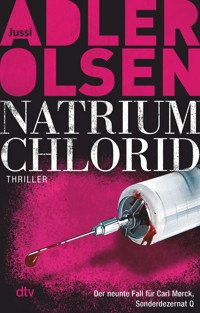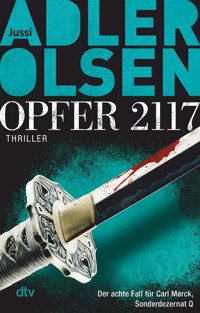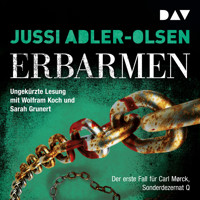9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Carl-Mørck-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine verwitterte Flaschenpost. Eine verzweifelte Botschaft. Eine fieberhafte Suche. Der dritte Fall für Kriminalkommissar Carl Mørck und sein Team des Sonderdezernats Q »›Was wird er mit uns machen, wenn er zurückkommt?‹ Die Angst flackerte auf in den Augen seines Bruders. Sie wussten, dass bald alles vorbei war. Aus diesem Bootshaus gab es kein Entrinnen.« Niemand hatte die verwitterte Flaschenpost beachtet, der Hilfeschrei in ihrem Inneren war ungehört verhallt. Jahre später gelangt das verblasste Schriftstück ins Sonderdezernat Q in Kopenhagen, die dänische Mordkommission für Cold Cases. Die Materialanalyse zeigt, dass die Botschaft mit menschlichem Blut geschrieben wurde. Die Entzifferung der Buchstaben führt Carl Mørck und seinen Assistenten Assad auf die Spur eines entsetzlichen Verbrechens – und in Bereiche der Gesellschaft, die ihnen beiden einigermaßen fremd erscheinen … Die große skandinavische Bestseller-Reihe – spannender geht es nicht »Eine große Thriller-Serie.« stern.de »Atemberaubend spannend und klug: Mit diesem Krimi übertrifft Adler-Olsen sogar die beiden hervorragenden Vorgänger.« Westdeutsche Zeitung »Jussi Adler-Olsens Markenzeichen sind ausführliche Schilderungen brutaler Verbrechen, genaue Charakterstudien seiner Figuren und eine gute Portion Humor.« Tobias Wenzel in ›NDR Kultur‹ Neben der Carl-Mørck-Reihe sind bei dtv außerdem folgende Titel von Jussi Adler-Olsen erschienen: - ›Das Alphabethaus‹ - ›Das Washington-Dekret‹ - ›Takeover‹ - ›Miese kleine Morde‹
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 754
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Jussi Adler-Olsen
Erlösung
Flaschenpost von P
Der dritte Fall für Carl Mørck, Sonderdezernat Q
Thriller
Aus dem Dänischen von Hannes Thiess
Gewidmet Kes, meinem Sohn.
Prolog
Der dritte Morgen war angebrochen, und inzwischen hing der Geruch von Teer und Tang schon in der Kleidung. Er hörte das grießige Eis, das unter den Planken des Bootshauses schwerfällig gegen die Pfähle schwappte. Erinnerungen an Tage wurden wach, als alles noch gut war.
Er hob seinen Oberkörper von dem Lager aus Papierabfällen und zog sich so weit nach vorn, dass er das Gesicht seines kleinen Bruders erkennen konnte. Noch im Schlaf wirkte er verfroren und gequält.
Bald würde er aufwachen und sich verwirrt umschauen. Dann würde er die straffen Lederriemen an den Handgelenken und um den Leib spüren und das Klirren der Kette hören, die ihn festhielt. Durch die Ritzen zwischen den geteerten Brettern würde er sehen, wie das Tageslicht und der Schnee darum kämpften, zu ihnen vorzudringen. Und dann würde er anfangen zu beten.
Unzählige Male schon hatte er die Verzweiflung in den Augen seines Bruders aufflackern sehen. Halb erstickt hinter dem Klebeband über seinem Mund hatte er immer wieder um Jehovas Gnade gewinselt.
Aber Jehova würdigte sie keines Blickes, das wussten sie beide, denn sie hatten von dem Blut getrunken. Von dem Blut, das der Wärter in ihre Wassergläser getröpfelt hatte. Und dann hatte er sie gezwungen, daraus zu trinken. Erst danach hatte er ihnen gesagt, was sie da getrunken hatten: Wasser mit dem verbotenen Blut. Jetzt waren sie auf ewig verdammt. Seither brannte die Scham in ihnen noch stärker als der Durst.
Was wird er mit uns machen? Was glaubst du?, hatten die ängstlichen Augen seines Bruders gefragt. Aber woher sollte er das wissen? Instinktiv fühlte er, dass bald alles vorbei sein würde.
Er lehnte sich zurück, und seine Augen suchten in dem schwachen Licht noch einmal den ganzen Raum ab. Er ließ den Blick an den Dachsparren und den vielen Spinnweben entlangwandern. Prägte sich alle Ecken und Kanten und Astvorsprünge ein. Registrierte die morschen Paddel und die Ruder, die hinter den Verstrebungen steckten, das verrottete Fischernetz, das schon vor langer Zeit seinen letzten Fang eingeholt hatte.
Dann fiel sein Blick auf die Flasche hinter ihm. Ein Sonnenstrahl war über das bläuliche Glas geglitten und hatte es aufblinken lassen.
Die Flasche war so nahe, und doch war es so schwer, an sie heranzukommen. Sie steckte eingekeilt zwischen den groben Planken, aus denen der Boden gezimmert war.
Er steckte die Finger zwischen die Bretter und versuchte, den Flaschenhals zu erreichen. Seine Hände waren steif gefroren vor Kälte. Wenn er die Flasche losbekam, würde er sie zerschlagen und mit den Scherben die Lederriemen an ihren Handgelenken aufscheuern. Sobald sie nachgaben, könnte er mit seinen tauben Händen die Schnalle im Rücken öffnen, das Klebeband vom Mund reißen und die Riemen vom Oberkörper und den Schenkeln abstreifen. Und sobald die Kette, die an den Lederriemen hing, ihn nicht länger festhielt, würde er losstürzen und seinen kleinen Bruder befreien. Ihn an sich ziehen und so lange im Arm halten, bis ihre Körper nicht mehr zitterten.
Anschließend würde er alle Kraft zusammennehmen und mit der Glasscherbe das Holz rings um die Tür bearbeiten. Versuchen, die Bretter auszuhöhlen, an denen die Scharniere saßen. Und sollte das Entsetzliche geschehen und das Auto kommen, bevor er fertig war, dann würde er den Mann erwarten. Hinter der Tür würde er ihm auflauern, in der Hand den zerbrochenen Flaschenhals. Ja, er würde es tun.
Er lehnte sich vor, faltete seine eiskalten Hände auf dem Rücken und bat um Vergebung für seine bösen Gedanken.
Aber dann kratzte und scharrte er weiter, um die Flasche freizubekommen. Kratzte und scharrte, bis sie sich schließlich so weit lockerte, dass er den Hals zu fassen bekam.
Er spitzte die Ohren.
War das ein Motor? Ja, eindeutig. Es klang wie der starke Motor eines großen Wagens. Aber kam das Auto näher oder fuhr es nur irgendwo da oben vorbei?
Das Brummen nahm zu, und er begann so fieberhaft an dem Flaschenhals zu zerren, dass seine Fingergelenke knackten. Dann wurde das Geräusch leiser. Waren das Windräder, die dort draußen rauschten und rumpelten?
Seine warme Atemluft bildete Dampfwolken vor seinem Gesicht. Im Moment fürchtete er sich eigentlich nicht. Der Gedanke an Jehova und seine Gnadengeschenke gab ihm Kraft.
Er biss die Zähne zusammen und machte weiter.
Als er die Flasche endlich losbekommen hatte, schlug er sie so fest auf die Bohlen, dass sein Bruder mit einem Ruck den Kopf hob und sich erschrocken umsah.
Immer wieder schlug er die Flasche auf die Bodenplanken. Aber mit den Händen auf dem Rücken konnte er einfach nicht weit genug ausholen. Und als seine Finger nicht mehr festzuhalten vermochten, ließ er die Flasche los, drehte seinen Kopf so weit er konnte nach hinten und starrte mit leerem Blick darauf.
Er sah zu, wie der Staub von den Dachbalken rieselte. Er schaffte es einfach nicht, diese verdammte Flasche zu zerbrechen. Diese lächerliche kleine Flasche. Aber es ging einfach nicht. Warum nur? Weil er von dem verbotenen Blut getrunken hatte? Hatte Jehova sie deshalb verlassen?
Er sah zu seinem Bruder hinüber, der sich in die Decke einrollte und langsam auf das Lager zurücksank. Sein Bruder sagte kein Wort. Versuchte nicht einmal, hinter dem Klebeband etwas zu murmeln.
Es dauerte lange, bis er alles eingesammelt hatte, was er brauchte. Am schwierigsten war es, sich angekettet so weit zu strecken, dass er mit den Fingerspitzen an den Teer zwischen den Dachbalken herankam. Alles andere hatte er in Reichweite: die Flasche, die Holzsplitter von den Bodenplanken und das Papier. Auf dem saß er.
Er streifte einen Schuh ab, hielt eine Hand über das Leder und stach sich mit dem Holzsplitter tief in die Handwurzel. Tränen schossen ihm in die Augen. Er ließ das Blut auf seinen Schuh tropfen, eine oder zwei Minuten lang. Dann riss er ein großes Stück Papier von der Unterlage, tauchte den Splitter in das Blut, drehte seinen Körper und zog so an der Kette, dass er gerade noch sehen konnte, was er hinter seinem Rücken schrieb. Es war schwer, in dieser Position zu schreiben, aber er versuchte, so gut wie möglich von ihrer Not zu berichten. Am Schluss unterschrieb er, rollte das Papier zusammen und schob es in die Flasche.
Er nahm sich Zeit, den Teerklumpen tief in den Flaschenhals zu stopfen. Ruckelte ihn hin und her und kontrollierte mehrmals, ob alles ordentlich verschlossen war.
Als er gerade fertig war, hörte er erneut Motorengeräusch. Diesmal gab es keinen Zweifel. Eine schmerzlich lange Sekunde sah er seinen Bruder an, dann streckte er sich mit aller Kraft zum Licht, das durch einen breiten Spalt in der Wand fiel – und damit zu der einzigen Öffnung, durch die er die Flasche pressen konnte.
Die Tür ging auf und in einer Wolke weißer Schneeflocken erschien ein riesiger Schatten.
Stille.
Dann ein Klatschen.
Die Flasche war frei.
1
Carl war schon unter besseren Bedingungen aufgewacht.
Als Erstes registrierte er den Säurespringbrunnen in seiner Speiseröhre. Er schlug die Augen auf, um nach etwas zu suchen, das dieses unangenehme Gefühl besänftigen könnte. Da entdeckte er auf dem Kissen neben sich das Gesicht einer Frau, mit Speichelfäden am Mund und verschmierter Wimperntusche.
Ach du Scheiße, dachte er, das ist ja Sysser. Krampfhaft versuchte er sich zu erinnern, was er sich wohl am vergangenen Abend geleistet haben mochte. Ausgerechnet Sysser. Seine wie ein Schlot rauchende Nachbarin. Die schnell sprechende und bald pensionierte »Frau für alle Fälle« aus dem Rathaus Allerød.
Ein entsetzlicher Gedanke kam ihm, und er hob ganz langsam die Bettdecke hoch. Erleichtert stellte er fest, dass er immerhin seine Unterhose anhatte.
»Verdammt«, stöhnte er und schob Syssers sehnige Hand von seinem Brustkorb. Solche Kopfschmerzen hatte er nicht mehr gehabt, seit Vigga ausgezogen war.
»Bitte keine Details«, sagte er zu Morten und Jesper unten in der Küche. »Erzählt mir einfach nur, was die Frau dort oben auf meinem Kopfkissen zu suchen hat.«
»Hey, die Alte wiegt ’ne Tonne«, unterbrach ihn sein Pflegesohn, öffnete einen Karton Orangensaft und hob ihn an den Mund. Den Tag, an dem Jesper lernte, aus einem Glas zu trinken, konnte nicht mal Nostradamus vorhersagen.
»Ja, also entschuldige, Carl«, sagte Morten. »Aber sie konnte ihre Schlüssel nicht finden, und du warst ja sowieso schon weg vom Fenster, und da hab ich gedacht …«
Das war das letzte Mal, dass ich bei einer von Mortens Grillpartys mitgemacht hab, schwor sich Carl und warf einen Blick ins Wohnzimmer zu Hardys Bett.
Als gemütliches Zuhause empfand er das hier nicht mehr, seit sie vor vierzehn Tagen seinen ehemaligen Kollegen in den häuslichen Gemächern installiert hatten. Nicht, weil das Krankenbett ein Viertel der Grundfläche des Wohnzimmers einnahm und die Aussicht zum Garten verdeckte, auch nicht, weil die Gestelle mit den diversen Tüten daran Carl unangenehm waren oder weil Hardys gelähmter Körper permanent übel riechende Gase verströmte – das alles war nicht der Grund. Nein, es war dieses konstant schlechte Gewissen, das alles veränderte. Dass Carls Beine ihre Funktion erfüllten und er, wann immer ihm der Sinn danach stand, abhauen konnte. Und zu diesem schlechten Gewissen gesellte sich das Gefühl, etwas wiedergutmachen zu müssen. Für Hardy da sein zu müssen. Etwas für diesen gelähmten Mann tun zu müssen.
»Nun mal ganz ruhig«, war ihm Hardy zuvorgekommen, als sie vor ein paar Monaten hin und her überlegt hatten, welche Vor- und Nachteile es hätte, wenn sie ihn aus der Klinik für Wirbelsäulenverletzungen in Hornbæk zu Carl nach Hause holten. »Hier oben vergeht durchaus mal ’ne ganze Woche, ohne dass ich dich sehe. Glaubst du nicht, dass ich da deine Aufmerksamkeit ein paar Stunden entbehren kann, wenn ich zu dir nach Hause ziehe?«
Aber die Sache war doch die: Hardy war trotzdem immer da, selbst wenn er so still vor sich hinschlummerte wie gerade jetzt. Physisch. In Gedanken. Bei der Alltagsplanung. In allen Worten, die plötzlich viel sorgfältiger überlegt sein wollten. Das war anstrengend. Dabei sollte Zuhausesein doch eigentlich nicht anstrengend sein, verdammt noch mal.
Hinzu kamen all die praktischen Details. Wäsche waschen, Bettzeug wechseln, sich mit Hardys gewaltigem Körper herumplagen. Der Einkauf, der Kontakt mit den Krankenschwestern und Ämtern. Essen kochen. Na ja, um das meiste kümmerte sich Morten. Aber das war eben nicht alles.
»Hast du gut geschlafen, altes Haus?«, fragte er vorsichtig, als er sich Hardys Lager näherte.
Sein ehemaliger Kollege öffnete die Augen und versuchte zu lächeln. »Tja, so ist das, Carl, der Urlaub ist um, die Arbeit ruft. Die letzten zwei Wochen sind wie im Flug vergangen. Aber Morten und ich werden das schon schaffen. Hauptsache, du vergisst nicht, die Kumpels von mir zu grüßen, klar?«
Carl nickte. Es musste verdammt hart sein für Hardy, verdammt hart. Wenn man doch nur einen Tag mit ihm tauschen könnte.
Nur einen einzigen Tag für Hardy.
Abgesehen von den Wachhabenden in ihrem Käfig sah Carl keine Menschenseele. Der Hof des Präsidiums war wie leer gefegt und der Säulengang wintergrau und abweisend.
»Was zum Teufel ist denn hier los?«, rief er, als er kurz darauf den Kellerflur entlangging.
Er hatte einen lautstarken Empfang erwartet, den Geruch von Assads Pfefferminzkleister oder zumindest eine von Roses gepfiffenen Versionen der großen Klassiker. Aber auch hier unten war alles wie ausgestorben. Waren die in den vierzehn Tagen, die er sich für Hardys Umzug freigenommen hatte, einfach alle von Bord gegangen?
Er betrat Assads Kämmerchen und sah sich irritiert um. Keine Fotos von alten Tanten, kein Gebetsteppich, keine Döschen mit klebrigem Gebäck. Sogar die Neonröhren an der Decke waren ausgeschaltet.
Er ging über den Flur und machte in seinem Büro Licht. Sein sicheres Terrain, bis zu dem das Rauchverbot nicht vorgedrungen war. Der Ort, wo er immerhin schon drei Fälle gelöst hatte – und erst zwei hatte aufgeben müssen. Wo alle alten Fälle, das Arbeitsgebiet des Sonderdezernats Q, in drei zierlichen Aktenstapeln überschaubar und ordentlich auf seinem Schreibtisch gelegen hatten, vorsortiert nach seinem unfehlbaren System.
Abrupt blieb er stehen. Der blank polierte Schreibtisch war nicht wiederzuerkennen. Kein Staubkörnchen. Kein einziger dicht beschriebener DIN-A4-Bogen, auf den man seine müden Beine legen und den man anschließend in den Papierkorb knüllen konnte. Kurz gesagt: Alles war wie leer gefegt.
»Rose!«, brüllte er mit so viel Nachdruck, wie er aufbringen konnte.
Aber seine Stimme verhallte in den Kellergemächern.
Er war der letzte Mohikaner, Kevin allein zu Haus, der Hahn ohne Hühnerhof. Der König, der für ein Pferd sein Königreich hergeben würde.
Er griff nach dem Telefon und gab die Nummer von Lis ein, oben in der Mordkommission.
Nach fünfundzwanzig Sekunden wurde abgenommen.
»Dezernat A, Sekretariat«, hörte er die Stimme von der Sørensen – der Kollegin, die Carl von allen wohl am feindlichsten gesonnen war.
»Frau Sørensen«, säuselte er. »Carl Mørck hier. Ich sitze mutterseelenallein hier unten. Was ist los? Wissen Sie zufällig, wo Assad und Rose sind?«
Es war noch keine Millisekunde vergangen, da hatte die blöde Kuh den Hörer aufgeknallt.
Er stand auf und nahm Kurs auf Roses Domizil ein Stück weiter den Gang hinunter. Vielleicht befanden sich die verschwundenen Akten ja dort. Als er ihr Büro betrat, traf ihn fast der Schlag: Tatsächlich sprangen ihm die Unterlagen sofort entgegen – allerdings nicht als Aktenstapel, sondern quasi als Tapete. Mindestens zehn Holzfaserplatten bedeckten die Wand zwischen Assads und Roses Büros, und diese Platten waren zugepflastert mit allen Fällen, die bis vor vierzehn Tagen noch auf seinem Schreibtisch gelegen hatten.
Eine Stehleiter aus gelblichem Lärchenholz zeigte an, wo der letzte Fall angepinnt worden war. Es war der zweite Fall, den sie hatten aufgeben müssen. Der zweite der ungelösten Fälle in Folge.
Carl trat einen Schritt zurück, um sich einen Überblick über diese Papierhölle zu verschaffen. Was zum Teufel hatten seine Fälle an dieser Wand zu suchen? War bei Rose und Assad eine Sicherung durchgeknallt? Waren sie deshalb verduftet?
Feiges Pack.
Im zweiten Stock war es genau dasselbe. Keine Menschenseele. Sogar Frau Sørensens Platz hinter der Theke war gähnend leer. Das Büro des Chefs, das des Stellvertreters, die Kaffeeküche, der Konferenzraum: nichts.
Was war denn verdammt noch mal hier los? Hatte es Bombenalarm gegeben? War die Polizeireform inzwischen so weit gediehen, dass man das Personal auf die Straße gesetzt hatte, um die Gebäude meistbietend zu verkaufen? War der neue Justizminister Amok gelaufen?
Er kratzte sich am Hinterkopf, griff nach dem Hörer und rief die Wache an.
»Carl Mørck hier. Wo zum Teufel sind die Kollegen hin verschwunden?«
»Die meisten haben sich im Gedenkhof versammelt.«
»Im Gedenkhof? Wieso denn das? Meines Wissens gedenken wir der Internierung der dänischen Polizei am 19. September. Das ist noch mehr als ein halbes Jahr hin. Was wollen die denn alle da?«
»Die Polizeipräsidentin möchte einigen Dezernaten die Reformanpassungen erläutern. Du musst schon entschuldigen, Carl, aber wir dachten, das wüsstest du.«
»Ja, aber ich hab doch gerade mit Frau Sørensen gesprochen, die hat keinen Ton gesagt.«
Carl schüttelte den Kopf. Das war doch total durchgeknallt. Bis er unten im Hof war, hatte das Justizministerium den ganzen Kram doch schon wieder geändert.
Er starrte den Sessel des Chefs der Mordkommission an. Verlockend weich. Dort konnte man zumindest mal ohne Zuschauer die Augen schließen.
Zehn Minuten später wachte er auf. Lars Bjørn, der stellvertretende Leiter der Mordkommission, hatte ihm die Hand auf die Schulter gelegt. Assads Kulleraugen lächelten nur zehn Zentimeter vor seinem Gesicht.
Schluss mit dem Frieden, aus und vorbei.
»Komm, Assad«, sagte er und drückte sich aus dem Sessel hoch. »Wir gehen runter in den Keller und holen ruckzuck die Papiere von den Wänden, ja? Wo ist eigentlich Rose?«
Assad schüttelte den Kopf. »Das geht nicht, Carl.«
Carl stopfte sich das Hemd in die Hose. Verdammt, was sagte der Mann da? Natürlich ging das. Hatte er, Carl, etwa nicht das Sagen?
»Nun komm schon. Und bring Rose mit. Und zwar JETZT.«
»Der Keller ist ab sofort gesperrt«, belehrte ihn Lars Bjørn. »Aus der Isolierung der Rohre rieselt Asbest. Die Gewerbeaufsicht war da. So sieht es aus.«
Assad nickte. »Ja. Wir mussten unsere Sachen hier hochbringen. Und wir sitzen in diesem Raum natürlich nicht besonders gut. Aber für dich haben wir einen schicken Stuhl aufgetrieben«, ergänzte er, als ob das ein Trost wäre. »Ach ja, und wir sind nur zu zweit. Rose hatte keine Lust, hier oben zu sitzen, deshalb hat sie ein verlängertes Wochenende eingelegt. Sie kommt aber nachher noch.«
Genauso gut hätten sie ihm in seine edleren Körperteile treten können.
2
Sie hatte in die Flammen gestarrt, bis die Kerzen heruntergebrannt waren und Dunkelheit sie umgab. Er war schon öfter einfach weggefahren, aber noch nie an ihrem Hochzeitstag.
Sie holte tief Luft und stand auf. Inzwischen hatte sie es sich abgewöhnt, am Fenster zu stehen und zu warten und seinen Namen auf die von ihrem Atem beschlagene Scheibe zu schreiben.
Es hatte nicht an Warnungen gefehlt, damals, als sie sich kennengelernt hatten. Ihre Freundin hatte vorsichtige Zweifel geäußert, und ihre Mutter hatte es ihr unumwunden gesagt. Er sei zu alt für sie. In seinen Augen funkele etwas Böses. Er sei ein Mann, den man nicht einschätzen könne. Ein Mann, auf den kein Verlass sei.
Deshalb hatte sie ihre Mutter und ihre Freundin schon lange nicht mehr gesehen. Und deshalb wuchs in dem Maße, in dem ihr Bedürfnis nach Kontakt größer wurde, ihre Verzweiflung. Mit wem sollte sie reden? Es gab doch niemanden mehr.
Jetzt saß sie in einem leeren, aufgeräumten Zimmer und presste die Lippen zusammen. Der Druck der ungeweinten Tränen nahm zu.
Da hörte sie ihren Sohn, er bewegte sich. Sie gewann ihre Fassung zurück, wischte sich die Nasenspitze mit dem Zeigefinger ab und holte zweimal tief Luft.
Wenn ihr Mann sie betrog, dann sollte er auch nicht mehr auf sie zählen können.
Das Leben hatte mit Sicherheit mehr zu bieten.
Ihr Mann kam so lautlos ins Schlafzimmer, dass ihn nur sein Schatten an der Wand verriet. Breite Schultern und offene Arme. Warm und nackt legte er sich neben sie und zog sie wortlos an sich.
Sie hatte schöne Worte erwartet und eine spitzfindige Entschuldigung. Vielleicht hatte sie den schwachen Duft einer fremden Frau befürchtet und wegen des schlechten Gewissens ein Zögern an den falschen Stellen. Stattdessen umarmte er sie, drehte sie leidenschaftlich herum und zerrte ihr die Sachen vom Leib. Sein vom Mondlicht beschienenes Gesicht erregte sie. Die Zeit des Wartens war vorbei, und Kummer und Zweifel waren wie weggeblasen.
Es war ein halbes Jahr her, seit er zuletzt so gewesen war.
Gott sei Dank, dass es wieder passierte.
»Schatz, ich werde eine Weile verreisen«, sagte er ohne Vorwarnung am nächsten Morgen beim Frühstück und streichelte dabei die Wange des Kindes. Zerstreut, als wäre das, was er da gerade gesagt hatte, völlig bedeutungslos.
Sie runzelte die Stirn und spitzte die Lippen, um die unausweichliche Frage noch einen Moment zurückzuhalten. Dann legte sie die Gabel auf den Teller und blickte konzentriert auf Rührei und Bacon. Die Nacht war lang gewesen. Sie spürte noch ihren Unterleib, seine Zärtlichkeiten und liebevollen Blicke hatten sie lange nachglühen lassen. Bis eben gerade. Aber jetzt drang die bleiche Märzsonne als unwillkommener Gast ins Zimmer und beleuchtete unmissverständlich die Tatsache: Ihr Mann war nur auf einen Sprung zu Hause. Wieder einmal.
»Warum kannst du mir nicht sagen, was du arbeitest? Ich bin doch deine Frau.«
Er hatte das Besteck schon in der Hand, hielt aber sofort inne. Schon wurden seine Augen dunkler.
»Nein, ich meine es ernst«, fuhr sie fort. »Wie viel Zeit soll denn diesmal vergehen, bis du wieder so bist wie heute Nacht? Sind wir schon wieder an dem Punkt, wo ich nichts von dir weiß, wo ich keine Ahnung habe, was du tust? Wo du nicht mehr greifbar bist für mich, selbst wenn du da bist?«
Er sah ihr direkt in die Augen. »Hast du nicht von Anfang an gewusst, dass ich nicht über meine Arbeit sprechen kann?«
»Doch, aber …«
»Dann frag auch nicht andauernd nach.«
Er ließ das Besteck auf den Teller fallen und wandte sich mit einem gezwungenen Lächeln ihrem Sohn zu.
Sie versuchte, tief und ruhig weiterzuatmen, aber in ihrem Inneren rumorte die Verzweiflung. Es stimmte ja. Schon lange vor der Hochzeit hatte er ihr klargemacht, dass er beruflich mit Dingen befasst war, über die er nicht sprechen durfte. Vielleicht ging es um nachrichtendienstliche Aufgaben oder etwas in der Art, sie erinnerte sich nicht mehr genau. Aber soweit sie wusste, führten auch Menschen, die für den Nachrichtendienst arbeiteten, neben ihrem Job ein einigermaßen normales Leben. Und normal war ihr Leben in keiner Hinsicht. Oder gehörten Alternativaufgaben wie Seitensprünge etwa zum Berufsalltag eines Geheimdienstlers? Denn um etwas anderes konnte es sich doch wohl kaum handeln.
Sie räumte die Teller zusammen und überlegte, ob sie ihm auf der Stelle ein Ultimatum setzen sollte. Und damit seine Wut riskieren? Eine Wut, die sie fürchtete, aber von deren wahrem Ausmaß sie keine Ahnung hatte.
»Wann sehe ich dich denn wieder?«, fragte sie.
Er lächelte. »Kann gut sein, dass ich nächsten Mittwoch wieder da bin. Dieser Job dauert normalerweise acht bis zehn Tage.«
»Ach so. Dann bist du also gerade rechtzeitig zum Bowlingturnier zurück«, konstatierte sie spitz.
Er stand auf, zog sie mit dem Rücken an seinen Oberkörper und faltete seine Hände unter ihrer Brust. Wenn sie seinen Kopf auf ihrer Schulter fühlte, hatte das bei ihr bisher immer wohliges Schaudern ausgelöst. Heute zog sie sich zurück.
»Ja«, sagte er. »Zum Turnier bin ich wieder da. Und dann können wir das von heute Nacht gleich wiederholen. Einverstanden?«
Als er gegangen und das Geräusch seines Wagens verklungen war, starrte sie lange mit verschränkten Armen vor sich hin. Ein Leben in Einsamkeit war eine Sache. Aber nicht zu wissen, wofür man diesen Preis bezahlte, war etwas ganz anderes. Doch die Chance, einen Mann wie den ihren des Ehebruchs zu überführen, war minimal. Das wusste sie, obwohl sie es nie versucht hatte. Sein Revier war groß, und er war ein vorsichtiger Mensch, alles in ihrem gemeinsamen Leben bewies das. Pensionen, Versicherungen, Fenster und Türen, Koffer und Gepäck, alles wurde zweifach gecheckt. Auf dem Tisch herrschte immer Ordnung, nie lagen Zettel oder Quittungen in Taschen oder Schubladen herum. Er war ein Mann, der nicht viele Spuren hinterließ. Selbst sein Geruch hing kaum mehr als wenige Sekunden in der Luft, nachdem er ein Zimmer verlassen hatte. Wie sollte sie ihm jemals eine Affäre nachweisen? Es sei denn, sie setzte einen Privatdetektiv auf ihn an. Aber wovon sollte sie den bezahlen?
Sie schob die Unterlippe vor und pustete sich ganz langsam warme Luft ins Gesicht. Das war eine Angewohnheit von ihr, das hatte sie schon immer gemacht, wenn sie angespannt war oder eine wichtige Entscheidung treffen musste. Damals, beim Kauf ihres Konfirmationskleides, vor den höchsten Hindernissen beim Springreiten und bevor sie ihrem Mann das Jawort gegeben hatte. Manchmal sogar, wenn sie einfach nur auf die Straße ging, um zu sehen, ob sich das Leben in dem milden Licht dort draußen anders anfühlte.
3
Rundheraus gesagt: Der ebenso kräftige wie gutmütige Sergeant David Bell machte sich gern einen lauen Lenz. Saß da und sah den Wellen zu, die gegen die Klippen donnerten. Ganz oben am äußersten Zipfel Schottlands, in John O’Groats, wo die Sonne nur halb so lange schien, aber doppelt so schön. Hier war David geboren und hier wollte er sterben – wenn es mal so weit war.
Die raue See war Davids Element. Warum also sollte er seine Zeit sechzehn Meilen weiter südlich vertun, in einem Büro auf der Polizeiwache in der Bankhead Road in Wick? Nein, diese verschlafene Hafenstadt bedeutete ihm nichts, und daraus machte er auch keinen Hehl.
Deshalb schickten seine Vorgesetzten auch ihn los, wenn es irgendwo in den kleinen Orten im Norden Ärger gab. Dann fuhr er mit dem Streifenwagen vor, drohte den testosterongesteuerten Typen damit, einen Officer aus Inverness herbeizurufen, und schon herrschte wieder Ruhe. Da oben wollte man keine Fremden, die sollten ihre Nasen nicht in die Angelegenheiten anderer Leute stecken. Dann schon lieber Pferdepisse im Bier, in ihrem guten alten Orkney Skull Splitter. Wegen der Fähre zu den Orkneys hatten sie nun wirklich oft genug Durchreisende.
Wenn sich die Gemüter wieder beruhigt hatten, warteten die Wellen auf ihn, und wenn es etwas gab, wofür sich Sergeant Bell reichlich Zeit nahm, dann für sie.
David Bells Liebe zum Meer war legendär – und ohne sie wäre die Flasche sonst wo gelandet. Aber da dieser Sergeant nun mal in seiner frisch gebügelten Uniform auf dem Felsen saß, den Wind im Haar und in der Uniformmütze, konnte man sie ebenso gut ihm geben.
Und das tat man dann auch.
Die Flasche hatte in den Maschen des Netzes festgesteckt und schwach geblinkt, als auf dem Trawler der Fang eingeholt wurde. Vom Meerwasser war das Glas im Laufe der Zeit matt geworden. Der jüngste Mann an Bord des Kutters ›BrewDog‹ hatte sofort gesehen, dass es keine gewöhnliche Flasche war.
»Schmeiß sie wieder ins Meer, Seamus!«, rief der Skipper, als er den Zettel in der Flasche entdeckte. »Solche Flaschen bringen Unglück. Bei uns heißen die Flaschenpest. Der Teufel steckt in der Tinte und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Du kennst doch die Geschichten!«
Aber der junge Seamus kannte die Geschichten nicht und beschloss, David Bell die Flasche zu geben.
Als der Sergeant endlich nach Wick zurückkam, hatte einer der ortsansässigen Alkis schon geraume Zeit in den Büroräumen der Wache gewütet, und die Kollegen hatten kaum noch Kraft, den Idioten auf den Fußboden zu pressen. Und so flog die Flasche aus David Bells Jackentasche, als er die Uniformjacke beiseitewarf, um die Kollegen zu unterstützen. Er hob die Flasche nur rasch auf und stellte sie auf die Fensterbank. Dann pflanzte er sich dem Besoffenen auf den Brustkorb, um da mal ein bisschen Luft rauszupressen. Aber Bell hatte nicht damit gerechnet, dass er es hier mit einem waschechten Wikingernachfahren aus Caithness zu tun hatte, der ihm unverhofft einen kräftigen Stoß in die Weichteile versetzte. Bells Glocken gerieten dabei dermaßen in Schwingung, dass sich jeder Gedanke an die Flasche in den scharfen blauen Blitzen verlor, die sein gemartertes Nervensystem aussandte.
Und so stand die Flasche sehr, sehr lange unbeachtet in der sonnigen Ecke der Fensterbank. Niemand nahm Notiz von ihr, und niemanden kümmerte es, dass das Sonnenlicht und das Kondenswasser, das sich allmählich auf der Innenseite des Glases bildete, dem Papier im Flascheninneren immer stärker zusetzten.
Niemand nahm sich die Zeit, die oberste Zeile des leicht verwischten und verblassenden Textes zu lesen, und deshalb fragte sich auch niemand, was das Wort »HJÆLP« womöglich bedeuten könnte.
Die Flasche gelangte erst wieder in Menschenhände, als so ein Scheißkerl, der sich über einen Bußgeldbescheid wegen Falschparkens aufregte, eine Sintflut von Viren auf das Intranet der Polizeiwache Wick losließ. In solchen Situationen rief man die EDV-Expertin Miranda McCulloch an. Vor ihr ging man immer dann auf die Knie, wenn Pädophile ihre Schweinereien verschlüsselten, wenn Hacker die Spuren ihrer Transaktionen beim Online-Banking verschleierten, wenn gekündigte Arbeitnehmer die Festplatten ihrer Firmen löschten.
Als Miranda McCulloch kam, wurde ihr wie einer Königin aufgewartet. Sie bekam ihr eigenes Büro, in dem schon eine Thermoskanne mit heißem Kaffee bereitstand, das Fenster weit aufgerissen und das Radio auf BBC Scotland eingestellt war.
Und da der Wind die Gardine vor dem Fenster bauschte, entdeckte sie die Flasche gleich an ihrem ersten Tag in dem Büro.
Was für eine schöne kleine Flasche, dachte sie und wunderte sich kurz über den Schatten im Innern, bevor sie sich weiter durch die Zahlenkolonnen der aggressiven Codes pflügte. Als sie sich am dritten Tag zufrieden von ihrem Platz erhob und ans Fenster trat, meinte sie, die Virustypen erfolgreich identifiziert zu haben. Sie nahm die kleine Flasche in die Hand und stellte überrascht fest, dass sie viel schwerer war als erwartet. Und warm fühlte sie sich an.
»Was ist denn da drin?«, fragte sie die Sekretärin nebenan. »Ist das ein Brief?«
»O Gott, die Flasche«, kam die Antwort. »Die hat, glaube ich, David Bell da mal hingestellt. Vermutlich nur so, in Gedanken. Wieso, was soll da drin sein?«
Miranda hielt die Flasche ins Licht. Waren das Buchstaben auf dem Zettel? Wegen des Kondenswassers auf der Innenseite war das schlecht zu erkennen.
Sie drehte und wendete die Flasche eine Weile. »Wo ist denn dieser David Bell, arbeitet der hier auf dem Revier?«
Die Sekretärin schüttelte den Kopf. »Leider nein. David ist vor ein paar Jahren etwas außerhalb von Wick ums Leben gekommen. Sie hatten einen Wagen verfolgt, dessen Fahrer Fahrerflucht begangen hatte. Schreckliche Geschichte. David war so ein netter Kerl.«
Miranda nickte. Sie hörte nur mit einem Ohr zu. Inzwischen war sie sicher, dass da etwas auf dem Papier stand. Aber das war es nicht, was ihre Aufmerksamkeit erregte, sondern das, was sich da am Flaschenboden befand.
Eine geronnene Masse, die verdammt nach Blut aussah.
»Glaubst du, ich darf die Flasche mitnehmen? Gibt es hier jemanden, den ich fragen kann?«
»Frag Emerson. Er ist ein paar Jahre lang mit David gefahren. Der sagt bestimmt Ja.« Die Sekretärin wandte sich zum Flur um. »Hey, Emerson«, rief sie in einem Ton, dass die Scheiben klirrten. »Komm doch mal.«
Miranda begrüßte einen kompakten, gutmütig aussehenden Kerl mit traurigen Augen.
»Ob du die mitnehmen darfst? Na klar doch. Ich will jedenfalls nichts damit zu tun haben.«
»Wie meinst du das?«
»Na ja, vielleicht ist das nur dummes Zeug. Aber unmittelbar bevor David verunglückte, war ihm die Flasche wieder in den Sinn gekommen, und er hatte gemeint, er müsse sich endlich mal darum kümmern, dass sie geöffnet würde. Er hatte sie von einem Fischerlehrling oben in dem Dorf, wo er herkommt. Der Junge und der Kutter waren einige Jahre später mit Mann und Maus abgesoffen. Deshalb fand David wohl, er sei es dem Jungen schuldig, nachzusehen, was sich da drin befand. Aber David starb ja, ehe er dazu gekommen war. Und das ist doch bestimmt kein gutes Omen, oder?« Emerson schüttelte den Kopf. »Nimm sie mit, aber ich sag’s dir gleich: An der Flasche hängt nichts Gutes.«
Am selben Abend saß Miranda in ihrem Reihenhaus in Edinburghs Vorort Granton und starrte die Flasche an. Circa fünfzehn Zentimeter hoch, leicht bläulich, etwas abgeflacht und mit langem Hals. Könnte ein Parfumflakon sein, war dafür aber etwas groß. Vielleicht eher eine Eau-de-Cologne-Flasche, und wahrscheinlich ziemlich alt. Sie klopfte daran. Solides Glas.
Miranda lächelte. »Was für ein Geheimnis birgst du Schätzchen wohl?« Sie nippte am Rotwein, und dann fing sie an, den Klumpen, der den Flaschenhals verschloss, mit dem Korkenzieher herauszupulen. Das Zeug roch nach Teer, aber durch die Zeit im Wasser war der Ursprung des Materials schwer zu bestimmen.
Sie versuchte, das Papier herauszufischen, ohne Erfolg. Sie drehte und wendete die Flasche, klopfte auf den Flaschenboden, aber das Papier bewegte sich keinen Millimeter. Da nahm sie die Flasche mit in die Küche und schlug ein paarmal mit dem Fleischklopfer darauf.
Das half. Die Flasche zersplitterte in bläuliche Kristalle, die wie geborstenes Eis durch die Küche flogen.
Sie starrte auf das Papier, das nun auf dem Hackbrett lag, und spürte, wie sich ihre Augenbrauen zusammenzogen. Sie ließ den Blick über die Glasscherben wandern und atmete tief durch.
Vielleicht war das, was sie eben getan hatte, nicht sehr schlau gewesen. »Ja«, bestätigte ihr Kollege Douglas aus der technischen Abteilung. »Das ist zweifellos Blut. Das hast du ganz richtig erkannt. Die Art und Weise, wie das Blut vom Papier aufgesogen wurde, ist charakteristisch. Besonders hier unten, wo die Unterschrift total verwischt ist. Und die Farbe ist auch ziemlich typisch.« Vorsichtig faltete er das Papier mit seiner Pinzette auseinander. Dann leuchtete er es noch einmal mit diesem blauen Licht ab. Blutspuren auf dem gesamten Papier. Jeder Buchstabe leuchtete diffus.
»Das ist mit Blut geschrieben?«
»Zweifelsfrei.«
»Und du glaubst wie ich, dass die Überschrift ein Hilferuf ist. Jedenfalls klingt es so.«
»Ja, das glaube ich«, antwortete er. »Aber ich bezweifle, dass wir außer der Überschrift etwas retten können. Der Brief ist ziemlich mitgenommen. Außerdem ist er wohl schon einige Jahre alt. Wir müssen ihn zuerst mal präparieren und konservieren. Anschließend kommen wir einer Datierung vielleicht näher. Und natürlich muss uns jemand sagen, was für eine Sprache das ist.«
Miranda nickte. Sie hatte schon einen Vorschlag.
Isländisch.
4
»Die Gewerbeaufsicht ist da, Carl.« Rose stand in der Tür und machte keine Anstalten, sich von dort wegzubewegen.
Der Mann von der Gewerbeaufsicht war klein und trug einen tadellos gebügelten Anzug. Er stellte sich als John Studsgaard vor. Inklusive einer kleinen braunen Aktenmappe, die unter seinem Arm klemmte, wirkte er durch und durch zuverlässig. Freundliches Lächeln, ausgestreckte Hand. Der Eindruck verpuffte in dem Moment, als er den Mund aufmachte.
»Bei der letzten Inspektion hat man hier auf dem Gang und im Kriechkeller Asbeststaub entdeckt. Aus dem Grund müssen die Rohre isoliert werden, damit man sich in den Kellerräumen sicher aufhalten kann.«
Carl sah zur Decke. Scheißrohr. Das einzige im gesamten Keller und dann so ein Aufstand.
»Ich sehe, dass Sie hier unten ein Büro eingerichtet haben«, fuhr der Papiertiger fort. »Entspricht das den Nutzungsbestimmungen des Präsidiums und der Brandschutzordnung?« Aus seiner Aktenmappe zog er einen Stoß Papiere, die ganz offensichtlich bereits die Antworten auf seine Fragen enthielten.
»Welche Büros?«, fragte Carl. »Meinen Sie den Archivrechenschaftsablageraum hier?«
»Archivrechenschaftsablageraum?« Eine Sekunde wirkte der Mann etwas irritiert, dann übernahm wieder der Bürokrat in ihm. »Der Terminus ist uns nicht bekannt. Aber es ist ja offensichtlich, dass Mitarbeiter des Präsidiums hier unten einen Großteil ihres Arbeitstages verbringen beziehungsweise Tätigkeiten verrichten, die mit ihrer polizeilichen Arbeit in Verbindung stehen.«
»Denken Sie dabei an die Kaffeemaschine? Die können wir ohne weiteres entfernen.«
»Keineswegs. Ich denke an alles hier. Die Schreibtische, die Pinnwände, die Regale, Haken, Schubladen mit Papier und Büroartikeln, den Fotokopierer.«
»So, so. Und wissen Sie auch, wie viele Stufen es bis in den zweiten Stock sind?«
Der Mann von der Gewerbeaufsicht schwieg.
»Nun. Dann wissen Sie vielleicht auch nicht, dass wir hier im Präsidium chronisch unterbesetzt sind und dass es halbe Tage in Anspruch nehmen würde, wenn wir jedes Mal zwei Stockwerke hochsausen müssten, nur um etwas aus dem Archiv zu kopieren. Lassen Sie etwa lieber Horden von Mördern frei herumlaufen als uns unsere Arbeit erledigen?«
John Studsgaard wollte gerade protestieren, aber Carl wehrte ab. »Wo ist dieser Asbest, von dem Sie reden?«
Der Mann runzelte die Stirn. »Ich habe nicht vor, das mit Ihnen zu diskutieren. Wir haben eine Asbestverunreinigung festgestellt. Und Asbest ist eine krebserregende Substanz. Das wischt man nicht einfach mit einem Putzlappen weg.«
»Rose, bist du hier gewesen, als die Aufsicht zur Inspektion kam?«, fragte Carl.
Sie deutete den Korridor hinunter. »Die haben da unten irgend so einen Staub gefunden.«
»Assad!«, brüllte Carl so laut, dass der Mann unwillkürlich einen Schritt zurücktrat.
»Komm, Rose, zeig es mir«, sagte er, als Assad auftauchte.
»Komm mit, Assad. Nimm den Wassereimer, den Lappen und deine schönen grünen Gummihandschuhe. Wir haben etwas zu erledigen.«
Sie gingen fünfzehn Schritte den Gang hinunter, und Rose deutete auf weißen, pulverigen Staub zwischen ihren schwarzen Stiefeln. »Da!«, sagte sie.
Der Mann von der Gewerbeaufsicht protestierte und versuchte, ihnen zu erklären, dass das, was sie da taten, sinnlos sei. Dass sie das Übel so nicht beseitigten und dass die Vernunft und die Bestimmungen besagten, der Staub müsse vorschriftsgemäß entsorgt werden.
Carl ignorierte seine Einlassung. »Wenn du den Dreck aufgewischt hast, Assad, dann rufst du einen Tischler an. Wir müssen eine Wand einziehen lassen zwischen der verunreinigten Zone und unserem Archivrechenschaftsablageraum. Diesen giftigen Kram wollen wir schließlich nicht in unserer Nähe haben, stimmt’s?«
Assad schüttelte langsam den Kopf. »Was ist das noch mal für ein Raum, von dem du da sprichst, Carl? Archiv …?«
»Wisch einfach auf, Assad. Der Mann hier hat es eilig.«
Der Beamte warf Carl einen feindseligen Blick zu. »Sie hören von uns«, war das Letzte, was er sagte. Dann eilte er den Gang hinunter, den Arm mit der Aktenmappe fest an den Körper gepresst.
Von denen hören! Ja, nur zu.
»Und jetzt erklärst du mir, Assad, warum meine Akten da oben an der Wand hängen«, sagte Carl. »Ich kann nur für dich hoffen, dass es Kopien sind.«
»Kopien? Wenn du Kopien willst, nehme ich sie einfach herunter. Du kannst so viele Kopien bekommen, wie du willst, Carl. Kein Problem.«
Carl schluckte. »Sagst du mir gerade ins Gesicht, dass das, was da hängt, die Originalakten sind?«
»Ja, aber Carl, sieh doch mal mein System! Sag ruhig, wenn du’s nicht ebenso phantastisch findest wie ich. Ich nehm’s dir nicht übel.«
Carl zog seinen Kopf zurück. Wie bitte? Was war denn das? Kaum war man mal vierzehn Tage weg, da drehten die Mitarbeiter vollkommen durch. Waren die high vom Asbest?
»Sieh mal, Carl.« Assad hielt ihm freudestrahlend zwei Rollen Paketschnur hin.
»Ja, sieh mal einer an: Du hast dir zwei Rollen Paketschnur besorgt, eine blaue und eine rote. Damit kannst du ja jede Menge Päckchen verschnüren! Wenn Weihnachten ist! In neun Monaten!«
Assad haute ihm auf die Schulter. »Ha ha ha, Carl. Der war gut! Jetzt bist du wieder ganz der Alte.«
Carl schüttelte den Kopf. O Gott, wie lange war’s noch bis zu seiner Pensionierung?
»Schau mal hier.« Assad rollte etwas von der blauen Paketschnur ab, nahm ein Stück Tesafilm, klebte damit das eine Ende der Schnur an einen Fall aus den Sechzigern, zog die Rolle quer über eine Menge anderer Fälle, schnitt die Schnur ab und heftete das andere Ende an einen Fall aus den Achtzigern. »Ist das nicht klasse?«
Carl faltete die Hände im Nacken, als müsste er den Kopf an seinem Platz halten. »Ein phantastisches Kunstwerk, Assad, wirklich! Andy Warhol hat nicht umsonst gelebt.«
»Andy wer?«
»Und was genau soll das, Assad? Versuchst du, die beiden Fälle miteinander in Verbindung zu bringen?«
»Ja, überleg doch mal, angenommen, die beiden Fälle hätten vielleicht was miteinander zu tun, dann könnte man das auf diese Weise ganz super sehen.« Er deutete wieder auf die blaue Schnur. »Genau hier! Blaue Schnur!« Er schnipste. »Das bedeutet: Es gibt Ähnlichkeiten zwischen den beiden Fällen. Parallelen.«
Carl holte tief Luft. »Aha! Tja, dann ahne ich natürlich, wofür die rote Schnur steht.«
»Ja, nicht wahr? Rot, wenn wir wissen, dass es erwiesenermaßen eine Verbindung zwischen den Fällen gibt. Gutes System, stimmt’s?«
Carl holte wieder tief Luft. »Ja, Assad. Aber die Fälle haben nun mal nichts miteinander zu tun, und dann ist es vielleicht doch besser, wenn sie auf meinem Schreibtisch liegen und wir ein bisschen darin blättern können.«
Das war zwar keine Frage, aber die Antwort kam trotzdem.
»Ja, okay, Chef.« Assad wippte auf seinen ausgelatschten Ecco-Schuhen vor und zurück. »Ja. In zehn Minuten fange ich mit dem Kopieren an. Dann bekommst du die Originale und ich hänge die Kopien auf.«
Marcus Jacobsen, der Chef der Mordkommission, wirkte auf einmal deutlich älter. In der letzten Zeit waren einfach abartig viele Fälle auf seinem Schreibtisch gelandet. In erster Linie die Bandenkonflikte und Schießereien in Nørrebro und Umgebung, aber auch ein paar von diesen ekelhaften Bränden. Brandstiftung mit gewaltigen wirtschaftlichen Schäden und leider auch einigen Toten. Und immer nachts. Hatte Jacobsen in der letzten Woche drei Stunden pro Nacht geschlafen, dann war das viel gewesen. Vielleicht sollte man ihm entgegenkommen, egal, was er auf dem Herzen haben mochte.
»Was ist los, Boss? Warum hast du mich hier raufbeordert?«
Jacobsen fummelte an seiner alten Zigarettenpackung herum, der arme Mann. Er kam mit dem Entzug überhaupt nicht klar. »Ja, Carl, ich weiß ja, dass deine Abteilung hier oben nicht so viel Platz bekommen hat. Aber streng genommen darf ich dich nicht unten im Keller sitzen lassen. Und jetzt rufen die von der Gewerbeaufsicht an und erzählen mir, du hättest dich ihren Anweisungen widersetzt.«
»Marcus, wir haben das unter Kontrolle. Wir ziehen in der Mitte eine Wand hoch, mit Tür und allem Drum und Dran. Dann ist der Mist isoliert.«
Jacobsens Augenringe wurden plötzlich noch eine Spur dunkler. »Ganz genau das, Carl, will ich nicht gehört haben«, sagte er. »Und deshalb müsst ihr, du und Rose und Assad, wieder nach hier oben. Ärger mit der Aufsicht, das schaffe ich nicht auch noch. Du weißt, wie sehr ich derzeit unter Druck stehe. Schau dir nur das mal an.« Er deutete auf seinen neuen winzigen Flachbildschirm an der Wand, wo die Nachrichten von TV2 über die Folgen des Bandenkrieges berichteten. Die Forderung nach einem Trauerzug für eines der Opfer durch die Straßen Kopenhagens fachte das Feuer nur weiter an. Die Polizei müsse endlich die Schuldigen finden und die Straßen wieder sicher machen, hieß es.
Ja, Marcus Jacobsen stand unter Druck.
»Okay, wenn du uns nach hier oben umziehen lässt, bedeutet das das Ende des Sonderdezernats Q.«
»Führe mich nicht in Versuchung, Carl.«
»Und acht Millionen Zuschuss pro Jahr verlierst du obendrein. Waren es nicht acht Millionen, die man dem Sonderdezernat Q zur Verfügung gestellt hat? Donnerwetter, man lässt sich uns echt was kosten! Büromöbel, Auto, Kopierer, Toner, Papier und – ach ja – natürlich noch die fetten Gehälter von Rose, Assad und mir. Acht Millionen, Wahnsinn.«
Der Chef der Mordkommission seufzte. Er steckte in der Klemme. Ohne Bewilligung der acht Millionen für das Sonderdezernat Q würden seinen eigenen Abteilungen mindestens fünf Millionen im Jahr fehlen. Kreative Umverteilung nannte man das. Das machte jede Kommune so. Eine Art legaler Raub.
»Lösungsvorschläge erbeten«, sagte Jacobsen.
»Wo sollen wir hier oben denn sitzen?«, fragte Carl. »Auf dem Klo? Oder auf der Fensterbank, wo Assad gestern saß? Oder besser noch hier in deinem Büro?«
»Draußen auf dem Flur ist Platz.« Marcus Jacobsen wand sich innerlich, als er das sagte, das war nicht zu übersehen. »Wir finden bald etwas anderes für euch. Ist doch nur ein Provisorium, Carl.«
»Okay, prima Lösung, einverstanden. Dann brauchen wir ja nur noch drei neue Schreibtische.« Carl erhob sich unaufgefordert und streckte ihm die Hand hin. Damit war das wohl abgemacht.
Der Chef der Mordkommission wehrte ab. »Moment mal«, sagte er. »An dem Angebot ist doch was faul.«
»Faul? Ihr bekommt drei zusätzliche Schreibtische, und wenn die Gewerbeaufsicht kommt, dann schicke ich Rose zu euch rauf, damit sie sich ein bisschen dekorativ auf den leeren Stühlen ausbreitet.«
»Damit kommen wir doch nicht durch, Carl.« Jacobsen machte eine kleine Pause. Trotzdem schien er anzubeißen. »Na, kommt Zeit, kommt Rat, wie meine alte Mutter immer sagt. Setz dich noch mal, Carl. Wir haben hier einen Fall, auf den du einen Blick werfen solltest. Kannst du dich an die Kollegen von der schottischen Polizei erinnern, die wir vor drei oder vier Jahren mal unterstützt haben?«
Carl nickte zögernd. Bereitete sein Chef gerade eine Okkupation des Sonderdezernats Q durch Dudelsackpfeifer vor? Schneidbrenner-Musik und Schafsmagen-Würste in seinen Kellerräumen? Nein, nicht, wenn er ein Wörtchen mitzureden hatte. Schlimm genug, dass dann und wann Norweger zu Besuch kamen. Aber Schotten!
»Wir hatten denen einige DNA-Proben von einem Schotten geschickt, der in Vestre einsaß, du erinnerst dich sicher daran. Das war Baks Fall. Die konnten auf diese Weise einen Mord aufklären, und jetzt haben wir noch was gut bei denen. Ein Polizeitechniker in Edinburgh, Gilliam Douglas heißt er, hat uns dieses Paket geschickt. Darin befindet sich ein Brief, den sie in einer Flasche gefunden haben. Sie haben einen Linguisten zu Rate gezogen und festgestellt, dass der Brief aus Dänemark kommen muss.« Er hob einen braunen Pappkarton vom Fußboden auf. »Wenn wir etwas herausfinden, würden sie gern erfahren, was da los war. Bitte sehr, Carl.«
Er drückte ihm den Karton in die Hand und signalisierte ihm dann zu verschwinden.
»Was soll ich damit?«, fragte Carl. »Warum übergeben wir das Ding nicht einfach der dänischen Post?«
Jacobsen lächelte. »Sehr witzig. Weil die Post keine Rätsel löst, sondern allenfalls welche aufgibt.«
»Wir haben eh schon alle Hände voll zu tun.«
»Ja, ja, Carl, das bezweifle ich ja nicht. Aber wirf doch einfach mal einen Blick drauf, das ist doch keine große Sache. Außerdem erfüllt die Geschichte alle Kriterien, die für das Sonderdezernat Q gelten: Sie ist alt, sie ist nicht aufgeklärt, und keiner sonst hat Zeit und Lust, sich damit zu befassen.«
Schon wieder so ein Fall, der mich daran hindert, die Haxen auf der Schreibtischschublade auszustrecken, dachte Carl, als er mit dem Karton in der Hand die Treppe hinunterstieg.
Egal. Es würde die schottisch-dänische Freundschaft kaum belasten, wenn er sich ein Stündchen oder zwei aufs Ohr haute.
»Morgen bin ich mit allem fertig, Rose hilft mir.« Assad überlegte, in welchem der drei Stapel von Carls System der Fall, den er gerade in der Hand hielt, ursprünglich gelegen hatte.
Carl brummte. Das schottische Paket stand vor ihm auf dem Schreibtisch. Ungute Gefühle hatten es ja leider so an sich, dass sie sich meist als richtig erwiesen. Und dieser Pappkarton mit dem Klebeband des Zolls hatte wahrlich keine gute Ausstrahlung.
»Ist das ein neuer Fall?« Assads Augen klebten förmlich an dem braunen Pappkarton. »Wer hat die Kiste aufgemacht?«
Carl deutete mit dem Daumen nach oben.
»Rose, komm mal«, rief Carl in den Flur.
Fünf Minuten vergingen, bevor sie auftauchte. Das war in etwa der zeitliche Rahmen, mit dem sie klarmachte, wer darüber bestimmte, was getan werden musste und besonders: wann. Daran gewöhnte man sich.
»Wie würdest du es finden, Rose, deinen ersten eigenen Fall zu bekommen?« Sanft schob er den Karton zu ihr hinüber.
Er konnte ihre Augen unter dem schwarzen Punkerpony nicht sehen. Aber erfreut schauten sie wohl kaum.
»Wahrscheinlich irgendwas mit Kinderpornos oder Frauenhandel, was, Carl? Irgendwas, was du selbst nicht mit der Kneifzange anfassen würdest. Insofern: nein danke. Wenn du selbst keine Lust darauf hast, dann lass doch unseren kleinen Kameltreiber den Stall ausmisten. Ich hab anderes zu tun.«
Carl lächelte. Keine Flüche, keine Tritte gegen den Türrahmen. Das klang ja fast schon nach guter Laune.
Er schob den Karton noch etwas weiter in ihre Richtung. »Das ist ein Brief, der in einer Flasche gesteckt hat. Ich hab ihn noch nicht gesehen. Wir können ja mal gemeinsam auspacken.«
Sie zog die Nase kraus. Skepsis hieß ihr ständiger Begleiter.
Carl öffnete die Laschen des Pakets, räumte den Styroporkram beiseite, fischte die Aktenmappe heraus und legte sie auf den Tisch. Dann wühlte er noch etwas in den Styroporkügelchen herum und fand schließlich eine Plastiktüte.
»Was ist da drin?«
»Die Glasscherben der Flasche, vermute ich.«
»Haben sie die zerdeppert?«
»Nein, sie haben die nur auseinandermontiert. In der Aktenmappe liegt ’ne Gebrauchsanweisung, aus der hervorgeht, wie man sie wieder zusammensetzt. Kinderkram für eine praktisch veranlagte Frau wie dich.«
Sie streckte ihm die Zunge raus und wog die Plastiktüte in der Hand. »Nicht sonderlich schwer. Wie groß war die?«
Er schob ihr die Aktenmappe rüber. »Lies selbst.«
Sie ließ den Pappkarton stehen und verschwand den Gang hinunter. Damit herrschte Frieden. In einer Stunde war der Tag vorbei. Dann würde er den Zug nach Allerød nehmen, eine Flasche Whisky kaufen und sich und Hardy dopen, ein Glas Whisky mit Strohhalm und eines mit Eis. Der Abend würde sicher nett.
Er schloss die Augen. Er hatte noch keine zehn Sekunden so gesessen, da stand Assad vor ihm.
»Ich hab da was gefunden, Carl. Komm mal mit und sieh es dir an. Gleich hier draußen an der Wand.«
Mit dem Gleichgewichtssinn passiert etwas Merkwürdiges, wenn man sich nur wenige Sekunden vollkommen aus der Welt entfernt hat, stellte Carl fest und lehnte sich benommen an die Mauer im Flur. Assad deutete stolz auf eine der Akten oben an der Wand.
Carl zwang sich zurück in die Realität. »Sag das noch mal, Assad. Ich hab gerade an was anderes gedacht.«
»Ich hab mich nur gefragt, ob der Chef der Mordkommission bei all diesen Bränden in Kopenhagen nicht mal ein bisschen an diesen Fall hier denken sollte.«
Carl spürte nach, ob seine Beine noch wackelig waren, dann trat er näher zur Wand, wo Assad seinen Zeigefinger auf einen Fall gepflanzt hatte. Die Geschichte war vierzehn Jahre alt. Es handelte sich um einen Brand mit Leichenfund, möglicherweise Brandstiftung, in Rødovre, ganz in der Nähe des Damhus-Sees. Die Leiche war durch das Feuer so zerstört, dass sich weder Todeszeitpunkt noch Geschlecht oder DNA ermitteln ließen. Und die Sache wurde auch nicht weniger kompliziert dadurch, dass keine vermissten Personen zu dem Leichenfund passten. Man hatte den Fall schließlich zu den Akten gelegt. Carl erinnerte sich sehr gut daran. Es war einer von Antonsens Fällen gewesen.
»Warum glaubst du, das könnte mit den verheerenden aktuellen Bränden zu tun haben?«
»Heer?«
»Die Brände, die derzeit so viel Schaden anrichten und Menschenleben kosten.«
»Deshalb!« Assad deutete auf eine Detailaufnahme der Skelettreste. »Diese runde Vertiefung an seinem Kleinfingerknochen. Dazu steht da auch was drin.« Er nahm die Aktenmappe von der Pinnwand und schlug die entsprechende Seite des Berichts auf. »Hier ist es beschrieben: ›Als hätte dort jahrelang ein Ring gesessen‹, steht da. Eine Vertiefung ringsum.«
»Und?«
»Na, der Kleinfinger, Carl.«
»Ja, und?«
»Als ich oben im Dezernat A war, fehlte dem ersten Brandopfer der komplette Kleinfinger.«
»Okay. Das heißt übrigens kleiner Finger. Zwei Wörter, Assad.«
»Ja, und beim nächsten Brand hatte die Leiche, die man fand, eine Vertiefung am kleinen Finger. Genau wie hier.«
Carl merkte, wie sich seine Augenbrauen beträchtlich nach oben bewegten.
»Ich finde, du solltest in den zweiten Stock raufgehen und unserm Chef erzählen, was du mir gerade gesagt hast, Assad.«
Der strahlte übers ganze Gesicht. »Ich hätte das gar nicht gesehen, wenn das Foto nicht die ganze Zeit in Nasenhöhe an der Wand gehangen hätte. Gut, oder?«
Es schien fast so, als hätte Roses undurchdringlicher Panzer aus punkerschwarzer Arroganz durch die neue Aufgabe einen klitzekleinen Riss bekommen. Jedenfalls knallte sie nicht gleich wie üblich das Dokument auf Carls Schreibtisch. Diesmal nahm sie erst den Aschenbecher weg und legte den Brief dann vorsichtig, fast ehrerbietig auf die Tischplatte.
»Man kann nicht sehr viel lesen«, sagte sie. »Das ist offenbar mit Blut geschrieben, und das Blut ist vom Kondenswasser verschmiert und dann vom Papier aufgesaugt worden. Außerdem ist die Schrift ziemlich unbeholfen und krakelig. Bei dem ersten Wort besteht allerdings kein Zweifel: Da steht ›Hilfe‹, klar und deutlich.«
Widerstrebend lehnte Carl sich vor und betrachtete die Reste der Druckbuchstaben. Vielleicht war das Papier einmal weiß gewesen, jetzt war es jedenfalls braun. An mehreren Stellen fehlten am Rand kleine Stücke. Vermutlich waren die verschwunden, als man den Brief nach seiner Bergung aus dem Meer auseinandergefaltet hatte.
»Welche Untersuchungen haben die denn schon durchgeführt, steht dazu was im Begleitschreiben? Und wann?«
»Die haben die Flasche in der Nähe der Orkneys gefunden. Sie hing in einem Fischernetz. Das war 2002, steht da.«
»2002? Da haben sie sich ja nicht gerade überschlagen, das Ding weiterzugeben.«
»Die Flasche hat auf einer Fensterbank gestanden und war in Vergessenheit geraten. Wahrscheinlich hat sich deshalb so viel Kondenswasser gebildet. Sie hat direkt in der Sonne gestanden.«
»Die saufen zu viel, die Schotten«, brummte Carl.
»Ein ziemlich unbrauchbares DNA-Profil ist beigelegt. Und ein paar Ultraviolett-Fotos. Die haben versucht, den Brief so gut es ging zu präparieren. Und da. Das ist ein Versuch, den Text zu rekonstruieren. Ein bisschen was kann man tatsächlich entziffern.«
Carl sah sich die Fotokopien an und nahm das mit den besoffenen Schotten zurück. Verglich man den Originalbrief mit der versuchten Rekonstruktion, dann war das ganz schön eindrucksvoll, was man dort lesen konnte. Er blickte auf den Zettel. Schon immer hatte Menschen der Gedanke fasziniert, eine Flaschenpost auf Reisen zu schicken, die am anderen Ende der Welt aus dem Meer gefischt und gelesen würde. In der Hoffnung, dass sich daraus ungeahnte Abenteuer entwickelten.
Aber romantische Träumereien waren zweifellos nicht der Anlass für diese Flaschenpost gewesen. Das hier war bitterer Ernst, das hatte nichts von Sehnsucht und weißem Sand und blauem Meer. Das hier war kein Dummejungenstreich. Dieser Brief war offenkundig das, wofür er sich ausgab.
Ein verzweifelter Hilferuf.
5
In dem Moment, wo er sie verließ, streifte er seine alte Identität ab. Er fuhr die zwanzig Kilometer zu dem kleinen Hof bei Ferslev, der etwa auf halbem Weg zwischen ihrem Haus in Roskilde und dem Haus am Fjord lag. Dann holte er den Lieferwagen aus der Scheune und parkte dafür den Mercedes dort drinnen. Er schloss das Tor ab, nahm schnell ein Bad und tönte sein Haar. Danach zog er sich komplett um und machte sich zehn Minuten vor dem Spiegel zurecht. Er suchte alles aus den Schränken zusammen, was er brauchte, und ging dann mit dem Gepäck zu dem hellblauen Renault Partner, den er auf seinen Touren benutzte. Dem fehlte jegliches besondere Kennzeichen, er war weder zu groß noch zu klein, die Nummernschilder waren nicht zu schmutzig, aber doch ziemlich unleserlich. Ein absolut unauffälliges Fahrzeug, registriert auf den Namen, den er sich zugelegt hatte, als er den kleinen Hof erwarb. Alles beides im Hinblick auf den Job, den er zu erledigen hatte.
Wenn er diesen Punkt erreicht hatte, war er bis ins kleinste Detail vorbereitet. Durch gründliche Recherchen im Internet und in den Melderegistern, die er seit Jahren als Online-Nutzer konsultierte, war er mit allen relevanten Informationen über seine potenziellen Opfer versorgt. Er hatte immer reichlich Bargeld bei sich. Er zahlte an Tankstellen mit mäßig großen Geldscheinen, ebenso die Brückenmaut. Er sah bei Überwachungskameras konsequent weg, und er sorgte dafür, sich stets von allem fernzuhalten, was Aufmerksamkeit erregen konnte.
Diesmal hatte er Mitteljütland zum Jagdrevier erkoren. Die Konzentration religiöser Sekten war dort sehr hoch, und es war schon ein paar Jahre her, seit er zuletzt in der Ecke zugeschlagen hatte. Doch, ja, er verwandte viel Sorgfalt darauf, den Tod zu verbreiten.
Mehrmals war er vorab in die Gegend gefahren, jedes Mal nur für zwei, drei Tage, und hatte seine Beobachtungen gemacht. Beim ersten Mal hatte er bei einer Frau in Haderslev gewohnt und die beiden nächsten Male in einem kleinen Ort, der Lønne hieß. Das Risiko, in der Gegend von Viborg wiedererkannt zu werden, war deshalb verschwindend gering.
Er hatte die Wahl zwischen fünf Familien gehabt. Zwei Familien waren Mitglieder bei den Zeugen Jehovas, eine bei der Neuapostolischen Kirche, eine bei den Mormonen und eine bei der Kirche der Gottesmutter. Im Moment tendierte er zu Letzterer.
Gegen zwanzig Uhr kam er in Viborg an. Vielleicht war das etwas zu früh für sein Vorhaben, besonders in einer Stadt dieser Größe. Aber man wusste ja nie, was passieren würde.
Zunächst musste er ein Lokal finden, in dem er gut nach Frauen Ausschau halten konnte, die sich für die Gastgeberinnenrolle eigneten. Die Kriterien für das Lokal waren immer dieselben: Es durfte nicht zu klein sein, es durfte nicht in einer Gegend liegen, wo sich alle kannten, nicht zu sehr auf Stammgäste ausgerichtet sein und nicht zu schmuddelig für eine alleinstehende Frau einer gewissen Klasse, die idealerweise zwischen fünfunddreißig und fünfundfünfzig Jahre alt sein sollte.
Das erste Lokal, Julles Bar, war zu eng und zu düster und es gab zu viele Spielautomaten und Dartboards an den Wänden. Das nächste war schon besser. Eine kleine Tanzfläche, absolute Durchschnittsklientel, bis auf einen Schwulen, der sich sofort auf den Nachbarstuhl pflanzte, nur Millimeter von ihm entfernt. Wenn er dort eine passende Frau entdeckte, würde sich der Schwule trotz höflicher Zurückweisung garantiert an ihn erinnern, und das war nicht gut.
Erst beim fünften Anlauf fand er, was er suchte. Der Laden war ideal für seine Zwecke, das verrieten ihm schon die Schilder über der Theke: »Wer nichts sagt, beißt am besten«, »Draußen ist’s gut, im Terminal besser« und »Hier gibt’s die besten Brüste«. Das Terminal schloss zwar schon um dreiundzwanzig Uhr, aber die Leute waren bei Hancock-Høker-Bier und Rockmusik in ausgezeichneter Stimmung. Bei den Rahmenbedingungen würde bestimmt noch vorm Zapfenstreich eine anbeißen.
Er suchte sich eine nicht ganz junge Frau aus, die neben dem Eingang in der Nähe der Spielautomaten saß. Als er hereinkam, hatte sie auf der winzigen Tanzfläche mit schwebenden Armen ganz allein getanzt. Sie war vergleichsweise hübsch und sicher keine ganz leichte Beute. Das hier war eine erfahrene Fischerin. Die wollte einen Mann, auf den sie sich verlassen konnte. Einen, der es wert war, dass sie für den Rest ihres Lebens neben ihm aufwachte. Und sie rechnete nicht damit, ihn hier zu finden. Nach einem anstrengenden Tag war sie mit Kolleginnen ausgegangen. Das war’s. Das sah man schon von weitem.
Zwei ihrer wohlgeformten Kolleginnen standen in der Raucherecke und kicherten, der Rest hatte sich an die höchst unterschiedlichen Tische verteilt. Vermutlich waren die Damen schon seit einiger Zeit heftig zugange. So wie er sie einschätzte, würden sie ihn schon wenige Stunden später kaum noch beschreiben können.
Er forderte die Frau zum Tanzen auf, nachdem sie fünf Minuten lang Augenkontakt gehabt hatten. Sie war noch einigermaßen nüchtern. Ein gutes Zeichen.
»Du kommst nicht von hier, sagst du? Was machst du denn dann in Viborg?«
Sie roch gut und sah ihm direkt in die Augen. Es war klar, dass sie eine Antwort erwartete. Vermutlich sollte er ihr sagen, dass er verhältnismäßig oft in die Stadt käme. Dass ihm Viborg gut gefiele. Dass er gebildet und Single sei. Also sagte er es. In aller Ruhe und in der richtigen Reihenfolge. Er hätte ihr sonst was erzählt, Hauptsache es tat seine Wirkung.
Zwei Stunden später lagen sie bei ihr zu Hause im Bett. Sie über die Maßen befriedigt, er wohl wissend, dass er hier ein paar Wochen wohnen konnte, ohne dass sie ihm mit allzu vielen Fragen käme. Außer den üblichen natürlich: Magst du mich wirklich, liebst du mich, willst du mich? Das ganze Programm.
Er achtete darauf, ihre Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben. Spielte den Verlegenen, sodass sie seine gelegentlich ausweichenden oder zögerlichen Antworten leicht seiner Schüchternheit zuschreiben konnte.
Um halb sechs am nächsten Morgen wachte er planmäßig auf, machte sich fertig, durchwühlte diskret ihre Sachen und fand eine Menge über sie heraus, noch bevor sie sich zu räkeln begann. Geschieden, wie er bereits wusste. Hatte erwachsene Kinder, die längst ausgezogen waren, und einen guten Job in der Verwaltung, wohl ein bisschen weiter oben angesiedelt, der ihr hoffentlich alle Energie raubte. Sie war zweiundfünfzig und gerade mehr als bereit, ihr Leben ins Märchenland zu verlagern.
Bevor er ein Tablett mit Kaffee und Toast neben sie aufs Bett stellte, zog er die Gardine auf, sodass ihr Blick sofort auf sein ausgeruhtes Lächeln fallen konnte.
Sie schmiegte sich dicht an ihn. Zärtlich, ergeben und sanft lächelnd. Sie streichelte seine Wange und wollte seine Narbe küssen. Aber so weit kam sie nicht, denn er hob ihr Kinn und stellte ihr die Frage: »Soll ich mich im Hotel Palads einmieten oder heute Abend wieder zu dir kommen?«
Die Antwort lag auf der Hand. Sie verriet ihm, wo der Schlüssel lag, und drückte sich noch einmal zärtlich an ihn. Dann schlenderte er zum Lieferwagen und fuhr davon.
Er hatte sich eine Familie ausgesucht, die das Lösegeld von einer Million, das er immer verlangte, schnell würde bezahlen können. Vielleicht würde man ein paar Aktien verkaufen müssen, auch wenn dafür gerade nicht der günstigste Zeitpunkt war. Aber selbst dann würde sich die Familie noch gutstehen. Natürlich hatte die Finanzkrise es auch für ihn schwerer gemacht, auf anständige Lösegeldsummen zu kommen. Aber er wählte seine Opfer sorgfältig aus, und bisher hatte er noch immer einen Weg gefunden. Auch diesmal schätzte er es so ein, dass die Familie sowohl die Möglichkeiten als auch den Willen hatte, seinen Forderungen zu entsprechen, und zwar diskret.
Inzwischen wusste er schon recht viel über sie. Er hatte ihre Gemeinde besucht und sich nach den Gottesdiensten mit den Eltern unterhalten. Wusste, wie lange sie schon Mitglieder der Sekte waren, wie ihr Vermögen entstanden war, wie ihre Kinder hießen, und in groben Zügen wusste er auch über ihren Tagesablauf Bescheid.
Die Familie wohnte am Rand von Dollerup. Fünf Kinder, zwischen zehn und achtzehn Jahren. Alle lebten zu Hause und alle waren aktive Mitglieder in der Kirche der Gottesmutter.
Die beiden Ältesten gingen in Viborg aufs Gymnasium, die übrigen wurden von der Mutter zu Hause unterrichtet. Sie, Mitte vierzig, ehemalige Tvind-Lehrerin an einer dieser alternativen Siebzigerjahre-Schulen, hatte sich, in Ermangelung anderer bleibender Lebensinhalte, eben nun Gott zugewandt. In diesem Haushalt hatte sie die Hosen an. Sie managte die Familie und die Religion. Der Mann war zwanzig Jahre älter und einer der wohlhabendsten Unternehmer der Gegend. Selbst wenn er die Hälfte seines Einkommens der Kirche der Gottesmutter spendete, was allen Mitgliedern empfohlen war, blieb reichlich übrig.
In der Familie gab es nur ein Problem: Der zweitälteste Sohn, an sich ein ausgesprochen gut geeignetes Objekt, hatte mit Karate angefangen. Das allein war zwar kein Grund, nervös zu werden, der schmächtige Junge stellte deshalb noch keine Gefahr für ihn dar. Aber er könnte das Timing ruinieren.
Und aufs Timing kam es an, wenn es unangenehm wurde. Mit dem Timing stand und fiel alles.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: