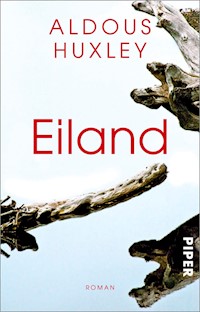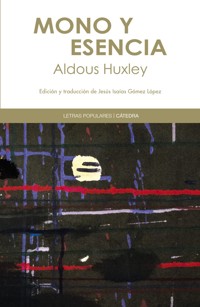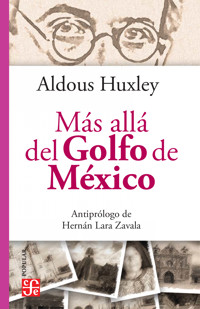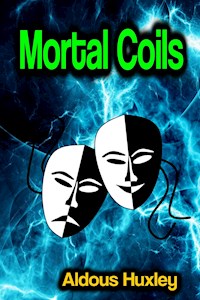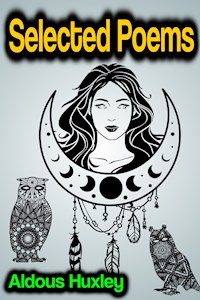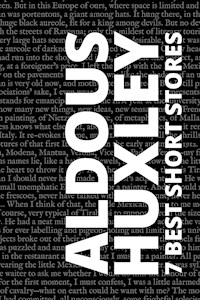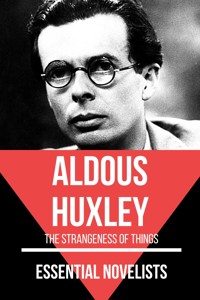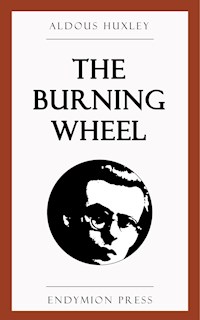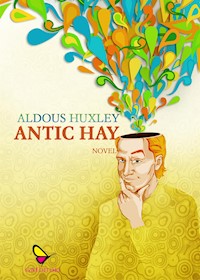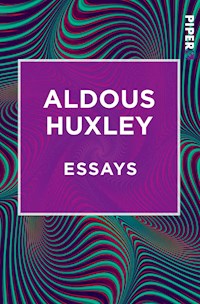
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Essays des Autors von »Schöne neue Welt« als E-Book in einem Band Der amüsante Feuilletonist, der Reiseschriftsteller, der unaufdringliche Besserwisser, unbestechlicher Zeitzeuge, skeptischer Wahrheitssucher, der Philosophie- und Utopiekritiker, der Ästhet, der Ökologe der ersten Stunde – sprechen all diese Huxleys noch oder wieder zu uns? Die vorliegende Ausgabe entstand aus dem Vertrauen darauf, dass Huxley, der Essayist, nicht nur außergewöhnlich lesbar, sondern auch erstaunlich aktuell geblieben ist: Wo er zu zeitgebundenen Fragen Stellung nimmt, macht sein Blickwinkel, der immer die Vergangenheit und Zukunft zu erfassen sucht, das Gesagte bedenkenswert; sein Geist und Witz gibt ihm Denkwürdigkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Sämtliche Essaybände Aldous Huxleys, denen die hier versammelten Beiträge entnommen sind, wurden im Verlag Chatto & Windus in London veröffentlicht. Die einzelnen Buchtitel sind jeweils am Ende eines Textes genannt.
Übersetzung aus dem Englischen von Hans-Horst Henschen, Sabine Hübner und Werner v. Koppenfels
Herausgegeben von Werner v. Koppenfels
Der Inhalt beruht auf der Neuauflage früherer Ausgaben (Essays Band 1-3)
ISBN 978-3-492-97730-2
März 2018
© Originalbeiträge Aldous Huxley
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 1994
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Essays – Band I: Streifzüge
Leidenschaft des Verstehens – Aldous Huxley als Essayist
I
II
III
IV
V
Vorrede
DIE NATUR
The Cicadas
Die Zikaden
Das Land
Ländliche Ekstasen
Wordsworth in den Tropen
Der Ölbaum
Die Wüste
Die zweifache Krise
REISEBILDER
Warum nicht gleich zu Hause bleiben?
Aus der Perspektive des Reisenden
Ansichten von Holland
Patinirs Fluss
Marginalie: Paris – London
Wandervögel
Montesenario
Portoferraio
Der Palio in Siena
Sabbioneta
Eine Nacht in Pietramala
Das Heilige Antlitz
Paradies
Könige und Wasserspiele
Agra
Benares
Auf See
Los Angeles. Eine Rhapsodie
Erster Satz
Zweiter Satz
Dritter Satz
Vierter Satz
Fünfter Satz
Glaube, Geschmack und Geschichte
Atitlan
Sololá
Copan
In einer tunesischen Oase
Gewöhnlich zerstört
Adonis und das Alphabet
PHYSIOLOGIE UND MODEN DER LIEBE
Schönheit anno 1920
Moden in der Liebe
Die Schönheitsindustrie
Katzen-Predigt
Liebesstil-Prognose
Appendix
Anmerkungen
Essays – Band II: Form in der Zeit
Vorrede
LITERATUR
Der Gegenstand der Poesie
Das Wörterbad: ein modernes Laster und eine verlorene Kunst
Literatur und Prüfungen
Die Tragödie und die Ganze Wahrheit
Drama für eine Neue Welt
Vulgarität und Literatur
I
II
III
IV
Wenn meine Bibliothek heute Nacht abbrennt
Swift
Beim Wiederlesen des Candide
Jahrhundertfeiern
Edward Lear
Baudelaire
Famagusta oder Paphos
Die Methode des 18. Jahrhunderts
D. H. Lawrence
Was genau heißt eigentlich ›modern‹?
BILDENDE KUNST
Conxolus
Der Musenquell
Rimini und Alberti
Das beste Bild
Breughel
Kunst und Religion
Meditation über El Greco
Variationen über El Greco
Variationen über Die Kerker
Picture by Goya: A Highway Robbery
Ein Bild von Goya: Überfall
Variationen über Goya
Morning Scene
Morgenszene
Kritzeleien in einem Wörterbuch
MUSIK
Musik bei Nacht
Der Rest ist Schweigen
Gesualdo: Variationen über ein musikalisches Thema
Anmerkungen
Essays – Band III: Seele und Gesellschaft
POLITIK UND DIE ZUKUNFT DES MENSCHEN
Revolutionen
Die neue Romantik
Anmerkungen zur Freiheit und zu den Grenzen des Gelobten Landes
Stierkämpfe und Demokratie
Zu Besuch auf einem Schlachtschiff
Deutsche Freudenfeuer
Illegaler Humor: Naziverordnung verbietet Bayernwitze
Der wild gewordene Affe: eine Lektion aus Gullivers Reisen
Worte und Verhaltensweisen
Morgen und morgen und dann wieder morgen
SOZIO-PSYCHOLOGISCHES
Acedia
Vergnügungen
Arbeit und Freizeit
Krieg der Generationen?
»Mohnsaft«
Mönche unter Reagenzgläsern
Der Kult des Infantilen
Warum sinkt die Selbstmordrate in Kriegszeiten?
Hyperion gegen Satyr
Irrungen, Wirrungen, Kirrungen
PHILOSOPHIE UND REALWELT
First Philosopher's Song
Erster Philosophen-Song
Fifth Philosopher's Song
Fünfter Philosophen-Song
Spinozas Wurm
Pascal
I Antworten auf das kosmische Rätsel
Pascal und der Rationalismus
Offenbarung
Historische Gründe für Pascals Glauben
Humanist und Christ
Der kranke Asket
II Das Universum des Kranken und seine Rechtfertigung
Pascal und der Tod
III Der Gott des Lebens
Das Credo des Lebensanbeters
Ausgewogene Exzesse
Leben und gelebte Routine
Pascal, der Todesanbeter
Pascals Universum
Musikalischer Beschluss
Variationen über einen Philosophen
Porträt eines Philosophen
Der Philosoph in der Geschichte
SKEPSIS UND GLAUBE
Glaube und Handeln
Über Gnade
Franziskus und Grigorij, oder die beiden Arten von Demut
Unser Glaube
Wunder im Libanon
Wissen und Verstehen
Anmerkungen
Essays
Band I: Streifzüge
Ansichten der Natur und Reisebilder
Leidenschaft des Verstehens – Aldous Huxley als Essayist
my primary occupation is the achievement of some
kind of over-all understanding of the world
(aus einem Brief vom 3. Sept. 1946)
I
Als Essayist ist Aldous Huxley ein Meister der anekdotischen Eröffnung. Der Einsatz erfolgt nicht selten in demonstrativer Distanz zum Thema, das so durch die exzentrische Art seiner Einführung von Anfang an eine persönliche und intellektuell spielerische Tönung annimmt. Nach der unmethodischen Methodik des Gattungsbegründers Montaigne führt auch Huxley nicht selten seinen Leser durch die Fülle seiner Assoziationen scheinbar ins Beliebige und in die Irre. Sobald wir uns freilich dem assoziativen Rhythmus dieses witzigen und wissenden Geistes hingeben, geraten wir in den Bann einer gedanklichen Grundströmung, die all die lebhaften, oft kuriosen, einander gegenläufigen, gelegentlich übermütigen Einzelbewegungen trägt und steuert. In der Essayistik wie beim Reisen – Huxley verstand sich auf beides – ist der Weg mindestens ebenso wichtig wie das Ankommen; und für den, der mehr sehen möchte, als was im Baedeker steht, sind Umwege die eigentliche Form des Fortschreitens.
So beginnt beispielsweise ein charakteristischer früher Essay über Faraday und das Glück naturwissenschaftlichen Forschens, der sein Thema hinter dem Titel »Eine Nacht in Pietramala« verbirgt, mit einer rauen Frühlingsfahrt über den Apennin und der eiskalten Nacht in einer üblen Herberge; eine eindringliche Meditation über Piranesis »Kerker« wird durch die groteske Begegnung mit der Mumie von Jeremy Bentham im Treppenhaus des University College zu London eingeleitet; und eine kleine Geschichte des Urbanen Schmutzes und der Abwässersanierung setzt mit einem kalifornischen Strandbummel in Begleitung von (ausgerechnet!) Thomas Mann ein. Am Anfang steht gern das paradoxe Bild, die selbstironisch konkrete subjektive Situation. Im Vorausschicken inkongruenter Aspekte des Themas, wie sie für Huxleys Sicht der menschlichen Dinge bezeichnend sind, kündigt sich der persönliche touch an und weckt im brillanten Versteckspiel unsere Neugier auf das, was sich an die überraschende Eröffnung anschließt – die Phase des Hinführens. Beim ersten der Beispiele sind es die von den Reisenden in der weiteren Umgebung ihrer Eishöhle sehnsüchtig anvisierten Erdgasflammen, die den Bogen zu Faradays Forschungen schlagen; der Utilitarist Bentham lenkt als Planer eines perfekt konzentrischen Gefängniskomplexes den Blick zurück auf die so ganz anders gearteten Carceri Piranesis; und das Gespräch mit Thomas Mann kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wird durch die groteske Wahrnehmung unterbrochen, dass die pazifischen Wogen aus den damals noch ungeklärten Abwässern von Los Angeles Myriaden gebrauchter Kondome an die Küste spülten. Die zufällige und unscheinbare Alltagsaktualität wird im Essay zu Anstoß und Quelle weitreichender gesellschaftlicher Erkenntnis, und der moderne Essayist wiederum teilt sich seiner Zeit, wenn er sie nicht nur interesselos betrachten, sondern auf sie einwirken will, journalistisch mit. Frivolität und moralischen Ernst, Höhe und Strenge des Denkens und elegante Gemeinverständlichkeit (ein Essayist schreibt nicht für Spezialisten) weiß Huxley auf eine besondere Art zu vereinbaren, die sein Markenzeichen als wirkungsbedachter Autor dieses Jahrhunderts ist.
Auch in eigener Sache verschmäht Huxley die anekdotisch-ironische Eröffnung nicht. Als 1961 eine stattliche Bibliografie seiner weit gestreuten Publikationen erschien, schrieb er bereitwillig ein kleines Vorwort dazu, das er mit einer seiner Lieblingsanekdoten einleitete:
Edward Gibbon war auf ganz rührende Weise versnobt, und als der zweite Band seines Decline and Fall herauskam, ließ er ein Exemplar in rotes Saffianleder binden und überreichte es einem der Söhne Georgs III. (war es der Herzog von Kent?). »Wie, Mr. Gibbon«, sagte die Königliche Hoheit, während sie die Gabe des Historikers huldvoll entgegennahm, »wie, Mr. Gibbon, schon wieder so ein dicker, verdammter, vierschrötiger Schmöker? Nichts als kritzeln, kritzeln, kritzeln?«
Die bewusste, keineswegs vollständige Huxley-Bibliografie umfasst 959 Titel, und in der Sparte »Essays und journalistische Arbeiten« – die Grenzen sind, wie gesagt, fließend – beläuft sich die Bilanz auf an die vierhundert Einträge. In seiner Glosse »Das Wörterbad« bekennt der Autor schon 1934, dass der jährliche Ausstoß des Buch- und Zeitungsmarktes an geschwärztem Papier etwas Erschreckendes habe, zumal für ihn selbst: »Denn ich bin einer von denen, die von Berufs wegen das große Meer des Gedruckten, in dem unser Geist unablässig badet, anschwellen lassen.« Im selben Atem nennt er jedoch seinen Beitrag ein bloßes Rinnsal im Vergleich zu den Mississippis und Amazonas der wahrhaft produktiven Autoren – eine Selbsteinschätzung, die schon für sein erstes Laufbahndrittel als ironisches understatement angesehen werden darf.
Doch Huxley hat viel geschrieben. Und ›Überproduktion‹ lautet denn auch ein Standardvorwurf seiner Kritiker (neben: Cleverness, Ungeschick, Hedonismus, Lebensfeindlichkeit, Prinzipienlosigkeit, Prinzipienreiterei etc. – aber er las keine Kritiken). Er schrieb viel, weil er vom Schreiben leben musste. Sein erster Verlagsvertrag, der ihm aus Tantiemenvorschüssen ein regelmäßiges Gehalt aussetzte, verpflichtete ihn zu zwei books of fiction pro Jahr; später wurden die Bedingungen für den erfolgreichen Hausautor von Chatto and Windus merklich gelockert: man senkte die Zahl und nahm auch Gedicht- und Essaybände ›in Zahlung‹. Immerhin sah Huxley in seinen ersten Jahren als freier Schriftsteller manchmal das Balzacsche Menetekel der Verlagsknechtschaft am Horizont. Doch die Feder wurde ihm nie zum Galeerenruder. Er schrieb viel, weil er viel zu sagen hatte.
II
Als einer, der im Schatten des Weltkriegs zum Schreiben berufen wurde, fand Huxley es aufregend, Zeuge einer wiederauflebenden, aber todesgezeichneten Welt zu sein, sie mit scharfem Verstand und künstlerischer Empfindung, mit seinem Witz und seinen fünf Sinnen zu durchdringen und im Spiegelkabinett seines Bewusstseins in ihrer disparaten Vielfalt zu reflektieren. Sein Mut, auch den späteren Schrecken des Jahrhunderts mit diagnostischer Kühle ins Auge zu sehen, seine große Interessenvielfalt und Lernfähigkeit – Goyas Motto für das Alter: aún aprendo, »ich lerne weitere«, ist auch das seine –, die Gabe, sich an den Absurditäten der Gattung Mensch zu delektieren, ohne den Aberglauben, selbst nicht dazuzugehören: all dies macht ihn, zwischen Distanz und Teilnahme, Vogel- und Froschperspektive wechselnd, zum unvergleichlichen essayistischen Zeugen des Jahrhunderts; seine Exzentrik trifft ins Zentrum. Er lebte in einer Zeit, deren verheerende Massenbewegungen seinen Individualismus aufs Äußerste herausforderten, und seine Leidenschaft des Verstehens wuchs an dieser Herausforderung durch das Ganz-Andere; in der eigenen Herausforderung spürt er der allgemeinen Bedrohung des Menschlichen durch die Mächte der Zeit nach. So weit er auch, in der Zeit lebend, über manche früheren Positionen hinauswuchs, in der Verteidigung der Vielgestalt des Lebens gegen die großen weltanschaulichen Vereinfacher und die kleinen sturen Dogmatiker blieb er sich treu. Unermüdlich erinnert uns der als Intellektualist verschriene Huxley daran, dass das wahre Potenzial des Menschen in seinem leib-seelischen Amphibiencharakter begründet liegt.
Hier erweist sich die Essayistik als ihren Ursprüngen in Antike und Renaissance eng verbundene Kunst der weisen Lebensführung, als durch eigene Anschauung in schwierigen Zeiten entwickelte ars bene vivendi. Die Einsichten ihrer schonungslosen, aber lebensbejahenden Betrachtung von Ich und Gesellschaft sind humane Prophylaxe gegen die Krankheiten der einzelnen und kollektiven Seele. Einige Mittel dieser essayistischen Aufklärung heißen: Pointe, Paradox und die Rolle des advocatus diaboli, um verhärtete Denkgewohnheiten spielerisch aufzusprengen; Hingabe an die eigene Assoziations- und Kombinationsgabe als Rhythmus geistiger Entdeckung; Inkongruenz und offene Form als dialogisches Prinzip und Genuss intellektueller Stimmenvielfalt – nicht im Sinne eines resignierenden Relativismus, sondern als Fähigkeit, »kontrapunktisch« in unaufgelösten Spannungen zu denken. So besehen ist Montaignes drittes Buch für Huxley das Pendant zur ganzen Comédie Humaine:
Unmöglichkeiten, zusammengesetzt aus Unvereinbarem, aber von innen nach außen zusammengesetzt … Wie es gerade kommt, eins nach dem anderen – doch in einer Abfolge, die auf wunderbare Weise das jeweilige Zentralthema entwickelt und mit dem Gesamtbereich menschlicher Erfahrung verbindet.
Der Name Autolycus, mit dem Huxley seine ersten journalistisch-essayistischen Glossen zeichnete, war Programm: er stammt von dem unreputierlichen Hausierer, der in der sizilischen Schäferidylle des Wintermärchens seinen Krimskrams feilbietet und einen illusionsfeindlichen Blick auf die goldene Pastoralwelt wirft. Der Lumpensack ist eine alte, Montaignesche Ironiemetapher des Essayisten für das eigene Metier. Hier wie an anderen Stellen (etwa in »Vulgarität und Literatur« oder »Paphos und Famagusta«) bekennt sich Huxley zu einer »unreinen«, wirklichkeitsgesättigten, ideell-materiellen Kunst. Als ihm einmal in einer Pariser Abendgesellschaft von einem Literaturprofessor eröffnet wird, er sei ein führendes Mitglied der »neoklassischen Schule«, quittiert er dieses Etikett mit komischem Entsetzen:
… denn zum einen finde ich Geschmack am Lebendigen, Gemischten und Unvollkommenen in der Kunst; ich ziehe es dem Allgemeingültigen und chemisch Reinen vor. Und zweitens betrachte ich die klassische Disziplin mit ihrer Insistenz auf Vereinfachung, Elimination, Konzentration wesentlich als eine Form der Furcht und Flucht vor der allergrößten Schwierigkeit: mit den Mitteln der Literatur jenes unendlich komplizierte und geheimnisvolle Ding angemessen wiederzugeben – die tatsächliche Realität.
In dieser »essayistischen« Einstellung liegt der Schlüssel zur besonderen Qualität der Huxleyschen Romane, einer Qualität, die den Nerv der Zeit treffen mochte, aber gern von der strengeren ästhetischen Richtung als Krudität verworfen wurde. So Virginia Woolf: »Alles roh, ungekocht, zu laut … Mir graust es vor Aldous' Roman [Point Counter Point]: so etwas ist unbedingt zu vermeiden. Aber Ideen sind klebriges Zeug – widerstehen der Verschmelzung, hemmen die schöpferische, unbewusste Fähigkeit.« Oder Hemingway: »Wenn ein Autor sein intellektuelles Gegrübel, statt es in preiswerten Essays abzusetzen, künstlich konstruierten Charakteren, die sich als Romanfiguren besser verkaufen, in den Mund legt, dann ist das vielleicht wirtschaftlich sinnvoll, aber noch lange keine Literatur.« Huxley, der nie den geringsten Ehrgeiz zeigte, wie Virginia Woolf oder Hemingway zu schreiben – auch über den Stierkampf hatte er schließlich ganz andere Ansichten als Letzterer –, nimmt sich bewusst ebendas als künstlerisches Programm vor, was man ihm hier als Verirrung ankreidet. Schon 1926 äußert er in einem Interview: »Mein eigenes Ziel ist es, auf technischem Wege zu einer vollkommenen Verschmelzung von Roman und Essay zu kommen: ich brauche einen Roman, in den man all seine Ideen stecken kann, einen Roman wie eine Reisetasche (like a hold-all).« Bis zuletzt bleiben seine Romane dieser Form, die so unverkennbar seine eigene war, treu. Ihre ironische Kühle und Härte ist weder nihilistisch noch zynisch – sie ist Mittel essayistischer Exploration.
III
Der Essayist macht sein subjektives Ich zur entscheidenden Prüfungsund Vermittlungsinstanz von Welterfahrung. Um die widersprüchliche Vielfalt der Welt zu reflektieren, bedarf es eines optimal vielfältigen Geistes, der die eigenen Spannungen produktiv macht. In dieser Hinsicht erfreute sich Aldous Huxley einer besonders guten Erbausstattung. Sein Vater war ein Sohn des großen viktorianischen Biologen Thomas Henry Huxley; mütterlicherseits war Aldous ein Urenkel des Reformpädagogen Dr. Arnold (of Rugby), Großneffe des Dichters und Kulturkritikers Matthew Arnold, und Neffe der zu ihrer Zeit viel gelesenen Romanautorin Mrs. Humphry Ward.
Naturwissenschaftliche Interessen – wie sie auch der Aldous zeitlebens eng verbundene Bruder Julian vertrat – bildeten zusammen mit dem poetisch-pädagogischen Erbteil der illustren Familientradition den geistigen Nährboden seiner Kindheit in Surrey, seiner Schulzeit in Eton (die abgebrochen wurde, als Erblindung drohte; eine Operation brachte Besserung) und seiner Studentenzeit in Oxford; Literaturstudium und erste Schreibversuche zeigen die gewählte Richtung an. Die folgende Tätigkeit als Lehrer in Eton (wo Orwell zu seinen Schülern zählte) blieb eine kurze, aber keineswegs milieufremde Episode. Die Spannung zwischen dem naturwissenschaftlichen und dem literarisch-pädagogischen Interessenpol ist jedenfalls eine Triebfeder seines Werkes geblieben. Noch sein letzter Großessay plädiert – angeregt durch die Debatte um die »Zwei Kulturen« – eindringlich für die Vereinbarkeit und Unverzichtbarkeit beider Erkenntnisweisen (denn die Künste sind ihm eine zentrale Form der Erkenntnis). Erkenntnis aber bedeutet zugleich Entdeckerglück und schmerzliche Desillusion. Als Moralist teilt Aldous Huxley die unbedingte Überzeugung seines Großvaters, der als Vorkämpfer Darwins gegen die viktorianischen Pietäten zu Felde zog, »dass es keine andere Linderung für die Leiden der Menschheit gibt als Wahrhaftigkeit des Denkens und Handelns und den entschlossenen Blick auf die Welt, wie sie ist, wenn man die Hülle schöner Täuschung, mit der fromme Hände ihre hässlicheren Züge verhüllt haben, von ihr abstreift«.
Bildungshintergrund der äußerlich abgeschirmten Oxforder Jahre war der Erste Weltkrieg mit seinem unermesslichen Verlust an Menschen und Gewissheiten. Wegen seiner schlechten Sicht war Huxley kriegsuntauglich. (Die Augen blieben prekär – vielleicht war er deshalb so sehbegierig und auf Malerei versessen; später gelang es ihm mit Hilfe einer Naturmethode, seine Sehkraft erstaunlich zu verbessern.) Das eigentliche geistige Leben vollzog sich, wie so oft, außerhalb der Universität: die Begegnung mit Bloomsbury, mit T. S. Eliot, mit D. H. Lawrence, dem späteren Freund und Antipoden, und natürlich mit Garsington.
Garsington, der Landsitz von Philip und Ottoline Morell vor den Toren Oxfords, war in jenen Tagen des Chauvinismus ein Erprobungsraum künftiger Zivilisation, Treffpunkt der künstlerischen Intelligenz und Hort gegen die Vorurteile der Zeit. Es wurde für Huxley eine zweite Heimat und der fiktional verbrämte Schauplatz seines ersten brillanten Konversationsromans Crome Yellow von 1921 (dt. Eine Gesellschaft auf dem Lande). Lady Ottoline und andere, die sich in dem Roman wiederzuerkennen meinten, waren »not amused«, das Nachkriegspublikum dafür umso mehr. Wie sehr Garsington durch geistige Geselligkeit Kulturgeschichte gemacht hat, verrät etwa die folgende beiläufige Passage aus einem Brief Huxleys von 1916: »Eine amüsante Christmas Party hier: Murry, Katherine Mansfield, Lytton Strachey … Bertrand Russell und Maria Nys.« Der letzte Name erinnert daran, dass Garsington nicht nur ein Ort des geistigen Eros war. In Maria Nys, eine junge Belgierin, die in England Zuflucht gefunden hatte, verliebte sich Aldous nachhaltig – und nach Kriegsende wurde geheiratet. Maria, deren warme Ausstrahlung von vielen Freunden der Familie bezeugt wird – auch Lawrence empfand sie stark –, war der Mensch, durch den und an dem Aldous erfüllen konnte, was seine Mutter ihm vor ihrem Tod auf die Seele gebunden hatte: »love much«. Darüber hinaus war sie für ihn jenes romanische Kontinentaleuropa, zu dem er sich kulturell und bald auch geografisch hingezogen fühlte, und eine diskret allgegenwärtige Präsenz in seinem Werk wie im Leben. Wer etwa, der die rhapsodischen Schilderungen seiner ersten italienischen und französischen Autoreisen liest, würde ahnen, dass Huxley nicht selbst am Steuer saß? Immer hat ihn Maria chauffiert – eine durchaus symbolische Konstellation.
IV
Nach der Todesorgie und Klaustrophobie des Krieges bedeuten die zwanziger Jahre eine belebende und befreiende Öffnung. Ihre respektlose Kritik an den Hohlformen der alten, diskreditierten Zivilisation, ihre Sehnsucht nach neuer Vitalität, ihre Experimentierfreude, ihre – nicht selten zynische – Genusssucht und ihre Reiselust hat Huxley in seinen frühen Romanen, Essays und Reisebildern protokolliert – die Gedichtbändchen nicht zu vergessen, deren moderne Tönung einigen Anklang bei der fortschrittlichen Leserschaft fand. Viele der späteren Zentralthemen tauchen im geschliffenen Konversationsstil dieser Texte erstmals auf: Literatur und Kunst aus ungewohnt und reizvoll subjektiver Sicht, die Faszination der Fremde, der amüsierte und entlarvende Blick auf die Nachkriegsgesellschaft, die kontrapunktischen Spannungsmuster, die Sorge um die zivilisatorische Zukunft. Die neue Welt war kein Garsington.
Der geografische Abstand zum »buchtenverwinkelten Albion« – erst lange Sommermonate in Italien, später ein jahrelanger Aufenthalt in Südfrankreich (in Sanary bei Toulon, wo Huxley in den dreißiger Jahren Nachbar der deutschen Exilkolonie war) – wird zu einem kritischen Beobachtungsposten. Eine Weltreise führt nach Indien, Japan und in die USA, die den Autor damals kaum weniger fremd anmuten als der Ferne Osten. Point Counter Point (dt. Kontrapunkt des Lebens) bezeichnet 1928 den Höhepunkt der frühen, ironisch vielstimmigen Romane. Der nächste Erfolg, die Antiutopie Brave New World von 1932 zeigt eine deutliche thematische Verschiebung, wie sie auch in den Essays zutage tritt: Die Schatten auf der gesellschaftlichen Zukunft vertiefen sich. Während die totalitäre Drohung wächst, vertritt Huxley in beredter Argumentation eine pazifistische Abkehr von aller Gewalt; zusammen mit seiner Suche nach metaphysischer Erleuchtung (der Roman Eyeless in Gaza, dt. Geblendet in Gaza, von 1936 bezeichnet den Übergang zu diesem Thema) und seiner 1937 erfolgten Übersiedlung in die USA war diese Wendung eines prominenten Intellektuellen heftigen Missverständnissen und bitterer Kritik ausgesetzt. Das Klischee vom geistigen Führer, der seine Verantwortung angesichts der europäischen Katastrophe im Stich lässt, um bei kalifornischen Millionären und Gurus Zuflucht zu suchen, erwies sich als zählebig.
Doch die Wendung nach außen und nach innen gehört zusammen, ebenso wie Huxleys Leben in der kalifornischen Wüste und in Hollywood, seine Mystik (einschließlich der Drogenexperimente) und seine Vorlesungen zur politischen und ökologischen Krise der Erde. Sie alle waren Teil einer außerordentlichen und höchst humanen Verständnisanstrengung, zu der er all seine reichen Fähigkeiten aufbot. Nie ging es ihm um egoistische Salvierung aus dem großen Weltschlamassel. Was Julien Benda die trahison des clercs nannte, den Verrat der Intellektuellen an ihrer Verantwortung für die Zivilisation, hat er nie praktiziert; gegen die Götzen der Zeit war er – sieht man von ein paar jugendlich-chauvinistischen Briefstellen ab – im ersten wie im Zweiten Weltkrieg und dem darauffolgenden kalten Krieg immun. Sein Bekennertum war nicht das der jeweiligen Konjunktur.
Noch deutlicher, weil direkter, als die Romane belegen die Essaysammlungen (für die er seine Zeitschriften-Essays häufig überarbeitete) Huxleys geistige Fortentwicklung, aber auch eine grundsätzliche Konstanz seines Denkens. Dies zeigt ein Vergleich zweier Werke, die zu seinen charakteristischsten und wichtigsten gehören, Do What You Will (1929) und Themes and Variations (1950). Das erste ist gleichsam in Dur, das zweite in Moll komponiert. Beide reihen nicht einfach zeitlich zusammengehörige Arbeiten aneinander, sondern gruppieren sie im magnetischen Feld eines Zentralthemas. Am Ende der zwanziger Jahre ist es das Thema der Befreiung des historisch beschädigten Menschen als Individuum und Gattung zum vollen Menschentum. Huxley verneint, um zu bejahen: Er macht der Leibfeindlichkeit des Christentums und mit ihr zugleich den Ideologen und Mechanikern der modernen Welt den Prozess. Franziskus, Pascal, Swift und Baudelaire sind einige seiner bêtes noires, Künstler und Heilige, die ihn bei aller Bewunderung zum Widerspruch herausfordern, weil er sie in Antithese zu seinem eigenen Künstler-Credo das volle Leben verstümmeln und damit dem Todestrieb der Zivilisation dienen sieht.
Der fröhliche Ikonoklasmus im Namen des Lebensprinzips weicht in den dreißiger Jahren und während des Krieges einer anderen Tonart. In dem Essayband von 1950 scheint das Todesthema zu triumphieren: Barocke Todesdarstellung, Piranesis metaphysische Kerker, El Grecos klaustrophobische und »eingeweidliche« Ekstasen, Goyas Reise ans Ende der Nacht – die Kunstessays dominieren auffällig, und die Kunst ist Erkenntnis und Ausdruck des Schrecklichen. Doch das Lebensthema erklingt als mächtiger Kontrapunkt im Preis der Künstler, die den Schrecken ausgelotet haben, im buchlangen Porträt des Philosophen Maine de Biran, des introvertierten, lächerlich ungeschickten und doch bewundernswerten Denkers in einer schwierigen Welt, und im abschließenden Plädoyer für eine »kosmische Ethik« zur Erhaltung der Erde. Eine ähnliche Unterschiedlichkeit der Tonlagen bei unbedingtem Einsatz für das volle Potenzial des Menschseins zeigen die wunderbaren Anthologien (die zur Hälfte Essays sind) Texts and Pretexts von 1933 und The Perennial Philosophy von 1946. Ein luzider Geist sichtet die poetische und metaphysische Tradition für den modernen Leser und führt ihn auf persönliche Weise an die Texte heran. Auch hier die verborgene Gemeinschaft der Themen: Dichterische Imagination und meditative Vision erscheinen gleichermaßen als Erfahrungsweisen spiritueller Grenzüberschreitung.
Die letzte Dekade seines Lebens sieht Huxley so rastlos schreibend wie eh und je, ungeachtet der kühlen Aufnahme seiner späten Romane. Bücher, Vorträge, psychische Experimente bestimmen seinen Lebensrhythmus, und wie immer die intensive Pflege von Freundschaft und geistiger Geselligkeit. Seine Schriften The Doors of Perception und Heaven and Hell (1954//56) erregen Aufsehen, werden später von der Drogenkultur der 60er-Jahre vereinnahmt. 1955 stirbt Maria, von Aldous liebevoll an die Schwelle geleitet; beide haben gelernt, den Tod als letzte Grenzüberschreitung zu begreifen. Am 22. November 1963, dem Tag der Kennedy-Ermordung, nach einem bis zuletzt tätigen und erfüllten Leben, stirbt Huxley in seinem Haus in Los Angeles. Seine zweite Frau, Laura, ist bei ihm, geleitet ihn, so wie er zuvor Maria. Als er das Ende näher kommen spürt, kritzelt er auf seine Schreibtafel die Worte: »LSD – Try it.« Sie gibt ihm, mit Einverständnis des befreundeten Arztes, die Injektion. Er wird ruhiger und entschläft nach einigen Stunden friedlich. Eine intellektuelle Ungeheuerlichkeit? Flucht in die Euphorie in extremis? Eher wohl das Verlangen nach höchster Bewusstheit menschlicher Erfahrung bis zuletzt, das so charakteristisch für Aldous Huxley ist.
V
Der amüsante Feuilletonist, der Reiseschriftsteller, der unaufdringliche Besserwisser, unbestechliche Zeitzeuge, skeptische Wahrheitssucher, der Philosophie- und Utopiekritiker, der Ästhet, der Ökologe der ersten Stunde – sprechen all diese Huxleys noch oder wieder zu uns? Die vorliegende Ausgabe entstand aus dem Vertrauen darauf, dass Huxley der Essayist nicht nur außergewöhnlich lesbar, sondern auch erstaunlich aktuell geblieben ist: Wo er zu zeitgebundenen Fragen Stellung nimmt, macht sein weiter Blickwinkel, der immer die Vergangenheit und Zukunft des Augenblicklichen zu erfassen sucht, das Gesagte bedenkenswert; sein Geist und Witz gibt ihm Denkwürdigkeit.
Im englischen Sprachbereich sind nicht nur die sieben (in sich jeweils durchkomponierten) Essaybände von On the Margin (1923) bis Adonis and the Alphabet (1956) und die beiden Reisebücher Jesting Pilate (1926) und Beyond the Mexique Bay (1934) im Rahmen der Werkausgabe zugänglich geblieben, Huxley selbst hat 1959 eine umfangreiche, thematisch geordnete Auswahl mit dem Titel Collected Essays vorgelegt, die einige Verbreitung fand. Dazu kamen die als selbstständige Bücher veröffentlichten Essays zur Zivilisationskritik und zum Drogenthema, die beiden kommentierten Anthologien und die eigens gesammelten Kunstessays (Of Art and Artists, 1960).
In Deutschland dagegen ist Huxleys Präsenz als Romanautor seinem essayistischen Werk noch kaum zugute gekommen. Die Zeitläufe lenkten das Interesse zunächst auf die Schriften zur Friedensfrage. Als erster Essay erschien 1939 bei Bermann-Fischer in Stockholm – unter dem Titel Unser Glaube und von unbekannter Hand übersetzt – das Zentralkapitel »Beliefs« aus Ends and Means (1937); der ganze Band wurde 1949 übertragen. Schon 1947 war die Schrift Science, Liberty and Peace, in der Huxley über das Kriegsende hinausdachte, auf Deutsch herausgekommen, vom Übersetzer des Erzählwerks, Herbert Herlitschka, übertragen, der 1952 auch den Band Themes and Variations (1950) – fast – vollständig übersetzte; dazu die Drogenbücher The Doors of Perception und Heaven and Hell (1954/56; dt. 1954/57), den großen Pascal-Essay (1929; dt. 1960) und den letzten als Buch publizierten Essay Literature and Science (1963; dt. 1964). Schließlich gibt es noch deutsche Fassungen der Erfahrung Huxleys mit einer Naturmethode der Augenheilung, The Art of Seeing (1943; dt. 1982), zweier pazifistischer Schriften aus den dreißiger Jahren (dt. 1984), der Essay-Anthologie The Perennial Philosophy (1945; dt. 1949) und des posthum veröffentlichten Sammelbandes Moksha, der – fast – alle Beiträge zur Drogenfrage enthält (1977; dt. 1983).
Die Situation ist demnach einigermaßen paradox. Mit Ausnahme des einen Bandes Themes and Variations ist der Essayist par excellence als solcher auf Deutsch noch kaum zu Wort gekommen, sondern nur der Fachmann für spezielle Zivilisationsprobleme. Die Pazifisten, die Meditativen, die Wissenschaftsskeptiker, die Drogeninteressenten, die Augenkranken – sie alle haben ihren Huxley. Der Versuch einer panoramatischen Ansicht, die der Spannweite dieses Lebens und dem Horizont dieses reflektierenden Geistes angemessen wäre, wurde nicht unternommen. Diesem Desiderat gilt es abzuhelfen. (Die bereits übersetzten Texte machen etwa ein Achtel der vorliegenden Ausgabe aus.)
Die Collected Essays geben ein willkommenes Modell dafür ab, wie Huxley seine essayistische Lebensernte eingebracht sehen wollte.[1]
Ihrem thematischen Gliederungsprinzip – wobei der systematische Standort bei der Gedankenfülle der Texte oft alles andere als eindeutig ist – und ihren Textvorschlägen – von denen sie etwa drei Viertel übernimmt – folgt die deutsche Ausgabe auf weite Strecken. Doch sie enthält auch anderes. Aus der ethischen und metaphysischen Perspektive von 1959 ist die späte Huxley-Editorik etwas zu streng mit seinen früheren Ichs umgegangen, deren zuweilen frivoler Brillanz sie misstraute. So fehlen in dieser reichen Huxley-Kollektion immerhin einige Kabinettstücke der frühen Essayistik wie »A Night at Pietramala«, »The Best Picture« und »Conxolus«, die zugleich aufschlussreiche Standortbestimmungen dieser Phase enthalten. Sie alle, und vieles mehr aus den Bänden vor der »Wende«, die wie gesagt keinen wirklichen Bruch der Kontinuität bedeutet, sind hier aufgenommen. Und darüber hinaus Dinge, die sich in keiner englischen Huxley-Ausgabe finden: journalistische Beiträge, die nie nachgedruckt wurden, wie eine frühe Proust-Rezension aus dem Athenaeum oder ein Aufsatz mit dem unheimlich prophetischen Titel »If my Library Burnt Down Tonight« (den 1961 ein kalifornisches Buschfeuer wahr machen sollte); schließlich eine Reihe von Kurzessays, die Anfang der dreißiger Jahre im Chicago Herald erschienen und sich zum Teil, aus gegebenem Anlass, mit deutschen Themen befassen; und dazu einige Gedichte, die Themenkreise der Essayistik berühren.
Es wird kein puristischer Huxley geboten: Gelegentliche Wiederholungen und Widersprüche, einige zweifelhafte Enthusiasmen und Sottisen wurden nicht weggekürzt; sie sind Teile jener indirekten Autobiografie, die ein essayistisches Werk darstellt, Provokationen eines hellwachen Geistes, der als Dialogpartner nicht nur unsere Zustimmung, sondern auch unseren Widerspruch fordert; und der, wenn er gelegentlich hoch zu Roß auf seinem elitären Pegasus am kulturellen Fußvolk vorbeigaloppiert, oft überraschend kehrtmacht, absteigt und sich unter die Menge mischt – wie in dieser selbstironischen Charakteristik der eigenen schriftstellerischen »Vulgarität« aus Vulgarity and Literature:
Ein Bild, glitzernd, irisierend, bietet sich an: fang es ein, spieß es auf, und wenn es auch noch so unpassend überbrillant für den Kontext ist! Eine Wendung, eine Situation suggeriert eine ganze Folge überraschender oder amüsanter Vorstellungen, die gleichsam tangential von der runden Welt, die der Schöpfer gerade in Arbeit hat, fortschießen; welch gute Gelegenheit, etwas Witziges oder Tiefschürfendes loszuwerden … Nur herein mit der Tangente, oder besser heraus, in die künstlerische Irrelevanz!
Witz, Provokation und Paradox (etymologisch verstanden als Widerspruch gegen die gängige Meinung) – Merkmal keineswegs nur des frühen Huxley – sind Dialogangebote des Essayisten an den Leser. Auf diese Stilqualitäten sowie generell auf den Konversationston, der den Leser zum Gesprächspartner macht, haben die Neuübertragungen besonders zu achten versucht; vor allem in diesem Sinne wurden auch die übernommenen älteren Übersetzungen stilistisch bearbeitet. Leider erwies es sich als unmöglich, auf Textkürzungen ganz zu verzichten, besonders in den buchlangen Essays über Pascal und Maine de Biran; sie sind auf wenige Werke beschränkt und jeweils im Text vermerkt. Die relativ lose, bewusst digressive Struktur, nach dem »tangentialen« Prinzip oder dem eines »Themas mit Variationen«, rechtfertigt solche Eingriffe, wie sie mit Huxleys Einverständnis bereits für einige Stücke seiner Collected Essays vorgenommen wurden, um der größeren Vielfalt willen.
Für die Textfolge innerhalb der einzelnen Themenbereiche ist in der Regel die Chronologie der Essays maßgebend, bei den Kunstessays jedoch diejenige der Kunstgeschichte; gelegentlich auch das Prinzip »vom Allgemeinen zum Besonderen«. Die Anlage soll aber auch die Weite der Themenkreise illustrieren, etwa von den frühen Reiseskizzen hin zu einigen späten Essays, in denen das Reiseerlebnis nur mehr Vorwand und Ausgangspunkt für eine weit ausgreifende Gedankenbewegung ist, oder von einem vitalistischen Naturgedicht zum leidenschaftlichen Appell an das ökologische Gewissen der Menschheit. In einem Fall wurden zwei Essays zum selben Thema (El Grecos Malerei) aufgenommen, weil sie zwei Huxleysche Stile illustrieren und weil der frühere die »Quelle« des späteren ist: so lässt sich die Entfaltung und Reifung eines Essays beispielhaft verfolgen.
Bei einem Autor, der so unablässig und beiläufig aus einer Fülle verschiedenster Quellen zitiert (schon seine Titel sind meist Zitate), natürlich ohne Quellenangaben – ein Essayist ist kein Pedant: er nimmt die geistige Beweglichkeit seiner Leser als gegeben an –, und der sich so sehr an englisch-romanischer Kultur orientiert und so wenig an deutscher (»deutsch« ist bei ihm oft negativ konnotiert: als pedantisch gelehrt, kunstlos, geistig unmäßig), scheint ein Minimum an Sacherklärung für den deutschen Leser ein Gebot der Höflichkeit; Vollständigkeit ist hier weder erreichbar noch wünschenswert. Das Register will die Einladung zum Kreuz- und Querlesen, die jede Essaysammlung (und diese besonders eindringlich) ausspricht, hilfreich unterstreichen.
München 1994, Werner von Koppenfels
Vorrede
»Ich bin ein lebendiger Mensch«, sagte D. H. Lawrence. »Aus diesem Grund bin ich Romanschreiber. Und als Romanschreiber finde ich mich dem Heiligen, dem Wissenschaftler, dem Philosophen und dem Dichter überlegen, die zwar allesamt große Experten für bestimmte Einzelbezirke des lebendigen Menschen sind, aber nie aufs Ganze gehen … Einzig und allein im Roman kommt alles voll ins Spiel.«
Was für den Roman gilt, darf fast in gleichem Umfang für den Essay gelten. Denn wie der Roman ist auch der Essay ein literarischer Kunstgriff, um fast über jedes Erdenkliche alles Erdenkliche zu sagen. Ein Essay ist traditionell, und beinahe per definitionem, ein kurzes Prosastück, weshalb es unmöglich ist, in den Grenzen eines einzelnen Essays alles voll ins Spiel zu bringen. Aber eine Essay-Sammlung kann ein fast ebenso großes Gebiet beackern – und es fast ebenso gründlich beackern – wie ein langer Roman. Montaignes drittes Buch ist in gewisser Hinsicht das Pendant zu einem guten Teil der Comédie Humaine.
Essays gehören einer literarischen Spezies an, deren außerordentliche Wechselhaftigkeit sich am besten im Rahmen eines dreipoligen Bezugssystems studieren lässt. Da ist einmal der Pol des Persönlich-Autobiografischen; dann der Pol des Objektiven, Tatsächlichen, Konkret-Besonderen; und schließlich der Pol des Abstrakt-Universellen. Die meisten Essayisten sind nur in der Nähe eines dieser drei essayistischen Pole wirklich zu Hause und in bester Form. So gibt es die vorwiegend persönlichen Essayisten, die Bruchstücke autobiografischer Selbstbetrachtung verfassen und die Welt durch das Schlüsselloch anekdotischer Beschreibung anschauen. Dann sind da die vorwiegend objektiven Essayisten, die nie direkt von sich selbst reden, sondern ihre Aufmerksamkeit ganz nach außen richten, auf irgendein literarisches, wissenschaftliches oder politisches Thema. Ihre Kunst besteht darin, die relevanten Gegebenheiten darzustellen, zu bewerten und als Ausgangspunkt für allgemeine Schlussfolgerungen zu benützen. Und in der dritten Kategorie finden wir jene Essayisten, die ihre Arbeit in einer Welt hochgradiger Abstraktion verrichten, sich nie zu einer persönlichen Bemerkung herablassen und kaum geruhen, von den besonderen Tatsachen Notiz zu nehmen, aus denen ihre Verallgemeinerungen ursprünglich abgeleitet waren.
Jede dieser Essay-Arten hat ihre eigenen Mängel und Meriten. Der persönliche Essayist kann so gut sein wie Charles Lamb in seiner Bestform oder so schlecht wie Herr XY in seiner flottesten oder schrulligsten Manier. Der objektive Essay kann so lebhaft, so auftrumpfend streitsüchtig daherkommen wie ein Stück Macaulayscher Prosa; aber er kann auch, mit fataler Leichtigkeit, ins bloß Informative abgleiten oder – falls es sich um einen kritischen Text handelt – ins bloß Gelehrte und Akademische. Und wie glanzvoll, wie offenbarungstief klingen die Aussagen der großen Verallgemeiner! »Wer Weib und Kind besitzt, hat dem Schicksal Geiseln in die Hand gegeben; denn sie behindern große Unternehmungen, solche der Rechtschaffenheit ebenso wie der Bosheit.«[1] Von Bacon zu Emerson: »Die Menschheit brüstet sich mit der gesellschaftlichen Besserung, aber kein Mensch bessert sich selbst. Die Gesellschaft an sich macht nie Fortschritte. Sie verliert auf der einen Seite ebenso rasch das an Terrain, was sie auf der anderen gewinnt. Für jedes Geschenk wird ihr etwas fortgenommen.« Selbst ein Baltasar Graciàn, jener knappste unter den Essayisten, der so schreibt, als würde er seine Weisheit für zwei Dollar das Wort auf die andere Erdhälfte kabeln, bringt es manchmal zu einer gewissen Großartigkeit: »Die Dinge haben ihre Frist; auch Vortrefflichkeit ist der Mode unterworfen. Der Weise besitzt einen Vorzug: Er ist unsterblich. Wenn das jetzige Jahrhundert das seine noch nicht ist, so werden es dafür viele andere sein.«
Doch die Medaille der feierlichen und lapidaren Verallgemeinerung hat auch ihre Kehrseite. Als Beispiel einer solchen »algebraischen« Schreibweise will ich eine kurze Passage aus Paul Valérys Dialogues anführen. Es lohnt sich bei dieser Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass die französische Literatur eine Tradition hoher und anhaltender Abstraktion aufweist, die englische dagegen nicht. Werke, die im Französischen keineswegs ungewöhnlich wirken, erscheinen in Übersetzung beinahe bis zur Absurdität seltsam. Doch selbst dann, wenn er durch Überlieferung und große Begabung genießbar wird, erscheint uns der algebraische Stil der lebenden Wirklichkeit unmittelbarer Erfahrung weit entrückt. Hier also, in den Worten eines imaginären Sokrates, beschreibt Valéry jenen Stil, in dem er (leider, wie ich meine) zu schreiben liebte: »Was gibt es Geheimnisvolleres als die Klarheit? Was ist launischer als die Verteilung der Lichter und Schatten über die Stunden und Menschen? Gewisse Völker verlieren sich in ihren Gedanken, aber für uns Griechen sind alle Dinge Gestalt. Wir behalten nur ihre Verhältnisse; und wie eingeschlossen in das klare Licht erbauen wir ähnlich dem Orpheus mit den Mitteln des Wortes Tempel der Weisheit und der Wissenschaft, die allen vernünftigen Wesen genügen können. Diese große Kunst verlangt von uns eine wunderbar genaue Redeweise. Der Name selbst, der sie bezeichnet, ist bei uns zugleich der Name der Vernunft und der Rechenkunst. Dasselbe Wort bezeichnet diese drei Dinge.«[2] Diese elegante Algebra macht sich gut in der Stratosphäre abstrakter Begriffe; doch eine vollkommen entkörperte Sprache kann nie den Gegebenheiten der unmittelbaren Erfahrung gerecht werden, und ebenso wenig kann sie etwas zu unserem Verständnis jener »launenhaften Lichter und Schatten« beitragen, inmitten derer wir, ob wir wollen oder nicht, nun einmal unser Leben leben müssen.
Am vollständigsten stellen jene Essays ihre Leser zufrieden, die das Beste nicht nur aus einer oder zwei, sondern aus allen drei Welten machen, in denen ein Essay leben kann. Frei und mühelos bewegen sich Denken und Fühlen in diesen vollkommenen Kunstwerken, hierhin und dorthin, zwischen den drei essayistischen Polen – vom Persönlichen zum Universellen, vom Abstrakten zurück zum Konkreten, von der objektiven Gegebenheit zum inneren Erlebnis.
Der Gipfel der Vollkommenheit einer Kunstform wird selten schon durch ihren ersten Erfinder erreicht. Zu dieser Regel ist Montaigne die große und großartige Ausnahme. Zu jenem Zeitpunkt, als er sich in sein drittes Buch vorangeschrieben hatte, erreichte er die Grenzen seiner neu entdeckten Kunst. »Was ist dies hier anderes«, so hatte er zu Beginn seiner Essayisten-Laufbahn gesagt, »als Grotesken und Zerrgebilde, aus verschiedenen Gliedern zusammengestückt, ohne bestimmte Gestalt, ohne andere als zufällige Ordnung, Folge und Verhältnis?« Doch wenige Jahre vergingen, und die Flickwerk-Grotesken waren zu lebendigen Organismen geworden, in der Form vielgestaltiger Hybriden wie jene schönen Ungeheuer alter Mythologien, die Meerjungfrauen, die vielköpfigen geflügelten Stiere, die Kentauren, Anubise und Seraphim: Unmöglichkeiten zusammengesetzt aus Unvereinbarem, aber von innen nach außen zusammengesetzt, in einem wachstumsähnlichen Prozess, sodass der Menschenrumpf wie selbstverständlich zwischen den Pferdeschultern zu entspringen scheint und der Fischleib so mühelos und unvermeidlich zur vollbrüstigen Sirene hinüberwechselt, wie ein musikalisches Thema von einer Tonart zur anderen wechselt. Freiheit der Assoziation unter künstlerischer Kontrolle – das ist das paradoxe Geheimnis von Montaignes besten Essays. Wie es gerade kommt, eins nach dem anderen – doch in einer Abfolge, die auf wunderbare Weise ein Zentralthema entwickelt und es mit dem Gesamtbereich menschlicher Erfahrung verbindet. Und wie schön Montaigne die Verallgemeinerung mit der Anekdote verknüpft, die Predigt mit der autobiografischen Erinnerung! Wie geschickt er das Konkret-Besondere, die chose vue, einsetzt, um eine umfassende Wahrheit auszudrücken, und sie auf diese Weise so viel eindringlicher und kraftvoller auszudrücken, als es selbst der hochfliegendste unter den Grossisten der Verallgemeinerung vermöchte.
So zum Beispiel das große Orakel, Dr. Johnson[3], wenn es sich zur conditio humana und zum Nutzen der Heimsuchung äußert: »Das Leiden ist untrennbar von unserem irdischen Stand; es heftet sich an alle Einwohner dieser Welt, gewiss in unterschiedlichem Maße, aber in einer Portionierung, die durch unser eigenes Verhalten nur wenig regulierbar erscheint. Es war der Stolz irgendeines groß tönenden Moralisten, dass jedes Menschen Geschick in seiner eigenen Macht stehe, dass die Klugheit alle übrigen Gottheiten ersetze und dass Glückseligkeit die unfehlbare Konsequenz der Tugend sei. Doch ganz gewiss ist der Köcher des Allmächtigen mit Pfeilen versehen, gegen die der Schild menschlicher Tugend, wie sehr man auch seine diamantene Härte gerühmt haben mag, vergeblich erhoben wird. Wir büßen nicht immer für unsere Vergehen, und nicht immer sind wir durch unsere Unschuld geschützt … Nichts verleiht uns so sehr die Fähigkeit, den Versuchungen, von denen wir tagtäglich umstellt sind, zu widerstehen, wie eine gewohnheitsmäßige Betrachtung der Kürze des Lebens und der Unsicherheit jener Genüsse, die um uns buhlen; und solche Betrachtung kann uns nur das Leiden einimpfen.«
Das ist durchaus bewundernswert, aber es gibt noch andere (und ich würde sagen, bessere) Arten, sich diesem Thema zuzuwenden. »J'ay veu en mon temps cent artisans, cent laboureurs, plus sages et plus heureux que des Recteurs de l'Université.« (Ich habe in meinen Tagen hundert Handwerker, hundert Bauern gesehen, die weiser und glücklicher waren als Hochschulrektoren.) Und weiter: »Werfen wir unseren Blick zur Erde auf die armen Leute, die wir da kommen und gehen sehen, den Kopf über ihre Arbeit gebeugt, die weder von Aristoteles noch von Cato noch von Beispielen und Leitsätzen wissen: in ihnen bringt die Natur Tag für Tag Werke der Beständigkeit und der Geduld hervor, reiner und aufrechter als jene, die wir in den Schulen so andächtig studieren.« Ein Schuss Natur und ein Schuss Ironie – das gibt zusammen eine Kritik des Lebens, die – so beiläufig und leichtfertig sie sich geben mag – tiefer dringt als der rhetorische Donner der Orakel. »Es sind nicht unsere Torheiten, die mich zum Lachen bringen«[4], sagt Montaigne, »sondern unsere Weisheiten.« Und warum reizen wohl einen Weisen die Weisheiten zum Lachen? Nicht zuletzt deshalb, weil unsere Berufsweisen dazu neigen, sich in einer Sprache höchster Abstraktion und weitester Verallgemeinerung auszudrücken, in einer Sprache, die sich bei all ihrer sibyllinischen Salbung dann, wenn es wirklich mulmig wird, gewöhnlich als hoffnungslos unpassend für die Dinge des Lebens in ihrer wahrhaft und tragisch gelebten Natur erweist.
Im Laufe der letzten vierzig Jahre habe ich Essays jeglicher Größe, Form und Farbe verfasst. Essays von beinahe Graciánischer Knappheit, andere, gelegentlich, von mehr als Macaulayscher Länge. Autobiografische Essays; Essays über die Dinge, die ich gesehen, und die Orte, die ich besucht habe; kritische Essays über Kunstwerke aller Art, aus dem Bereich von Literatur, bildender Kunst, Musik; Essays über Philosophie und Religion, einige in der Form abstrakter Argumentation, andere in Gestalt einer kommentierten Anthologie, wieder andere, in denen allgemeine Ideen auf dem Weg über konkrete Tatsachen der Geschichte und Biografie erschlossen werden. Essays schließlich, in denen ich in der Nachfolge Montaignes versucht habe, das Beste aus allen drei essayistischen Welten zu machen und alles auf einmal zu sagen – aus dem Bemühen, mich der kontrapunktischen Gleichzeitigkeit der Musik so sehr anzunähern, wie es die Natur sprachlicher Kunst nur irgend erlaubt.
Manchmal, so will mir scheinen, ist es mir einigermaßen gelungen, das zu tun, was ich mir im einen oder anderen Bereich vorgenommen hatte. Manchmal, dessen bin ich mir schmerzlich bewusst, ist es misslungen. Aber: »Bitte nicht auf den Pianisten schießen; er tut sein Bestes.« Sein Bestes selon ses quelques doigts perclus, um mit seinem kleinen Klavier so viel auszudrücken wie das Sinfonieorchester eines Romans, sein Bestes, um »alles voll ins Spiel zu bringen«. Zumindest für den Autor, und vielleicht auch für den Leser, ist es besser, bei dem Versuch solcher Vollständigkeit zu scheitern, als sich nie auf den Versuch einzulassen.
Aldous Huxley
(Collected Essays, 1959; Ü.: Werner von Koppenfels)
DIE NATUR
The Cicadas
Sightless, I breathe and touch; this night of pines
Is needly, resinous and rough with bark.
Through every crevice in the tangible dark
The moonlessness above it all but shines.
Limp hangs the leafy sky; never a breeze
Stirs, nor a foot in all this sleeping ground;
And there is silence underneath the trees –
The living silence of continuous sound.
For like inveterate remorse, like shrill
Delirium throbbing in the fevered brain,
An unseen people of cicadas fill
Night with their one harsh note, again, again.
Again, again, with what insensate zest!
What fury of persistence, hour by hour!
Filled with what devil that denies them rest,
Drunk with what source of pleasure and of power!
Life is their madness, life that all night long
Bids them to sing and sing, they know not why;
Mad cause and senseless burden of their song;
For life commands, and Life! is all their cry.
I hear them sing, who in the double night
Of clouds and branches fancied that I went
Through my own spirit's dark discouragement,
Deprived of inward as of outward sight:
Who, seeking, even as here in the wild wood,
A lamp to beckon through my tangled fate,
Found only darkness and, disconsolate,
Mourned the lost purpose and the vanished good.
Now in my empty heart the crickets' shout
Re-echoing denies and still denies
Die Zikaden
Sichtlos atme, befühl ich Piniennacht,
So nadlig, harzig, rauh von Rindenrunzeln.
Durch alle Ritzen im greifbaren Dunkeln
Rinnt die Mondlosigkeit, wie licht gemacht.
Schlaff hängt das Himmelsblattwerk; nicht ein Hauch
Regt sich, kein Fuß schlafenden Grund entlang;
Dicht liegt die Stille unter Baum und Strauch,
Stille, die lebt, aus unablässigem Klang.
Wie eingefleischte Pein, rasend und schrill,
Wie Wahnsinn, der in Fieberhirnen pocht –
Ein unsichtbares Heer Zikaden füllt
Die Nacht mit grellem Misston, noch und noch.
Und noch und noch, mit unstillbarer Gier!
Welch ein Dämon hat ihre Ruh geraubt?
Stunde um Stunde rast es, stur und irr,
Aus welchem Quell der Lust und Macht berauscht?
Ihr Wahn ist Leben, Leben: all die Nächte lang
Heißt es sie singen, singen, wissen nicht, warum;
Irrwitz der Grund und Kehrreim für den Sang;
Das Leben will's, und Leben! schrillt ihr Ruf.
Ich hör sie singen, zweifach nächtig blind
Durch Wolken und Gezweig, als irrte ich
In meines Geistes ödem Labyrinth,
Beraubt der inneren und der äußeren Sicht;
Der suchend (so wie hier im dunklen Wald)
Nach Licht, das mich durch Schicksalswirren leitet,
Nur Finsternisse fand und oft, verzweifelt,
Mein Heil verloren gab, und meinen Halt.
Jetzt widerhallt mir das Zikadenschreien
Im leeren Herzen, und verneint, verneint
With stubborn folly all my learned doubt,
In madness more than I in reason wise.
Life, life! The word is magical. They sing,
And in my darkened soul the great sun shines;
My fancy blossoms with remembered spring,
And all my autumns ripen on the vines.
Life! and each knuckle of the fig-tree's pale
Dead skeleton breaks out with emerald fire.
Life! and the tulips blow, the nightingale
Calls back the rose, calls back the old desire:
And old desire that is for ever new,
Desire, life's earliest and latest birth,
Life's instrument to suffer and to do,
Springs with the roses from the teeming earth;
Desire that from the world's bright body strips
Deforming time and makes each kiss the first;
That gives to hearts, to satiated lips
The endless bounty of to-morrow's thirst.
Time passes, and the watery moonrise peers
Between the tree-trunks. But no outer light
Tempers the chances of our groping years,
No moon beyond our labyrinthine night.
Clueless we go; but I have heard thy voice,
Divine Unreason! harping in the leaves,
And grieve no more; for wisdom never grieves,
And thou hast taught me wisdom; I rejoice.
In starrer Narrheit meine klugen Zweifel:
Weiser ist, was ihr Wahn, als meine Weisheit, meint.
Leben, Leben! das Zauberwort. Sie singen.
In Seelennacht erhebt sich Sonnenschein;
Frühlings-Erinnerung lässt die Triebe springen,
All meine Herbste keltern sich zu Wein.
Leben! Aus dem Skelett des farbenleeren
Feigenbaums bricht ein Feuer von Smaragd.
Leben! Die Tulpen blühn; es ruft die Nachtigall
Die Rosen, ruft zurück altes Begehren:
Sieh das Begehren, alt und ewig jung,
Begier, die Erst- und Letztgeburt des Lebens,
Werkzeug des Seins zum Leiden und zum Tun,
Sich mit den Rosen aus dem Erdschoß heben!
Begehren streift vom hellen Leib der Welt
Auswuchs der Zeit; Erstling wird jeder Kuss;
Ins dürre Herz, auf satte Lippen fällt
Unendliche Verheißung: künftiger Durst.
Die Zeit verstrich. Wässrig späht jetzt ein Mond
Zwischen den Stämmen. Doch kein äußeres Licht
Erhellt der tastend blinden Jahre Schwund –
Mondloses Labyrinth aus Finsternis.
Spurlos gehn wir. Doch hört ich deine Stimme,
Göttliche Unvernunft!, die aus den Ästen stieg,
Und werf den Kummer ab: Weisheit ist nie bekümmert.
Du lehrst mich weise sein – und sieh, ich freue mich.
(Arabia Infelix, 1929; Ü.: Werner von Koppenfels)
Das Land
Es ist eine merkwürdige Tatsache, die ich mir nicht so recht erklären kann, dass die Begeisterung für das Landleben und die Liebe zur Natur gerade in jenen europäischen Ländern am stärksten ausgeprägt und am weitesten verbreitet sind, in denen das ungünstigste Klima herrscht und die Suche nach Pittoreskem mit den größten Unannehmlichkeiten verbunden ist. Die Verehrung der Natur wächst proportional zur Entfernung vom Mittelmeer. Die Italiener und Spanier interessiert die Natur an sich so gut wie gar nicht. Die Franzosen fühlen sich zwar irgendwie zum Land hingezogen, aber doch nicht so stark, dass sie dort leben wollten, solange sie irgendeine Möglichkeit haben, in der Stadt zu wohnen.
Die Süddeutschen und Schweizer bilden scheinbar eine Ausnahme von der Regel. Obwohl sie näher am Mittelmeer leben als die Pariser, lieben sie das Land mehr. Aber wie gesagt, dies ist nur scheinbar eine Ausnahme; denn durch die Gebirgslandschaft und die große Entfernung zum Meer kommen diese Menschen fast das ganze Jahr über in den Genuss eines in jeder Hinsicht arktischen Klimas. Wir Engländer, mit unserem scheußlichen Klima, lieben das Land so sehr, dass wir für das Privileg, auf dem Land zu leben, bereit sind, Sommer und Winter um sieben Uhr aufzustehen, bei Regen und Sonne zu einem weit entfernten Bahnhof zu radeln und eine einstündige Fahrt zu unserem Arbeitsplatz zu unternehmen. Wir nützen jeden freien Augenblick zum Wandern und betrachten Reisen im Wohnwagen als Vergnügen. Da in Holland ein viel raueres Klima herrscht als in England, sollte man erwarten, dass die Holländer noch leidenschaftlicher fürs Land schwärmen als wir. Aber das allgegenwärtige Wasser macht es holländischen Zeitkartenbesitzern schwer, sich einfach so auf dem Land niederzulassen. Wenn sich die sumpfigen Wiesen der Niederlande jedoch schon nicht als Bauland eignen, ist der Boden doch fest genug, um Zelte zu tragen. Da sie nicht ständig auf dem Land leben können, sind die Holländer die eifrigsten Camper der Welt. Als der arme Onkel Toby dort einst im Feld stand, zwang ihn die durchdringende Feuchtigkeit, in seinem Zelt guten Brandy zu verbrennen, damit die Luft trocken wurde. Aber unser Onkel Toby war schließlich bloß Engländer und in einem Klima aufgewachsen, das im Vergleich zum holländischen balsamisch ist. Die robusteren Holländer zelten zum Vergnügen. Was Norddeutschland betrifft, so genügt der Hinweis, dass dort die Wandervögel beheimatet sind. Und Skandinavien – jedermann weiß, dass sich in keinem Teil der Welt, außer den Tropen, Menschen so unbefangen ihrer Kleidung entledigen. Die Schweden empfinden eine derart heftige Naturleidenschaft, dass sie ihr nur so, wie die Natur sie schuf, angemessen Ausdruck verleihen können. »As souls unbodied«[5], sagt Donne, »bodies unclothed must be to taste whole joys.« (Wie Seelen entleibt, so müssen Leiber entkleidet werden, um höchste Wonnen zu genießen.) Nobel, nackt und weit moderner als alle übrigen Europäer tummeln sie sich im eisigen Wasser der Ostsee, nackt wandern sie durch den wilden Wald. Der vorsichtige Italiener dagegen badet nur in zwei von zwölf Monaten in seinem lauwarmen Meer, trägt andauernd Unterhemden und verlässt nach Möglichkeit die Stadt erst, wenn der Sommer wirklich zur Hölle wird, und dann wieder für kurze Zeit im Herbst, um die Produktion seines Weins zu beaufsichtigen.
Seltsamer und unerklärlicher Sachverhalt! Versuchen die Menschen, die in rauen Gegenden leben, sich vorzuspiegeln, sie bewohnten das Paradies? Lieben sie die Natur ganz bewusst in der Hoffnung, sie könnten sich einreden, dass sie bei Nässe und Dunkelheit genauso schön ist wie bei Sonnenschein? Bieten sie den Unannehmlichkeiten des nördlichen Landlebens trotzig die Stirn, um denen, die in bevorzugteren Breiten leben, sagen zu können: Seht her, unsere Landschaft ist genauso reizvoll wie eure; und der beste Beweis dafür ist, dass wir hier leben?
Was immer auch der Grund sein mag, es bleibt die Tatsache, dass die Naturverehrung mit der Entfernung von der Sonne wächst. Zwar ist es aussichtslos, nach Ursachen zu suchen; aber es ist einfach und zudem nicht uninteressant, die Auswirkungen aufzulisten; so hat zum Beispiel unsere angelsächsische Begeisterung für das Land dazu geführt, dass es in eine einzige riesige Stadt verwandelt wurde; allerdings ohne die Urbanen Annehmlichkeiten, die das Leben in der Großstadt erträglich machen. Denn wir alle lieben das Land so sehr, dass wir unbedingt dort leben möchten, und sei es nur nachts, wenn wir nicht arbeiten. Wir bauen Landhäuser, kaufen uns Fahrräder, die uns zum Bahnhof bringen, und Zeitkarten. Und währenddessen geht das Land zugrunde. Das Surrey meiner Kindheit war die reinste Wildnis. Heute kann man Hindhead kaum noch von Elephant & Castle unterscheiden. Mr. Lloyd George hat (was mir irgendwie angemessen erscheint) am Fuß der Devil's Jumps ein Wochenendhaus gebaut; und Tausende folgen eifrig seinem Beispiel. Aus jeder Gasse ist jetzt eine Straße geworden. Harrod's und Selfridge[6] liefern täglich. Das Land gibt es nicht mehr, zumindest nicht im Umkreis von fünfzig Meilen um London. Unsere Liebe hat es zerstört.
Außer im Sommer, wenn es in der Stadt zu heiß wird, meiden die Franzosen, und erst recht die Italiener, das Land. Die Folge ist, dass sie immerhin noch Land haben, das sie meiden können. Einsame Landschaft erstreckt sich fast bis vor die Tore von Paris. (Und Paris, wohlgemerkt, hat noch Tore; man erreicht sie über Landstraßen, fährt hindurch und ist nur noch ein paar Minuten vom Stadtzentrum entfernt.) Es herrscht Stille, die durch nichts gestört wird, außer durch die zarten Geisterklänge kaum eine Meile entfernt vom Victor-Emmanuel-Monument in Rom.
In Frankreich und Italien leben auf dem Land nur Bauern. Hier nimmt man die Landwirtschaft noch ernst; Bauernhöfe sind noch Bauernhöfe und nicht Wochenendhäuser; und auf Feldern, die in England nur begehrter Baugrund wären, lässt man hier noch Korn wachsen.
In Italien existieren, trotz der Tatsache, dass die gebildeten Italiener noch weniger gern auf dem Land leben als die Franzosen, weniger völlig einsame Landstriche als in Frankreich, weil es mehr Bauern gibt. Aber wie viele sind es in Frankreich! Eine Fahrt von der belgischen Grenze ans Mittelmeer füllt jene Statistik mit Leben, die rein theoretisch besagt, dass Frankreich unterbevölkert ist. Lange Strecken offenen Landes dehnen sich zwischen den einzelnen Städten:
Like stones of worth they thinly placèd are
Or captain jewels in the carcanet.
Gleich edlen Steinen sind sie dünn gesät,
Wie Kronjuwelen auf dem Diadem.
Sogar Dörfer sind selten und liegen weit auseinander. Und jene zahllosen Gehöfte, die an italienischen Berghängen zwischen den Olivenbäumen hervorleuchten – nach ihren französischen Pendants sucht man vergeblich. Wenn man durch die fruchtbaren Ebenen Mittelfrankreichs fährt, kann man den Blick über die Felder schweifen lassen, ohne ein einziges Haus zu entdecken. Und was für Wälder wachsen noch auf französischem Boden! Riesige unbewohnte Waldgebiete, in deren Schatten man keinem einzigen Wochenendausflügler oder Wanderer begegnet.
Mich persönlich entzückt dieser Tatbestand; denn ich mag das Land, genieße die Einsamkeit und interessiere mich nicht für die politische Zukunft Frankreichs. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass einem französischen Patrioten eine Fahrt durch sein Heimatland deprimierend vorkommen muss. Jenseits fast sämtlicher Grenzen wuchern ungeheure Populationen, auf deren Schädeln man aus zweihundert Metern Entfernung den Höcker der Fortpflanzungsfreudigkeit entdecken kann. Ohne Hast, ohne Rast, wie durch ein unaufhörliches Wunder vermehren sich die Deutschen und Italiener wie Fische und Brot[7]. Alle drei Jahre spähen eine Million frischgebackener Teutonen über den Rhein, fragen sich eine Million Italiener, wo sie in ihrem engen Land Raum zum Leben finden werden. Doch mehr Franzosen gibt es nicht. Noch zwanzig Jahre, und dann? Die französische Regierung stellt kinderreichen Familien Prämien in Aussicht. Vergeblich: Alle kennen sich bestens mit Geburtenkontrolle aus, und selbst in den ungebildetsten Schichten existieren keinerlei Vorurteile, dafür aber ein ausgeprägter Hang zur Sparsamkeit. In hellen Scharen werden Mauren gedrillt und bewaffnet; doch Mauren sind auf lange Sicht nur ein dürftiger Schutz gegen die Fortpflanzungsfreudigkeit der Europäer. Früher oder später wird dieses halbleere Land kolonisiert werden; vielleicht friedlich, vielleicht mit Gewalt; hoffentlich friedlich, mit Zustimmung und auf Einladung der Franzosen selbst. Vorübergehend importieren die Franzosen ja schon jetzt wer weiß wie viele ausländische Arbeiter pro Jahr. Im Lauf der Zeit werden sich die Ausländer niederlassen: die Italiener im Süden, die Deutschen im Osten, die Belgier im Norden und vielleicht sogar ein paar Engländer im Westen. Dieser Plan mag den Franzosen vielleicht nicht gefallen. Aber bis sich alle Nationen bereit erklären, in genau demselben Umfang Geburtenkontrolle zu praktizieren, ist das die denkbar beste Lösung.
Die Portugiesen, die Ende des sechzehnten, Anfang des siebzehnten Jahrhunderts an akuter Unterbevölkerung litten (die Hälfte der körperlich leistungsfähigen Männer waren in die Kolonien ausgewandert, wo sie im Krieg oder an Tropenkrankheiten starben, während die Daheimgebliebenen in regelmäßigen Abständen durch Hungersnöte dezimiert wurden – denn die Kolonien lieferten nur Gold, kein Brot), lösten ihre Probleme durch den Import von Negersklaven, die die verlassenen Felder bestellten. Die Neger wurden sesshaft. Sie gingen Mischehen mit der Bevölkerung ein. Binnen zwei oder drei Generationen war das Volk, das die halbe Welt erobert hatte, ausgestorben, und Portugal wurde, mit Ausnahme eines kleinen Gebiets im Norden, von einer hybriden euroafrikanischen Rasse bewohnt. Die Franzosen werden sich vielleicht glücklich schätzen, wenn sie, ohne Krieg zu führen, ihr leer gewordenes Land mit zivilisierten Weißen auffüllen können.
Einstweilen jedenfalls freut sich jeder, der die Natur und die Einsamkeit liebt, über die Leere Frankreichs. Aber selbst in Italien, wo es auf dem Land von Bauernhöfen, Bauern und Bauerskindern nur so wimmelt, fühlt sich jemand, der das Land liebt, viel glücklicher als in möglicherweise tatsächlich spärlicher bewohnten Gebieten der Home Counties[8]. Denn Bauernhöfe und Bauern sind Landprodukte, ebenso urwüchsig und harmlos wie Bäume oder das sprießende Korn. Es ist der städtische Eindringling, der die englischen Landgegenden zerstört. Weder er noch sein Haus gehören dorthin. In Italien hingegen findet der städtische Eindringling, der sich vereinzelt aufs Land wagt, dieses auch wirklich ländlich vor. Trotz dichter Besiedlung ist es doch immer noch das Land. Die tödliche Zuneigung derer, die so wie ich die Städter der Natur sind, hat ihm noch nicht den Garaus gemacht.
Ich fürchte, die Zeit ist nicht mehr fern, bis in ganz Europa, selbst in Spanien, das Land von Naturfreunden aus der Stadt überschwemmt sein wird. Schließlich ist es nicht allzu lang her, dass Evelyn der Anblick der Felsen von Clifton mit Abscheu und Entsetzen erfüllte. Bis zum Ende des achtzehnten lahrhunderts fürchtete und verabscheute jeder vernünftige Mensch die Berge, selbst in England, selbst in Schweden. Die moderne Begeisterung für die wilde Natur ist eine neuere Entwicklung und ging – ebenso wie die Tierliebe, der Industrialismus und das Reisen mit der Eisenbahn – von den Engländern aus. (Es ist vielleicht nicht überraschend, dass die Leute, die als Erste ihre Städte durch Schmutz, Lärm und Abgase unbewohnbar machten, auch die Ersten waren, die die Natur liebten.) Von dieser Insel aus haben sich Maschinen und Landinnigkeit verbreitet. Die Maschinen haben in aller Welt begeisterte Aufnahme gefunden; die Landinnigkeit floriert bis jetzt nur im Norden.
Und doch gibt es eindeutige Anzeichen, dass allmählich sogar die Romanen davon angesteckt werden. In Frankreich und Italien ist die wilde Natur – wenn auch in weit geringerem Maß als in England – Gegenstand des Snobismus geworden. Es gilt in jenen Ländern als ausgesprochen schick, die Natur zu lieben. In einigen Jahren, ich wiederhole es, wird das jedermann als selbstverständlich betrachten. Denn selbst im Norden wird den Leuten, die für das Land absolut nichts übrig haben, von den Profitmachern der Landliebe unaufhörlich auf raffinierteste Weise eingeredet, dass sie es doch lieben. Kein moderner Mensch, selbst wenn er das Land verabscheute, könnte dem Appell der unzähligen Anzeigen widerstehen, die von Bahn, Automobilindustrie, Thermosflaschenfirmen, Sportbekleidungsherstellern, Immobilienmaklern und allen übrigen Branchen veröffentlicht werden, deren Lebensunterhalt davon abhängt, dass er oft aufs Land fährt. Noch ist die Kunst der Werbung in den romanischen Ländern nicht sehr weit entwickelt. Aber selbst dort verbessert sie sich. Der Fortschritt ist nicht mehr aufzuhalten. Fiat und die Staatsbahn brauchen bloß amerikanische Werbemanager zu engagieren, und die Italiener verwandeln sich in ein Volk von Wochenendausflüglern und Zeitkartenbesitzern. Schon gibt es am Rande Roms eine Città Giardino; Ostia wird zu einer am Meer gelegenen Vorortwohnsiedlung ausgebaut; die kürzlich eröffnete Autostraße hat die Seen Mailands Gnade ausgeliefert. Ich sehe es schon kommen, meine Enkel werden ihren Urlaub einmal in Zentralasien verbringen müssen.
(Along the Road, 1925; Ü.: Sabine Hübner)
Ländliche Ekstasen
(Whitman hatte zwei Studierstuben zum Lesen: die eine war das Oberdeck eines Omnibusses, und die andere eine kleine, gänzlich unbewohnte Sandbank namens Coney Island weit draußen im Ozean. – M. D. Conway, 1866)
The Revelation
An idle poet, here and there,
Looks round him, but, for all the rest,
The world, unfathomably fair,
Is duller than a witling's jest.
Love wakes men, once a lifetime each;
They lift their heavy lids and look;
And lo, what one sweet page can teach