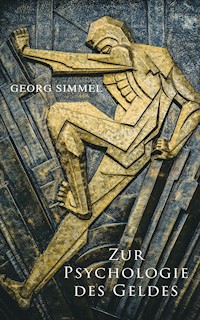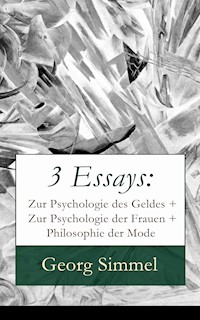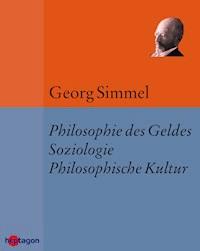Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieser Band beinhaltet die folgenden Werke Simmels: Ästhetik der Schwere Das Christentum und die Kunst Das Ende des Streits Das Problem des Stiles Der Fragmentcharakter des Lebens Der Militarismus und die Stellung der Frauen Der platonische und der moderne Eros Die ästhetische Quantität Die beiden Formen des Individualismus Die Gegensätze des Lebens und die Religion Die Krisis der Kultur Die Lehre Kants von Pflicht und Glück
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Essays und Schriften, Band 1
Georg Simmel
Inhalt:
Georg Simmel – Biografie und Bibliografie
Ästhetik der Schwere
Das Christentum und die Kunst
Das Ende des Streits
Das Problem des Stiles
Der Fragmentcharakter des Lebens
Der Militarismus und die Stellung der Frauen
Der platonische und der moderne Eros
Die ästhetische Quantität
Die beiden Formen des Individualismus
Die Gegensätze des Lebens und die Religion
Die Krisis der Kultur
Die Lehre Kants von Pflicht und Glück
Essays und Schriften, Band 1, Georg Simmel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849616854
www.jazzybee-verlag.de
Georg Simmel – Biografie und Bibliografie
Geb. 1. März 1858 in Berlin, gest. 26. September 1918 in Straßburg.
S. verbindet die psychologisch-genetische, evolutionistische mit einer logisch-idealistischen, an Kant und Hegel orientierten, vielfach »dialektischen« Betrachtungs- und Denkweise. Das Erkennen enthält apriorische Faktoren, die aber (als Kategorien) eine Entwicklung durchmachen, nicht unverändert bleiben. Alle Formen und Methoden des Erkennens haben sich im Verlaufe der menschlichen Geistesgeschichte entwickelt und entwickeln sich weiter, so aber, daß das Erkennen eine formende, gesetzgebende Aktivität des Geistes bleibt, welche aus dem Chaos der Erlebnisse erst einen sinnvollen, verständlichen, einheitlichen Zusammenhang gestaltet. Die Kategorien usw. stammen aus »der dem Geiste eigenen Fähigkeit, zu verbinden, zu vereinheitlichen«, können aber als historische Gebilde die Totalität der Weltinhalte nie völlig adäquat aufnehmen. Das Ich hat die Funktion der Einheitsetzung, das Streben zur Einheit. Die Wahrheit ist, rein logisch, etwas Zeitloses, Absolutes, vom subjektiven Denken Unabhängiges, sie gehört dem »dritten Reich«, dem »Reich der ideellen Inhalte« an; diese Inhalte sind wahr, gleichviel ob sie gedacht werden oder nicht. Das Geistige bildet inhaltlich einen geschlossenen Zusammenhang, den unser individuelles Denken unvollkommen nachzeichnet. Die ideellen Inhalte sind nicht, sie gelten, sie sind nicht mit den psychologischen Vorgängen zu verwechseln. Anderseits hat die Wahrheit auch eine biologisch-evolutionistische Seite. Wahr sind hier jene Vorstellungen, die, als reale Kräfte in uns wirksam, »uns zu nützlichem Verhalten veranlassen« (vgl. James). Durch Selektion haben sich bestimmte Vorstellungen als wahr erhalten, nämlich jene, »die sich als Motive des zweckmäßigen, lebenfördernden Handelns erwiesen haben« (vgl. Nietzsche). »Die Nützlichkeit des Erkennens erzeugt zugleich für uns die Gegenstände des Erkennens.« Es gibt so viele prinzipielle »Wahrheiten«, als es verschiedene Organisationen und Lebensanforderungen gibt. Das Objektive und Wahre bedeutet die »gattungsmäßige Vorstellung«.
Auch in der Ethik verbindet S. die genetisch-relativistische Betrachtungsweise betreffs der empirischen Einzeltatsachen mit einem gewissen Apriorismus und Idealismus. So ist das Sollen etwas Ursprüngliches und Objektives, als eine Forderung, die mit der Sache selbst gegeben ist, als ein »in dem Verhältnis von Seele und Welt präformiertes Sollen, das einer besonderen, aber nicht weniger übersubjektiven Logik unterliegt, wie das Sein«. Unser Bewußtsein empfindet Forderungen an sich, die es durch den Willen realisieren kann. Das Sollen schlechthin ist eine »Urtatsache«, eine »ursprüngliche Kategorie«, mag auch der Inhalt des Sollens noch so wechseln und sozial-historisch bedingt sein. Tatsächlich sind es immer »historische Zustände der Gattung, die in dem Einzelnen zu triebhaftem Sollen werden«. Der »Wille der Gattung« kommt in uns zum Ausdruck, kündigt sich imperativisch an. Ein ungeheurer Teil der an uns gestellten Ansprüche ist sozialen Inhalts, ohne daß dadurch die Unbedingtheit des idealen Sollens überhaupt, die »innere Logik ideeller Ansprüche« beeinträchtigt wird. Das sittlich Gute besteht nicht im Anstreben des Glücks u. dgl. (gegen den Eudämonismus), sondern es ist eine »unmittelbare Qualität und Lebensform des Willensprozesses«. Etwas ist gut, weil und wofern es Inhalt eines an sich guten Willens ist. Die moralischen Imperative sind »Ausmündungen, Ausformungen, Substantialisierungen des guten Willens«. Die Sittlichkeit liegt nicht im Material des Willens, sondern in diesem selbst, in dessen Funktion. Das Ideal des sittlichen Verhaltens liegt im Unendlichen. Das Sollen kann sich an den verschiedensten Inhalten verwirklichen; die Einheit des Zieles ist nicht notwendig, es genügt die Einheit der psychologisch-ethischen Funktion, die den Zweck trägt. Ursprünglich ist das sozial Erforderte die Norm des Verhaltens der Einzelnen. Den »kategorischen Imperativ« Kants kritisiert S. nach der Richtung der Versöhnung des Individualismus mit der Allgemeinheit des Handelns. Das Gewissen ist nach S. gleichsam ein »rückwärts gewandter Instinkt«; es ist die.Lust oder Unlust der Gattung über die Tat, die in uns zum Ausdruck kommt. Der Altruismus ist ebenso primär wie der Egoismus, er ist »Gruppenegoismus«, ein vererbter Instinkt. Sehr oft. »machen die Motivierungen unserer Handlungen... an Punkten Halt, die völlig und definitiv außerhalb unser selbst liegen«. Auch enthält das Ich noch eine Fülle von Motiven außer dem »Glück«. – Die Freiheit des Willens bedeutet, daß sich der Charakter des Ich ungehindert im Wollen ausprägen kann, das Vermögen, das für uns wertvolle Wollen realisieren zu können. Freiheit ist »Selbstbestimmung«, sie ist zugleich, weil das Ich nur so sein kann, wie es ist, Notwendigkeit. Die Verantwortlichkeit ist nicht aus der Willensfreiheit abzuleiten, sondern umgekehrt: »Derjenige ist frei, den man mit Erfolg verantwortlich machen kann.« Zurechnungsfähig ist jemand, wenn die strafende Reaktion auf seine Tat bei ihm den Zweck: der Strafe erreicht.
Die Grundfrage der Geschichtsphilosophie ist die: wie ist Geschichte möglich? Geschichte ist nur durch Kategorien, apriorische Verbindungsformen möglich, sie ist kategorial verbreitete Wirklichkeit und daher hat die Geschichtsphilosophie die »Aprioritäten festzustellen und zu erörtern, durch welche aus dem Erleben... Geschichte als Wissenschaft wird«. Die Kompliziertheit des historischen Geschehens gestattet nicht die Aufstellung eigener historischer Gesetze, wenn auch das Historische auf (biologisch-psychologischen) Gesetzmäßigkeiten beruht. Das ganze Spiel der Geschichte ist die Folge, Erscheinung oder Synthese dieser primären Gesetzmäßigkeiten, geht aber nicht aus einem besonderen Gesetz hervor.
Die Soziologie ist die »Wissenschaft vom Gesellschaftlichen als solchen, von den Formen der Vergesellschaftung, von den Beziehungsformen der Menschen zueinander«. Die Soziologie ist keine Universalwissenschaft vom Menschen u. dgl., sondern eine besondere Methode; sie abstrahiert vom Inhalt des Gesellschaftlichen, achtet nur auf dieses, wie der Mathematiker etwa nur auf die geometrische Form, nicht auf das Material der Körper achtet. Die Soziologie, hat die »Kräfte, Beziehungen und Formen zum Gegenstand, durch die die Menschen sich vergesellschaften«, sie ist die »Lehre von dem Gesellschaft-Sein der Menschheit«. »Gesellschaft im weitesten Sinne ist offenbar da vorhanden, wo mehrere Individuen in Wechselwirkung treten. Die besonderen Ursachen und Zwecke, ohne die natürlich nie eine Vergesellschaftung erfolgt, bilden gewissermaßen den Körper, das Material des sozialen Prozesses; daß der Erfolg dieser Ursachen, die Förderung dieser Zwecke gerade eine Wechselwirkung, eine Vergesellschaftung unter den Trägern hervorruft, das ist die Form, in die jene Inhalte sich kleiden.« Solche Formen sind Über- und Unterordnung, Konkurrenz, Arbeitsteilung usw.; wichtig sind besonders auch die kleinen, flüchtigen Wechselwirkungen von Person zu Person. Die sozialen Verbindungen erwachsen aus bestimmten Trieben oder Willenstendenzen (Zielen), sind etwas Psychisches, aber nichts Psychologisches, denn die Soziologie hat es nicht mit psychologischen Vorgängen, sondern mit Inhalten solcher zu tun, mit Kombinationen soziologischer Kategorien, mit etwas Sachlichem. Es gibt keinen Gesamtgeist, wohl aber eine seelische Beeinflussung der Individuen durch ihre Vergesellschaftung. In der Gesellschaft herrscht Arbeitsteilung und Differenzierung, verbunden mit Integrierung, indem jede Befreiung zu einer neuen Bindung führt. Die Religion wurzelt in den Gesamttendenzen der Persönlichkeit und ihrer Beziehung zum All.
SCHRIFTEN: Das Wesen der Materie nach Kants physischer Monadologie, 1881. – Über soziale Differenzierung, 1890; 3. A. 1906, – Einleit. in die Moralwissenschaft, 1892-93; 2. A. 1901. – Die Probleme der Geschichtsphilosophie, 1892; 2. A. 1905; 3. A. 1907. – Philosophie des Geldes, 1900; 2. A. 1907. – Vorlesungen über Kant, 1904; 2. A. 1905. – Die Religion, 1906. – Schopenhauer u. Nietzsche, 1906. – Soziologie, 1908. – Hauptprobleme der Philosophie, 1910. – Das Problem der Soziologie, Schmollers Jahrbücher, Bd. 18, 1894. – Skizze einer Willenstheorie, Zeitschr, f. Psychol. d. Sinnesorgane, Bd. 9, – Beitrag zur Erkenntnistheorie der Religion, Zeitschr. f. Philos., Bd. 118. – Über eine Beziehung der Selektionslehre zur Erkenntnis, Archiv f. systemat, Philos., 1895. – Über die Grundfrage des Pessimismus, Zeitschr. f. Philos., Bd. 90. – Zur Psychologie der Frau, Zeitschr. f. Völkerpsychol, 1890, u. a.
Ästhetik der Schwere
Die Dinge und Verhältnisse, aus denen wir unser Leben formen, treten uns mit so vergewaltigender Wirklichkeit, mit so rücksichtsloser Eigenheit entgegen, dass wir diesen ganzen Stoff des Lebens oft als eine blosse Last empfinden, nach deren gänzlicher Beseitigung erst die Seele ihre ganze Freiheit entfalten würde.
Der Druck, den wir von der Natur wie von der Gesellschaft erfahren, lässt uns, im Ganzen wie im Einzelnen, vergessen, dass wir ohne ihre Härte und ihren Widerstand gar kein Material haben würden, an dem unser inneres Leben sich zu vollziehen, sich auszuprägen vermöchte: wenn der Meissel keinen Widerstand am Marmor fände, würde er ihm auch keine Form verleihen können.
Die Freiheit der Seele ist etwas Wirksames nur an der Eigengesetzlichkeit der übrigen Welt, von der sie freilich eingeengt wird, mit der zusammen sie aber erst ein wirkliches Leben ergibt.
Sogar unsere sittlichen Impulse bedürfen eines Rohstoffes sinnlich-selbstischer Triebe, um im endlosen Bekämpfen, Unterjochen, Umformen dieser erst ihre Kraft zu erweisen.
So ist der Stand des inneren Lebens in jedem Augenblick der eines Antagonismus zwischen dem eigentlichen, zu vollem Ausleben drängenden Ich und beengenden Mächten, auf deren Vernichtung zwar seine ganze Freiheit gerichtet ist, deren gänzliches Verschwinden ihm aber allen Stoff des Lebens und alle Möglichkeit nähme, sich zu festen Formen auszugestalten.
Dieses typische Schicksal der Seele setzt sich auf ihre Umgebungen fort.
Die Bewegungen unserer Glieder zeigen fortwährend den Stand eines Kampfes zwischen der physikalischen Schwere, die uns nach unten zieht, und den seelisch-physiologischen Impulsen, die die Schwerkraft des Körpers immerzu aufheben und abbiegen- ja, unsere Bewegungen sind dieser Kampf.
Die willensmässigen Energien beherrschen unsere Glieder nach ganz anderen Normen, in ganz anderen Richtungen als die physikalischen, und unser Leib ist in jedem Moment der Kampfplatz, auf dem beide sich treffen, sich gegenseitig ablenken, sich zu Kompromissen nötigen.
Und während es scheint, als verhinderten die materiellen Widerstände, dass sich die innere Bewegung restlos darstelle, bedingt in Wirklichkeit dieser Widerstand gerade jegliche Offenbarung der Seele: nur an ihm, in seiner Überwindung kann die Bewegung zu Stande kommen und ihren Sinn anschaulich machen.
Die typischen Weisen nun, wie der Mensch sich darstellt, und wie er in den verschiedenen Stilen der Kunst erscheint, sind durch die besondere Art bestimmt, in der jene beiden Kräfte sich begegnen, eine die andere umbiegt, hemmt, gelegentlich fördert, ihr ausweicht, in mannigfaltigen Mischungen mit ihr die Einheit der Erscheinung erzeugt.
Vergleicht man zum Beispiel eine griechische Statue mit einer Barockplastik, so fällt sofort auf, dass der Grieche es mit der Überwindung der Schwere lange nicht so leicht nimmt wie der Barockkünstler.
Weder an der menschlichen Erscheinung selbst noch an dem Marmor empfindet dieser die natürliche Schwere, er spielt mit den physikalischen Bedingungen des Stoffes, als wäre dieser dem inneren Anstoss absolut nachgiebig, wie die Luft, die man da und dort hin blasen kann, ohne ihren Widerstand zu merken.
Dennoch wirkt die Barockkunst lange nicht so geistig und von innen heraus beseelt wie die klassische, damit beweisend, dass jener Widerstand der Materie keineswegs bloss ein "böses Prinzip" ist, das besser nicht bestünde, sondern dass er gerade der notwendige Stoff und Gegenhalt ist, dem allein sich die Seele anschaulich einschreiben kann.
Das Gewand um den Körper ist in seinen Falten und seinem Fall, seinen Schwingungen und seinen Schwellungen ein enthüllendes Symbol jenes Streites der Kräfte.
An den Figuren eines japanischen Holzschnittes etwa verrät die wunderliche Gebrochenheit, das uns so schwer begreifliche Ausladen und Eingezogensein der Formen, dass die irdische Schwere und der nervöse Impuls sich in diesen Körpern ganz anders, als wir es gewohnt sind, mischen, dass die Überwindung des einen durch das andere in ganz fremdartigen Rhythmen, Anstössen und Nachgiebigkeiten erfolgt.
Das Wesentliche des Menschen: das Mass und die Art, wie er seelische Energien in die elementaren Begebenheiten der Natur verweht, jedes über jedes siegen, ich gegenseitig fördern oder hemmen lässt, - dies ist für den Japaner ersichtlich etwas ganz anderes als für uns.
Die einheitliche Erscheinung, in der der Künstler dieses Wesentliche anschaulich macht, divergiert so weit von unserer Art, weil die Elemente dieser Einheit, das physikalische und das psycho-physiologische, dort in so ganz abweichenden Proportionen und Wechseln zusammengehen.
Nicht weniger wird der persönliche Stil, in dem der einzelne Künstler den Menschen bildet, durch seine besondere Formel für diesen Antagonismus bestimmt.
Bei Michelangelo fühlen wir alle Körper gegen einen Druck ringen, eine ungeheure Schwere zieht sie nieder, und eben deshalb müssen sie eine ungeheure, leidenschaftliche Kraft aufwenden, um sich dagegen auf zuarbeiten; der Kampf der Seele, die sich befreien will, gegen das elementare Lasten des natürlichen Seins, das zugleich die dumpfe Tragik innerer Belastungen symbolisiert, dieser Kampf ist hier auf dem Punkt zum Stehen gekommen, wo beide Richtungen ihr Äusserstes entfalten.
Sobald das von ihm mit unbegreiflicher Kunst festgehaltene Gleichgewicht beider in der späteren Entwicklung ins Wanken geriet, sobald man die seelische Freiheit und Impulsivität durch einfache Vernachlässigung der Schwere zu vollerem Ausdruck zu bringen meinte, glitt der Stil Michelangelos in das Barock über.
Ein völlig originelles Verhältnis zwischen der physikalischen Schwere und der seelischen Anspannung, die sie zu überwinden strebt, charakterisiert den Stil Konstantin Meuniers.
Seine Plastik hat ein gänzlich neues Problem in die Kunst eingeführt: den arbeitenden Menschen; das heisst, er hat den formal-ästhetischen Wert der Arbeitsbewegung als solcher entdeckt, im Unterschied etwa von Millet und anderen Malern des arbeitenden Volkes, die mehr die Reflexe der Arbeit in dem Gefühl und Charakter der Menschen zur Anschauung bringen, aber nicht ihre rein anschauliche Bedeutung, die ganz jenseits ihrer ethischen oder sentimentalen steht.
Er hat die Arbeit nach der ästhetischen Seite zuerst so zu Ehren gebracht, wie die Stadtbürger des Mittelalters sie nach der sozialen hin zu Ehren brachten.
Wie das diesen gelang, indem sie zuerst den Knechtschaftsbegriff von ihr lösten, der vom Altertum her mit ihr verbunden war, so hat Meunier alles Aesthetisch-Indifferente oder Widrige, das in den Ergebnissen oder den Begleiterscheinungen der Arbeit liegt, von ihr gelöst und die Arbeitsbewegung als ästhetische Formgebung des Menschenkörpers zuerst ebenso behandelt, wie man diesen sonst als ruhend oder als spielend oder als durch Affekte erregt bildet.
In dem Heben, Ziehen, Wälzen, Rudern, das Meunier an seinen Menschen darstellt, ist die Schwere des Körpers nach aussen hin verlegt, sie setzt sich in die tote Materie fort, um von dort aus ungeheure und ganz eigenartige Ansprüche an ihre Überwindung durch die Kraft, das heisst: durch die Seele des Menschen zu stellen.
Die soziale Bewegung der Gegenwart knüpft sich daran, dass man aus den unendlich verschiedenartigen Arbeiten des Eisengiessers und des Schneiders, des Barbiers und des Bergmannes das Gleichartige, ihre Interessen Verbindende erkannt hat: sie sind eben alle Lohnarbeiter - ein Begriff, dessen Einheit und Immergleichheit frühere Zeiten vor jenen Verschiedenheiten des Arbeitsinhaltes nicht zu erkennen vermochten.
Diese begriffliche Identität der Arbeit hat Meunier zu einer ästhetischen gestaltet.
Die Arbeit mag ein sehr verschiedenes Kraftmass, mag sehr verschiedene Muskelgruppen beanspruchen: sie ist doch überall eines und dasselbe Verhältnis des beseelten Körpers zu den Aufgaben, die ihm durch den Widerstand der Materie gegen seine Zwecke gestellt werden.
Arbeit ist die Hineinbildung der Seele in die Materie, und so wiederholt sie ausserhalb des Körpers jenen Streit zwischen der physikalischen Schwere und den seelischen Gegenimpulsen, der jede unserer Bewegungen färbt.
Oder richtiger: die Arbeit bleibt doch in den Grenzen des menschlichen Leibes; sie ist nur eine besondere Akzentuierung der physikalischen Widerstände, die unsere seelischen und physiologischen Tendenzen an der Härte, der Schwere, der Unbiegsamkeit unserer Materie finden. Erst die Meunierschen Bronzen erzählen in der Sprache der Kunst, was Arbeit ist, indem sie die allgemeingültige Formel für das Verhältnis offenbaren, in das gerade der arbeitende Mensch die Kräfte der blossen Materie zu den sich dagegen aufringenden Willensmächten setzt.
Die Plastik besitzt, um das Schweremoment und seine Gegenkraft empfinden zu lassen, den Vorteil des Materials, das selbst schwer ist, und dessen Lasten wir fühlen, wie wir das Gewicht des Gebälkes und die Strebekraft der Säule gleichsam innerlich nachbilden und so die Angemessenheit beider Kräfte durch ein unmittelbares Gefühl - als ob sie in uns ihren Antagonismus austrugen - entscheiden.
Der Marmor hat in dieser Richtung ganz unvergleichliche Eigenschaften, indem seine Weisse und sein Schimmern die Schwere des Steines erleichtern und vergeistigen.
Er hat etwas Objektives, wie der Raum, er ist sozusagen der blosse Raum als Körper, so dass die Plastik als Gestaltung des Raumes an ihm das biegsamste, jedem Verhältnis der Formen und Kräfte nachgiebigste Material findet; während bei dem Holz, dem Porzellan, der Bronze schon besondere, dem Stoffe eigene Schwereverhältnisse stark präjudizierend wirken.
So sind lebensgrosse Bronzefiguren nur unter besonderen Umständen ästhetisch möglich, weil die ungeheure Schwere, mit der wir sie empfinden, kaum durch irgend eine innere Kraft und Lebendigkeit zu überwinden ist; wogegen zum Beispiel Porzellanfiguren sehr leicht den Eindruck des Barocken machen, weil ihre Bewegtheiten gegenüber der Leichtigkeit des Materials, an dem sie so wenig zu überwinden haben, fast immer zu übertreiben und Kraft ins Leere zu verschwenden scheinen.
Der Gegensatz von Anmut und Würde innerhalb des Anschaulichen geht, wenn ich mich nicht täusche, gleichfalls auf die Verschiedenheit der Verhältnisse zurück, in die sich die seelischen und nervösen Energien zu dem Druck der Materie setzen.
In beiden Daseinsformen wird die materielle Lastung an den Erscheinungen durch beseelte Bewegungen überwunden. Der Anmut gelingt dies, indem sie jenen Widerstand des Stoffes von vornherein herabzusetzen scheint; sie steigert nicht die Kraft, sondern verringert die Ansprüche an sie so, dass die Bewegung sich wie widerstandslos vollzieht, als gäbe es überhaupt nur Freiheit der Seele, für die alle Hemmungen von aussen her gerade nur da sind, um ihr ein Spiel zu sein. Umgekehrt erreicht die anschauliche Würde dasselbe Gleichgewicht zwischen der seelisch-physiologischen Leistung und ihren Widerständen, indem sie diesen zwar ihr volles Gewicht lässt, aber jene zu vollkommenem Hinausragen erhöht.
Der Feind ist nicht, wie die Anmut ihn erscheinen lässt, nur eine leise, wie schon durch sich selbst vernichtigte Andeutung eines Widerstandes; die Würde lässt die beschwerenden, nach unten strebenden Kräfte der Erscheinung ungeschmälert wirken, ja sie betont sie sogar, um nun erst darüber hinwegzugreifen und den Triumph der seelischen Kraft an der Stärke des überwundenen Gegners fühlen zu lassen.
Es gibt eine genau entsprechende Zweiheit im sittlichen Leben.
Wir bezeichnen dessen höchste Stufe als sittliches "Verdienst" - als eine Handlung, die alle Versuchungen der Sinnlichkeit, alle Widerstände des Egoismus in harten Kämpfen überwunden hat und die äusserste Stärke des Pflichtgefühles an der äussersten Stärke des Willens zur Sünde bewährt.
Die "schöne Seele" dagegen ist sittlich, weil ihre Sittlichkeit aus der Selbstverständlichkeit des Naturtriebes quillt; sie hat keine Versuchungen zu überwinden, weil sie die Tugend geniesst, wie der Andere, der erst überwinden muss, die Sünde geniessen würde. Sie ist von selbst sittlich, weil ihr die Gegenkräfte fehlen, die sie in das Böse hinabzögen.
Ihr ist die sittliche Anmut eigen, da ja auch die Anmut der Anschauung nichts anderes ist als jene Selbstverständlichkeit des Sieges, den die Freiheit der Seele über die dunkle Schwere der blossen Materie an uns gewinnt - oder richtiger gar nicht erst zu gewinnen braucht. jener tieferen und schwereren Seele aber, die erst über die bitterste Selbstüberwindung, über alle Dunkelheiten der Versuchung und der Allzuirdischkeit hinweg ihr Ich und ihre Freiheit rettet, - ihr ist die Würde eigen, die nicht über die Schwäche, sondern über die Stärke der niederziehenden Kräfte gesiegt hat.
So enthüllt sich der Widerstreit der beiden Energien, den ich zu skizzieren versuchte, als die ästhetische Form des grossen Kampfes zwischen der menschlichen Seele und den Mächten der blossen Natur, dessen Masse und Stadien, Siege und Kompromisse, Ablenkungen und Zuspitzungen der Geschichte des Menschen ihre Farben und ihre Werte geben.
Das Christentum und die Kunst
Die geschichtlichen Fäden, die sich zwischen Religion und Kunst spinnen, sind unzählige Male verfolgt worden: wie die Kultzwecke das Götterbild entstehen ließen, wie sich aus der religiösen Feier und der Anrufung der Götter die poetischen Formen entwickelten, wie die Erhebungen und wie der Verfall der Religion die Kunst oft in gleichem, oft in völlig entgegengesetztem Sinn beeinflussten - alles dies ist zu begriffenen Tatsachen der Kulturgeschichte geworden.
Allein die Motive, mit denen aus dem Wesen der Sache heraus das eine das andre anzieht oder abstößt, durch die all jene historischen Verknüpftheiten nur als die mehr oder weniger vollkommenen Verwirklichungen tieferer und prinzipieller Zusammenhänge erscheinen diese Motive harren noch ihrer Klärung.
In das räumliche Gleichnis von Nähe und Distanz müssen wir unzählige Male das Verhältnis seelischer Inhalte bannen, dessen innerliches Wesen diesem Symbol mit seiner äußeren Messbarkeit schließlich ganz fremd ist.
Auf seine Verständlichkeit dennoch rechnend, kann man die Gemeinsamkeit des religiösen und des künstlerischen Verhaltens so bezeichnen: dass das eine wie das andre seinen Gegenstand in eine Distanz, weit jenseits aller unmittelbaren Wirklichkeit hinausrückt - um ihn uns ganz nahe zu bringen, näher, als je eine unmittelbare Wirklichkeit ihn uns bringen kann.
In dem Maß, in dem eine Religion wirklich ihrem reinen Begriff entspricht und nicht von andern Seelenprovinzen her mit allerhand Bedürftigkeiten und Beschränktheiten gemischt ist, drängt sie den Gott ins "Jenseits", sein Abstand von allem Greifbaren und von der Welt unsrer Wirklichkeiten ist die absolute Steigerung jener "Distanz", in der der hohe und überlegene Mensch alle ihm Nicht-gleichen hält.
Aber der Gott, in dieser Distanz verbleibend, bleibt zugleich nicht in ihr, sondern als wäre jene nur ein Anlaufrückschritt, bemächtigt sich die Seele seiner als des Nächsten und Vertrautesten, bis zur mystischen Einswerdung mit ihm.
Dieses Doppelverhältnis zu unserer Wirklichkeit wiederholt die Kunst. Sie ist das Andere des Lebens, die Erlösung von ihm durch seinen Gegensatz, in dem die reinen Formen der Dinge, gleichgültig gegen ihr subjektives Genossen- oder Nichtgenossen-Werden, jede Berührung durch unsere Wirklichkeit ablehnen.
Aber indem die Inhalte des Seins und der Phantasie in diese Distanz rücken, kommen sie uns näher, als sie es in der Form der Wirklichkeit konnten.
Während alle Dinge der realen Welt in unser Leben als Mittel und Material einbezogen werden können, ist das Kunstwerk schlechthin für sich. Aber all jene Wirklichkeiten behalten dabei eine letzte, tiefe Fremdheit gegen uns; und selbst zwischen unserer Seele und der des andern findet unsere Sehnsucht des Nehmens und des Gebens eine hoffnungslose Unüberbrückbarkeit.
Das Kunstwerk allein kann ganz unser werden, in seine Form gegossen ist allein eine Seele uns ganz zugängig: indem es mehr für sich ist, als alles andere, ist es mehr für uns als alles andere.
Von den Inhalten des Lebens als solchen pflegen wir zu empfinden, dass es irgend einer Bewegung des Daseins, irgend eines "Schicksals" bedurfte, um sie uns nahe zu bringen, dass sie durch ihr bloßes Dasein noch nicht zu uns gehören.
Nur der Gott, an den wir glauben, und die Kunst, die wir genießen, sind von vornherein und bloß dadurch, dass sie da sind, für unsere Seele bestimmt.
Und wenn auch die große Liebe sich solcher Vorbestimmtheit füreinander bewusst ist, die das zusammenführende Schicksal nur vollstrecken kann, so unterscheidet sie von jenen beiden ihr völlig individuelles Wesen: nur mit diesem einen Menschen und weil er gerade dieser eine ist, ist ihm die andere Seele rein von sich aus verbunden.
Wenn aber der Gläubige schon durch seine Existenz sich mit seinem Gotte eins weiß, wenn der vom Kunstwerk Ergriffene dies wie seine eigne innere Notwendigkeit empfindet - so sind hier nicht mehr individuelle Besonderheiten am Werke, sondern jene tiefen Schichten, in denen der Mensch zwar sein ganzes Ich wirksam, dieses aber doch als den Träger einer überpersönlichen, seine Sondergestaltung hinter sich lassenden Gesetzlichkeit und Seinsbedeutung fühlt.
Und dies erscheint mir als die tiefste Formgleichheit, aus der heraus die Religion allenthalben als der Vorläufer der Kunst, die Kunst allenthalben als die Erregerin religiöser Stimmung auftritt: dass nur diese beiden ein absolut für sich existierendes Sein zum innersten und wie selbstverständlichen, wie vorbestimmten Besitztum der Seele machen.
Diese prinzipielle Beziehung zwischen der Form des religiösen Lebens und der der Kunst realisiert sich in den verschiedenen Kulturen in sehr mannigfaltigen Arten.
Es ist gewissermaßen ihre eigene Steigerung, durch die sie im Christentum manchmal in ihr Gegenteil umzuschlagen scheint.
Sicher ist hier unter allen bekannten Religionen die Spannung zwischen der Entferntheit und der Nähe des Gottes die allerenergischste, aber auch die versöhnteste, weil hier eine Beziehung des Herzens zu dem Gotte besteht, die an der Unendlichkeit der metaphysischen Distanz gegen ihn ihre ganze siegende Kraft zeigt.
Hiermit scheint das Bedürfnis mancher Seelen, einen Lebensinhalt sich ganz ferne zu rücken, um ihn dann ganz in sich einzuziehen, so völlig gedeckt, dass die Kunst in ihrer parallelen Leistung als überflüssig, ja als ein unzulässiger Wettbewerb erscheint.
Dass das Christentum so oft die Kunst unmittelbar abgelehnt hat, ist weder immer asketische Verwerfung des Sinnenreizes, noch immer ästhetische Unkultur, sondern geht, neben manchen andern Motiven, auf diesen Instinkt zurück: dass die Seele der Kunst nicht mehr bedarf, weil sie alle Ausdehnung in das Reich jenseits des Gegebenen und alles Wiedereinbeziehen dieses in sie hinein - bereits besitzt.
Andrerseits bietet das Christentum ebenso durch die Personen und Geschehnisse seiner Tradition wie durch den körperlichen Ausdruck, zu dem die ihm eigenen Gemütsverfassungen drängen, Motive dar, die wie auf die Formgebungen der bildenden Kunst angelegt erscheinen.
Die Demut, das Gebet, das innige Insichverzücktsein - alles dies bringt den Körper besonders gut in sich zusammen, hält die Extremitäten an den Rumpf und begünstigt damit die Geschlossenheit und anschauliche Einheit des Körpers.
Selbst das Ausstrecken der Arme zum Gebet ist etwas völlig anderes als das Abspreizen, das die Konzentriertheit der Erscheinung auflöst.
Denn entweder sind die Hände vereinigt, was eine sehr entschiedene Zusammengefasstheit des Bildes ergibt, oder, selbst wenn sie sich breiten, streben sie einem ideellen Brennpunkt zu, in dem die Richtungen ihrer inneren Bewegtheit sich begegnen - wie man von parallelen Linien sagt, dass sie sich im "Unendlichen" treffen.