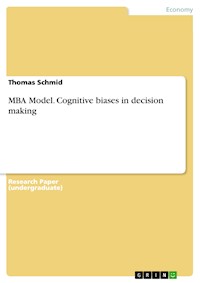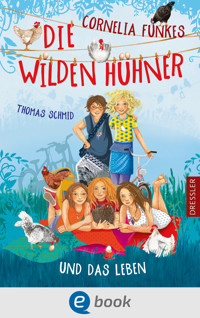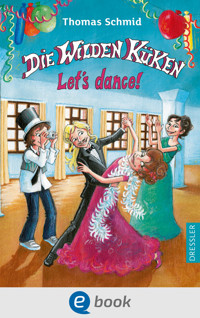11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Europa neu denken – ein Appell!
Mit Europa war einst die große Hoffnung auf einen Kontinent des Friedens und Wohlstands verbunden. Nach vielen Krisen scheint es heute damit vorbei zu sein. Viele Europäer sehen in der EU nur noch ein bürokratisches Monster. Doch es gibt überhaupt keinen Grund, sich enttäuscht oder zornig abzuwenden. Es gilt, das unerhörte Experiment der europäischen Einigung schwungvoll fortzusetzen. Dabei geht es um den Beweis, dass geteilte Souveränität die Staaten und Völker nicht schwächt, sondern stärkt, dass Vielfalt nicht spaltet, sondern zusammenführt. Thomas Schmid plädiert für ein Europa, das Experimente und unterschiedliche Geschwindigkeiten zulässt, das liberaler wird und dem Einbruch globaler Konflikte nicht mit Festungsdenken begegnet. Die europäische Einigung wird den Nationalstaat überwinden, ohne die Bürger heimatlos zu machen. Die hoffnungsvolle Botschaft des Autors lautet: Europa bleibt sich treu, indem es sich neu erfindet – kühn und pragmatisch zugleich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Mit Europa war einst die große Hoffnung auf einen Kontinent des Friedens und Wohlstands verbunden. Nach vielen Krisen scheint es heute damit vorbei zu sein. Viele Europäer sehen in der EU nur noch ein bürokratisches Monster. Doch es gibt überhaupt keinen Grund, sich enttäuscht oder zornig abzuwenden. Es gilt, das unerhörte Experiment der europäischen Einigung schwungvoll fortzusetzen. Dabei geht es um den Beweis, dass geteilte Souveränität die Staaten und Völker nicht schwächt, sondern stärkt, dass Vielfalt nicht spaltet, sondern zusammenführt. Thomas Schmid plädiert für ein Europa, das Experimente und unterschiedliche Geschwindigkeiten zulässt, das liberaler wird und dem Einbruch globaler Konflikte nicht mit Festungsdenken begegnet. Die europäische Einigung wird den Nationalstaat überwinden, ohne die Bürger heimatlos zu machen. Die hoffnungsvolle Botschaft des Autors lautet: Europa bleibt sich treu, indem es sich neu erfindet – kühn und pragmatisch zugleich.
Autor
Thomas Schmid, Jahrgang 1945, engagierte sich in der Studentenbewegung, leitete die Zeitschrift »Autonomie« und arbeitete als Lektor im Verlag Klaus Wagenbach. Er war in leitenden Positionen bei »Wochenpost« und »FAZ« tätig, zuletzt als Chefredakteur und Herausgeber der »Welt«-Gruppe. Schmid lebt als Publizist in Berlin und betreibt den Blog www.schmid-blog.de. Er veröffentlichte u. a.: »Staatsbegräbnis. Von ziviler Gesellschaft« und (mit Daniel Cohn-Bendit) »Heimat Babylon. Das Wagnis der multikulturellen Demokratie«.
Thomas Schmid
Europa ist tot, es lebe Europa!
Eine Weltmacht muss sich neu erfinden
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
2. Auflage
© 2016 by C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: buxdesign München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-20083-1V003www.cbertelsmann.de
Für Edith
Inhalt
Vorwort
1. KapitelEuropas Problemgebirge. Und die Kraft der Krise
Vorwärts immer, Stillstand nimmer?
Den großen Kladderadatsch wird es nicht geben
Der Euro: Not kennt kein Gebot
Mit Putin kam die Geopolitik zurück
Noch Fremde im neuen Club: Mittel- und Osteuropa
Die Massenflucht: Zerlegt der Kontinent sich selbst?
Drei unkluge Reaktionen auf die Krise
Ein Phönix aus der Asche: Die Römischen Verträge
Im Würgeeisen der immer engeren Union
Was daraus folgt
2. KapitelGlanz und Elend der Einigung: Ein Zwischenspiel
COREPERELEREGFL: Die unnötige babylonische Sprachverwirrung
Brüssel I: Die schlanke und polyglotte Bürokratie
Brüssel II: Hort der Arroganz
Eigentümlich schwach: Das Europäische Parlament
Nur die Besten sind gut genug
Was daraus folgt
3. KapitelKein Land ist eine Insel. Werden sich die Briten wirklich vom Kontinent abwenden?
Mind the gap
Reif für die Insel?
Ein verpasstes Rendezvous
Nebel im Ärmelkanal – Kontinent isoliert
Auenland oder: Nostalgie, Zorn und soziales Elend
Was daraus folgt
Wie Wildgänse fliegen
4. KapitelMerkur und Mars: Mehr Außenpolitik!
Ein Konflikt ist ein Konflikt – und bleibt ein Konflikt
Zu viel Innenarchitektur, zu wenig Außenpolitik
Polnische Kapriolen
Europas Weltvergessenheit
Mare nostrum
Die Union für das Mittelmeer: Mehr als nichts, aber zu wenig
Was daraus folgt
5. KapitelGewollt oder nicht: Der Kontinent wird ein anderer werden
Auf dem Rücksitz der europäischen Kutsche
Exkurs: Die Flüchtlinge verändern Europa
Syrien liegt nicht hinter den sieben Bergen
Gehört Istanbul zu uns?
Big is beautiful? Nicht in Europa
Unterschiedliche Geschwindigkeiten wagen
Intermarium
Was daraus folgt
6. KapitelDer Euro: Eine Fehlkonstruktion ohne Exit
In Unfrieden vereint
Gibt es ein Lateinisches Reich?
Norden und Süden: Zähe Mentalitäten
Die gemeinsame Währung kann nicht abgeschafft werden
Deutsch-französischer Motor: Stottert oder explodiert er?
Vielfalt statt Einfalt
Transferunion: Was denn sonst?
Was daraus folgt
7. KapitelZuerst die Kultur?
Die »Méthode Monnet«
Eine Morgenröte der europäischen Literatur?
Das Schweigen der Dichter
Vom langen Elend der Stadt L’Aquila
Wissen eint
Was daraus folgt
8. KapitelStaatlichkeit ohne Staat: Die Zukunft beginnt jetzt
Zwei vermeidbare Sackgassen
Warum mehr Nationalstaat keine Lösung ist
Die Vereinigten Staaten von Europa: Auch keine Perspektive
Ein guter Weg: Staatlichkeit ohne Staat
Liberaler, als man glaubt
Eine friedfertige Waffenschmiede
Ein langes Patiencespiel
Dank
Anmerkungen
Literatur
Vorwort
Europa kann und muss in ganz anderem Maße als bisher zu einer weltpolitischen Macht werden. Die Zeichen scheinen dafür nicht gut zu stehen. Denn die Europäische Union gibt derzeit kein gutes Bild ab, sie wirkt zerrissen und uneins. Doch dabei muss es nicht bleiben. Europa, das nie in sich abgeschlossen war, hat die Kraft, zur Gemeinsamkeit in Vielfalt zurückzufinden. Ein Blick in die Geschichte der europäischen Einigung zeigt das.
Sie versprachen sich Einigkeit und Gemeinsamkeit. Als die Regierungschefs Frankreichs, Italiens, der Beneluxstaaten und der Bundesrepublik Deutschland im März 1957 in der italienischen Hauptstadt die Römischen Verträge unterzeichneten, war das der Anfang einer bisher undenkbaren Entwicklung. Mit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) machten sich sechs europäische Staaten als Pioniergruppe auf einen gänzlich neuen Weg der Verständigung. Erst zwölf Jahre war es her, dass der Zweite Weltkriegs zu Ende gegangen war, der nicht nur diesem Kontinent so furchtbare Verwüstungen gebracht und viele Millionen Menschen das Leben gekostet hatte. Nun ging vom Kapitol in Rom eine große Hoffnung aus, die Europas Völker beflügelte. Man würde sich zusammentun, die Nationalstaaten würden allmählich verblassen.
Das ist lange her. Heute versteht sich die Europäische Union nicht mehr von selbst. Sie ist mehr Last und Problem als Attraktion und Lösung. Viele andere ängstigt die EU. Sie empfinden Zorn gegen sie und wollen zurück in den vollkommen souveränen Nationalstaat. Die europäische Einigung scheint zu fördern, was sie doch beenden wollte: den Nationalismus. Ist die Krise der EU aufzuhalten? Und von welchen Kräften könnte diese Gegenbewegung in Zukunft ausgehen?
In zwei europäischen Staaten – Ungarn und Polen – stellen aggressive EU-Skeptiker und -Gegner seit geraumer Zeit die Regierung. Denkbar ist, dass die Franzosen bald die Vorsitzende des rechtspopulistischen Front National, der den Ausstieg Frankreichs aus der EU will, zur Staatspräsidentin wählen. Und der wirtschaftlich zweitstärkste Mitgliedstaat der EU hat es im Juni 2016 nicht bei seiner Dauerkritik an der EU belassen, sondern höchst praktische Konsequenzen gezogen: Die Briten haben der Europäischen Union nach 43 Jahren Mitgliedschaft den Rücken gekehrt. Es ist durchaus denkbar, dass demnächst andere EU-Staaten diesem Exit-Beispiel folgen werden.
Zuletzt hat die EU in der Flüchtlingsfrage auf dramatische Weise ihre Unfähigkeit bewiesen, gemeinsam zu handeln. Zu viele Staaten igeln sich national ein, kehren gar zum alten Grenzregiment zurück, Zäune inbegriffen. Die vereinbarten Regeln, die das Rückgrat der Union sein müssten, gelten plötzlich nicht mehr. Erstmals ist das Ende des Prozesses der europäischen Einigung vorstellbar geworden.
Dieses Buch schließt sich einem solchen Pessimismus nicht an. Es geht von der Überzeugung aus, dass die Europäische Union wie aus früheren Krisen auch aus der gegenwärtigen gestärkt und erneuert hervorgehen kann. Ein großes europäisches Übel steht dem jedoch im Wege: das unerschütterliche »Weiter so« der fanatischen Berufseuropäer. Schon lange leidet die europäische Gemeinschaft unter einem Defekt. Nach der großen Katastrophe zweier Weltkriege und zweier Totalitarismen sollte in Europa eine politische Ordnung geschaffen werden, die den Rückfall des Kontinents in die Barbarei ein für alle Mal unmöglich macht. Deswegen wurde es zum ehernen Gesetz der Europapolitik, dass es immer nur vorangehen darf in Richtung der »immer engeren Union«. Auch diese Sturheit bewirkte, dass viele Bürger die EU als gefräßiges Ungeheuer wahrnehmen.
Eine andere, eine bessere EU ist machbar. Sie muss nur ihre Ursünde tilgen: Sie muss sich von ihrem antiliberalen Erbe befreien. Die Europäische Union kann unterschiedliche Geschwindigkeiten zulassen. Sie ist keine aufgeblähte Kopie des Nationalstaats, sondern ein Gebilde neuer Art: mehr Bund oder Staatenbund als Staat im alten Sinne. Eine erneuerte Europäische Union könnte es den Völkern möglich machen, ohne Verlustgefühle vom unzeitgemäßen Phantom vollkommener nationaler Souveränität Abschied zu nehmen.
Das Buch lässt die gegenwärtige Krise der Europäischen Union und deren Vorgeschichte Revue passieren und weist auf vergessene Traditionsfäden der europäischen Einigung hin. Es macht Vorschläge, wie das Gefüge der EU so verändert werden kann, dass es fehlerfreundlicher wird. Es plädiert für die Möglichkeit unterschiedlicher Wege. Es zeichnet die Geschichte der Euro-Katastrophe nach, die hätte vermieden werden können, und vertritt die Ansicht, dass Austritte aus der Eurozone möglich sein sollten. Und es setzt sich dafür ein, dass sich die EU neue Schwerpunkte vornimmt, vor allem außenpolitische, und in der Flüchtlingsfrage zu neuer Gemeinsamkeit findet.
Auch der mit Aplomb beschlossene, aber sehr langsam in Gang gesetzte Auszug der Briten aus der Europäischen Union muss keineswegs die vielfach prognostizierte Katastrophe bedeuten. Denn erstens könnte Europa diesen Verlust, den der Austritt Großbritanniens zweifelsfrei bedeutet, endlich zum Anlass nehmen, Politik und Vorgehensweise der EU-Institutionen gründlich zu überdenken und ohne großes Vertragstamtam zu reformieren. Das Nein der Briten drückt ja eine Unzufriedenheit mit der EU aus, die allgemeineuropäische Dimensionen hat. Und zweitens besteht jetzt die Chance, das Vereinigte Königreich durch neue, flexible Formen der Kooperation weiter an die EU zu binden und damit der Tatsache gerecht zu werden, dass Großbritannien zwar eine Insel, aber immer schon ein höchst aktiver Teil Europas war.
»Le roi est mort, vive le roi«: Mit diesem Ausruf gab einst in Frankreich ein Herold den Tod des Königs bekannt, um im selben Moment den neuen König auszurufen. Die Parole, 1824 zum letzten Mal verwendet, war kein düsterer Trauerruf. Sie erzählt vielmehr eine Geschichte: die Geschichte einer Kontinuität. Der König stirbt, aber die Monarchie bleibt. »Europa ist tot, es lebe Europa!« Der Titel dieses Buches erzählt auch eine Geschichte. Die Geschichte vom Vermögen der europäischen Einigung, an Krisen nicht zugrunde zu gehen, sondern sie zu meistern.
Noch eine persönliche Bemerkung: Die europäische Einigung habe ich lange Zeit nur am Rande wahrgenommen. Es gab sie einfach, wie das Wetter. Das mag mit der verächtlichen Gleichgültigkeit gegenüber Institutionen zu tun haben, die mir, einem 68er, einst selbstverständlich war. Mein Interesse wuchs nur langsam, verzögert auch deswegen, weil mich die funktionärshafte Gschaftlhuberei der Durch-dick-und-dünn-Europäer abstieß und noch immer abstößt. Spätestens in dem Moment aber, als mit Putins Rückkehr zur Geopolitik erstmals im europäischen Raum wieder Grenzen bewusst verletzt wurden und Europa dann in der Flüchtlingsfrage so dramatisch versagte, wurde mir vollends klar, was wir an der EU als einer Gesprächs- und Verhandlungsunion haben. Genauer: haben könnten.
Europa muss eine politische Weltmacht werden – aber nicht im Sinne herkömmlicher Machtpolitik und auch nicht in moralisch-zivilgesellschaftlicher Überheblichkeit. Was sich schon andeutete, könnte unter Trumps Präsidentschaft Wirklichkeit werden: Die USA ziehen sich so radikal wie nie zuvor auf sich selbst zurück. Nun spätestens ist der Zeitpunkt gekommen, an dem Europa gar keine andere Wahl mehr hat, als sich zu einen und selbstverantwortlich für seine Sicherheit zu sorgen. Europa allein zu Haus: Darin liegt auch eine Chance.
Dieses Buch versteht sich als Herausforderung an die Europäische Union, sich selbst offenen Geistes zu überdenken und liberal zu bekräftigen. Geduld und Leidenschaft sind gefragt. Let’s twist again.
Berlin und Schmölln, im Frühsommer 2016
1. KapitelEuropas Problemgebirge. Und die Kraft der Krise
Vorwärts immer, Stillstand nimmer?
Politiker können wie Kinder sein. Sie glauben dann zum Beispiel an die unmittelbare Überzeugungskraft von Bildern, mögen sie auch noch so schief sein. Es soll Walter Hallstein, der erste Vorsitzende der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, gewesen sein, der die »Fahrradmetapher« in die Europapolitik einführte, die später von vielen anderen Europapolitikern ebenfalls gerne bemüht wurde. »Europa«, soll er gesagt haben, »ist wie ein Fahrrad. Hält man es an, fällt es um.« Gemeint war damit: immer mehr Europa, ein immer größeres Tempo der Integration, weiter so. Vorwärts immer, Stillstand nimmer. Das Bild kommt zwar harmlos daher, steckt aber voller bauernschlauer Bosheit. Denn es suggeriert: Wer das europäische Fahrrad bremsen oder anhalten will, riskiert Sturz wie Verletzung und gefährdet den Europaverkehr. Nur als Perpetuum mobile, so die Botschaft, kann Europa, kann die europäische Einigung1 Bestand haben.
Das Perpetuum mobile gibt es bekanntlich nicht. Und so kann auf den zweiten Blick die verführerische Kraft des Fahrradbildes nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ziemlich töricht, ja unsinnig ist. Als Jacques Delors, ein wahrer Mehr-Europa-Fanatiker, im Europäischen Parlament zur Begründung einer abermaligen Temposteigerung des europäischen Integrationsprozesses wieder einmal das Fahrrad strapazierte, entgegnete ihm ein Abgeordneter aus dem Vereinigten Königreich mit trockenem britischen Sarkasmus: »Dann stellen Sie doch den Fuß auf den Boden!« Es verhält sich ganz einfach: Man kann ein Fahrrad fahren, unterwegs auch bremsen und anhalten, man kann absteigen und gegebenenfalls wieder weiterfahren. Was für das Fahrrad gilt, gilt auch für Europa. Schlecht für Europa ist es, dass die meisten Europapolitiker fast aller Mitgliedstaaten der EU das bis heute partout nicht einsehen wollen. Das Strampeln, so glauben sie fest, sei unser aller Schicksal. Mehr Europa, immer und überall: Dies ist das Grundübel der europäischen Einigung.
Die Europäische Union befindet sich heute in keiner guten Verfassung. Auch wer nicht zum Alarmismus neigt, wird um die Einsicht nicht herumkommen, dass es noch nie so schlecht um die europäische Einigung stand wie jetzt. Lange begleitete die EU unser Leben wie eine Hintergrundmusik. Diese erklang so beständig und dezent, dass wir sie kaum mehr zur Kenntnis nahmen. Manchmal nervte die Union zwar mit ihren bürokratischen Kapriolen, ihrer blutleeren Sprache und ihrem Einheitsfimmel. Aber das machte weiter nichts aus, es gab die EU so selbstverständlich wie die Verkehrsnachrichten, das Wetter und die Luft, die wir atmen. Nun aber ist die EU auffällig geworden. Erstmals in ihrer Geschichte ist sie nicht nur von einer Krise erschüttert, sondern in ihrem schieren Bestand bedroht. Ihr Scheitern, ihr Zerbrechen, ihre mutwillige Selbstaufgabe oder gar Selbstzerstörung mag man nicht mehr ganz ausschließen. Es könnte dahin kommen, dass sich Europa zerlegt und seine Völker und Staaten wieder in ihre alten nationalen Gehäuse zurückkriechen oder dorthin zurückgeschleudert werden.
Eine Grundüberzeugung vieler, ja fast aller Europapolitiker war und ist, dass der Prozess der europäischen Integration ein unumkehrbarer sei muss. Dahinter stand die verständliche Angst einer Kriegsgeneration, die die Schrecken eines entfesselten Nationalismus erlebt hatte, vor einem Rückfall in nur noch einzelstaatliches politisches Denken. Es war und ist aber auch ein weniger nobles Motiv am Werk: die Überzeugung nämlich, man könne die europäische Gemeinschaft nur als coup d’etat, nur von oben verwirklichen. Das Volk, so die weitverbreitete Überzeugung, sei nicht fähig, den Segen des europäischen Einigungswerks zu verstehen und es dauerhaft, auch in Krisensituationen mitzutragen. Die europäische Einigung, eigentlich ein von gegenseitigem Vertrauen getragenes Unternehmen, war und ist zugleich zu seinem eigenen Schaden ein Projekt des Misstrauens. Aus diesem Misstrauen entsprang der feste Wille der – wenn man so will – europäischen politischen Klasse, Fakten zu schaffen, möglichst schnell und unwiderruflich. So bekam die europäische Einigung in ihrem Drang, wetterfeste Institutionen zu schaffen, einen autoritären Zug. Und den verhängnisvollen Drall, Integration um der Integration willen zu betreiben. Die Frage nach dem Sinn einzelner Maßnahmen wurde mit einem Tabu belegt, galt geradezu als unanständig. Wer fragte oder gar zweifelte, galt als Antieuropäer.
Das konnte eine Weile, aber nicht ewig gut gehen. Es ist eigentlich leicht einzusehen, dass die europäische Einigung dauerhaft nur dann eine Chance hat, wenn sie von den Völkern Europas wenigstens halbwegs akzeptiert wird. Mit den Völkern war also von Anfang an zu rechnen. Manche von ihnen stimmten einst einigermaßen emphatisch der europäischen Einigung zu. Etwa das (west-)deutsche und das italienische, denn in beiden Staaten bedeutete Europa auch die schnelle Abkehr von einer Vergangenheit, mit der sich kein aufrechter Mensch identifizieren konnte. Anderen Völkern erging es anders. Dem britischen etwa. Es konnte nach 1945 – trotz des Verwelkens des Empires – stolz sein auf seine lange Parlamentsgeschichte, auf seinen Beitrag zum Sieg über das nationalsozialistische Deutschland und auf seine politische Kultur der Mäßigung, die auch etwas mit der insularen Lage des Landes zu tun hat. Diesem Volk, für das die Souveränität des Parlaments ein sehr hoher Wert ist, musste die Überlistungsstrategie der Europapolitiker wider den Strich gehen. Gewiss, die Briten sind mit ihrer Extravaganz anderen europapolitisch oft auf die Nerven gegangen. Das ändert aber nichts daran, dass es ein fundamentaler Fehler der europäischen Gremien war, das lange angestaute Missfallen vieler Briten zu übersehen oder es zwar zu sehen, sich aber darüber hinwegzusetzen. Man hat in Brüssel die Zeichen an der Wand nicht erkannt.
Nur eine flexiblere, nicht mehr nach dem Gral der Vertiefung suchende Europäische Union hätte der Mehrheit der Briten attraktiv erscheinen können. Weil man in Brüssel (wie in den Regierungen vieler EU-Mitgliedstaaten) fest davon überzeugt war, dass die europäische Einigung keinen Rückwärtsgang haben darf und kann, konnte man sich bis zuletzt schlicht nicht vorstellen, was dann doch geschah: dass Großbritannien aus den heiligen Hallen der EU ins angeblich oder tatsächlich Freie austritt. Beide Seiten haben in Großbritannien während der Referendumskampagne maßlos und polemisch agiert – das Votum war keine Entscheidung kühler Köpfe. Und doch liegt ein Gutteil der Verantwortung für das britische Nein bei Brüssel und den europäischen Institutionen. In ganz Europa erklingt der Ruf nach einer beweglicheren, weniger auf Regulierung setzenden Europäischen Union. Rechte, fanatische und europafeindliche Populisten werden auch deswegen stark, weil die EU bisher nicht bereit ist, den rationalen Kern dieses Unbehagens ernst zu nehmen, Konsequenzen daraus zu ziehen und das europäische Einigungswerk etwas abzurüsten. So paradox es klingt: Sollte die Europäische Union auseinanderbrechen, dann wären dafür nicht zuletzt jene Europapolitiker und jene europäischen Institutionen verantwortlich, die der EU eine Ewigkeitsgarantie verschaffen wollten.
Den großen Kladderadatsch wird es nicht geben
So muss es nicht kommen, und so wird es nicht kommen. Doch selbst wenn es so käme, müsste das nicht zu dem großen Kladderadatsch führen, den so viele Durchhalteeuropäer befürchten und als Schreckensgemälde an die Wand malen, um ihrer Drohbotschaft Gewicht zu verleihen. Etwa Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn: »Die Europäische Union«, sagte er, »kann auseinanderbrechen. Das kann unheimlich schnell gehen, wenn Abschottung statt Solidarität nach innen wie nach außen zur Regel wird […]. Und dieser falsche Nationalismus kann zu einem richtigen Krieg führen.«2 Nein, so muss es nicht kommen. Es ist nämlich keineswegs ausgemacht, dass die Furien eines aggressiven, bösartigen und kampfbereiten Nationalismus wieder Besitz von Europa ergreifen würden. Die Le Pens kommen und gehen. Sie sind ganz und gar Kräfte des Neins und deswegen außerstande, es mit Europa aufzunehmen und ihm ihren armseligen Stempel aufzudrücken. Die Alternative lautet nicht: mehr Europa oder Rückkehr des alten Nationalismus. Wir sollten uns das nicht einreden lassen. Das Ende der EU müsste keineswegs mit einem kontinentalen Siegeszug militanter Nationalismen zusammenfallen, wie so viele Europa-Begeisterte von Joschka Fischer bis Martin Schulz warnend behaupten. Viele Farben Grau wären viel wahrscheinlicher. Das Ende der EU könnte ganz unspektakulär ausfallen, ohne Klamauk, Pathos, Blut und Tränen. Wir könnten sogar damit leben. Eine Misere wäre es aber doch.
Käme es so weit, dann liefen die Völker und Staaten vermutlich einfach auseinander und zerstreuten sich – still, vielleicht gedrückt, doch vermutlich weder lärmend noch verzweifelt noch aggressiv. Denn in Europa geht nicht der Ungeist von 1933 um. Die europäische Einigung hat Europa grundlegend verändert und die Bürger des Kontinents in ihren Lebensgewohnheiten einander angenähert und sie miteinander vertraut gemacht. Das kann niemand mehr rückgängig machen. Wohl aber könnte es dahin kommen, dass sich alte Allianzen wiederbeleben, etwa eine der skandinavischen Staaten. Neue Allianzen entstünden, etwa eine der bisherigen osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten oder derjenigen des Südens. Großbritannien etwa könnte noch stärker als bisher nach den USA und nach Kanada blicken oder sich womöglich enger an die skandinavischen Staaten binden. Kein Trennungsdrama käme auf den Spielplan. Eher ginge Europas Reise in Richtung Anomie: schwache Ordnungen. Grenzen würden wieder mehr trennen als verbinden, das wäre aber nicht gänzlich unerträglich. Das Rendezvous zwischen Europas Osten und Europas Westen, das nun schon seit einem Vierteljahrhundert ansteht, käme wohl nicht mehr zustande. Der alte Nord-Süd-Streit, in dem es nicht nur um unterschiedliche Wirtschaftsweisen, sondern auch um unterschiedliche Vorstellungen vom Sinn des Lebens und vom Glück ging, wäre ergebnislos beendet, wort- und grußlos verließen die Kämpen vermutlich die Arena. Und um ein letztes von vielen weiteren Beispielen zu nennen: Deutschland und Frankreich, die als »Motoren« der europäischen Einigung galten, fielen zwar nicht in die alte Erbfeindschaft zurück, würden sich aber noch gleichgültiger werden, als sie es heute schon sind.
Das alles wäre vielleicht kein großes Unglück, mehr wäre aber möglich gewesen. Und selbst dann, wenn es hernach neue Formen von europäischen Bündnissen und Verträgen gäbe – die Idee der europäischen Einigung wäre erst einmal begraben. Auch für jene, die der EU herzlich abgeneigt sind, wäre ein schwerwiegender Verlust spürbar. Eine große Chance wäre vertan, das Gründungskapital der europäischen Einigung – das sich zu gleichen Teilen aus Interessen und Idealen zusammensetzte – verspielt. Eine zweite Chance bekäme ein derart breit und verzweigt angelegtes Unternehmen wie die europäische Einigung wohl nicht. Zumindest nicht in den nächsten Jahren. Halb mutwillig, halb zufällig wäre der einzigartige Versuch abgebrochen, einen Verbund von Staaten auf Freiwilligkeit, Recht und gegenseitige Anteilnahme zu gründen. Dieser war und ist so wertvoll, dass alles getan werden sollte, um einen knirschenden Halt auf freier Strecke zu verhindern.
Dass das Ende der EU denkbar geworden ist, hat mehrere Gründe. Es kommt einfach sehr viel zusammen, mehr als jemals zuvor. Die wichtigsten Stichworte lauten: Euro, Russland, Osterweiterung, Flüchtlingsfrage, die innere Verfasstheit der Europäischen Union und der Austritt der Briten (dem ein eigenes Kapitel, das dritte, gewidmet ist). Es hat sich im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte viel angesammelt, teils kommen die Probleme von außen, teils sind sie selbst verschuldet. Dass sie nicht in der Folge ihres Auftretens angegangen und gelöst wurden, hat zu einer bedrohlichen Problemkumulierung geführt.
Der Euro: Not kennt kein Gebot
Der Euro war von Anfang an eine Fehlkonstruktion.3 Auch wenn es sich um verschüttete Milch handelt, muss doch darüber geredet werden. Als seine Einführung geplant wurde, sagten gewichtige Europapolitiker häufig, die europäische Währungs- und Wirtschaftsunion müsse Hand in Hand gehen mit der politischen Union. Manche stellten sogar klipp und klar fest, die Einführung der gemeinsamen Währung sei nur dann zu verantworten, wenn sie auf die politische Einigung folge und gewissermaßen deren »Krönung« sei. So etwa der damalige Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg, in der Bundesregierung der ordnungspolitische Gegenspieler des Euro-Drückers Hans-Dietrich Genscher. In einer Stellungnahme zur Zukunft der währungspolitischen Zusammenarbeit in Europa schrieb er in gedrechselter Politikersprache, dennoch unmissverständlich: »Als auf Dauer angelegte und alle Unterschiede in der Wirtschafts- und Währungsentwicklung ausgleichende Solidargemeinschaft mit einer einheitlichen Währung […] muss sie vor allem durch eine weitgehende politisch-institutionelle Umgestaltung der Gemeinschaft in Richtung einer umfassenden Union fundiert werden.«4 Wohlgemerkt: fundiert, nicht ergänzt. Genau so, wie es einst in Italien, der Schweiz und in Deutschland geschah: erst die Einigung, dann die einheitliche Währung. In Deutschland dauerte es nach der Reichsgründung 1871 noch fünf Jahre, bis es eine gemeinsame Zentralbank gab. Und erst 38 Jahre später, im Jahre 1909, kam die gemeinsame Währung, die Reichsmark.5
Helmut Kohl und andere führende Europapolitiker sprachen klar, deutlich und entschieden von der Notwendigkeit, die gemeinsame Währung einzuführen – von der politischen Union sprachen sie, wenn überhaupt, nur sehr undeutlich. Was eigentlich mit dieser gemeint sei, wurde nie präzisiert. In allen Dokumenten, die der Prozess der Euro-Schöpfung hinterlassen hat, ist nahezu nichts darüber zu erfahren – die kleine Phrase und das große Schweigen. Das hat mit Ratlosigkeit zu tun und mit einer unglaublichen Wurstigkeit: Wird schon werden, irgendwie. Es hat aber auch viel mit dem Epochenbruch des Jahres 1989 und dem Umstand zu tun, dass die sogenannte deutsch-französische Achse vom Beginn der europäischen Einigung an zu einem quasi sakralen Wert verklärt wurde. Frankreichs Präsident François Mitterrand, wie de Gaulle ein Nationalnostalgiker, fürchtete, dass mit der Wiedervereinigung Deutschlands Stärke in Europa noch weiter zunehmen und die Kluft zu Frankreich noch tiefer werden würde. Wie fast allen französischen Nachkriegspolitikern vor ihm ging es auch Mitterrand darum, Deutschland durch Einbindung an die Leine zu legen. »Die D-Mark«, sagte Mitterrand, der die Verfügungsgewalt über die mit Atomwaffen ausgestattete force de frappe hatte, »ist Deutschlands Atombombe«.
In der Wirtschafts- und Währungsunion, hoffte er, würde es gelingen, diese Bombe zu entschärfen und zu verhindern, dass Deutschland seinen Kurs haushaltspolitischer Strenge ganz Europa aufzwingt. Und umgekehrt wusste Helmut Kohl, der den Euro ohnehin wollte, ganz genau, dass er ohne sein klares Ja zur Euroeinführung nie die Zustimmung des höchst zögerlichen Frankreichs zur deutschen Vereinigung bekommen hätte.
Zum Missgeschick der Euroeinführung gehört außerdem der Zufall, dass entscheidende Schachzüge genau in den zwei Monaten getan wurden, in denen die DDR ihren brüchigen Geist aufgab und die Wiedervereinigung unabweisbar auf die politische Tagesordnung kam: im November und Dezember 1989, als die DDR über Nacht zum offenen Staat wurde. Das war keine gemächliche Zeit, es waren Tage und Wochen, in denen es pressierte. Mitterrand wurde sehr deutlich. Wenn die Westintegration durch die deutsche Vereinigung stehen bleibe, sagte er der Niederschrift eines Gespräches zwischen ihm und Außenminister Genscher zufolge, bedeute das einen Rückschritt. Mehr noch: »Es sei sogar nicht ausgeschlossen, dass man dann in die Vorstellungswelt von 1913 zurückfalle.«6 Das wollte natürlich niemand, Kohl schon gar nicht, dem das Nein zum Europa der Kriege über fast alles ging. Schnell war er dazu bereit, seine ohnehin schwach ausgeprägten ordnungspolitischen Reserven über Bord zu werfen. Keine strategische Vision, sondern ein tagespolitischer Deal stand an der Wiege des Euro. Kein Wunder, dass Deutschland vor der Einführung des Euro stabilitätspolitische Bedenken pflichtschuldig zu Protokoll gab, dann aber Kompromisslösungen zustimmte, mit denen diese Bedenken leichtfertig hintangestellt wurden.
Doch auch unabhängig davon war der Euro ein misslungenes Konstrukt. Man kann es sich heute kaum noch vorstellen, dass die Notwendigkeit seiner Einführung auch damit begründet wurde, diese werde quasi automatisch einen gemeinsamen Wirtschaftsraum der Eurozone schaffen. Mehr noch, man glaubte, wie in den einschlägigen Entwürfen nachzulesen ist, ernsthaft daran, dass mit der Einführung des Euro die bisher bestehenden und zum Teil krassen wirtschaftlichen Disparitäten der Mitgliedstaaten mit Zauberhand eingeebnet würden und die Eurozone zu einer Sphäre allgemeinen Wohlstands würde. Der Euro war als wirkliches Zahlungsmittel noch nicht eingeführt, da trompete der Europäische Rat im März 2000: »Der Euro ist erfolgreich eingeführt worden und bringt den erwarteten Nutzen für die europäische Wirtschaft mit sich.«7 Das grenzt, blickt man zurück, an magisches Denken und beweist einmal mehr, dass auch sehr kluge Menschen sehr danebenliegen können. Als das Eurobargeld gerade einmal 129 Tage, also etwas mehr als vier Monate, in Umlauf war, wurde am 9. Mai 2002 – dem Europatag – in Aachen der Internationale Karlspreis für Verdienste um Europa und die europäische Einigung verliehen. Der Preis ging an eine ganz besondere Persönlichkeit: den Euro, dem das verleihende Direktorium freizügig bescheinigte, schon als Heranwachsender Ungeheures vollbracht zu haben. Die Begründung ist ausgesprochen vollmundig: »Wie kein anderer Integrationsschritt zuvor wird [nicht: könnte, was vielleicht angemessener gewesen wäre, t. s.] die neue Währung, der EURO, die Identifikation mit Europa befördern. Der EURO leistet damit einen entscheidenden, epochemachenden Beitrag zum Zusammenwachsen der Völkerfamilie. […] Der EURO ist die überzeugendste, pragmatischste [!] Lösung auf dem Weg zur europäischen Gemeinsamkeit seit 1200 Jahren. Mit der Verleihung des Internationalen Karlspreises im Jahre 2002 tragen wir der Überzeugung Rechnung, dass gerade aus dem EURO ein völlig neues Gefühl der Zusammengehörigkeit in der Union erwachsen wird. […] Und wer künftig von Frankreich nach Griechenland, von Österreich nach Finnland, von Luxemburg nach Portugal, von Belgien nach Irland, von Spanien in die Niederlande und von Deutschland nach Italien reist, der wird durch den EURO ein ›Stück Heimat‹ auch jenseits der nationalen Grenzen erleben.«8
Eine neue Heimat, die sich als brüchig erweisen sollte. Selbst wenn man nachsichtig darüber hinwegsieht, dass in Feierstunden nun einmal Schmus verbreitet wird: Das war schon ein starkes Stück. Die Preisverleiher haben sich mit ihrer Großspurigkeit ziemlich blamiert. Und es ist kein gutes Zeichen, dass sie nie zu einem Wort des Bedauerns fanden. Der Euro wurde politisch erzwungen, und es bekamen ihn Länder, die ihn nie hätten bekommen dürfen – nicht nur das arme Griechenland, das heute als alleiniger Sünder gilt. Auch Italien etwa, dessen Haushaltsdefizit 1995 bei 7,7 Prozent lag, also fast fünf Prozent über der vertraglich vorgesehenen Obergrenze. Bundesbank wie Finanzministerium plädierten gegen die Aufnahme des Landes – worauf Frankreich drohte, dann gar nicht erst an der Währungsunion teilzunehmen. Also bekam auch Italien den Euro – ein weiteres Beispiel dafür, dass politische Opportunität sich durchsetzte.
Vor allem aber hat der Euro das schiere Gegenteil von dem erreicht, was er den hochfliegenden Plänen der Gründer der Wirtschafts- und Währungsunion zufolge bewirken sollte. Er hat die Volkswirtschaften der Länder der Eurozone nicht einander angeglichen oder auch nur angenähert. Er hat die Gräben tiefer, das Gefälle schroffer gemacht. Er hat die Länder des Olivengürtels (olive belt) – die so hübsche wie böse Charakterisierung kommt aus Großbritannien – mit der leichten Verfügbarkeit schnellen Geldes dazu verführt, fröhlich auf Pump zu leben und das saure Brot der Reformen gar nicht erst anzurühren. Griechenland erlebte von 2000 bis 2008 eine durchschnittliche Steigerung der Reallöhne um 39,6 Prozent9 – denen keine auch nur annährend entsprechende Steigerung der Produktivität gegenüberstand. Der Euro hat den Staaten des »Südens« Zeit gestohlen, hat sie noch weiter abgehängt. Und er hat die Staaten des »Nordens« in die doppelt ungemütliche Rolle des potenziellen Dauertransferzahlers gezwungen: Bei den Empfängerländern südlich der Alpen gelten sie als hartherzige Modernisierungsdiktaturen, ja fast als Protektoratsmächte, bei der eigenen Bevölkerung stehen sie im Verdacht, wie Hallodris mit dem Staatshaushalt – also dem von den Bürgern erwirtschafteten Geld – umzugehen. Viel paradoxer, viel schlimmer hätte das Euro-Abenteuer kaum enden können. Es hat die europäische Einigung nicht vorangetrieben, es hat Europa mit dem finanzpolitischen Beil gespalten. Der Euro, der die Völker zusammenführen sollte, hat stattdessen eine elende »Spirale des Unmuts, der Missgunst und der gegenseitigen Schuldvorwürfe«10 in Gang gesetzt.
Es wird Auswege aus diesem Dilemma geben. Sie werden nicht so schlüssig und scharf umrissen sein wie die Alternativen, die schlaue Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler seit Jahren an ihren Reißbrettern entwerfen. Sie werden mühsam und oft wenig eindeutig sein. Den angerichteten Schaden, der das Vertrauenskapital drastisch hat schrumpfen lassen, können sie allenfalls langfristig beheben. Eine misslungene Währungsunion lässt sich nicht einfach neu gründen. Wie im wirklichen Leben gilt auch hier: Fehler fallen ins Gewicht, Fehler zählen. Es ist schwerer, sie zu revidieren als sie zu vermeiden.
Es kommt noch schlimmer. Die Dynamik, die der Euro und das Bemühen, ihn um jeden Preis zu retten, in Gang setzten, hat die Verlässlichkeit des europäischen Regelwerks schwer beschädigt. Es fing schon ganz früh, nämlich 1988, an, als von deutscher Vereinigung und dem neuerlichen Bedürfnis, Deutschland zu zähmen, noch keine Rede war. 1988 setzte der Europäische Rat auf seiner Tagung in Hannover eine Kommission ein, die Prinzipien für die Entwicklung eines europäischen Währungsraums und ein Statut für die Errichtung einer Europäischen Zentralbank festsetzen sollte. Vorsitzender der Kommission wurde nicht, wie ursprünglich gedacht, Karl Otto Pöhl, der Präsident der Deutschen Bundesbank, ein scheuer Mann von ordnungspolitischer Schärfe. Den Vorsitz erhielt vielmehr der Präsident der EU-Kommission, der Franzose Jacques Delors: ein, wie man sagt, undogmatischer Sozialist, mit dem Helmut Kohl gut konnte, der sich während seiner gesamten Kanzlerschaft ja auch nicht gerade als ein ordnungspolitischer Überzeugungstäter erwiesen hat. Delors’ Kommission wurde nun unter kräftiger Mitwirkung des Vorsitzenden nicht etwa damit betraut, die Frage zu klären, ob die Gemeinschaft aus überzeugenden Gründen zu einer Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) weiterentwickelt werden soll. Sie bekam vielmehr von vorneherein den alleinigen Auftrag, die gestellte Frage positiv zu beantworten.
Im Dokument zum Abschluss der Tagung in Hannover heißt es: »Der Europäische Rat erinnert daran, dass die Mitgliedstaaten […] bestätigt haben, dass sie eine schrittweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion anstreben. Sie beschlossen, […] die Mittel zur Herbeiführung dieser Union zu prüfen. Im Hinblick darauf haben sie vereinbart, einem Ausschuss die Aufgabe zu übertragen, die konkreten Etappen zur Verwirklichung dieser Union zu prüfen und vorzuschlagen.«11 Nicht die Sinnhaftigkeit der Union, sondern die Etappen ihrer Verwirklichung sollten geprüft werden. Es ging also von Beginn an nur um das Wie. Ein gutes Beispiel für das, was die Sozialwissenschaftler Pfadabhängigkeit nennen und was in der europäischen Politik fast den Rang eines ehernen Gesetzes einnimmt: Ein einmal eingeschlagener Weg wird verfolgt, koste es, was es wolle. Damit begibt sich die Gemeinschaft der Lernfähigkeit, sie setzt sich gewissermaßen Scheuklappen auf. Leichthin missachteten die EU-Verantwortlichen alle Stimmen, die den Euro für verfrüht erklärten. Und wer glaubte, hinter der Einführung einer gemeinsamen Währung zur Unzeit sei eine überrumpelnde List der Vernunft am Werk, der hat sich geirrt: Die List verfing offensichtlich nicht.
»Scheitert der Euro, dann scheitert Europa«, befand Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung vom 19. Mai 2010.12 Der zutiefst fatalistische Satz, der Ratlosigkeit in eisernen Durchhaltewillen ummünzt, könnte als Überschrift über dem gesamten Verlauf der Eurokrise stehen. Wie noch nie zuvor in der Union setzte sich nun ein einseitiger Marschbefehl durch, der nicht mehr hinterfragt werden durfte. Das manövrierte die nationalen Parlamente, so sie denn den Eurorettungsmaßnahmen zustimmen mussten, an den Rand der Bedeutungslosigkeit. Die Rettung um der Rettung willen wurde zum ehernen Gesetz. Zu Recht sagt Peter Graf Kielmansegg: »Unter dem Schock der Krise hat sich die europäische Staatenföderation eine Verfassung gegeben, deren ungeschriebener Basissatz lautet: Not kennt kein Gebot. Das europäische Projekt ist wichtiger als die Rechtssätze, in denen es Gestalt gewonnen hat.«13 Mit gutem Grund kritisieren die Euroskeptiker das Verfahren der Eurorettung als ziemlich undemokratisch. Selten hat man in demokratischen Zeiten eine solche schroffe Selbstermächtigung der Politik erlebt – die schnell in die von der Politik gestützte Selbstermächtigung der Europäischen Zentralbank (EZB) und seines gegenwärtigen Präsidenten Mario Draghi mündete.
In einer Rede, die Draghi am 26. Juli 2012 in London auf der Global Investment Conference hielt, kündigte der Mann mit den unergründlichen Gesichtszügen eines Renaissancefürsten die Entscheidung für einen abenteuerlichen Weg der Eurorettung an. Er sagte: »The European Central Bank is ready to do whatever it takes to preserve the Euro.« (Was auch immer es kosten und erfordern wird, die EZB wird alles tun, um den Euro zu erhalten.)14 Man hört förmlich, wie Draghi diese Ungeheuerlichkeit mit nahezu tonloser Stimme und einem dünnen Lächeln in die Welt setzt. Whatever it takes: In diesem stolzen Statement ist die Abdankung, ja die Entmachtung der Politik enthalten. Und der Grundstein gelegt für eine zügellose Geldschöpfungspolitik, die in der Festung EZB betrieben wird. Um die Fehler der Euroeinführung zu korrigieren oder zu beheben, wurden – wissentlich oder nicht – noch größere Fehler begangen. So wurde der Euro zur Atombombe, deren Drohung die Völker und Staaten Europas ausgesetzt sind. Selten hat eine eigentlich gute Idee ein derart schlimmes Ende genommen. Mit gutem Grund fällt das Urteil des Historikers Andreas Rödder knapp und scharf aus: »Die Wirtschafts- und Währungsunion hat sich, selbst wenn der Euro gerettet wird, mit ihren ökonomischen, institutionellen und politisch-kulturellen Problemen als Fehlkonstruktion erwiesen.«15 Politik kann viel bewirken, die Geschichte der europäischen Einigung ist ein stolzer Beweis dafür. Wirtschaftliche Grundregeln kann sie dehnen und auch eine Zeit lang suspendieren. Auf Dauer außer Kraft setzen kann sie sie nicht. So zahlen wir in einer verbeulten Währung, deren Zukunft noch längst nicht gesichert ist. Und müssen zumindest in Erwägung ziehen, ob die Briten nicht recht hatten mit ihrer Entscheidung, auf das neue Stück Heimat namens Euro zu verzichten.
Mit Putin kam die Geopolitik zurück
Eine zweite – nicht unmittelbare – Existenzbedrohung der europäischen Einigung kommt von außen: von Russland. Man kann gut begründet darüber streiten, ob die Staaten Europas und die USA in den späten Jelzin- und den frühen Putin-Jahren hinreichend sorgfältig und achtsam mit dem tönernen Koloss Russland umgegangen sind. Vermutlich wurde nicht so viel Energie auf die Einbindung verwandt, wie notwendig und angemessen gewesen wäre, um das Land und seine Führung zu einer vorbehaltlosen Partnerschaft und einer alle wesentlichen Bereiche umfassenden Vertragsgemeinschaft zu bewegen. Sicher ist aber, dass sich Russlands Herrscher Putin irgendwann zielstrebig und kühlen Herzens entschlossen hat, mit der Politik der Verständigung und der Annäherung radikal zu brechen. Er ist zur klassischen Machtpolitik zurückgekehrt, wie sie in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr betrieben worden ist.
Welchen gravierenden, schockartig wirkenden Einschnitt das bedeutet, machen die Reaktionen eines großen Russlandkenners und -liebhabers deutlich, der das Land seit Jahrzehnten erkundet, beschrieben und manchmal fast besungen hat: Karl Schlögel. Vor 1989 hatte er den Epochenbruch geahnt und aus den Gesellschaften der Sowjetunion herausgelesen. Nach 1989 sah er einen Aufbruch des vom Eise befreiten Russlands kommen. Trotz allen Autoritarismus, der blieb, trotz aller Rückschläge hielt er mit Leidenschaft daran fest, dass das große Russland zu neuen Ufern aufgebrochen sei. Gerade deswegen hat ihn das neue Russland, das Putin allmählich geformt hat, so schockiert: »Für mich ist es eine sehr gravierende Zäsur. Ich fühle mich zurückgeworfen. Russland ist nun wieder da als das Land, das Angst verbreitet. Diese Verachtung und Anmaßung und Arroganz – darauf war ich nicht gefasst.«16 Sein Forschungsgegenstand Russland sei, so schreibt er, aufs Engste mit dem eigenen, persönlichen Leben verbunden gewesen, »fast möchte man es eine Bezauberung, eine Verstrickung«17 nennen. Putins Annexion der Krim habe ihm, bildlich gesprochen, den Boden weggezogen, auf dem er sicher zu stehen glaubte. Plötzlich gehe es um alles: »um das, woran man ein Leben lang gearbeitet hat, weil man sich gleichsam verwundet fühlt«. Es bleibe ein »Gefühl grenzenloser Ohnmacht«.
Europa wurde, salopp gesagt, kalt erwischt. Ein Paradoxon: Obwohl es nach dem Holocaust keinen Grund mehr geben kann, an die unwiderrufliche Kraft zivilisatorischer Übereinkünfte, Regeln und Gewohnheiten zu glauben, ist ebendieser Glaube in Europa in den Nachkriegsjahrzehnten allmählich erwachsen und hat eine große Selbstverständlichkeit gewonnen. Jahrzehntelang machten die eisernen Regeln des Kalten Krieges Grenzverschiebungen in Europa unmöglich. Man hatte sich daran gewöhnt. Und als in der Folge von 1989 auf dem Balkan neu-alte ethnische Konflikte aufbrachen, galten sie als Ausnahme an der Peripherie Europas. Wir blieben im Grunde bei der trügerischen Überzeugung, die Zeit gewaltsamer Grenzveränderungen sei vorbei und dies stelle den Normalzustand im Verhältnis der Staaten zueinander dar. Und wir glaubten, es würde immer so bleiben. Zu diesem Glauben trug die erfolgreiche europäische Einigung ganz entscheidend bei. Denn sie lieferte ja den anschaulichen Beweis dafür, dass Staaten und Völker dazu in der Lage sein können, ihre gegenseitigen Beziehungen in ein festes, von allen geachtetes Regelwerk einzubinden und – bei allen Interessenkonflikten, die weiterhin kraftvoll ausgetragen wurden – die Macht der Kanonen durch die des Rechts zu ersetzen. Die europäische Einigung machte deutlich, dass Kants Idee vom ewigen Frieden mehr als der Spleen eines alternden Königsberger Träumers war. Unsere Vorfahren reisten zumeist als Soldaten durch Europa. Wenn sie Grenzen überschritten, verhieß das in der Regel nichts Gutes. Wenn wir heute – Grenzen nehmen wir dabei kaum mehr wahr – durch Europa reisen, können wir spüren, erleben und genießen, dass der alte Kontinent des ewigen Haders zum Kontinent des Friedens geworden ist.
Doch der Friede herrscht nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem jemand ihn bricht. Genau das hat Putin durch die Rückkehr zum scharfen Freund-Feind-Denken, durch die innere Verrohung seines Landes und zuletzt durch die Annexion der Krim und die Staatszersetzung im Donezbecken getan. Er hat drastisch vor Augen geführt, dass wir Europäer in einer Region der Welt leben, die mancher – mit billiger und törichter Verächtlichkeit – eine Komfortzone nennt. Der Komfort hat uns vermutlich dazu verleitet, mit dem Ernstfall und der Rückkehr brutaler Machtpolitik nicht mehr zu rechnen. Das ist zwar verständlich, war aber nach dem Verlauf, den das 20. Jahrhundert in seiner ersten Hälfte genommen hatte, ziemlich naiv. Offensichtlich hat das Erschrecken darüber zu Lähmung und Starre geführt. Es wäre ja denkbar gewesen, dass Europa in doppelter Weise offensiv auf die Putin’sche Rebrutalisierung der Politik reagiert hätte. Es hätte schnell zu einer gemeinsamen, unter allen EU-Mitgliedstaaten abgestimmten Haltung gegenüber Russland finden können. Und es hätte die Bedrohung der Unverletzlichkeit von Grenzen und damit auch des Friedens entschlossen dazu nützen können, den eigenen inneren Zusammenhalt noch einmal ausdrücklich zu bekräftigen und zu stärken. Die EU hätte also die kostbare Verfassung Europas gerade im Moment der Bedrohung ganz besonders hochhalten und festigen können.
Beides wurde versäumt. Als die Existenz der – trotz Majdan nahezu unreformierbaren – Ukraine akut bedroht war, schien es Europa nicht zu geben. Zwar reisten im kritischsten Moment, als das Regime des Präsidenten Janukowitsch unter dem Druck des Majdan dem Offenbarungseid entgegenschlitterte, drei europäische Außenminister – der polnische, der deutsche und der französische – im Februar 2014 nach Kiew und wirkten, insbesondere durch die leidenschaftliche Intervention des polnischen Außenministers Radosław Sikorski, positiv auf das Geschehen ein. Aber die Europäische Union als Einheit, als gebündelte Kraft war nicht präsent. Sie fand zu keiner gemeinsamen Stimme. Drei alte Nationalstaaten – Deutschland, Frankreich und ein wenig auch Polen – ergriffen Initiativen. In Brüssel, mit anderen Dingen beschäftigt, schwieg man lange und unternahm kaum ernsthafte Versuche, die in der Tat sehr divergierenden außenpolitischen Vorstellungen der EU abzuwägen und miteinander in Einklang zu bringen. Die damalige Außenbeauftragte der EU, Catherine Ashton, hielt sich eher zurück. Doch wann, wenn nicht damals, wäre der geeignete Moment gewesen, um endlich zu einer gemeinsamen Außenpolitik der EU zu finden, die in der Welt nicht als Sammelsurium strategischer Fetzen, sondern als Wurf zur Kenntnis genommen würde? Der Augenblick verstrich, wieder einmal war der EU das Hemd der internen Befindlichkeiten und Querelen näher als die Jacke außenpolitischer Klarheit. Und der deutsche Außenminister, der das ihm heilige Erbe der sozialdemokratischen Ostpolitik nicht beschädigt sehen will, sendet seither in einem so unverständlichen wie empörenden Alleingang allzu versöhnliche Signale nach Moskau.
Was eigentlich eine Stärke der EU und ihrer Institutionen ist, wurde diesmal zu ihrer Schwäche: dass sie nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen sind. Der Bestand der Europäischen Union, die an die Ukraine grenzt, war ja durch Putins Machtmanöver unmittelbar nicht bedroht. Deswegen begriff man in der EU nicht, welche indirekte, aber gleichwohl existenzielle Bedrohung von seiner Machtdemonstration ausgeht. Putin versucht den Völkern Europas zu demonstrieren, dass es auch ohne Vertrag, ohne Recht, ohne das Hüten von Regeln geht. Durchaus in der Nachfolge totalitärer Herrscher des 20. Jahrhunderts, das vielleicht doch länger war, als wir glaubten, versucht er zu zeigen, dass es Wichtigeres, Vitaleres, Echteres gibt als das Recht. Zu einer Rechtsgemeinschaft, so seine vielerorts in Europa auch mit begieriger Zustimmung vernommene Botschaft, finden sich die Schwachen, die sich nicht selbst helfen können, zusammen, die Dekadenten, die durch Friedensprämien Verzärtelten.
Moderne Gesellschaften sind komplex, unübersichtlich, scheinbar steuerungslos. Jeder, der hier lebt, ist für die Schaffung und die Gültigkeit seine Werte gewissermaßen selbst verantwortlich. Gerade weil das so schwierig ist, lebt in solchen Gesellschaften der Wunsch nach Einfachheit, Sicherheit, nach der Herr-Knecht-Idylle und nicht zuletzt nach dem starken Mann als untergründiger Strom mächtig fort. Putin versteht es, diese Saite zum Schwingen zu bringen. Er sendet in den Westen und wird dort empfangen. Das wäre ein guter Anlass für ein verstärktes Bemühen, den zivilisatorischen Wert zu bekräftigen, den die europäische Einigung auszeichnet. Schaut man aber auf die in immer schnellerer Folge stattfindenden EU-Gipfel, auf den Brüsseler, Straßburger und Luxemburger EU-Alltag und darauf, wie die nationalen Regierungen und Parteien auf die bedrohlichen Zeichen an der Wand reagieren, so wird man schnell der Illusion beraubt, Europa verstehe es, sich selbst und seine Leistungen der vergangenen Jahrzehnte wertzuschätzen. Zwar wäre eine geistige oder gar politische Neubegründung der EU, die mancher fordert, auch angesichts des jähen Einbruchs von Macht- und Geopolitik in den europäischen Garten nicht nötig gewesen. Denn schon so, wie sie ist, ist die EU, die ramponierte, wertvoll. Eines Bemühens um Selbstvergewisserung wäre der historische Moment aber wert gewesen. Es gilt auch hier: Was du besitzt, kannst du nur bewahren, wenn du es immer wieder neu erwirbst.
Noch Fremde im neuen Club: Mittel- und Osteuropa
Nicht zuletzt diese Nachlässigkeit hat zu einem dritten Problem beigetragen, das die europäische Einigung beträchtlich ins Holpern bringt. Zum Nord-Süd-Graben, der eine Folge der unachtsamen Euroeinführung ist, kommt eine weitere Kluft hinzu, die sich seit einiger Zeit zwischen den »alten« EU-Staaten und denen Ost- und Mitteleuropas auftut. Diese Kluft ist neu, hat aber eine lange Vorgeschichte. Dass sie sich ausgerechnet jetzt wieder auftut, ist ganz besonders schmerzhaft und widersinnig. Denn nichts wollten die Völker, die nach 1989 endlich dem sowjetischen Zwangsverband entkommen konnten, sehnlicher als den Anschluss an den europäischen Westen. Go west