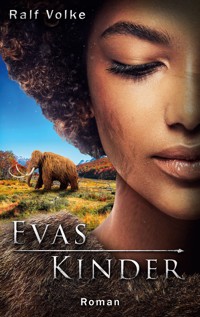
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Books on DemandHörbuch-Herausgeber: Storyble
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Naher Osten vor 55.000 Jahren: Eine Sippe moderner Menschen kämpft an den Ufern des großen Jordansees ums Überleben. Der Tierbestand nimmt immer weiter ab, und die Winter sind hart. Zudem machen die Jäger eine besorgniserregende Entdeckung: Sie sind nicht allein in diesem Jagdgebiet. Und diese Fremden sind anders - ganz anders! Allein ihre seltsam helle Haut und der massive Körperbau wirken verstörend. Sind sie eine Bedrohung für die eigene Sippe? Oder kann man sich mit ihnen verständigen? In der Geschichte der Menschheit gibt es mehrere Ereignisse, die einen entscheidenden Wendepunkt darstellen. Die erste Begegnung von Homo sapiens und Neandertaler während der mittleren Altsteinzeit ist ein solches Ereignis. Ohne diese Begegnung wäre unsere Spezies heute eine andere.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Eigentlich fühlt sich die 17-jährige Katja durch und durch als Deutsche – was mehrere Mitschüler wegen ihrer relativ dunklen Hautfarbe anders sehen. Der Rassismus, den sie an ihrer Leipziger Schule immer wieder erlebt, nagt an ihr. Als sie in den Sommerferien in Israel ein Messer aus der Steinzeit entdeckt, will sie mehr über die Menschen herausfinden, die dieses uralte Werkzeug einst anfertigten. Bei ihren Recherchen taucht sie tief in eine Zeit ein, in der unsere Vorfahren erstmals auf eine andere Menschenart trafen: die Neandertaler. Dabei entdeckt sie, dass diese Begegnung vor 55.000 Jahren Folgen hatte – Folgen, die bis heute sichtbar sind und die auch für Katjas Leben eine große Bedeutung haben.
In seinem Roman über die Vermischung des Homo sapiens mit dem Neandertaler wirft Ralf Volke einen Blick weit zurück in die Vergangenheit der Menschheitsgeschichte – zu einem Zeitpunkt, an dem entscheidende Weichen für Jahrtausende gestellt wurden. Wir werden Zeuge vom Überlebenskampf verschiedener Sippen, von Abgrenzung und Feindschaft – und davon, dass es wichtigere Dinge gibt als die Farbe der Haut oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe.
Inhaltsverzeichnis
Historische Anmerkung
Prolog
Kapitel 1: Spurlos verschwunden
Kapitel 2: Aufbruch ins Unbekannte
Kapitel 3: Ein Schock fürs Leben
Kapitel 4: Die andere Seite
Kapitel 5: Höhlen und Bären
Kapitel 6: Vergebliches Warten
Kapitel 7: Jagd mit Überraschungen
Kapitel 8: Dicke Nasen und lange Beine
Kapitel 9: Neue Jagdgefährten
Kapitel 10: Kleines Ding, großer Fortschritt
Kapitel 11: Tades Plan
Kapitel 12: Berichte aus dem Norden
Kapitel 13: Pferdefleisch und Menschenleben
Kapitel 14: Ein zweites Leben
Kapitel 15: Eine Narbe und ihr Geschichte
Kapitel 16: Angekommen
Kapitel 17: Fasminas Verlust
Kapitel 18: Nachwuchs
Kapitel 19: Weit nach Westen
Kapitel 20: Fremde Feuer
Kapitel 21: Eine beunruhigende Entdeckung
Kapitel 22: Hunger
Kapitel 23: Ein einsamer Unbekannter
Kapitel 24: Die andere Höhle
Kapitel 25: Besuch mit Folgen
Kapitel 26: Jagderfolge
Kapitel 27: Gazellen und Flussseiten
Kapitel 28: Felsen und Eier
Kapitel 29: Feindschaft
Kapitel 30: Bedrohliche Nachbarn
Kapitel 31: Ungebetene Besucher
Kapitel 32: Das Schweigen der Väter
Kapitel 33: Der Preis des Friedens
Kapitel 34: Fremde Verwandte
Kapitel 35: Die Jägerin
Kapitel 36: Geschichten am Feuer
Kapitel 37: Wetterwechsel
Kapitel 38: Wasser
Kapitel 39: Flüchtlinge und Widerstände
Kapitel 40: Generation Mischling
Kapitel 41: Die Wanderung der alten Männer
Epilog
Anhang: Die Neandertaler und wir
Der Autor
Historische Anmerkung
Als der Homo sapiens vor vielen Jahrtausenden seinen Heimatkontinent Afrika verließ, stieß er im Nahen Osten auf Neandertaler. Offensichtlich sind diese Begegnungen zumindest teilweise recht freundlich verlaufen. Jedenfalls haben sich beide Menschenarten so gut verstanden, dass sie gemeinsame Nachkommen zeugten: unsere Vorfahren. Alle Menschen, die heute einem nicht schwarzafrikanischen Volk angehören, tragen die Spuren dieser Vermischung in sich – in Form von Neandertaler-Genen. Viel spricht dafür, dass diese Begegnungen im heutigen Israel stattfanden, wo damals ein riesiger See das gesamte Jordantal einnahm.
Prolog
Rechts lag Zypern, links schlief ihr Vater. Katja betrachtete die Küstenlinien der großen Mittelmeerinsel, die aus 10.000 Metern Höhe aussahen wie auf einer Karte von Google-Maps. Dann warf sie wieder einen Blick auf ihren Vater, der umgehend eingeschlafen war, als die Lufthansa-Maschine Reiseflughöhe erreicht hatte. Viereinhalb Stunden würde der Flug von Tel Aviv nach Frankfurt dauern. Ihn zu verschlafen war nicht das Schlechteste. Aber Katja konnte im Flugzeug nicht gut schlafen.
Sie schnallte sich ab und holte ihren Rucksack aus dem Gepäckfach über dem Sitz. Sie wühlte kurz darin und zog schließlich den Stein heraus, den sie am Ausgrabungsort gefunden hatte. Erst jetzt fiel ihr ein, dass sie den vielleicht gar nicht mit ins Handgepäck hätte nehmen dürfen. Jemand hätte auf die Idee kommen können, ihn als Waffe zu bewerten. Katja musste lächeln, als sie den länglichen Stein betrachtete. Eine Waffe? Naja, er sah schon irgendwie aus wie ein Messer. Allerdings konnte sie sich nicht so recht vorstellen, dass dieser seltsam geformte Stein irgendjemanden ernsthaft gefährden könnte.
Als das Flugzeug die türkische Küste überflog, gab es ein paar Turbulenzen, und ihr Vater wurde wach. Etwas benommen sah er Katja an und betrachtete den Gegenstand in ihren Händen.
„Was hast du da?“, fragte er.
„Einfach nur einen Stein“, entgegnete sie. „Ich habe ihn in der Nähe eures Ausgrabungsortes gefunden.“
„Einfach nur ein Stein?“, murmelte der Archäologe und nahm ihr den Gegenstand aus der Hand.
Plötzlich war er hellwach und betastete Katjas Fundstück von allen Seiten. Vorsichtig ließ er seine Finger über die Kanten gleiten.
„Das ist nicht einfach nur ein Stein“, sagte er.
„Sondern?“
„Das ist ein Messer.“
„Sagen wir, es sieht aus wie ein Messer. Aber es ist wohl doch eher eine Laune der Natur.“
„Von wegen! Das ist Flint. Das hat jemand gemacht.“
„Flint?“
„Ja, Flint. Auch Feuerstein genannt.“
„Du meinst, damit hat mal jemand in grauer Vorzeit ein Feuer entzündet?“, fragte Katja und bekam große Augen.
„Nein, damit sicher nicht. Das ist ein Messer. Das war für den Besitzer viel zu wertvoll, um es gegen Katzengold oder einen anderen eisenhaltigen Stein zu schlagen und damit Funken zu erzeugen. Damit hätte er sein Messer zerstört. Mit Feuerstein haben die Menschen der Steinzeit nicht nur Feuer gemacht, sondern auch Werkzeuge und Waffen hergestellt.“
„Wie dieses Messer?“
„Wie dieses Messer.“
„Das würde zumindest die Fundstätte erklären“, überlegte Katja laut.
„Wo hast du es denn gefunden?“
„Zwischen ein paar versteinerten Knochen.“
„Wie groß waren die?“
Katja zog ihr Smartphone aus dem Rucksack und zeigte ihrem Vater die Fotos, die sie von dem Fund gemacht hatte, bevor sie das Steinmesser an sich genommen hatte.
„Denkst du, es waren Menschenknochen?“, fragte sie.
„Nein, das sieht mir eher aus wie die Rippen eines mittelgroßen Tieres. Vielleicht eine Ziege oder ein Wolf oder etwas in der Größe.“
„Ein Glück, ich dachte jetzt schon, ich wäre einem prähistorischen Mordfall auf die Spur gekommen.“
„Eher einer missglückten Jagd, bei der der Jäger sein Messer eingebüßt hat, würde ich sagen. Das ist ein fantastischer Fund! Warum hast du mir davon nichts erzählt?“
„Ich wollte. Aber da hattet ihr gerade diese Sandalenschnalle eines römischen Legionärs entdeckt. Da warst du ganz aus dem Häuschen und nicht ansprechbar. Später habe ich dann einfach nicht mehr daran gedacht.“
„Sei froh, dass das am Flughafen niemand entdeckt hat. Das hätte Ärger geben können.“
„Weil man es für eine Waffe hätte halten können?“
„Deshalb vielleicht auch. Aber vor allem, weil das ein archäologischer Fund ist. Den darfst du ohne Erlaubnis nicht einfach so mitnehmen.“
„Dann war es ja vielleicht ganz gut, dass ich das Ding in meinem Rucksack wieder vergessen hatte.“
„Ja, vielleicht“, bestätigte er und betastete das Steinzeitmesser mit wachsendem Interesse und größer werdenden Augen. „Es ist noch immer ganz scharf. Und das nach all der Zeit. Erstaunlich!“
„Kein schlechter Brieföffner, was?“, entgegnete sie lachend.
„Brieföffner? Bist du wahnsinnig? Das bekommt einen Ehrenplatz im Institut, wo wir …“
„Vergiss es!“, unterbrach Katja ihren Vater und nahm ihm das Messer wieder ab. „Das habe ich gefunden. Und das behalte ich!“
Sein Blick schwankte zwischen Enttäuschung und Tadel. Eigentlich ging es nicht, dass seine Tochter einen solchen historischen Fund einfach so im Bücherregal ihres Jugendzimmers verschwinden lassen wollte. Andererseits hatte sie recht: Es war ihr Fund. Auch wenn es seiner Archäologenseele wehtat, dies einzugestehen.
Katja hatte ihn in diesen Sommerferien zum ersten Mal zu einer Ausgrabung nach Israel begleitet – und dann gleich ein solches Artefakt entdeckt. Allerdings fehlte ihr noch die richtige Einstellung zu derlei Funden. Aber immerhin schien das Interesse der 17‑ Jährigen für die Archäologie geweckt zu sein. Ob sie vielleicht einmal in seine Fußstapfen treten würde? Eine schöne Vorstellung.
„Wem das wohl mal gehört hat?“, fragte sie eher sich selbst als ihren Vater.
„Auf jeden Fall ist es alt – sehr alt! Möglicherweise hat das nicht einmal ein moderner Mensch gemacht, sondern ein Neandertaler.“
„Ein Neandertaler? Die haben in Israel gelebt?“
„Ja, haben sie. Und vermutlich über mehrere Tausend Jahre hinweg gemeinsam mit unseren Vorfahren, den Homo sapiens.“
„Glaubst du, die sind sich begegnet?“
„Mit Sicherheit sind sie das.“
Katja sah ihren Vater mit großen Augen an. Darüber wollte sie mehr erfahren.
Leipzig (Deutschland), eine Woche später
Der erste Schultag begann mit den üblichen Rüpeleien.
„Na Katja, was hast du in den Ferien gemacht? Heimaturlaub in Afrika?“, rief Samuel ihr über den halben Pausenhof entgegen.
Seine beiden Freunde, die er stets im Schlepptau hatte, lachten. Katja konnte die drei nicht ausstehen. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit versuchte das Trio, sie wegen ihrer eher dunklen Hautfarbe zu mobben – während sie sich bemühte, das bestmöglich zu ignorieren. Manchmal gelang ihr das, meist aber nicht.
„Nein, ich war in Israel“, entgegnete sie, während sie den dreien ausweichen wollte – was aber misslang. „Und zu Hause bin ich in Leipzig.“
„So siehst du aber nicht aus“, entgegnete Samuel.
Sprachs und begann mit seltsam hüpfenden Bewegungen, kratzte sich mit beiden Händen an den Seiten und gab Laute von sich, die entfernt an Testobjekte im Primatenzentrum erinnerten.
„Ah, und du hast ein Praktikum im Zoo gemacht, wie ich sehe“, sagte sie und versuchte möglichst gelassen zu bleiben – obgleich sie innerlich bebte. „Erstaunlich, dass sie dich wieder rausgelassen haben. Da bestand doch akute Verwechslungsgefahr.“
„Sag das noch mal!“, fauchte er, griff ihr unter das Kinn und drückte sie mit einer plötzlichen Bewegung an die Wand des Schulgebäudes.
Dabei sah er sie sehr ernst an. Katja hielt dem Blick stand – auch wenn sie es mit der Angst zu tun bekam. Was für ein Idiot er doch war. Samuel und seine Clique hielten sich für die Hüter der abendländischen Kultur an dieser Schule – was auch immer sie darunter verstehen mochten. Alles, was ihnen auch nur im Entferntesten fremdländisch erschien, war verdächtig. Dazu zählten alle Zuwandererkinder, Juden und Menschen, deren Hautfarbe nicht zum nordischen Ideal passte, das sich in ihren verschwurbelten Hirnen festgesetzt hatte. Ob Samuel eigentlich je darüber nachgedacht hatte, dass er selbst einen jüdischen Vornamen trug? Vermutlich nicht. Trotz seiner grotesken Ausländerfeindlichkeit hatte er ja auch kein Problem damit, sich regelmäßig beim Dönerimbiss mit seiner türkischen Lieblingsverpflegung einzudecken.
„Lass mich gefälligst los!“, fauchte sie und trat ihm gegen das Schienbein – was durchaus die erhoffte Wirkung zeigte.
Tatsächlich lockerte sich umgehend sein Griff und sie konnte sich ihm entwinden. Offenbar hatte er nicht mit ihrer Gegenwehr gerechnet. Doch zu seiner Verblüffung über ihren schmerzhaften Tritt kam nun auch Wut:
„Niemand nennt mich einen Affen! Schon gar nicht so ein dunkelhäutiger Mischling wie du!“, brüllte Samuel und versetzte ihr einen Faustschlag ins Gesicht.
Benommen ging sie zu Boden. Einer der drei wollte nach ihr treten, aber sie konnte im letzten Moment ausweichen. Zur Überraschung der drei war sie umgehend wieder auf den Beinen. Statt zu flüchten, sah sie ihre Mitschüler mit zornigem Blick an. Als Samuel sie erneut attackieren wollte, ging sein Schlag in das Steinmesser aus Israel, das sie plötzlich in der Hand hielt. Sie stach damit gar nicht zu, sie hielt es einfach nur vor sich. Aber da Samuel das zu spät bemerkte, schlug er hinein und fügte sich selbst eine Wunde am Unterarm zu. Keine sehr tiefe, aber sie blutete ernsthaft.
Ihr Vater hatte recht, schoss es Katja durch den Kopf. Trotz seines Alters war dieses Steinzeitmesser noch immer erstaunlich scharf. Wer auch immer es in grauer Vorzeit gemacht hatte: Katja war ihm dankbar dafür. Eigentlich hatte sie es mit in die Schule genommen, um es ihrem Geschichtslehrer zu zeigen. Der hatte ein Faible für alles Prähistorische. Plötzlich stellte sie fest, dass ihr Fund auch einen ganz praktischen Nutzen haben konnte.
Samuels erstaunter Blick schwankte zwischen Katjas Augen, dem seltsamen Messer in ihrer Hand und seiner blutenden Wunde. Würde sie ihre Waffe erneut benutzen müssen, oder hatten die drei genug? Sie war darauf gefasst, dass die Sache noch nicht ausgestanden war.
„Samuel! Tom! Mattis!“, hörte Katja im nächsten Augenblick die vertraute Stimme ihres Geschichtslehrers, der auf sie zukam.
„Was denn?“, fragte Samuel und versuchte, möglichst unschuldig zu wirken.
Dabei legte er eine Hand auf seine frische Wunde, um sie zu verbergen. Dominic Lunghard sah sie natürlich trotzdem, stellte aber keine Frage dazu. Hatte er mitbekommen, was soeben passiert war? Katja hatte das Messer umgehend wieder in ihrer Tasche verschwinden lassen. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, es dem Lehrer zu zeigen – zumindest nicht jetzt. Ihrem Vater hatte sie es nicht überlassen wollen, nun verspürte sie auch nicht die geringste Lust, dass ein Lehrer es ihr als verbotene Waffe abnahm. Aber offenbar war diese Sorge unbegründet. Jedenfalls sagte er nichts dazu, obgleich er einen solchen Vorfall eigentlich bei der Schulleitung hätte melden müssen.
„Alles in Ordnung?“, fragte der Lehrer, nachdem sich das Trio getrollt hatte.
Eigentlich ist das eine vollkommen blödsinnige Frage, schoss es ihr durch den Kopf. Die Menschen neigten dazu, genau dann diese Frage zu stellen, wenn sie sahen, dass gar nichts in Ordnung war. Aber Katja war ihrem Lehrer dankbar für sein Eingreifen. Erst jetzt spürte sie, dass sie am ganzen Körper zitterte – was sie sich aber nicht anmerken lassen wollte.
„Ich bin klargekommen“, entgegnete sie.
„Ja, den Eindruck hatte ich“, bestätigte er und sah auf ein paar Tropfen Blut am Boden. „Machen Sie sich nichts draus. Die drei sind einfach Idioten.“
„Sie haben gut reden“, entgegnete Katja. „Sie haben ja auch weiße Haut und laufen nicht wie ich mit dem Stempel ‚Zuwanderer‘ auf der Stirn herum.“
„Quatsch, Sie haben gar nichts auf der Stirn. Und soweit ich weiß, sind Sie auch nicht zugewandert, sondern in Leipzig geboren.“
„Mein Großvater stammt aus Mosambik – und das sieht man mir an. Oder etwa nicht?“
„Ja und? Ihre Haut ist eben etwas dunkler als die ihrer Mitschüler. Aber Sie sehen doch nicht aus wie eine Afrikanerin.“
„Ach, das wäre dann noch schlimmer, oder was?“, fuhr sie ihn an.
„So habe ich das nicht gemeint.“
„Ich weiß, bitte entschuldigen Sie“, entgegnete Katja nun wieder in einem halbwegs normalen Tonfall.
„Mit dem Thema begibt man sich immer auf vermintes Gelände“, murmelte der Lehrer.
Da hatte er wohl recht. Katja wusste selbst, dass sie oft heftig reagierte, wenn es um Hautfarben und ethnische Herkunft ging. Tatsächlich war sie froh, dass sie nicht derart dunkle Haut hatte wie ihr Großvater. Und für genau diesen Gedanken schämte sie sich. Vor allem, wenn sie sich wieder einmal bei dem Wunsch ertappte, ebenso helle Haut zu haben, wie die meisten ihrer Mitschüler. Sie war in Deutschland geboren und aufgewachsen. Das Gleiche galt für ihre Eltern und auch ihre Großmutter. Katja fühlte sich durch und durch als Deutsche und als Europäerin. Sie hatte nur immer wieder das Gefühl, die falsche Hautfarbe zu haben – auch wenn ihr Verstand genau wusste, dass das eine blödsinnige Sichtweise war. Aber was sollte man gegen seine Gefühle machen? Vor allem, wenn solche Idioten wie Samuel und Co immer wieder genüsslich in diese Kerbe schlugen und sie als Afrikanerin bezeichneten. Warum war ihr Großvater nicht ihr Urgroßvater oder Ururgroßvater? Mit ein, zwei Generationen mehr Abstand würde man ihr die afrikanischen Vorfahren vermutlich nicht mehr ansehen.
„Sagen Sie mal, Herr Lunghard“, setzte Katja nun wieder mit einer halbwegs ruhigen und sachlichen Stimme an. „In Ihrem Geschichtskurs für unsere Stufe geht es in diesem Halbjahr doch um Ur- und Frühgeschichte, habe ich das richtig verstanden?“
„Ja, um die Wanderungsbewegungen des Homo sapiens. Also um die Zeit nachdem er Afrika verlassen hatte.“
„Super“, sagte sie. „Ich war in den Ferien in Israel und habe eine spannende Entdeckung gemacht, die zu dem Thema passt. Ich würde gern ein Referat halten.“
„Nur zu“, entgegnete der Lehrer lächelnd. „Ich weiß ja nicht, was Sie uns erzählen wollen, aber ich bin gespannt darauf.“
Zwei Wochen später saß Katja am Lehrerpult vor ihren Mitschülern des Geschichtskurses. Sie ordnete ihre Unterlagen und legte das Steinmesser vor sich, das sie in Israel gefunden hatte. Sie hatte das Gefühl, dass diese Trophäe einfach dazugehörte, wenn es um das Thema ging. Sie bemerkte, dass Tom das Artefakt lange und nachdenklich anstarrte. Seit dem Vorfall auf dem Schulhof hatten er, Samuel und Mattis sie erfreulicherweise in Ruhe gelassen. Immerhin etwas.
Wie würde Tom wohl auf ihr Referat reagieren? Vermutlich würde ihm nicht gefallen, was sie zu erzählen hatte – es passte mit Sicherheit nicht ins rassistische Weltbild seiner Clique. Aber darauf konnte sie natürlich keine Rücksicht nehmen. Im Gegenteil, dachte sie innerlich schmunzelnd und begann ihren Vortrag:
„Als der Homo sapiens seinen Heimatkontinent Afrika verließ, kam er nach einer langen Wanderung über die Arabische Halbinsel vor vermutlich rund 55.000 Jahren ins Gebiet des heutigen Israel“, begann sie ihren Vortrag. „Zur gleichen Zeit wurde der Neandertaler mit der fortschreitenden Eiszeit von seinem ursprünglichen Siedlungsgebiet Europa aus immer weiter nach Süden verdrängt. In der Folge wanderte er ebenfalls in den Nahen Osten ein.“
„Und was bedeutet das für unser Thema?“, unterbrach sie einer der Mitschüler.
„Das bedeutet“, entgegnete Katja, machte eine kurze Pause und betrachtete das Steinmesser, das vor ihr lag. „Das bedeutet, dass dort vermutlich eins der wichtigsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte stattgefunden hat.“
Kapitel 1: Spurlos verschwunden
Jordantal (Naher Osten), einige Tausend Generationen zuvor
Als Tade an diesem Morgen erwachte, bemerkte er ein Geräusch, das er gut kannte – und nicht im Geringsten mochte. Es kam von seinem Magen. Er knurrte. Vielleicht lag es daran, dass er von frisch geröstetem Gazellenfleisch geträumt hatte. Der Duft lag förmlich in seiner Nase. Sivacisa hatte das Fleisch lange über dem Feuer gedreht, es sorgfältig mit Kräutern gewürzt und ihm schließlich mit einem liebevollen Lächeln angeboten. Tade liebte Gazelle. Doch als er hineinbeißen wollte, löste sich die knusprige Keule ebenso auf wie die junge Frau, die das Fleisch für ihn geröstet hatte. Schade.
Ganz allmählich kehrte er aus dem Traum in die Wachwelt zurück. Vielleicht hatte sein ganz reales Magenknurren auch einen viel schlichteren Grund als seinen wundervollen Traum: Er hatte seit drei Tagen nichts mehr gegessen.
Tades Augen blinzelten gegen die Sonne, die bereits aufgegangen war. Als nächstes fiel sein Blick auf das beinahe erloschene Feuer. Daneben saß sein Bruder und war eingeschlafen. Das war nicht gut. Einer von ihnen musste immer wach bleiben und das Feuer hüten. Alles andere war zu gefährlich, wenn man unterwegs war. Doch bevor Tade seinen kleinen Bruder tadeln konnte, wurde er von etwas anderem abgelenkt. Plötzlich war er hellwach.
Mit einem Satz sprang er auf, griff gleichzeitig seinen Speer und schleuderte ihn in Richtung des Schilfgeflechts am Rand des Baches. Mit schnellen Schritten sprang er seinem Wurfgeschoss nach, hob es auf und hielt triumphierend die aufgespießte Ente in die Luft.
„Frühstück“, sagte er, grinste seinen verblüfften Bruder an und fügte mit ernstem Unterton hinzu: „Jedenfalls wenn du das Feuer wieder zum Brennen bringst.“
Mehr musste er gar nicht sagen. Allein sein Blick in die armseligen Feuerreste und der deutliche Ton in seiner Stimme reichten völlig aus, dass Cukewo die Botschaft verstand. Er sah betreten auf das schwache Glimmen und fühlte sich schuldig. Das Feuer war nicht ganz erloschen, aber es war viel zu weit heruntergebrannt, als dass es wilde Tiere hätte auf Distanz halten können. Glücklicherweise hatte kein Bär oder Wolf versucht, diese Unachtsamkeit zu nutzen. Die unvorsichtige Ente am Bachrand war das einzige Tier, das sie in den vergangenen Tagen entdeckt hatten. Aber man konnte ja nie wissen.
Die beiden jungen Männer redeten nicht viel, als sie etwas später das geröstete Fleisch der mageren Ente aßen. Sie machten nie viele Worte – schon gar nicht, wenn sie auf Jagd waren. Menschenstimmen verscheuchten das Wild, wie jeder Jäger wusste. Allerdings musste zum Verscheuchen auch etwas da sein. Das war heute nicht der Fall. Gestern auch nicht. Und vorgestern ebenfalls nicht. Ihr Streifzug in dieses Gebiet fernab des großen Sees war ein völliger Fehlschlag. Die soeben erlegte und kurz darauf verspeiste Ente zählte nicht wirklich. Sie bescherte ihnen beiden an diesem Morgen zwar eine Mahlzeit, aber ansonsten würden sie mit leeren Händen zur Höhle zurückkehren – sofern sie auf dem Rückweg nicht doch noch ein größeres Tier entdeckten.
Tade wusste nicht, was schlimmer sein würde: der Misserfolg oder der rechthaberische Kommentar seines Vaters, der natürlich zu erwarten war. Sem würde ganz sicher anmerken, dass er es gleich gesagt hatte. Das Schlimme daran war: Er hatte es tatsächlich gleich gesagt und recht behalten. In dieser Gegend war einfach nicht viel zu holen – warum auch immer. Doch Tade und sein Bruder hatten dennoch ihr Glück hier probieren wollen – vielleicht auch aus Trotz gegenüber ihrem Vater. Dass die Alten immer alles besser wissen wollten, war schwer zu ertragen. Noch schwerer war es, wenn sie es tatsächlich besser wussten.
Auf dem Rückweg zur Höhle stießen sie zu ihrer Überraschung auf die Fährte von Schweinen. Das Glück schien es doch noch gut mit ihnen zu meinen. Tade spürte sein Herz. Es pochte beinahe ebenso heftig wie an jenem Tag, an dem er erstmals an der Jagd hatte teilnehmen dürfen – womit er in den Augen der Sippe vom Kind zum Mann geworden war. Vier Winter lag das nun zurück, und er hatte seither bewiesen, wie gut er mit dem Speer umgehen konnte. Sein kleiner Bruder brauchte da noch etwas Übung. Aber es wurde allmählich. Cukewo durfte nur nicht immer einschlafen, wenn er während der Jagd das Feuer zu hüten hatte.
Die Spur der Schweine war frisch. Wenn es ihnen doch noch gelingen sollte, ein großes Tier zu erlegen, dann wäre die weite Wanderung nicht sinnlos gewesen – und er könnte seinem Vater beweisen, dass er nicht immer recht behielt.
Tatsächlich entdeckten sie ein einzelnes Schwein, einen ausgewachsenen Eber – allerdings in einiger Entfernung. Doch den beiden Brüdern gelang es, sich still anzuschleichen. Kurz bevor sie in Wurfweite waren, trennten sie sich, um die Beute von zwei Seiten angreifen zu können. Tade war fast nahe genug. Er hob bereits den Arm, um seinen Speer zu schleudern.
In diesem Moment hörte er das Knacken. Sein Bruder war auf einen trockenen Ast getreten. Das Schwein schreckte auf, nahm offensichtlich die Jäger wahr und stürmte mit lautem Grunzen davon. Beide Männer schleuderten ihre Speere – und beide verfehlten das Ziel. Das Tier war doch noch etwas zu weit entfernt gewesen. Jetzt mussten sie das fliehende Wild hetzen. So etwas war anstrengend, aber das große Schwein war die Mühe wert.
Sie stürmten zu ihren Speeren, auf dem Weg dorthin stolperte Cukewo über seine eigenen Füße. Er kam zwar sofort wieder auf die Beine, brach aber umgehend erneut zusammen. Er hatte sich bei seinem Sturz offensichtlich verletzt, stellte Tade entsetzt fest, während sein Blick zwischen dem davontrabenden Schwein, den ins Leere gegangenen Speeren und seinem am Boden kauernden Bruder pendelte. Cukewo hielt mit schmerzverzerrtem Gesicht sein Schienbein und sah seinen Bruder unglücklich an.
Soviel zum Thema Hetzjagd, dachte Tade missmutig, ging zu Cukewo und untersuchte dessen Bein. Sein kleiner Bruder war einfach ein großer Unglücksrabe. Sie würden also doch mit leeren Händen zur Sippe zurückkehren. Anfangs musste Tade den humpelnden Cukewo sogar stützen. Heute war einfach kein guter Tag.
Er sollte noch schlechter werden.
Kurz bevor sie die Höhle erreichten, wurde der Himmel im Westen rot. Nicht mehr lange, und die Sonne würde vollends verschwunden sein. Das war die Zeit, in der vor der Höhle meist mehrere Feuer brannten, und die Familien sich zum Essen um diese Feuerstellen scharten – wenn denn etwas zu essen da war. Hoffentlich hatten die anderen Jägergruppen mehr Glück gehabt.
Doch außer dem einen Feuer, das immer brennen musste, waren noch keine weiteren entzündet worden. Erstaunt stellte Tade fest, dass stattdessen hektische Betriebsamkeit herrschte. Es schien, als würden sich die Jäger zum Aufbruch bereitmachen – was so kurz vor Sonnenuntergang aber höchst ungewöhnlich wäre. Nachts jagte man nicht. Nachts jagten Bären, und denen kam man besser nicht in die Quere.
„Was ist los?“, fragte Tade, als sie die Höhle erreicht hatten.
„Eva!“, entgegnete Sivacisa nur knapp und war mit diesem einen Wort fast schon an ihm vorübergeeilt.
„Was ist mit ihr?“, wollte Tade wissen und hielt die junge Frau am Arm fest.
„Sie ist verschwunden.“
„Verschwunden? Wie verschwunden?“
„Ich weiß auch nicht. Wir haben Früchte gesammelt“, sagte Sivacisa. „Eva, Alika, zwei der Kinder und ich. Und plötzlich war Eva nicht mehr da. Sie war allein zum Fluss gegangen und dann war sie weg.“
In diesem Moment kam Sem zu ihnen.
„Na, keinen Erfolg gehabt?“, fragte sein Vater. Natürlich hatten sie keinen Erfolg gehabt, dachte Tade verärgert. Das sah er doch. Oder glaubte er etwa, er habe ein erlegtes Schwein unter seiner Felljacke versteckt? Tade hatte die rechthaberische Bemerkung zwar erwartet, aber jetzt gab es doch wohl Wichtigeres: Seine kleine Schwester war verschwunden – und sein Vater wollte über die Sinnhaftigkeit längerer Jagdwanderungen abseits des Sees sprechen. Manchmal hatte Tade den Eindruck, Sem war seine einzige Tochter völlig gleichgültig. Vielleicht war das ja auch tatsächlich der Fall.
Tade ging nicht weiter darauf ein, sondern brach mit den anderen Jägern auf, um sich an der Suche nach Eva zu beteiligen. Auch Cukewo wollte sich anschließen, aber mit seinem verletzten Bein hätte er alle nur aufgehalten.
Der Weg führte die Jäger zu dem kleinen Fluss, an dem die Frauen Eva das letzte Mal gesehen hatten. Natürlich war es denkbar, dass sie an einer tiefen Stelle ins Wasser gefallen und ertrunken war. Aber wahrscheinlich war es nicht. Tades kleine Schwester konnte gut schwimmen.
Wie erwartet, fanden sie hier keine Spur von ihr. Sie entdeckten am Ufer auch keine Stelle, die darauf hindeutete, dass hier jemand abgerutscht und ins Wasser gefallen war. Als die Fackeln, die ihnen nach Sonnenuntergang noch eine Weile spärliches Licht spendeten, erloschen waren, kehrten sie um. Es war sinnlos, in der Dunkelheit zu suchen. Sinnlos und gefährlich. In der Nacht konnte man leicht auf Bären oder Wölfe stoßen. Wenn man dann kein Feuer hatte, konnte ein Jäger leicht selbst zur Beute werden. Aber das galt natürlich umso mehr für eine junge, noch nicht ganz erwachsene Frau, die allein und bei Dunkelheit in der Wildnis unterwegs war.
Tade und sein Vater suchten deshalb auch nach Erlöschen der Fackeln weiter. Oder genauer gesagt: Sie verbrachten die Nacht damit, durch den Wald zu stolpern und immer wieder laut Evas Namen zu rufen. Erst als es schon wieder hell zu werden begann, machten auch sie sich auf den Rückweg – und waren dankbar, dass ihnen nun andere Jäger entgegenkamen, die die Suche bei Tageslicht fortsetzen würden.
Erfolg hatten auch sie nicht.
Obgleich die Jäger lange nach der Vermissten suchten, blieb Eva verschwunden. Sie entdeckten lediglich heruntergetretenes Gras und Gestrüpp, aber das hatten vermutlich die Frauen bei der Beerensuche verursacht. Wenn Eva wirklich wilden Tieren zum Opfer gefallen war, dann musste man irgendwo Blut finden oder Überreste ihrer Leiche. Aber da war nichts. Rein gar nichts. Auch in zwei Schluchten, die es in dieser Gegend gab, oder am Rand der Klippen, die sich an einer Stelle am Seeufer erhoben, fanden sie keine Spur. Hier war sie nicht abgestürzt. Wo um alles in der Welt war sie?
Nach einigen Tagen kehrten die Männer zur Jagd zurück und gaben Eva auf. Auch wenn es bitter war: Das Leben musste auch ohne sie weitergehen. Und die permanente Suche nach Nahrung war nun einmal der wichtigste Teil davon. Lediglich Tade und Cukewo setzten die Suche fort. Dabei wanderten sie weit nach Norden. Sie blieben mehrere Tage fort, entdecken aber nichts von ihrer Schwester. Am Ufer eines kleinen Baches stießen sie auf einen eingetrockneten Fußabdruck, der aber unmöglich von einer jungen Frau stammen konnte. Dafür war er zu groß.
Viel zu groß, wie Tade verblüfft feststellte, als er seinen eigenen Fuß in den Abdruck stellte und sah, dass auch sein Fuß zu klein war, als dass er einen solchen Abdruck hätte hinterlassen können.
„Wer in unserer Sippe hat denn derart große Füße?“, fragte Cukewo und betrachtete den Fuß seines Bruders in dem großen Abdruck.
„Niemand“, sagte Tade. „Keiner von uns hat solche Füße. Dieser Abdruck hier muss von einem sehr großen Menschen stammen. Viel größer als irgendjemand von uns.“
Bei dieser Erkenntnis griff er instinktiv zu seinem Messer, während sein Blick unruhig die Umgebung absuchte. Tade und Cukewo hatten noch nie fremde Menschen gesehen. Sie wussten, dass es andere Sippen gab, denn die Alten erzählten von solchen Begegnungen, die nicht immer freundlich verlaufen waren. Offenbar waren sie jetzt auf die Spuren einer solchen Sippe gestoßen. Und dieser Fußabdruck ließ darauf schließen, dass jene unbekannten Fremden beängstigend groß waren. Zumindest einer von ihnen. Die Erkenntnis ließ ihn erschaudern.
Nach ihrer Rückkehr zur Höhle gab es an den abendlichen Feuern kein anderes Thema als Füße und Spuren. Alle sprachen über den seltsamen Fund. Tade musste immer wieder beschreiben, wie groß der Abdruck gewesen war, den er und Cukewo entdeckt hatten.
„Vielleicht war es ein besonders großer Bär“, mutmaßte Sem.
„Das war kein Bär“, entgegnete Tade und sah seinen Vater beleidigt an. „Ich werde doch wohl eine Bärenspur von der eines Menschen unterscheiden können!“
„Wie nah am Wasser war der Abdruck denn?“
Tade zeigte seinem Vater die Entfernung mit beiden Händen.
„Wahrscheinlich war der Schlamm so nah am Bach einfach in Bewegung und hat den Abdruck in die Länge gezogen.“
„Gleichmäßig in alle Richtungen?“
„Könnte doch sein.“
„Und von wem war dann der Abdruck? Cukewo und ich waren vorher nicht an dieser Stelle.“
„Vielleicht von uns“, warf einer der älteren Jäger ein. „Wir sind vor einigen Tagen weiter im Norden auch über einen Bach gekommen. Vielleicht stammte der Abdruck von mir.“
„Oder von mir“, sagte einer der kleinen Jungen und griff sich lachend an den Fuß.
Je länger das Gespräch über Füße und Abdrücke dauerte, umso mehr wurde gelacht, und umso stiller wurde Tade. Er mochte es nicht, wenn man ihn auslachte. Er wusste, was er gesehen hatte. Und sein Bruder hatte es auch gesehen. Der allerdings sagte fast nichts zu alledem.
„Warum willst du es nicht wahrhaben, dass dieser seltsame Fußabdruck etwas mit dem Verschwinden unserer Tochter zu tun haben könnte?“, fragte schließlich Alika und sah ihren Gefährten Sem durchdringend an.
Tade war dankbar für die Hilfe seiner Mutter und war gespannt, was sein Vater dazu zu sagen hatte. Missmutig stellte er jedoch fest, dass Sem gar nichts weiter zu sagen hatte. Er drehte ein Stück Fleisch viel länger als nötig über dem Feuer und schwieg. Das war wieder einmal einer der Momente, in denen Tade nicht wusste, ob ihn das Verhalten seines Vaters wütend oder einfach nur fassungslos machen sollte.
Tade hatte nie verstehen können, warum Sem oft so unfreundlich zu seinem jüngsten Kind gewesen war. Allein an ihrem seltsamen Namen konnte das doch nicht liegen. Vielleicht hatte er sich noch einen weiteren Sohn gewünscht und keine Tochter.
„Eva?“, hatte Sem damals zu seiner Gefährtin gesagt. „Du willst unsere Tochter Eva nennen? Was ist das denn für ein Name?“
Alika hatte es nicht so recht erklären können, aber sie fand den Namen einfach schön, den sie sich für ihre Tochter ausgedacht hatte. Sie hatte ihn während der Schwangerschaft geträumt und beim Aufwachen beschlossen, dass ihr Kind den Namen Eva bekommen würde, wenn es ein Mädchen werden sollte. Da es in der Sippe üblich war, dass Väter ihren Söhnen einen Namen gaben und Mütter ihren Töchtern, trug das Kind fortan den Namen Eva – sehr zu Sems Verdruss. Viele Namen wurden von einer Generation an die nächste oder die übernächste weitergegeben. Die meisten davon waren deshalb sehr alt. Sich einen gänzlich neuen Namen auszudenken, kam vor, war aber eher selten.
„Noch nie hat ein Kind Eva geheißen“, sagte Sem, als er seine neugeborene Tochter betrachtete, und prophezeite zugleich: „Und nie wieder wird ein Kind Eva heißen.“
Alika störte das nicht. Jedenfalls nicht sehr. Sie pochte auf ihr mütterliches Recht, den Namen des Mädchens bestimmen zu dürfen, und Sem fügte sich schließlich. Das Mädchen trug den Namen voller Stolz und freute sich immer, wenn ihre Brüder oder ihre Mutter nach ihr riefen. Nur ihr Vater vermied es, sie mit ihrem Namen anzusprechen. Und wenn es sich nicht vermeiden ließ, dann hatte es stets einen seltsamen Beiklang. Während der nächtlichen Suche nach seiner verschwundenen Schwester hatte Tade erstmals das Gefühl, Evas Namen aus Sems Mund mit angemessener Ernsthaftigkeit zu vernehmen.
Nach etwas weniger als einem Vollmond gab auch Cukewo auf. Ebenso wie Tade hatte er es anfangs nicht hinnehmen wollen, dass seine kleine Schwester verschwunden blieb und einfach aufgegeben wurde. Schließlich aber gab er dem Drängen der Alten nach, sich endlich wieder mehr an der Jagd zu beteiligen, statt sinnlose Wanderungen zu unternehmen.
Tade hingegen beugte sich diesem Druck nicht – jedenfalls nicht völlig. Auch er ging wieder jagen, doch wenn es ihm gelungen war, ein großes Tier zu erlegen, dann empfand er das als Berechtigung, sich wieder anderen Dingen zuzuwenden. Kopfschüttelnd stellten seine Verwandten fest, dass er immer wieder für zwei, drei Tage verschwand. Und wenn er zurückkehrte, sprach er wenig oder gar nicht darüber, wo er gewesen war. Natürlich war ihm bewusst, dass solche einsamen Wanderungen gefährlich waren. Aber er lernte, auch mehrere Nächte mit sehr wenig Schlaf auszukommen und sein Feuer in Gang zu halten. Die Hoffnung, bei diesen Streifzügen doch noch seine Schwester oder zumindest eine ernsthafte Spur von ihr zu entdecken, wurde mit der Zeit immer kleiner. Bis er sie ganz aufgab, waren jedoch mehrere Vollmonde verstrichen.
Schließlich gestand auch er sich ein, dass es sinnlos war. Das Leben musste weitergehen. Und seine Schwester war nun kein Teil mehr davon. Sie blieb verwunden. Ohne jede Spur.
Jedenfalls wenn man den seltsamen Fußabdruck am Bach nicht als Spur betrachtete.
Kapitel 2: Aufbruch ins Unbekannte
Mit der Zeit fiel Tade mehr und mehr die Rolle des Anführers bei der Jagd zu. Er zählte zwar noch immer zu den jungen Jägern, aber nicht mehr zu den ganz jungen. Und da er sehr erfolgreich war, ordneten sich ihm andere Männer bereitwillig unter. Tade konnte wie kein anderer Fährten lesen und entwickelte ein gutes Gespür dafür, wo Wild zu finden war – vor allem, seit er die Ratschläge der Alten nicht mehr einfach so in den Wind schlug. Und dieses Gespür wurde immer wichtiger.
Denn die Herden wurden kleiner oder ließen sich zuweilen gar nicht mehr blicken. Immer wieder kehrten Jägergruppen mit leeren Händen zurück. Auch die Jagd nach großen Fischen im See oder am Fluss war ein Glücksspiel. Fische waren unglaublich schnell, und oft stieß der Speer ins Leere. Zumindest gab es viele Fische, sodass man mit Geduld immer wieder auch Erfolg hatte. Von Fischen allein konnte die Sippe aber nicht leben. Meist war die Nahrung zwar halbwegs ausreichend. Aber es gab Zeiten, in denen das nicht der Fall war. Und diese Zeiten wurden häufiger.
„Vielleicht sollten wir weiter nach Norden ziehen“, sagte Tade eines Abends am Feuer. „Mit der ganzen Sippe, meine ich. Und uns eine neue Höhle und neue Jagdgebiete suchen.“
„Nach Norden?“, fragte sein Vater erstaunt.
„Ja, so wie es das Wild tut.“
„Woher weißt du, dass es im Norden mehr Wild gibt als hier?“
„Weil ich es gesehen habe. In der Zeit, als ich damals nach Eva gesucht habe, bin ich einmal sehr weit nach Norden gewandert. Dort habe ich größere Herden entdeckt.“
„Das ist einige Winter und noch mehr Vollmonde her. Diese Herden können längst verschwunden sein.“
„Vielleicht finden sie im Norden besser Nahrung als hier. Oder sie sind ganz einfach vor uns ausgewichen.“
Der Gedanke bewegte Tade schon seit Langem. Vielleicht waren Tiere doch nicht ganz so dumm, wie er immer geglaubt hatte. Zumindest erlebten sie, dass Menschen gefährlich für sie waren. Mehrfach hatte Tade beobachtet, dass selbst Wolfsrudel verschwanden, wenn Menschen auftauchten. Woran es auch immer liegen mochte: Auf jeden Fall gab es hier inzwischen zu wenig Wild, um auf Dauer alle satt zu bekommen. Im vergangenen Winter waren zwei Kinder gestorben, die das kritische Alter eigentlich schon hinter sich hatten. Sie waren nicht direkt verhungert, aber der Verdacht, dass die unzureichende Nahrung bei ihrem Tod eine Rolle gespielt hatte, war nicht abwegig. Die Sippe hatte zwar keinen regelrechten Hungerwinter erlebt, aber knapp war die Nahrung über mehrere Vollmonde hinweg doch gewesen – für schwache Kinder offensichtlich zu knapp.
Nachdem Tade den Gedanken einer Wanderung einmal ausgesprochen hatte, wurde an den Feuern der Sippe immer häufiger darüber geredet. Manche, vor allem einige der jungen Männer, pflichteten Tade bei, andere waren gegen den Vorschlag, die Höhle dauerhaft zu verlassen. Sicher, eine gute und große Höhle war wichtig. Und auf die Frage, ob Tade im Norden auch Höhlen entdeckt hatte, musste er mit Achselzucken antworten. Aber danach hatte er auch nicht gesucht. Manchmal übersah man wesentliche Dinge, wenn der Blick auf etwas anderes gerichtet war. Vielleicht gab es Höhlen, die man nur finden musste.
Eines Abends wurde am Feuer wieder einmal die Geschichte von der Einwanderung der Vorfahren in das Tal am See erzählt. Jeder kannte sie, und doch hörten alle aufmerksam zu, als Tades Onkel davon sprach, wie eine Gruppe junger Männer und Frauen unter einem Anführer namens Moko die Vorfahren hierher geführt hatte. Der Bruder seines Vaters erzählte die Geschichte ganz genau so, wie sie immer erzählt wurde. Und doch hatte Tade das Gefühl, dieses Mal eine andere Geschichte zu hören – vor allem, als er seinem Onkel am Ende eine Frage stellte:
„Warum sind Moko und seine Gefährten damals eigentlich aufgebrochen?“
Offensichtlich hatte der Onkel genau diese Frage erwartet, denn bevor er antwortete, lächelte er Tade augenzwinkernd zu.
„Es war der Hunger“, sagte er schließlich. „In den alten Jagdgebieten war das Wild knapp geworden.“
„Also ist die Sippe den Tieren gefolgt und weitergezogen?“, hakte Tade nach.
„Nicht ganz. Viele in der alten Sippe wollten die angestammten Gebiete nicht verlassen. Es gab einen langen Streit, und am Ende hat sich die Sippe geteilt. Moko brach mit einigen jungen Männern und Frauen auf, die anderen blieben zurück. Die Menschen, die sich schließlich auf die Wanderung begeben haben, waren unsere Vorfahren.“
Tade nickte und wirkte nachdenklich.
„Eine Teilung wird uns hoffentlich erspart bleiben“, sagte er schließlich.
„Warum sollten wir uns denn teilen?“, entgegnete sein Vater barsch.
Sem erkannte natürlich, worauf dieses Gespräch hinauslief, und es gefiel ihm ganz und gar nicht. Hatten sein Bruder und sein Sohn sich etwa abgesprochen, um mit der Geschichte der Vorfahren Stimmung für eine Wanderung der Sippe zu machen? Auszuschließen war es nicht. Beide hatten ein seltsames Lächeln im Gesicht, als Sems Blick zwischen ihnen pendelte.
„Weil es uns ebenso geht wie Mokos alter Sippe damals“, entgegnete Tade. „Es gibt zu wenig Wild, manche wollen weiterziehen, manche wollen bleiben.“
„Das war doch etwas völlig anderes“, entgegnete Sem barsch.
Worin der Unterschied bestand, konnte er allerdings auch auf Nachfrage nicht erklären.
„Dann geht doch nach Norden!“, brüllte er Tade schließlich an, als der immer wieder nachhakte.
Damit wollte er jedes weitere Gespräch unterbinden. Für den Augenblick gelang ihm das auch. Was er aber nicht unterbinden konnte, waren die Gedanken seines Sohnes. Im Gegenteil: War die Wanderung in den Norden bisher eher eine vage Idee gewesen, so löste Sems Wutausbruch nun eine sehr konkrete Überlegung aus: Stand die Sippe vielleicht doch vor der Teilung? Sollte Tade die Jungen nach Norden führen, so wie fünf Generationen zuvor jener Moko das getan hatte? Der Gedanke löste ein ähnliches Herzklopfen bei ihm aus wie seine erste Jagd vor einigen Wintern.
Schließlich gaben die Alten nach – jedenfalls ein bisschen. Niemand wollte die Sippe teilen, aber eine gute Höhle einfach so aufgeben, war sicherlich auch nicht klug. So wurde beschlossen, dass Tade mit drei Gefährten aufbrechen und nach Norden wandern sollte, um eine neue Höhle zu suchen. Wenn sie dabei erfolgreich sein würden und sie zudem auch viel Wild entdeckten, dann sollte die gesamte Sippe folgen. Wenn nicht, würde man bleiben, wo man war, und auf die Rückkehr der großen Herden hoffen. Letzteres, da war Tade sich ziemlich sicher, war allerdings Unsinn. Die Tiere kamen nicht zu den Menschen – die Menschen mussten den Tieren folgen. So war es immer gewesen, so würde es immer sein. Eigentlich wussten die Alten das auch ganz genau. Eine Erholung des Wildbestandes als ernsthafte Möglichkeit in Betracht zu ziehen, war nichts weiter als ein Nachgeben vor der Starrsinnigkeit seines Vaters.
Dass die vier Jäger wegen ihrer Erkundungswanderung nun einige Zeit nichts zur Versorgung ihrer Familien beitragen konnten, war unschön, musste aber wohl in Kauf genommen werden. Es war Sommer, es gab Früchte, einige der größeren Kinder waren sehr geschickt beim Fischfang – und Beute bei der Jagd machten schließlich auch andere Männer. Allerdings hatte Tade für seine Wanderung die besten Jäger ausgesucht. Sie stießen in ein unbekanntes Land vor – da brauchte er Männer, auf die er sich verlassen konnte.
Der Wichtigste von ihnen war sein Bruder. Cukewo war zwar nicht wohl bei der Sache, aber er folgte Tade widerspruchslos – so wie er das immer tat. Als sie den Bach überquerten, an dem sie damals jenen seltsamen Fußabdruck entdeckt hatten, hielt Tade unwillkürlich inne. Er musste an seine verschollene Schwester denken. Für einen Augenblick blitzte der Gedanke durch seinen Kopf, Eva vielleicht doch noch wiederfinden zu können. Er musste über sich selbst lachen. Nach so vielen Wintern? Was für eine absonderliche Fantasie!
Sie wanderten viele Tage nach Norden, erheblich weiter, als Tade das damals bei seiner Suche nach Eva getan hatte. Dabei blieben sie immer in der Nähe des großen Sees, der ihnen gute Orientierung bot. Dieser See schien endlos zu sein – zumindest Richtung Norden. Am Südufer waren Tade und Cukewo einmal gewesen und ein Stück weit auf der anderen Seite nach Norden gewandert, bevor sie wieder umgekehrt waren. Doch das nördliche Ende hatte nie jemand gesehen. Gab es überhaupt ein nördliches Ende?
Vom Ufer aus stießen sie immer wieder Richtung Sonnenuntergang vor, um nach geeigneten Höhlen zu suchen und Ausschau nach Wild zu halten. Die erste Höhle, die sie entdecken, wäre durchaus geeignet gewesen. Aber hier gab es nicht mehr Wild als in der Nähe ihrer bisherigen Behausung. Auch Tierspuren entdeckten sie nur wenige. Ein Umzug wäre somit sinnlos. Sollte sein Vater womöglich recht behalten? Wer wusste schon, wo die großen Herden waren, die Tade einst bei der Suche nach Eva entdeckt hatte. Hier waren sie jedenfalls nicht mehr. So wanderten sie weiter und erkundeten das Land – immer am See entlang, immer weiter nach Norden.
Wenn sie auf eine Anhöhe kamen, sah Tade über den See und fragte sich, was wohl auf der anderen Seite sein mochte. Das gegenüberliegende Ufer war zu sehen, wenn auch sehr undeutlich. Man konnte nicht erkennen, was dort war. Aber auch, wenn man es hätte erkennen können: Was hätte es genützt? Der See war zu breit, man konnte ihn unmöglich überqueren. Allenfalls umrunden – falls es denn ein nördliches Ende geben sollte.
Einige Tage später stellten sie fest, dass es dieses Ende gab. Sie kamen an einen großen Fluss, der sich in den See ergoss, weiter im Norden waren Berge zu erkennen. Offenbar entsprang der Fluss dort.
Berge hatten den Vorteil, dass man dort vermutlich Höhlen finden konnte. Cukewo drängte darauf, weiter in diese Richtung zu wandern. Tade hingegen wollte den Fluss überqueren und an der anderen Seite des Sees wieder nach Süden gehen. Der Fluss und der See seien eine bessere Umgebung für Wild als die Berge, meinte er. Seine Gefährten waren sich da nicht so sicher – ungeachtet der Tatsache, dass sie seit zwei Tagen deutlich mehr Wild gesichtet hatten.
„Wild ist eine Sache“, sagte Cukewo. „Und natürlich wichtig. Aber wenn die Sippe hier leben soll, dann brauchen wir auch eine Höhle. Warum sollte es auf der anderen Seite des Flusses mehr Tiere geben als in den Bergen?“
„Warum sollte es sie dort nicht geben?“, entgegnete Tade. „Ich weiß wirklich nicht, warum du nicht über den Fluss gehen willst.“
Tatsächlich wusste Tade das ganz genau. Sein Bruder hatte einen sehr guten Grund, lieber nach Norden als nach Osten zu wandern. Aber diesen Grund nannte er nicht – und auch Tade vermied das Thema ebenso wie die anderen Gefährten: Cukewo hatte Angst vor dem Fluss. Wasser zu überqueren, war für sein Empfinden eine riskante Sache – gefährlicher noch, als einem Höhlenbären oder einem Löwen zu begegnen. Und wer wusste schon, ob sie überhaupt eine Furt finden würden. Ohne Furt war das ohnehin ein Ding der Unmöglichkeit. Dafür floss der Fluss zu schnell. Doch selbst wenn: Wasser war immer gefährlich. Sogar in kleineren Gewässern konnte man sein Leben verlieren, wie Cukewo nur zu gut wusste. Und dies hier war alles andere als ein kleines Gewässer.
Kapitel 3: Ein Schock fürs Leben
C














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














