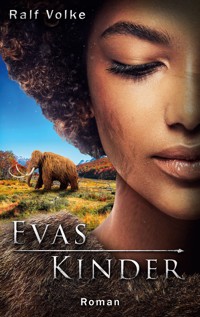Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Die Geschichte des Klimaschutzes ist eine Geschichte des Versagens. Während Wissenschaftler klare Beweise für den katastrophalen menschlichen Einfluss auf unsere wichtigsten Lebensgrundlagen vorlegen, ignorieren Politik, Wirtschaft und Gesellschaft diese Menschheitsaufgabe noch immer. Klimaleugner sprechen gar von einer Klimalüge und stellen gänzlich in Abrede, dass wir überhaupt eine Klimakrise haben - womit sie einen wirksamen Klimaschutz künstlich erschweren. Warum ist das so? Warum bekommen wir diese Überlebensfrage nicht in den Griff? Eine Spurensuche in drei Jahrzehnten des Scheiterns - und ein Ausblick auf die Möglichkeiten, die wir noch haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Die Geschichte des Klimaschutzes ist eine Geschichte des Versagens. Während Wissenschaftler klare Beweise für den katastrophalen menschlichen Einfluss auf unsere wichtigsten Lebensgrundlagen vorlegen, ignorieren Politik, Wirtschaft und Gesellschaft diese Menschheitsaufgabe noch immer. Warum ist das so? Eine Spurensuche in drei Jahrzehnten des Scheiterns – und ein Ausblick auf die Möglichkeiten, die wir noch haben.
Der Autor
Ralf Volke hat als Journalist seit Anfang der 1990er-Jahre den Klimawandel und die Bemühungen für den Klimaschutz beobachtet, auch als Berichterstatter mehrerer Klimakonferenzen. Er war mehr als 20 Jahre Politikredakteur der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, seit 2014 ist er beim Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
Der Weg des Eichhörnchens: Unwissenheit und Ignoranz
Was wäre wenn: Irrtum und Folgen
Ein kurzes Leben: Der Geist von Rio
Eine riskante Abhängigkeit: Die Welt und das Erdöl
Segensreich und gefährlich: Der Treibhauseffekt
Macher der Weltgeschichte: Das Klima
Ein Motor für den Klimawandel: Der Klimawandel
Der Punkt ohne Wiederkehr: Das Klima wandelt sich nicht, es kippt
Hitzewellen am Nordpol: Das ewige Eis ist nicht mehr ewig
Ein Meter oder 80 Meter: Das Wasser steigt
Erwärmung oder Abkühlung: Gefahr für Europas Warmwasserheizung
Hitze, Kälte, Hochwasser: Das Wetter neigt zum Extremismus
Zwei und zwei macht fünf: Die bizarre Welt der Klimaskeptiker
Ein grüner Faschismus? Freiheit und Egoismus
Risiken und Nebenwirkungen: Die Vögel und der Wind
Unsichere Lieferanten: Energie und Politik
Gegen den Wind: Ökostrom und seine Bremser
Was nutzt die Erkenntnis? Das Pippi-Langstrumpf-Prinzip
Die Später-Mentalität: Denken in Vier-Jahres-Zeiträumen
Politik im luftleeren Raum: Die Zeit läuft uns davon
Keine Frage der Kosten: Klimawandel ist teurer als Klimaschutz
Sind so kleine Preise: Das Versagen der Märkte
Tresorknacker und Milchmädchen: Wir lassen uns von der Umwelt subventionieren
Die Welt ist zu klein oder wir sind zu groß: Der ökologische Fußabdruck
Die zwei Gesichter des großen Sünders: Die USA und der Klimaschutz
Lachs oder Quallen: Was wollen wir essen?
Das sechste Massenaussterben: Die Menschheit arbeitet an ihrer Ausrottung
Brutale Wahrheiten: Das Ende der Zivilisation?
Kassandra und Greta: Ein bisschen Hoffnung
Danksagung und Bildnachweise
1. Der Weg des Eichhörnchens: Unwissenheit und Ignoranz
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“(Albert Einstein, Physik-Nobelpreisträger)
Wenn ein Eichhörnchen vor 2000 Jahren Spanien von Nord nach Süd durchqueren wollte, dann konnte es dies problemlos tun, indem es von Baum zu Baum hüpfte. Heute dürfte es damit erhebliche Schwierigkeiten haben. Die einst ausgedehnten Wälder der iberischen Halbinsel sind längst abgeholzt. Sie wurden zu Rauch, weil die Bauern den Boden wollten oder liegen auf dem Grund der Weltmeere, weil die Könige am Ende des Mittelalters Holz für ihre Schiffe und die Träume vom Weltreich brauchten.
In der Folge des Kahlschlags blieb der Regen aus, sodass die Landschaft immer mehr versteppte. Der Wassermangel, der heute auf der iberischen Halbinsel herrscht, ist auch eine Folge dieser früheren Umweltsünden. Aber immerhin hätten die Spanier jener Zeiten eine gute Ausrede gehabt: Sie wussten vermutlich nicht, was sie mit dem Raubbau an der Natur anrichteten.
Genau das ist der Unterschied zwischen den Menschen von damals und der Gesellschaft der Gegenwart. Heute sind die Zusammenhänge zwischen der Verbrennung fossiler Energien und dem Klimawandel gut erforscht und allgemein bekannt – und trotzdem verfeuern wir mit jedem Stück Kohle und jedem Liter Benzin ein Stück unserer Lebensgrundlagen. Wir wissen ganz genau, was wir tun und tun es trotzdem. Für ein solches Verhalten gibt es einen simplen Begriff: Man nennt es Dummheit.
2. Was wäre wenn: Irrtum und Folgen
„Eine Erfindung der Chinesen.“(US-Präsident Donald Trump über den Klimawandel)
Stellen Sie sich einmal einen Patienten vor, dem sein Arzt sagt, er habe höchstwahrscheinlich eine schwere Krankheit. Das lasse sich zwar noch nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, aber die Wahrscheinlichkeit liege bei mehr als 95 Prozent. Nun empfiehlt der Arzt, mit einer zwar aufwendigen, aber auf jeden Fall hochwirksamen Therapie zu beginnen. Diese Therapie erfordere einige Anstrengungen und Veränderungen im Lebensstil, aber als Nebenwirkung seien ausschließlich positive Effekte für die allgemeine Gesundheit zu erwarten. Ohne diese Therapie, so der Arzt, werde sich der Patient nach einiger Zeit immer schlechter fühlen und allmählich dahinsiechen – sofern er tatsächlich an der vermuteten Krankheit leide, auf die eine ganze Reihe von Symptomen sehr deutlich hinweisen.
Nun schüttelt der Patient den Kopf und verlangt eine 100-prozentige Sicherheit, dass er tatsächlich an der vermuteten Krankheit leide. Ansonsten wolle er mit der aufwendigen Therapie nicht beginnen. Den Hinweis des Arztes, dass es bei Vorliegen dieser absoluten Sicherheit aber zu spät für eine Heilung sein werde, wischt der Patient vom Tisch.
Eine absurde Vorstellung? Selbstverständlich. Kein Patient würde so handeln. Bei den Lebensgrundlagen unserer Zivilisation verhalten sich viele Menschen aber ganz genau so.
Vor allem die Haltung einer kleinen (aber ziemlich lautstarken) Gruppe von Menschen, die sich mit dem Klimawandel beschäftigt, geht genau in diese Richtung. Man nennt sie Klimaskeptiker, Klimakritiker oder Klimaleugner (genauer gesagt: Klimawandelleugner – aber der etwas kürzere Begriff hat sich durchgesetzt). Die Bezeichnung ist unterschiedlich, aber ihre Haltung ist im Wesentlichen die Gleiche: Der Mensch, so unterstellen sie, sei nicht schuld am Klimawandel, sondern ausschließlich natürliche Faktoren. Also sei die Energiewende ebenso wie alle anderen Klimaschutzmaßnahmen hinausgeworfenes Geld. Die hartgesottensten Klimaskeptiker unterstellen sogar, dass es den Klimawandel gar nicht gibt.
Zu dieser Gruppe zählen jedoch nicht nur diverse Verschwörungstheoretiker im Internet, sondern auch ernsthafte Politiker, die man leider nicht so ohne Weiteres ignorieren kann. Man denke nur an US-Präsident Donald Trump, der den Klimawandel einmal als „Erfindung der Chinesen“ bezeichnet hat. Bereits vor seiner Wahl sagte er zu dem Thema: „Dieser sehr kostspielige Bockmist der globalen Erwärmung muss aufhören. Unser Planet friert, rekordniedrige Temperaturen, und unsere Wissenschaftler sitzen im Eis fest.“ Nach seiner Ansicht gibt es keinen Klimawandel, sondern lediglich Schwankungen im Wetter, die ganz normal seien. Wobei man wohl davon ausgehen muss, dass Trump den Unterschied zwischen Klima und Wetter nicht verstanden hat.
Solche Politiker, die als gewählte Volksvertreter in Parlamenten sitzen, gibt es auch in Deutschland. Die AfD-Fraktion im Bundestag stellte im Juni 2018 allen Ernstes den Antrag, alle Maßnahmen für den Klimaschutz wegen „erwiesener aktueller und zukünftiger Nutz- und Wirkungslosigkeit einzustellen“. Sie spricht von einer „Hypothese vom menschgemachten Klimawandel“, für die jeglicher Beweis fehle.
Machen wir einmal ein Gedankenspiel und stellen uns vor, diese Menschen hätten recht: Die immer weiter steigenden CO2-Werte in unserer Atmosphäre und die gestiegene Durchschnittstemperatur auf der Erde, die Häufung extremer Wetterlagen, das Abtauen der Gletscher und des Polareises – alles nur zufällig zur selben Zeit. Falls dem so wäre, dann könnten wir uns beruhigt zurücklehnen und darauf hoffen, dass die Autohersteller irgendwann einmal Autos produzieren, deren Abgase die Menschen nicht mehr krank machen. Ansonsten aber müssten wir keine größeren Anstrengungen mehr unternehmen, Luftschadstoffe zu reduzieren. Die Abgase aus der Industrie sind (zumindest in Europa) in den vergangenen Jahren erfreulicherweise recht sauber geworden, nur das Verbrennungsprodukt Kohlendioxid (CO2) wird weiterhin kräftig in die Luft geblasen. In diesen Konzentrationen schadet dieses Gas unserer Gesundheit aber nicht – und nach der Theorie der Klimaskeptiker ist es ja auch für das Klima harmlos.
Vielleicht unterliegen Politiker, Wissenschaftler und Umweltschützer, die einen Zusammenhang von Kohlenstoffverbrennung und Klimawandel sehen, ja tatsächlich einem kollektiven Irrtum. Um es klar zu sagen: Es wäre ein großer Segen, wenn die Klimaskeptiker recht behalten würden.
Was aber, wenn nicht?
Seit mehr als 100 Jahren steigt die Durchschnittstemperatur auf der Erde an. Das ist seriös nicht zu bestreiten. Auch Wissenschaftler, die Kohlendioxid und andere Treibhausgase für harmlos halten, zweifeln diesen beweisbaren Umstand normalerweise nicht an. Damit stellt sich die Frage, woher das eine Grad kommt, um das sich unsere Atmosphäre im globalen Mittel seit Beginn der Industrialisierung aufgeheizt hat.
Da stehen sich nun zwei Meinungen gegenüber: Die große Mehrheit der Wissenschaftler unterstellt einen Zusammenhang mit dem Verbrennen von Erdöl, Kohle sowie Erdgas und dem damit verbundenen Ausstoß von Kohlendioxid. Die andere Gruppe vermutet als Ursache der Erwärmung vor allem eine Veränderung im Sonnenzyklus, also einen natürlichen Vorgang, wie es ihn in der Geschichte der Erde immer wieder gegeben hat.
Hat die zweite Gruppe recht, dann sind alle Anstrengungen zur Vermeidung der Treibhausgase unnötig. Energie muss man dann allenfalls aus Kostengründen oder wegen der Endlichkeit der Ressourcen sparen. Kohlendioxid könnten wir in diesem Fall aber ohne Bedenken weiter und immer mehr in die Atmosphäre pusten. Für Mensch und Tier ist es harmlos, Pflanzen brauchen es sogar. Alles wäre in bester Ordnung.
Gäbe es da nicht die (ziemlich große) Gruppe von Forschern, die recht gut belegen kann, dass Kohlendioxid eben doch den Treibhauseffekt in der Atmosphäre verstärkt. Das internationale Wissenschaftler-Panel der Vereinten Nationen (IPCC) gibt die Wahrscheinlichkeit, dass Kohlendioxid und einige andere Gase diese verheerende Wirkung haben, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 bis 100 Prozent an. Das ist zwar nicht wirklich 100-prozentig, aber die Gefahr ist doch recht groß, dass es die Menschheit selbst ist, die das seit 12.000 Jahren insgesamt sehr stabile Klima auf der Erde durcheinanderbringt.
Es gibt eine ganze Reihe von Interessengruppen, Politikern und Verschwörungstheoretikern, die dennoch erst einen 100-prozentigen Beweis verlangen, bevor sie bereit sind, den Ausstoß der Klimagase zu reduzieren.
Dieselben Leute haben aber kein Problem damit, Geld beispielsweise für ihre persönliche Autoversicherung auszugeben, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Unfall verursachen, weniger als ein Prozent beträgt. Es ist trotzdem sinnvoll, dass sie sich versichern. Man nennt so etwas Vorsorge.
Das gleiche Prinzip sollte auch für unseren Planeten gelten. Natürlich gibt es noch immer Unsicherheiten über das Klimageschehen (die immer kleiner werden). Aber die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Art der Energieversorgung das Klima verändert, ist mit mehr als 95 Prozent sicherlich nicht zu klein, um aktiv zu werden.
Versicherungsunternehmen, bei denen das Denken in Wahrscheinlichkeiten zum Geschäft gehört, werden bei weitaus geringerem Risiko aktiv – und erhöhen beispielsweise die Prämien, wenn sich Risiken erhöhen. Das ist in aller Regel nachvollziehbar und wird allgemein akzeptiert. Nur mit unserem Planeten gehen wir erstaunlich sorglos um und betrachten jede Vorsorge, etwa durch Investitionen in erneuerbare Energien, als zu teuer.
Machen wir noch einmal das Gedankenspiel, dass die Klimaskeptiker recht behalten, und wir unsere Energieversorgung unnötigerweise umstellen: Die Folgen wären vergleichsweise harmlos. Denn dann würden wir lediglich etwas früher als nötig aus den fossilen Energien aussteigen. Langfristig müssen wir das ohnehin tun. Die Endlichkeit des Erdöls ist bereits absehbar, Erdgas wird noch ein paar Jahrzehnte länger reichen, Kohle noch etwas länger. Aber irgendwann sind all diese kohlenstoffbasierten Energien aufgebraucht oder stehen zumindest zu keinen vertretbaren Preisen mehr zur Verfügung. Auf Dauer haben wir überhaupt keine andere Wahl, als komplett auf Sonne und Wind umzusteigen – sofern nicht irgendein kluger Mensch noch eine ganz andere bahnbrechende Erfindung für die Energieversorgung macht, die derzeit allerdings nicht in Sicht ist. Auch wenn die Klimaskeptiker mit ihrer Theorie recht behalten würden, wäre das Geld für die Energiewende keineswegs verschwendet, sondern lediglich etwas früher als nötig investiert.
Damit kann man leben.
Was aber passiert im umgekehrten Fall? Was ist, wenn die Klimaskeptiker sich irren – und wir dennoch auf sie hören? Dann unterlassen wir alle Maßnahmen zum Klimaschutz und sehen tatenlos zu, wie sich unser Planet immer weiter aufheizt. Die Folgen wären mit verfrüht ausgegebenem Geld überhaupt nicht zu vergleichen: Wir verlieren nicht weniger als die Grundlagen der menschlichen Zivilisation.
Damit kann man nicht leben.
3. Ein kurzes Leben: Der Geist von Rio
„Wenn ihr nicht wisst, wie ihr das alles reparieren könnt, dann hört bitte damit auf, es zu zerstören.“
(Die zwölfjährige Severn Cullis-Suzuki im Juni 1992 in einer kurzen Rede beim Erdgipfel von Rio)
Dabei war der internationale Umwelt- und Klimaschutz recht hoffnungsvoll gestartet: mit einem internationalen Vertrag, der die Welt retten sollte. Dieser Vertrag erfüllte tatsächlich die Hoffnungen, die in ihn gesetzt wurden. Das Montrealer Protokoll zum Schutz der Ozonschicht von 1987 gilt bis heute als Meilenstein für den globalen Umweltschutz.
Dieser Vertrag kam zustande, obwohl die erschreckenden Nachrichten aus einer völlig menschenleeren Gegend kamen: der Antarktis. Und die Erkenntnisse über die drohende Gefahr kamen aus dem Weltraum: von Sonden der Nasa, die bedrohliche Werte über dem eisigen Kontinent aufzeichneten. Die Ozonschicht, die das Leben auf der Erde vor der gefährlichen ultravioletten Strahlung der Sonne schützt, nahm ab. Und das derart massiv, dass die Nasasonden ihre Messergebnisse zunächst als fehlerhaft aussortierten. Derart niedrige Werte waren in ihrem Programm gar nicht vorgesehen. Deshalb erkannte man die Gefahr, die im Süden drohte, auch erst mit etwas Verspätung.
Dann aber herrschte bei den Wissenschaftlern schnell Einigkeit über die Ursachen: FCKW – jene ungemein praktischen Chemikalien, die als Kältemittel, Treibgas oder zum Aufschäumen von Kunststoffen so gute Dienste leisteten, hatten in den oberen Schichten der Erdatmosphäre eine böse Nebenwirkung. In letzter Konsequenz konnte das zu einer Bedrohung des Lebens auf der Erde werden. Das Zeug musste weg – und das so schnell wie möglich.
1987 wurde deshalb im kanadischen Montreal ein weitreichendes Verbot dieser Chemikalien beschlossen, das drei Jahre später in London sogar noch verschärft wurde. Obgleich erhebliche wirtschaftliche Interessen dagegenstanden, begnügte sich die Londoner Konferenz 1990 nicht mehr mit irgendwelchen Formelkompromissen oder langen Übergangsfristen, wie man das später bei diversen Klimakonferenzen beobachten konnte. Damals war man sich rasch einig, dass FCKW und alle verwandten Stoffe innerhalb von zehn Jahren komplett vom Markt verschwinden mussten.
Was dann weitgehend tatsächlich auch passierte. Die FCKW-Produktion wurde gestoppt, und die Wirkung zeigte sich schneller als erhofft: Das Ozonloch begann seit der Jahrtausendwende wieder zu schrumpfen. Zwischen 2006 und 2012 hatte seine Ausdehnung bereits um ein Drittel abgenommen. Vollständig erholen wird sich die Ozonschicht wegen der Langlebigkeit der schädlichen Chemikalien zwar wohl erst nach der Mitte dieses Jahrhunderts – aber die Ausdünnung ist inzwischen keine ernsthafte Gefahr mehr. Auch in Chile und Argentinien kann man wieder in die Sonne gehen – auch wenn man im Süden dieser Länder besser eine gute Sonnencreme benutzen sollte. Während der größten Ausdünnung des Ozons in den 80er- und 90er-Jahren war die Sonne in manchen Regionen der Südhalbkugel für Sonnenbäder zu gefährlich geworden.
Auf diese erste Sternstunde des globalen Umweltschutzes hätte nahtlos eine zweite folgen können. Als 1992 der Erdgipfel von Rio stattfand, glaubten nicht wenige genau daran. Der Optimismus passte in die Zeit. Der Ost-West-Gegensatz war mit dem Zerfall des Ostblocks beendet, allgemein war die Rede von einer Friedensdividende, die sich aus einer neuen Weltordnung ergeben sollte. Mit dem Montrealer Protokoll hatte man soeben die Rettung des Ozonlochs eingeleitet – warum sollte das nicht auch mit dem Klima gelingen, dessen Veränderung mehr und mehr ins allgemeine Bewusstsein geriet.
In einem gemeinsamen Projekt namens Medea stellten die USA und Russland 1992 sogar ihre vom Militär gewonnenen Erkenntnisse über die Arktis einer internationalen Gruppe von Klimawissenschaftlern zur Verfügung. Die Offenlegung solcher bis dahin streng geheimer Daten über dieses wichtige Schlachtfeld des Kalten Krieges wäre wenige Jahre zuvor undenkbar gewesen und hätte in beiden Ländern mit Sicherheit strafrechtliche Konsequenzen für alle Beteiligten nach sich gezogen. Anfang der 1990er-Jahre aber war die Zeit, in der so etwas möglich wurde. Es herrschte viel Optimismus – auch was den globalen Umweltschutz betraf.
Erstmals in der Geschichte kamen fast alle Staats- und Regierungschefs der Welt im Juni 1992 in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro zusammen, um über die Zukunft des Planeten zu beraten. Umweltschützer in aller Welt waren geradezu euphorisiert. Noch nie hatte es eine so hochkarätige internationale Konferenz gegeben, die sich mit den ökologischen Fragen des Planeten beschäftigte. Plötzlich schien alles möglich. Wenn die Staats- und Regierungschefs sogar bereit waren, der Rede eines zwölfjährigen Mädchens aus Kanada zu lauschen, das sehr eindringlich darlegte, wie sich die Verschwendung von Ressourcen aus Sicht der künftigen Generation anfühlte, dann hatte wirklich ein Umdenken eingesetzt.
Oder?
Severn Cullis-Suzuki wurde damals bekannt als „das Mädchen, das die Welt zum Schweigen brachte“. Während ihrer gerade mal sechs Minuten langen Rede herrschte eine stille Betroffenheit im Plenum. „Wenn ihr nicht wisst, wie ihr das alles reparieren könnt, dann hört bitte damit auf, es zu zerstören“, sagte sie zu den vielfältigen Folgen der Umweltverschmutzung. Man hatte das Gefühl, dass alle im Saal ihr innerlich zustimmten.
Leider war es das dann aber auch. Die zwölfjährige Kanadierin hatte einen bewegenden Auftritt – und danach machten alle weiter wie gehabt. Man mag sich vielleicht einmal auf das Gedankenspiel einlassen, dass Severn Cullis-Suzuki 1992 eine ähnliche Bewegung angestoßen hätte, wie 26 Jahre später eine 15-jährige Schwedin namens Greta Thunberg. Möglicherweise wäre die Geschichte des Klimaschutzes dann ganz anders verlaufen. Wie wir wissen, ist das aber leider nicht passiert. Der Auftritt von Severn Cullis-Suzuki auf dem Erdgipfel war atmosphärisch ein Höhepunkt, aber ansonsten leider nur eine folkloristische Fußnote ohne weitere Bedeutung.
Dabei hätte der Gipfel von Rio durchaus bedeutsam sein können. Hätte – wenn die Mächtigen der Welt ihre eigenen Beschlüsse in der Folge denn auch ernst genommen hätten. Leider haben sie das aber nicht. Nicht einmal ansatzweise. Die damals verabschiedete Agenda 21 – gewissermaßen der internationale Leitfaden für das 21. Jahrhundert – wurde lediglich zu einer Sammlung schöner Absichtserklärungen und neuer Begriffe.
Der wichtigste davon war „Nachhaltigkeit“: Der Ausstoß von Treibhausgasen sollte nachhaltig gebremst, die Artenvielfalt nachhaltig geschützt, die Ausbreitung der Wüsten nachhaltig gestoppt, die Wirtschaft der armen Länder nachhaltig entwickelt werden. Obgleich der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ (im englischen Original: „sustainable development“) seither zum Schlagwort für alles und nichts geworden ist, beschreibt er doch eine Erkenntnis, die zu den Vereinbarungen von Rio führte: Nicht kurzatmige Aktionen helfen der Welt, sondern nur strukturelle Veränderungen, die langfristig und dauerhaft wirken – nachhaltige Entwicklungen eben.
Zu diesen nachhaltigen Veränderungen, die in Rio als notwendig beschrieben wurden, zählt der Klimaschutz. An dieser Stelle waren die Staats- und Regierungschefs sogar ziemlich mutig. Die Erkenntnisse der Klimaforscher galten damals zwar noch nicht als gesichert, aber die Mächtigen der Welt nahmen sie scheinbar ernst. Die in Rio von 154 Staaten unterschriebene Klimarahmenkonvention sah vor, dass der Ausstoß der klimarelevanten Gase im Jahr 2000 weltweit nicht höher sein sollte als 1990. Zehn Jahre später sollte er dann um fünf bis zehn Prozent unter dem Wert von 1990 liegen.
Die tatsächliche Entwicklung sah allerdings ganz anders aus: Bis 2000 stabilisierte sich etwa der Ausstoß des wichtigsten Klimagases CO2 keineswegs, sondern stieg weltweit um rund zehn Prozent an. Bis 2010 sogar um rund 40 Prozent gegenüber 1990. Gegenüber der eigentlich angestrebten Reduzierung um fünf bis zehn Prozent ist das schon ein recht eindrucksvolles Verfehlen der Zielmarke. Es wurde nicht einmal der Weg zu einer Reduzierung eingeschlagen. Die Emissionen stiegen in der Zeit nach Rio immer schneller an. Statt den Ausstoß der Klimakiller zu reduzieren, pustete die Menschheit fröhlich immer mehr davon in die Atmosphäre – mit verheerenden Auswirkungen, die bereits 1992 absehbar waren.
Vermutlich ahnte in Rio kaum ein Staatschef, was seine Unterschrift unter die Klimarahmenkonvention eigentlich hätte bedeuten müssen. Außerdem war Papier ja schon immer geduldig gewesen. Warum sollte das in einer neuen Weltordnung anders sein? Der Geist von Rio hatte ein ziemlich kurzes Leben. Auch das Medea-Projekt beendeten die amerikanischen und russischen Militärs nach einigen Jahren wieder. Militärische Geheimnisse wurden wieder wichtiger als die Zusammenarbeit beim globalen Klimaschutz.
Immerhin hatte Rio zur Folge, dass das Thema Klimaschutz auf die internationale Tagesordnung kam und dort blieb – mal mehr, mal weniger. Drei Jahre nach dem Erdgipfel kamen im März 1995 zahlreiche Umweltminister sowie auch einige Staats- und Regierungschefs in Berlin zur ersten UN-Klimakonferenz zusammen. Geleitet wurde dieses Treffen von einer bis dahin in der internationalen Politik ziemlich unbekannten, jungen deutschen Umweltministerin, die gerade mal seit vier Monaten im Amt war: Angela Merkel.
Zwar hatte Deutschland mit einer CO2-Reduktion um zwölf Prozent gegenüber 1990 international etwas vorzuweisen, aber jeder wusste, dass diese Reduktion lediglich auf einer unschönen Nebenwirkung der deutschen Wiedervereinigung beruhte: dem Zusammenbruch der DDR-Industrie, die sehr stark von der schmutzigen Braunkohle abhängig war.
Trotz der vollmundigen Ankündigung des deutschen Kanzlers Helmut Kohl, Deutschland werde bis 2005 seinen CO2-Ausstoß um 25 Prozent reduzieren, musste seine Umweltministerin eingestehen, dass die Emissionen zuletzt auch im Klimamusterland Deutschland wieder etwas gestiegen waren. Das von Kohl verkündete Ziel, so lautete Merkels Schlussfolgerung, könne nur durch „zusätzliche Maßnahmen“ erreicht werden. Und sie sagte auch, was sie unter „zusätzlichen Maßnahmen“ verstand: Energie sparen.
Nun ist es nicht so, dass Umweltschützer oder Klimawissenschaftler gegen das Sparen von Energie wären. Im Gegenteil: Wenn der Verbrauch sinkt, dann sinken damit auch die Kohlendioxid-Emissionen. Das Problem mit dieser Ankündigung war eher, dass Merkel damit lediglich eine Selbstverständlichkeit beschrieben hatte, über die eigentlich niemand mehr groß diskutieren musste. Die notwendigen strukturellen Veränderungen – eine völlig andere Energieversorgung – wurde in Berlin nicht angeschoben. Und in den Jahren danach auch nur sehr zaghaft.
Aber warum tun wir uns an dieser Stelle auch Jahrzehnte später noch immer so schwer? Wir wissen inzwischen, dass wir mit unserer Art der Energieversorgung die menschliche Zivilisation mittelfristig vor die Wand fahren werden. Und dennoch machen wir weiter, als gäbe es kein Morgen. Warum bekommt die Menschheit hier nicht die Kurve, von der alle wissen, wie dringlich sie ist? Was unterscheidet den Klimaschutz vom Schutz der Ozonschicht?
Die schlichte Antwort lautet: Weil wir Junkies sind. Wir alle sind süchtig nach dem Stoff, der seit dem 19. Jahrhundert unsere Wirtschaft am Laufen hält und zumindest den Industrieländern einen nie zuvor gekannten Wohlstand beschert hat: Kohlenstoff.
Für die ozonschädigenden FCKW standen schnell Alternativen zur Verfügung, die für unser Wirtschaftsleben keine allzu großen Veränderungen mit sich brachten. Das Umsteuern war deshalb vergleichsweise einfach. Beim Klimaschutz sieht das ganz anders aus. Da muss man nicht nur ein paar Chemikalien ersetzen, sondern auf Kohle, Erdöl und am Ende auch auf Erdgas verzichten. An diesen drei Energieträgern aber hängt fast die komplette Weltwirtschaft. Die Menschheit hat sich mit der übermäßigen Nutzung kohlenstoffhaltiger Energieträger in eine Abhängigkeit begeben, die sich bitter rächen wird.
4. Eine riskante Abhängigkeit: Die Welt und das Erdöl
„Wir müssen das Öl verlassen, bevor es uns verlässt.“
(Fatih Birol, türkischer Wirtschaftswissenschaftler und Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur in Paris)
Vor allem Erdöl ist der Schmierstoff, der unsere Wirtschaft am Laufen hält. 40 Prozent aller Energie, die derzeit auf der Erde verbraucht wird, stammt aus Erdöl – jenem uralten Stoff, den die Natur vor 100 bis 400 Millionen Jahren aus abgestorbener Biomasse produziert hat.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts die systematische Ausbeutung der Lagerstätten begann, haben wir uns immer mehr in die Abhängigkeit von Erdöl und seinen Produkten begeben. Nach Berechnungen des britischen Ölkonzerns BP verbrauchte die Menschheit im Jahr 2016 rund 15,4 Milliarden Liter Öl – pro Tag. Tendenz weiter steigend. Von einem Rückgang des Verbrauchs ist der Planet auch drei Jahrzehnte nach dem Erdgipfel von Rio weit entfernt. Dieser Rückgang allerdings ist unabdingbar, wenn die auf diversen Klimakonferenzen beschlossenen Ziele der CO2-Minderung erreicht werden sollen.
Das jährliche Wachstum beim Ölverbrauch wird besonders von den großen Schwellenländern wie China, Indien oder Brasilien verursacht. Allerdings kann man sie dafür schlecht an den Pranger stellen. Denn diese Staaten bemühen sich lediglich nachzuholen, was wir in den vergangenen Jahrzehnten bereits erreicht haben: Wohlstand für die breite Gesellschaft. Und leider haben wir diesen Ländern auch vorgemacht, wie man so etwas ohne Rücksicht auf die Umwelt tut.
In Deutschland wird mehr als die Hälfte des Öls (53 Prozent) von Autos, Flugzeugen, Schiffen oder sonstigen Verkehrsmitteln verbrannt, der Rest dient als Heizenergie oder Ausgangsstoff für die chemische Industrie. Zwar geht der Verbrauch bei uns seit den 1990er-Jahren kontinuierlich zurück – aber nur leicht. Hätten einige Autobauer ihre kreativen Fähigkeiten weniger für die Umgehung von Umweltvorschriften oder die Entwicklung schwerer SUVs und dafür mehr für die Entwicklung der E-Mobilität genutzt, wären wir da schon auf einem besseren Weg. So oder so ist Erdöl aber aus unserer Wirtschafts- und Lebensweise derzeit nicht wegzudenken.
Was fatale Folgen haben kann – nicht nur für das Klima. Denn wie sicher die Versorgung mit Öl wirklich ist, kann niemand sagen. Das hat zwei Gründe – einen geologischen und einen politischen.
Da sind zunächst einmal die weltweiten Vorräte, von denen trotz diverser Berechnungen niemand so recht weiß, wie groß sie wirklich sind. Da die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) Förderquoten abhängig von den vorhandenen Reserven vergibt, neigen viele Opec-Länder dazu, die eigenen Quellen schönzurechnen. Nachprüfen lassen sich deren Angaben nicht. Länder wie Saudi-Arabien oder Iran lassen sich ebenso wenig in die Karten schauen wie Russland oder Venezuela. Was die Förderländer an Reserven melden, muss man glauben – oder eben auch nicht.
Unabhängige Wissenschaftler, wie etwa der britische Erdölgeologe Colin J. Campbell, sind schon seit Längerem der Ansicht, dass die Vorräte kleiner sind, als die offiziellen Zahlen vermuten lassen – und der als Peak Oil bezeichnete Zeitpunkt des weltweiten Fördermaximums bereits überschritten ist oder zumindest in naher Zukunft bevorsteht. Ob wir den Peak Oil tatsächlich schon überschritten haben, lässt sich erst mit einigen Jahren Verzögerung im Rückblick verlässlich sagen. Viele Fachleute vermuten den Zeitpunkt irgendwann zwischen 2010 und 2020.
Unstrittig ist jedoch, dass beim Nordseeöl das Fördermaximum bereits überschritten wurde, vermutlich schon in den ersten Jahren dieses Jahrtausends. Infolgedessen ist Großbritannien 2006 vom Ölexporteur zum Importeur geworden. Dasselbe gilt für andere Ölförderstaaten wie etwa Indonesien und Malaysia. Auch die Ölfelder in Alaska und Mexiko befinden sich im Niedergang. Selbst russische Ölmanager räumen mittlerweile ein, dass im ölreichen Westsibirien das Fördermaximum überschritten sein dürfte.
Mit Öllagerstätten ist das so eine Sache. Sie sind weitaus schwieriger zu managen als etwa der Heizöltank im Keller eines Einfamilienhauses. Wenn der zur Hälfte leer ist, dann kann man auch die zweite Hälfte völlig problemlos abzapfen. Bei Erdöllagerstätten unter der saudischen Wüste oder dem Boden der Nordsee funktioniert das nicht so ohne Weiteres – aus ganz schlichten physikalischen Gründen.
Denn mit der Ölmenge nimmt auch der Druck in einer Lagerstätte ab. Wenn ungefähr die Hälfte ausgebeutet ist, kann man anschließend zwar weiterhin Öl herausholen, aber es dauert immer länger, bis die gleiche Menge nach oben kommt. Die Förderrate sinkt also immer weiter ab. Das Öl ist zwar da, aber eben nicht hier. Man bekommt es immer schwerer aus der Erde.
So pumpen die Saudis bereits seit Jahren in einige Ölfelder massiv Wasser hinein, um den Druck und damit die Fördermenge zu erhöhen. Damit nehmen sie allerdings in Kauf, dass sie aus diesen Feldern zunehmend ein unerwünschtes Öl-Wasser-Gemisch fördern. Ohne Not würde man eine solche Technik nicht anwenden, weshalb zu vermuten ist, dass selbst das ölreiche Saudi-Arabien seinen Peak Oil bereits überschritten hat.
Überschreiten wir nun auch weltweit das Fördermaximum, so geht das Angebot auf dem Weltmarkt unweigerlich zurück – bei vermutlich weiter wachsender Nachfrage. Was dann passiert, dürfte jeder Wirtschaftsstudent im ersten Semester vorhersagen können: Die Preise steigen. Viele Fachleute sind der Ansicht, dass ein Barrel dann durchaus auch 200 Dollar und mehr kosten kann. Ob unsere Wirtschaft das ebenso gut wegstecken kann wie die bisherige Preisspitze von 147 Dollar (im Jahr 2008), bleibt abzuwarten.
Natürlich werden auch immer wieder neue Lagerstätten entdeckt. So wurde im Frühjahr 2017 der Fund eines Ölfeldes in Alaska gemeldet, das die US-Regierung als „riesig“ bezeichnete. 1,2 Milliarden Barrel lagern dort vermutlich. Tatsächlich war dies der größte Fund in den USA seit 30 Jahren. Wenn man das Feld komplett ausbeuten kann, dann reicht das rechnerisch aber gerade mal, um die gesamten USA zwei Monate lang zu versorgen. Und das war es dann auch schon mit dem angeblich riesigen Ölfeld.
Das einzige wirklich große Ölfeld, das in den vergangenen Jahrzehnten entdeckt wurde, liegt vor der brasilianischen Küste im Atlantik. Dort werden immerhin 30 Milliarden Barrel vermutet, was die bekannten weltweiten Reserven tatsächlich vergrößert – allerdings auch nur um drei Prozent.
Zudem ist mit diesem Öl schwer ins Geschäft zu kommen, da es unter dem Meeresboden liegt. Und der Atlantik ist an dieser Stelle dummerweise 4000 Meter tief, was die Förderung nicht eben einfach und schon gar nicht preiswert macht. Kleinere Ölfelder, wie jenes in Alaska, werden zwar immer mal wieder gefunden, aber die fallen angesichts des gigantischen globalen Verbrauchs nicht sonderlich ins Gewicht.
Die Hoffnung, noch weitere große Ölfelder zu entdecken, ist ausgesprochen vage. Denn um Erdöl finden zu können, braucht man bestimmte geologische Formationen. Und die sind weltweit überwiegend erkundet. Seit den 1980er-Jahren wird weltweit mehr Öl verbraucht als neu gefunden. Die Reserven gehen also unweigerlich zurück.