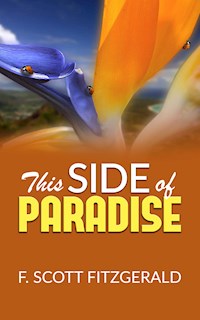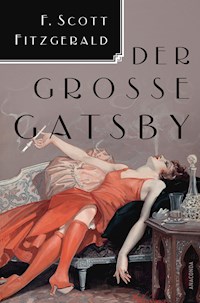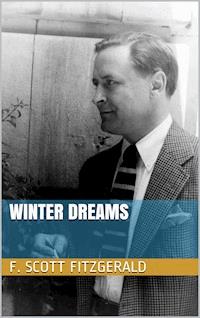9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Anaconda Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Mit F. Scott Fitzgerald geht es tief hinein in die Goldenen Zwanziger und die Welt der Schönen, Reichen und Unglücklichen. Hier wird fürstlich getrunken, eigenartig geliebt und aufs Prächtigste aneinander vorbeigelebt. Mit seinem Werk schuf der amerikanische Schriftsteller ein kunstvoll gestaltetes Porträt seiner Generation. Dieser Band umfasst die beiden großen Romane »Zärtlich ist die Nacht« und »Der große Gatsby«, dazu kommen »Der seltsame Fall des Benjamin Button« und eine Auswahl der besten Geschichten.
- »Meister von Wehmut und tiefster Melancholie« Deutschlandfunk
- Das Beste des amerikanischen Kult-Autors der »Roaring Twenties« in einem Band
- 736 Seiten, gebunden in fein geprägter Leinenstruktur auf Naturpapier mit Goldprägung
- »Der Tanz über dem Abgrund verlieh den Büchern ihren schillernden Glanz.« Deutschlandfunk
- Fitzgerald gelang es, »das Bild seiner Epoche seismografisch einzufangen«, »mit leichter Hand und ungemein packend erzählt« Deutschlandfunk
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1149
Ähnliche
F. Scott Fitzgerald
Gesammelte Werke
Aus dem amerikanischen Englisch vonElga Abramowitz, Kai Kilian, Kim Landgraf und Grete Rambach
Anaconda
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und
enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte
Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung
durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung
oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in
elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und
zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhaltedieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhGausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Das Copyright sämtlicher Übersetzungen von Elga Abramowitz (siehe EditorischeNotiz) liegt bei © Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 1972, 2008.
Hinweis:
Texte dieses Bandes enthalten stereotype Figurenkonstellationen und rassistischeBegriffe. Die im Deutschen verwendeten Begriffe entsprechen jenen des Originals.Die Begriffe und dahinterstehende Vorstellungen sollten mit historisch-kritischerDistanz rezipiert werden.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2024 by Anaconda Verlag, einem Unternehmender Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotiv: F. Scott Fitzgerald, um 1930, PVDE / Bridgeman Images
Umschlaggestaltung: Druckfrei. Dagmar Herrmann, Bad Honnef
Satz und Layout: InterMedia – Lemke e. K., Heiligenhaus
ISBN 978-3-641-32432-2V001
www.anacondaverlag.de
Inhalt
Der große Gatsby
Zärtlich ist die Nacht
Erzählungen
Der seltsame Fall des Benjamin Button
Ein Diamant, so groß wie das Ritz
Das Vernünftige
Die Skandaldetektive
Die letzte Schöne des Südens
Eine Frau mit Vergangenheit
Familie im Wind
Ein patriotischer Kurzfilm
Zwei Oldtimer
Drei Stunden zwischen zwei Flügen
Editorische Notiz
Der große Gatsby
Einmal mehrfürZelda
So trag denn den goldnen Hut, falls solches sie rührt;
Kannst du hoch fliegen, flieg auch für sie,
Bis sie ruft: »Goldbehüteter, hochfliegender Liebling,
Dich muss ich haben!«
– Thomas Parke D’Invilliers
Kapitel 1
Als ich noch jünger und verwundbarer war, gab mein Vater mir einen Rat, der mir seither nicht aus dem Kopf geht.
»Wann immer du glaubst, jemanden kritisieren zu müssen«, sagte er zu mir, »denk daran, dass unter all den Menschen auf dieser Welt niemand solche Vorzüge genossen hat wie du.«
Mehr sagte er nicht, doch auf eine zurückhaltende Art pflegten wir uns außerordentlich viel mitzuteilen, und ich verstand, dass er weit mehr meinte als das. Seither halte ich mich in der Regel mit jeglichem Urteil zurück, eine Angewohnheit, die mir schon zahlreiche merkwürdige Charaktere erschlossen hat, mich zugleich aber auch so manchem altgedienten Schwätzer in die Fänge trieb. Außergewöhnliche Naturen wittern diese Eigenschaft rasch, und sie klammern sich daran, sobald sie sie an einem gewöhnlichen Menschen bemerken; so kam es, dass ich auf dem College ungerechterweise bezichtigt wurde, ein Intrigant zu sein, da ich in die geheimen Nöte ausschweifend fremdartiger Männer eingeweiht war. Die meisten dieser Bekenntnisse kamen ungebeten – oft stellte ich mich schlafend, tat beschäftigt oder gab mich leichthin feindselig, sobald ich an irgendeinem untrüglichen Zeichen erkannte, dass ein vertrauliches Geständnis heraufdämmerte; im Großen und Ganzen nämlich sind die vertraulichen Geständnisse junger Männer, oder zumindest die Worte, in die sie sie kleiden, abgekupfert und durch offenkundige Heimlichkeiten verzerrt. Mit Urteilen zurückhaltend zu sein ist eine Sache grenzenloser Zuversicht. Ich bin noch immer leicht besorgt, dass mir etwas entgeht, sollte ich vergessen, dass, wie mein Vater hochnäsig fallenließ und ich hier hochnäsig wiederhole, der Sinn für grundlegenden Anstand nicht allen gleichermaßen in die Wiege gelegt ist.
Nachdem ich nun derart mit meiner Toleranz geprahlt habe, muss ich auch eingestehen, dass sie durchaus ihre Grenzen hat. Ein bestimmtes Verhalten mag auf harten Fels oder feuchtes Marschland gegründet sein, doch ab einem gewissen Punkt ist es mir gleich, worauf es sich gründet. Als ich letzten Herbst aus dem Osten zurückkehrte, wünschte ich mir die Welt auf ewig in Uniform und in einer Art moralischer Habachtstellung; ich legte keinen Wert mehr auf wilde Streifzüge mit privilegierten Einblicken in die menschliche Seele. Nur Gatsby, der Mann, der diesem Buch seinen Namen gibt, blieb von meiner Reaktion ausgenommen – Gatsby, der für all das stand, was ich aus tiefstem Herzen verachte. Falls Persönlichkeit nichts anderes ist als eine durchgehende Abfolge gelungener Gesten, so hatte er etwas Schillerndes an sich, eine erhöhte Sensibilität für die Verheißungen des Lebens, ähnlich einem dieser komplizierten Apparate, die noch zehntausend Meilen entfernt ein Erdbeben registrieren. Seine Empfänglichkeit hatte freilich nichts zu tun mit jener läppischen Erregbarkeit, die man als »schöpferische Wesensart« überhöht – sie war eine außergewöhnliche Gabe der Hoffnung, ein romantisches Vermögen, wie ich es bei keinem anderen je gefunden habe und wahrscheinlich nie wieder finden werde. Nein – Gatsby erwies sich am Ende als rechtschaffen; was mein Interesse an den kümmerlichen Leiden und kurzlebigen Freuden der Menschen vorübergehend erkalten ließ, war das, was an Gatsby zehrte, was als fauliger Dunst seinen Träumen entstieg.
Die Mitglieder meiner Familie leben seit drei Generationen als angesehene, wohlhabende Leute hier in dieser Stadt im Mittleren Westen. Die Carraways sind so etwas wie ein Clan, und es wird überliefert, wir stammten von den Dukes of Buccleuch ab, doch der eigentliche Gründer meiner Linie war der Bruder meines Großvaters, der einundfünfzig herkam, einen andern statt seiner in den Bürgerkrieg schickte und den Eisenwarengroßhandel eröffnete, den mein Vater noch heute betreibt.
Ich habe diesen Großonkel nie zu Gesicht bekommen, aber man sagt, ich sähe ihm recht ähnlich – mit besonderem Hinweis auf das ziemlich nüchterne Porträt, das im Büro meines Vaters hängt. Meinen Abschluss in New Haven machte ich 1915, genau ein Vierteljahrhundert nach meinem Vater, und kurz darauf nahm ich an jenem verspäteten Teutonenfeldzug teil, der als Großer Krieg in die Geschichte einging. Ich genoss den Vergeltungssturm derart gründlich, dass ich nach meiner Rückkehr keine Ruhe mehr fand. Statt als wärmender Nabel der Welt erschien mir der Mittlere Westen nun als zerklüfteter Rand des Universums – also beschloss ich, in den Osten zu gehen und mich im Aktienhandel zu versuchen. All meine Bekannten waren im Aktienhandel, sodass ich annahm, einen Mann mehr werde er wohl noch ernähren können. Meine Onkel und Tanten beratschlagten die Sache, als ginge es um das richtige College für mich. Schließlich setzten sie sehr ernste, unschlüssige Mienen auf und sagten: »Also schön – ja-a.« Vater willigte ein, mich ein Jahr lang zu finanzieren, und nach ein paar Verzögerungen kam ich im Frühjahr zweiundzwanzig – für immer, wie ich dachte – an die Ostküste.
Am praktischsten wäre gewesen, in der Stadt eine Bleibe zu finden, doch der Frühling war damals recht warm und ich kam geradewegs aus einer ländlichen Gegend mit viel Grün und freundlichen Bäumen, sodass ich es für eine gute Idee hielt, als ein junger Kollege mir vorschlug, gemeinsam ein Haus in einem Vorort zu mieten. Er fand auch tatsächlich ein Haus, eine einstöckige verwitterte Pappschachtel für achtzig Dollar im Monat, doch in letzter Minute beorderte ihn die Firma nach Washington und ich zog allein aufs Land. Ich hatte einen Hund – zumindest für ein paar Tage, bis er davonlief –, einen alten Dodge und eine Finnin, die mir das Bett machte und das Frühstück zubereitete und über den Elektroherd gebeugt finnische Weisheiten vor sich hin murmelte.
Für einen Tag oder mehr war es einsam, bis mich eines Morgens auf der Straße ein Mann ansprach, der wohl noch nach mir eingetroffen war.
»Wie kommt man von hier nach West Egg Village?«, fragte er ratlos.
Ich sagte es ihm. Und als ich weiterging, war ich nicht mehr einsam. Ich war ein Wegweiser, ein Pfadfinder, ein echter Siedler. Ganz beiläufig hatte er mich zum rechtmäßigen Bürger dieser Gegend gemacht.
Und so, unter dem Sonnenschein und den kräftig ausschlagenden Bäumen, an denen die Blätter wie im Zeitraffer wuchsen, kam mir die vertraute Gewissheit, dass mit dem Sommer das Leben von Neuem begann.
Zunächst gab es so viel zu lesen, dann auch so viel Kraft aus der frischen, belebenden Luft zu ziehen. Ich kaufte ein Dutzend Bände über das Banken- und Kreditwesen sowie über Anlagepapiere, sie standen rot und golden in meinem Regal wie frisch geprägte Münzen und schienen jene funkelnden Geheimnisse preisgeben zu wollen, um die nur Midas und Morgan und Mæcenas wussten. Ich hatte mir fest vorgenommen, nebenher noch viele andere Bücher zu lesen. Im College war ich literarisch recht interessiert gewesen – in einem Jahr hatte ich sogar eine Reihe todernster und ziemlich trivialer Leitartikel für die Yale News geschrieben –, und nun würde ich all diese Dinge zurück in mein Leben holen und wieder zum beschränktesten aller Experten werden, zum »vielseitig gebildeten Mann«. Das ist beileibe nicht bloß ein Sinnspruch – schließlich lässt sich das Leben weit besser überblicken, wenn man es nur durch ein einziges Fenster betrachtet.
Der Zufall wollte es, dass ich ein Haus in einer der eigenartigsten Gemeinden Nordamerikas gemietet hatte. Es lag auf jener schmalen, wild-turbulenten Insel, die sich direkt östlich von New York erstreckt – und auf der es, neben anderen Launen der Natur, zwei ungewöhnliche Landgebilde gibt. Zwanzig Meilen vom Stadtzentrum entfernt ragen zwei riesige Eier, gleich in ihren Umrissen und nur durch eine hübsche Bucht voneinander getrennt, in die wohl kultivierteste Salzwasserfläche der westlichen Hemisphäre hinaus: den großen nassen Scheunenhof des Long Island Sound. Es sind keine perfekten Ovale – wie das Ei in der Kolumbus-Geschichte sind sie beide am Landende platt gedrückt –, doch ihre so ähnliche Gestalt muss den über sie hinwegfliegenden Möwen ein Quell fortwährender Verwunderung sein. Für alle Flügellosen dagegen dürfte der Umstand interessanter sein, dass sie abseits von Größe und Form völlig verschieden waren.
Ich wohnte in West Egg, dem – nun ja, dem weniger mondänen der beiden Inselteile, wenngleich dieses Etikett den bizarren und ziemlich beunruhigenden Kontrast zwischen ihnen nur höchst oberflächlich beschreibt. Mein Haus stand genau an der Spitze des Eis, keine fünfzig Meter vom Ufer entfernt und zwischen zwei riesige Villen gequetscht, die für zwölf- und fünfzehntausend Dollar pro Saison vermietet wurden. Die zu meiner Rechten war ein in jeder Hinsicht gigantischer Kasten – ein detailgetreuer Nachbau irgendeines Hôtel de Ville in der Normandie mit einem Turm an der Seite, funkelnagelneu unter einem dünnen Bartgespinst aus jungem Efeu, mit einem marmornen Swimmingpool und mehr als vierzig Morgen Park- und Rasenfläche. Dies war Gatsbys Anwesen. Oder vielmehr, da ich Mr Gatsby noch nicht kannte, das Anwesen, das ein Herr dieses Namens bewohnte. Mein eigenes Haus war ein Schandfleck, allerdings ein kleiner Schandfleck, den man geflissentlich übersah, und so konnte ich den Blick aufs Wasser, die Aussicht auf Teile des nachbarlichen Gartens und die tröstliche Nähe von Millionären genießen – und das Ganze für achtzig Dollar im Monat.
Jenseits der geschwungenen Bucht glänzten die weißen Paläste des mondänen East Egg am Ufer, und eigentlich beginnt die Geschichte dieses Sommers an jenem Abend, als ich dort hinüberfuhr, um mit den Buchanans zu Abend zu essen. Daisy war die Tochter einer Cousine zweiten Grades von mir, und Tom kannte ich noch vom College. Gleich nach dem Krieg hatte ich zwei Tage bei ihnen in Chicago verbracht.
Daisys Mann hatte sich vielfach als Sportler hervorgetan und war unter anderem einer der schlagkräftigsten Verteidiger gewesen, die je für New Haven Football gespielt hatten – gewissermaßen eine Art Volksheld, einer jener Männer, die es mit einundzwanzig zu solch spezieller Höchstleistung bringen, dass der Rest ihres Lebens nach Abstieg schmeckt. Seine Familie war unverschämt wohlhabend – schon auf dem College hatte sein verschwenderischer Umgang mit Geld für Unmut gesorgt –, doch die Art und Weise, in der er nun Chicago verlassen hatte und an die Ostküste gezogen war, verschlug einem schier die Sprache: So hatte er eine ganze Koppel von Polo-Ponys aus Lake Forest mit herübergebracht. Es war kaum zu begreifen, dass ein Mann in meinem Alter derart reich sein konnte.
Weshalb sie an die Ostküste kamen, weiß ich nicht. Zuvor hatten sie ohne besonderen Grund ein Jahr in Frankreich verbracht und sich dann rastlos mal hierhin, mal dorthin treiben lassen, wo immer die Leute Polo spielten und gemeinsam reich waren. Dieser Umzug sei nun endgültig, sagte Daisy am Telefon, aber das glaubte ich nicht – ich konnte ihr zwar nicht ins Herz sehen, doch ich hatte das Gefühl, Tom würde sein Leben lang weiter umhertreiben, ein bisschen wehmütig auf der Suche nach der erregenden Wildheit irgendeines unwiederbringlichen Football-Spiels.
So fuhr ich also eines warmen windigen Abends hinüber nach East Egg, um zwei alte Freunde zu besuchen, die ich kaum richtig kannte. Ihr Haus war noch prachtvoller, als ich erwartet hatte, eine freundliche rot-weiße Villa im georginischen Kolonialstil mit Blick auf die Bucht. Der Rasen begann direkt am Strand, lief über eine Viertelmeile auf die Eingangstür zu, sprang dabei über Sonnenuhren und Steinpfade und flammhelle Beete – und endlich beim Haus angelangt, drängte er wie noch im Schwung seines Laufs in leuchtenden Reben die Seitenwand hinauf. Die Front war von einer Reihe Fenstertüren durchbrochen, die jetzt glühend das goldene Licht spiegelten und, weit geöffnet, die warme Brise des frühen Abends hineinließen. Tom Buchanan stand im Reitdress breitbeinig auf der Veranda.
Er hatte sich verändert seit seiner Zeit in New Haven. Jetzt war er ein stämmiger Dreißiger mit strohigem Haar, einem leicht verhärteten Zug um den Mund und herablassendem Auftreten. Zwei hochmütig funkelnde Augen hatten die Herrschaft über sein Gesicht angetreten und verliehen ihm einen Ausdruck, als recke er sich unentwegt angriffslustig vor. Selbst der eher feminine Schick seiner Reitkleidung vermochte die enorme Kraft dieses Körpers nicht zu verbergen – seine Waden schienen noch die oberste Schnürung der blitzblanken Stiefel sprengen zu wollen, und wenn er unter der dünnen Jacke seine Schulter bewegte, sah man ein riesiges Muskelpaket zucken. Es war ein Körper von gewaltiger Wucht – ein unbarmherziger Körper.
Seine Sprechstimme, ein rauer, heiserer Tenor, verstärkte noch den Eindruck der Reizbarkeit, den er vermittelte. Ein Anflug von überheblicher Geringschätzung lag darin, selbst gegenüber Menschen, die er mochte – und in New Haven hatte es viele gegeben, die ihn abgrundtief hassten.
»Nun, du musst nicht glauben, dass meine Meinung in dieser Sache unumstößlich ist«, schien er zu sagen, »nur weil ich stärker und männlicher bin als du.« Wir hatten derselben Senior Society angehört, und obwohl wir nie wirklich befreundet gewesen waren, hatte ich schon damals den Eindruck, dass er mich akzeptierte und auf seine schroffe und wehmütig trotzige Weise wollte, dass ich ihn gern hatte.
Wir unterhielten uns ein paar Minuten auf der sonnigen Veranda.
»Nettes Plätzchen, das ich hier habe«, sagte er und seine Augen irrlichterten rastlos umher.
Er nahm mich beim Arm, drehte mich um und wies mir dabei mit einem Schwung seiner breiten flachen Hand den Ausblick von der Veranda, der einen niedriger gelegenen italienischen Garten, einen halben Morgen tiefdunkler, intensiv duftender Rosen und ein stumpfnasiges Motorboot einschloss, das vor der Küste in der Strömung schaukelte.
»Es gehörte Demaine, dem Ölunternehmer.« Wieder drehte er mich herum, höflich und abrupt. »Lass uns hineingehen.«
Wir durchquerten eine hohe Eingangshalle und gelangten in einen lichten, rosenfarbenen Raum, den Fenstertüren an beiden Seiten vage mit dem Innern des Hauses verbanden. Die Fenster waren weit geöffnet und hoben sich strahlend weiß vom frischen Gras draußen ab, das ein kleines Stück ins Haus hineinzuwachsen schien. Eine Brise ging durch den Raum, wehte Vorhänge wie blasse Fahnen zur einen Seite herein und zur andern hinaus, wirbelte sie hinauf zur glasierten Hochzeitstorte von Zimmerdecke, kräuselte den weinfarbenen Teppich und hinterließ darauf ein Schattenspiel wie der Wind auf dem Meer.
Der einzige vollkommen unverrückbare Gegenstand im Raum war eine riesige Couch, auf der zwei junge Frauen schwebten wie auf einem fest verankerten Ballon. Beide waren ganz in Weiß, und ihre Kleider wogten und flatterten, als wären sie nach einem kurzen Flug ums Haus eben erst wieder hereingeweht worden. Einige Augenblicke stand ich wohl nur so da, lauschte dem Schlagen und Peitschen der Vorhänge und dem Ächzen eines Bildes an der Wand. Dann ertönte ein dumpfer Knall, als Tom Buchanan die hinteren Fenster schloss, der im Zimmer gefangene Luftzug erstarb und die Vorhänge und der Teppich und die jungen Frauen sanken langsam zu Boden.
Die Jüngere der beiden kannte ich nicht. Sie lag ausgestreckt auf ihrer Seite des Diwans, vollkommen reglos und mit leicht erhobenem Kinn, als balancierte sie etwas darauf, das jeden Moment herunterzufallen drohte. Falls sie mich aus den Augenwinkeln wahrnahm, ließ sie es sich nicht anmerken – unwillkürlich hätte ich fast eine Entschuldigung gemurmelt, dass ich sie durch mein Erscheinen gestört hatte.
Das andere Mädchen, Daisy, machte Anstalten, sich zu erheben – sie lehnte sich mit gewissenhafter Miene ein wenig nach vorn –, dann lachte sie, ein albernes, bezauberndes kleines Lachen, und ich lachte auch und trat näher ins Zimmer.
»Ich bin wie g-gelähmt vor Freude.«
Sie lachte erneut, als hätte sie etwas sehr Geistreiches gesagt, und hielt für einen Moment meine Hand, während sie mir von unten herauf ins Gesicht sah mit einem Blick, der versicherte, dass sie sich niemanden auf der Welt so sehr herbeigewünscht hatte wie mich. Das war so ihre Art. Wispernd gab sie mir zu verstehen, der Nachname des balancierenden Mädchens sei Baker. (Manch einen habe ich sagen hören, Daisys Wispern diene nur dazu, dass die Leute sich zu ihr hinüberneigen; ein belangloser Vorwurf, der es nicht weniger hinreißend machte.)
Miss Bakers Lippen jedenfalls zitterten kurz, sie nickte mir fast unmerklich zu und legte dann rasch ihren Kopf zurück in den Nacken – offenbar war der Gegenstand, den sie balancierte, ein wenig ins Wanken geraten und hatte ihr dadurch einen leichten Schreck versetzt. Wiederum lag mir eine Entschuldigung auf der Zunge. Die Zurschaustellung derart vollkommener Selbstgenügsamkeit ringt mir fast jedes Mal ehrfürchtige Hochachtung ab.
Ich wandte den Blick wieder meiner Cousine zu, die mir jetzt mit ihrer leisen, elektrisierenden Stimme Fragen zu stellen begann. Es war eine Stimme, der das Ohr in alle Höhen und Tiefen folgt, als wäre jeder Satz ein Arrangement von Noten, das kein zweites Mal so erklingt. Daisy hatte ein trauriges, hübsches Gesicht mit leuchtenden Stellen darin, leuchtenden Augen und einem leuchtenden, sinnlichen Mund, doch in ihrer Stimme lag eine Erregung, die Männer, denen sie etwas bedeutet hatte, nur schwer vergessen konnten: ein singendes Drängen, ein raunendes »Hör doch«, eine Verheißung, sie habe eben erst köstliche, aufregende Dinge erlebt und schon die nächste Stunde halte weitere köstliche, aufregende Dinge für sie bereit.
Ich erzählte ihr, dass ich auf meinem Weg an die Ostküste einen Tag in Chicago haltgemacht hatte und ihr von einem Dutzend Leute herzliche Grüße ausrichten sollte.
»Vermissen sie mich?«, rief sie verzückt.
»Die ganze Stadt ist untröstlich. Die Autos fahren zum Zeichen der Trauer allesamt mit schwarz gestrichenen linken Hinterreifen, und am Nordufer herrscht in der Nacht ein einziges stetiges Wehklagen.«
»Wie herrlich! Lass uns zurückgehen, Tom. Gleich morgen!« Dann fügte sie wie beiläufig hinzu: »Du solltest die Kleine sehen.«
»Das würde ich gern.«
»Sie schläft. Sie ist jetzt zwei Jahre alt. Hast du sie noch nie gesehen?«
»Nein, nie.«
»Nun, das solltest du aber. Sie ist –«
Tom Buchanan, der währenddessen ruhelos durch den Raum gewandert war, blieb stehen und legte mir die Hand auf die Schulter.
»Was treibst du so, Nick?«
»Ich bin Börsenmakler.«
»Für wen?«
Ich sagte es ihm.
»Nie von denen gehört«, bemerkte er entschieden.
Das ärgerte mich.
»Wart’s ab«, erwiderte ich. »Das wirst du schon noch, wenn du im Osten bleibst.«
»Oh, ich bleibe im Osten, keine Sorge«, sagte er, blickte erst kurz zu Daisy und dann wieder zu mir, als sei er wegen irgendetwas auf der Hut. »Nur ein gottverdammter Idiot würde anderswo leben wollen.«
An diesem Punkt sagte Miss Baker: »Allerdings!«, und zwar derart unvermittelt, dass ich erschrak – es war das erste Wort, das sie von sich gab, seit ich den Raum betreten hatte. Offenkundig überraschte es sie ebenso sehr wie mich, denn sie gähnte und stand dann mit einer Folge schneller, flinker Bewegungen auf.
»Ich bin ganz steif«, klagte sie. »Ich muss eine halbe Ewigkeit auf diesem Sofa gelegen haben.«
»Sieh nicht mich an«, gab Daisy zurück, »ich habe den ganzen Nachmittag versucht, dich zu einem Trip nach New York zu bewegen.«
»Nein, danke«, sagte Miss Baker mit Blick auf die vier Cocktails, die gerade aus dem Anrichteraum hereingebracht wurden, »ich bin strikt im Training.«
Ihr Gastgeber sah sie ungläubig an.
»Ach wirklich!« Er schüttete seinen Drink hinunter, als wäre er nur ein Tropfen auf dem Boden des Glases. »Wie du je irgendwas fertigbringst, ist mir ein Rätsel.«
Ich warf einen Blick auf Miss Baker und fragte mich, was es wohl war, das sie ›fertigbrachte‹. Es gefiel mir, sie anzusehen. Sie war ein schlankes, flachbrüstiges Mädchen mit einer aufrechten Körperhaltung, die sie noch unterstrich, indem sie die Schultern zurücknahm und sich straffte wie ein junger Kadett. Ihre grauen, sonnenstrapazierten Augen erwiderten meinen Blick mit höflicher Neugier aus einem blassen, reizenden, unzufriedenen Gesicht. Jetzt fiel mir ein, dass ich sie oder zumindest ein Bild von ihr irgendwo schon einmal gesehen hatte.
»Sie wohnen also in West Egg«, bemerkte sie abschätzig. »Ich kenne dort jemanden.«
»Ich kenne nicht einen einzigen –«
»Sie müssen doch Gatsby kennen.«
»Gatsby?«, fragte Daisy dazwischen. »Welchen Gatsby?«
Bevor ich antworten konnte, dass er mein Nachbar war, rief man uns zum Essen; und indem er seinen sehnigen Arm gebieterisch unter meinen klemmte, beförderte Tom Buchanan mich aus dem Raum, als bewegte er eine Schachfigur auf ein anderes Feld.
Feingliedrig, träge, die Hände leicht auf die Hüften gelegt, schlenderten die beiden jungen Frauen uns voran auf eine rosenfarbene, sich zum Sonnenuntergang öffnende Veranda, wo vier Kerzen auf einem Tisch im schwächer gewordenen Wind flackerten.
»Wozu Kerzen?«, beschwerte Daisy sich stirnrunzelnd. Sie schnippte sie mit den Fingern aus. »In zwei Wochen haben wir den längsten Tag des Jahres.« Sie blickte uns strahlend an. »Wartet ihr auch immer auf den längsten Tag des Jahres und verpasst ihn dann? Ich jedenfalls warte immer auf den längsten Tag des Jahres und verpasse ihn dann.«
»Wir sollten uns irgendwas vornehmen«, gähnte Miss Baker und setzte sich an den Tisch, als ginge sie zu Bett.
»Also gut«, sagte Daisy. »Was sollen wir uns vornehmen?« Ratlos wandte sie sich an mich. »Was nehmen Menschen sich vor?«
Bevor ich antworten konnte, heftete sie ihren Blick mit entsetztem Ausdruck auf ihren kleinen Finger.
»Seht nur!«, klagte sie. »Ich hab mich verletzt.«
Wir sahen genauer hin – der Knöchel war dunkelblau.
»Das warst du, Tom«, sagte sie vorwurfsvoll. »Ich weiß, du wolltest es nicht, aber du warst es trotzdem. Das habe ich nun davon, dass ich so ein Untier von Mann geheiratet habe, ein riesiges, klotziges, grobschlächtiges Exemplar eines –«
»Ich hasse das Wort grobschlächtig«, unterbrach Tom sie gereizt, »auch im Scherz.«
»Grobschlächtig«, beharrte Daisy.
Manchmal redeten sie und Miss Baker gleichzeitig, unaufdringlich und mit einer neckischen Flatterhaftigkeit, die nie ganz zum Geplauder wurde, die so kühl war wie ihre weißen Kleider und ihre teilnahmslosen, nichts begehrenden Blicke. Sie waren hier, sie nahmen Tom und mich hin und machten den allenfalls höflichen, netten Versuch, zu unterhalten oder sich unterhalten zu lassen. Sie wussten, bald würde das Essen vorbei sein, und etwas später würde auch der Abend vorbei und erledigt sein. Wie vollkommen anders war das im Westen, wo man solche Abende von einer Etappe zur nächsten und bis an ihr Ende jagte, in unablässig enttäuschter Erwartung oder in blanker Furcht vor dem Augenblick selbst.
»Deinetwegen fühle ich mich schon ganz unzivilisiert, Daisy«, gestand ich bei meinem zweiten Glas korkigen, aber ziemlich imposanten Bordeaux’. »Kannst du nicht mal über die Ernte oder so etwas reden?«
Meine Bemerkung bezog sich auf gar nichts Bestimmtes, doch sie wurde auf unerwartete Weise aufgegriffen.
»Die Zivilisation geht sowieso vor die Hunde«, platzte Tom lautstark heraus. »Ich bin bei so was inzwischen ein schrecklicher Schwarzseher. Hast du ›Der Aufstieg der farbigen Völker‹ von diesem Goddard gelesen?«
»Habe ich nicht, nein«, erwiderte ich, etwas befremdet über seinen Ton.
»Tja, ist ein gutes Buch, sollte jeder gelesen haben. Der Tenor ist, dass, wenn wir nicht aufpassen, die weiße Rasse vollständig – vollständig überschwemmt wird. Ist alles wissenschaftlich belegt; alles erwiesene Tatsache.«
»Tom wird jeden Tag tiefsinniger«, sagte Daisy mit einem Ausdruck gedankenloser Traurigkeit. »Er liest schwierige Bücher mit langen Wörtern darin. Wie hieß noch das Wort, das wir –«
»Nun, diese Bücher sind allesamt wissenschaftlich«, insistierte Tom und warf ihr einen ungeduldigen Blick zu. »Der Bursche hat das Ganze gründlich durchdacht. Wir, die überlegene Rasse, müssen auf der Hut sein, sonst werden diese anderen Rassen die Macht übernehmen.«
»Wir müssen sie niederschlagen«, flüsterte Daisy und blinzelte grimmig in die glühende Sonne.
»Ihr solltet in Kalifornien leben –«, begann Miss Baker, doch Tom unterbrach sie, indem er heftig auf seinem Stuhl herumrutschte.
»Er sagt, wir gehören zur nordischen Rasse. Ich und du und du und –« Nach kaum merklichem Zögern schloss er mit einem leichten Nicken auch Daisy mit ein, und sie zwinkerte mir abermals zu. »– und wir haben all das hervorgebracht, was Zivilisation ausmacht – na ja, Wissenschaft und Kunst und das alles. Versteht ihr?«
Seine Konzentration hatte etwas Klägliches, als würde ihm seine Selbstgefälligkeit, heftiger denn je, nicht mehr genügen. Als fast unmittelbar darauf im Haus das Telefon klingelte und der Butler die Veranda verließ, nutzte Daisy die kurze Unterbrechung und neigte sich zu mir herüber.
»Ich verrate dir ein Familiengeheimnis«, flüsterte sie lebhaft. »Es geht um die Nase des Butlers. Willst du sie hören, die Geschichte von der Nase des Butlers?«
»Deswegen bin ich ja hergekommen.«
»Nun, er ist nicht immer Butler gewesen; davor hat er als Silberputzer bei irgendwelchen Leuten in New York gearbeitet, die ein Silberservice für zweihundert Gäste besaßen. Das musste er von morgens bis abends polieren, bis die Politur eines Tages seine Nase anzugreifen begann –«
»Die Sache wurde immer schlimmer«, warf Miss Baker ein.
»Genau. Die Sache wurde immer schlimmer, und schließlich musste er seine Anstellung aufgeben.«
Einen Augenblick lang strichen die letzten Sonnenstrahlen mit zärtlicher Hingabe über ihr glühendes Gesicht; ihre Stimme zwang mich immer weiter nach vorn, während ich ihr atemlos lauschte – dann erlosch das Glühen, zögernd, bedauernd wich alles Licht von ihr, wie Kinder in der Abenddämmerung eine heitere Straße verlassen.
Der Butler kam zurück und flüsterte Tom etwas ins Ohr, worauf dieser die Stirn runzelte, seinen Stuhl zurückschob und wortlos ins Haus ging. Als hätte seine Abwesenheit etwas in ihr zu neuem Leben erweckt, lehnte Daisy sich abermals vor, mit glühender, singender Stimme.
»Ich sehe dich so gern an meinem Tisch, Nick. Du erinnerst mich an – an eine Rose, eine vollkommene Rose. Findest du nicht?« Sie wandte sich um Zustimmung an Miss Baker. »Eine vollkommene Rose?«
Das war Unsinn. Ich erinnere nicht einmal entfernt an eine Rose. Sie improvisierte nur, doch sie verströmte dabei eine betörende Wärme, als versuchte ihr Herz, zu dir herauszukommen, verborgen in einem dieser atemlosen, erregenden Wörter. Dann plötzlich warf sie ihre Serviette auf den Tisch, entschuldigte sich und ging ins Haus.
Miss Baker und ich wechselten einen kurzen, bewusst ausdruckslosen Blick. Ich wollte gerade etwas sagen, als sie sich flink aufrichtete und mir ein warnendes »Sch!« zuwarf. Im angrenzenden Zimmer war ein gedämpftes, aufgebrachtes Flüstern zu hören, und Miss Baker beugte sich ungeniert vor, um zu lauschen. Das Flüstern war einen Augenblick lang fast zu verstehen, verebbte, brandete leidenschaftlich auf und versiegte dann ganz.
»Dieser Mr Gatsby, den Sie erwähnt haben, er ist mein Nachbar –«, begann ich.
»Nicht reden. Ich will hören, was passiert.«
»Passiert denn was?«, fragte ich arglos.
»Soll das heißen, Sie wissen es nicht?«, entgegnete Miss Baker ehrlich erstaunt. »Ich dachte, alle Welt wüsste es.«
»Ich nicht.«
»Na ja …«, sagte sie zögernd, »Tom hat da so eine Frau in New York.«
»So eine Frau?«, wiederholte ich einfältig.
Miss Baker nickte.
»Sie sollte doch wenigstens so viel Anstand besitzen, ihn nicht zur Essenszeit anzurufen. Finden Sie nicht?«
Noch ehe ich ganz begriffen hatte, was sie meinte, hörte man ein Kleid rascheln und Lederstiefel knarren und Tom und Daisy standen wieder bei uns am Tisch.
»Tja, so ist das manchmal!«, rief Daisy angestrengt fröhlich.
Sie setzte sich, warf erst Miss Baker, dann mir einen forschenden Blick zu und fuhr fort: »Ich habe eben mal kurz nach draußen geschaut, dort ist es richtig romantisch. Da sitzt ein Vogel auf dem Rasen, eine Nachtigall, glaube ich, die bestimmt mit der Cunard oder der White Star Line herübergekommen ist. Sie singt und singt –« Ihre Stimme sang: »Ist das nicht romantisch, Tom?«
»Sehr romantisch«, sagte er, und dann kläglich, an mich gewandt: »Wenn es nach dem Essen noch hell genug ist, würde ich dir gern die Stallungen zeigen.«
Im Haus klingelte das Telefon, durchdringend, und während Daisy Tom ansah und entschieden den Kopf schüttelte, löste sich das Thema Stallungen, lösten sich sämtliche Themen buchstäblich in Luft auf. An die letzten fünf Minuten bei Tisch erinnere ich mich nur bruchstückhaft, ich weiß noch, dass jemand sinnlos die Kerzen wieder entzündete und dass ich jedem offen ins Gesicht sehen und doch allen Blicken ausweichen wollte. Ich konnte nicht ahnen, was in Daisy und Tom vorging, aber ich glaube, dass selbst Miss Baker, die sich eine gewisse robuste Skepsis anerzogen zu haben schien, das schrille metallische Drängen dieses fünften Gastes nicht völlig aus ihrem Kopf verbannen konnte. Einem anderen Naturell wäre die Situation vielleicht faszinierend erschienen – ich aber hätte am liebsten augenblicklich die Polizei gerufen.
Die Pferde wurden natürlich mit keinem Wort mehr erwähnt. Tom und Miss Baker schlenderten, mit einigen Armlängen Zwielicht zwischen ihnen, zurück in die Bibliothek wie zur Nachtwache bei einem tatsächlich greifbaren Körper, während ich mich freundlich interessiert und ein wenig verschlossen gab und Daisy über eine Reihe miteinander verbundener Veranden zur Vorderseite des Hauses folgte. Dort setzten wir uns im tiefen Abendschatten Seite an Seite auf eine Korbbank.
Daisy legte ihr Gesicht in die Hände, wie um seine hübsche Form zu ertasten, und ihr Blick wanderte langsam hinaus in die samtene Dämmerung. Ich sah, dass heftige Gefühle von ihr Besitz ergriffen hatten, und so erkundigte ich mich nach ihrer kleinen Tochter, in der Hoffnung, dass meine Fragen sie beruhigen würden.
»Wir kennen uns nicht sonderlich gut, Nick«, sagte sie plötzlich. »Obwohl wir verwandt sind. Du warst nicht auf meiner Hochzeit.«
»Ich war noch nicht aus dem Krieg zurück.«
»Richtig.« Sie zögerte. »Tja, ich hab ziemlich viel durchgemacht, Nick, und ich bin ganz schön zynisch geworden.«
Dazu hatte sie offenbar guten Grund. Ich wartete, aber sie sprach nicht weiter, und kurz darauf kam ich recht unbeholfen wieder auf ihre Tochter zurück.
»Ich nehme an, sie spricht und – isst und so weiter.«
»Oh, ja.« Geistesabwesend sah sie mich an. »Hör zu, Nick, ich will dir erzählen, was ich sagte, als sie geboren wurde. Möchtest du’s hören?«
»Ja, sicher.«
»Du kannst daran sehen, wie ich inzwischen über – über die Dinge denke. Nun, sie war noch keine Stunde alt und Tom war weiß Gott wo. Ich wachte aus der Narkose auf, fühlte mich unendlich verlassen und fragte die Schwester sofort, ob es ein Junge oder ein Mädchen sei. Ein Mädchen, sagte sie mir, und ich wandte mich ab und weinte. ›Na schön‹, sagte ich, ›ich bin froh, dass es ein Mädchen ist. Und ich hoffe, sie wird ein Dummkopf – das ist das Beste, das ein Mädchen in dieser Welt sein kann, ein hübscher kleiner Dummkopf.‹
Du siehst, ich finde sowieso alles ganz furchtbar«, fuhr sie mit Nachdruck fort. »Alle denken so – auch die kultiviertesten Leute. Und ich kenne das alles. Ich bin überall schon gewesen, hab alles gesehen und alles gemacht.« Ihre Augen flackerten aufsässig, ähnlich wie Toms, und sie lachte schrill und höhnisch. »Weltklug – Gott, ich bin so weltklug!«
Kaum war ihre Stimme abgebrochen und meine Aufmerksamkeit, mein Zutrauen nicht länger in Bann geschlagen, ahnte ich die völlige Unaufrichtigkeit ihrer Worte. Ich fühlte mich unbehaglich, als wäre der ganze Abend nur eine Art Trick gewesen, um mir eine Regung der Anteilnahme abzuringen. Ich wartete, und tatsächlich, im nächsten Moment sah sie mich an mit einem ganz und gar affektierten Lächeln auf ihrem hübschen Gesicht, als hätte sie soeben unmissverständlich klargestellt, dass sie und Tom einem besonders exklusiven Geheimbund angehörten.
Im Haus war der karmesinrote Raum strahlend hell erleuchtet. Tom und Miss Baker saßen je an einem Ende der langen Couch, und sie las ihm aus der Saturday Evening Post vor – die Worte, ein unmoduliertes Gemurmel, zerflossen zu einer sanfttönenden Melodie. Das Lampenlicht glänzte auf seinen Stiefeln, lag matt auf ihrem herbstlaubgelben Haar und schimmerte auf dem Papier, während sie mit zittrigem Spiel ihrer schlanken Armmuskeln eine Seite umblätterte.
Als wir eintraten, gebot sie uns mit erhobener Hand, noch einen Moment still zu sein.
»Fortsetzung folgt«, sagte sie und warf das Magazin auf den Tisch, »in unserer nächsten Ausgabe.«
Ihr Körper rief sich mit einem nervösen Zucken des Knies in Erinnerung, und sie stand auf.
»Zehn Uhr«, bemerkte sie und schien die Zeit an der Decke abzulesen. »Dieses artige Mädchen gehört jetzt ins Bett.«
»Jordan spielt morgen bei dem Turnier«, erklärte Daisy, »drüben in Westchester.«
»Oh – Sie sind Jordan Baker.«
Ich wusste jetzt, weshalb ihr Gesicht mir vertraut war – sein angenehm hochmütiger Ausdruck hatte mir aus vielen Tiefdruckfotografien vom sportlichen Treiben in Asheville, Hot Springs und Palm Beach entgegengeblickt. Ich hatte über sie auch eine Geschichte gehört, eine unschöne, heikle Geschichte, aber worum es ging, hatte ich längst vergessen.
»Gute Nacht«, sagte sie leise. »Weckt mich um acht, ja?«
»Wenn du dann aufstehst.«
»Das werde ich. Gute Nacht, Mr Carraway. Auf bald.«
»Auf sehr bald sogar«, bekräftigte Daisy. »Im Ernst, ich glaube, ich werde euch beide miteinander verkuppeln. Komm nur oft zu uns, Nick, und ich bringe euch zwei schon irgendwie – oh – ans Anbändeln. Ihr wisst schon, euch versehentlich im Wäscheschrank einsperren, in einem Boot aufs Meer hinausstoßen und all solche Sachen –«
»Gute Nacht!«, rief Miss Baker von der Treppe aus. »Ich habe nicht ein Wort verstanden.«
»Ein nettes Mädchen«, sagte Tom nach einer Weile. »Sie sollten sie nicht so allein in der Gegend herumlaufen lassen.«
»Wer sollte das nicht?«, erwiderte Daisy kühl.
»Ihre Familie.«
»Ihre Familie besteht aus einer einzigen Tante, die ungefähr tausend Jahre alt ist. Außerdem kümmert Nick sich ja jetzt um sie, nicht wahr, Nick? Sie wird diesen Sommer einige Wochenenden hier draußen verbringen. Der häusliche Einfluss wird ihr bestimmt guttun.«
Daisy und Tom sahen sich einen Augenblick schweigend an.
»Ist sie aus New York?«, fragte ich rasch.
»Aus Louisville. Dort haben wir gemeinsam unsere weiße Kindheit verbracht. Unsere prächtige weiße –«
»Hast du Nick auf der Veranda dein Herz ausgeschüttet?«, fragte Tom jäh dazwischen.
»Hab ich das?« Sie schaute mich an. »Ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich glaube, wir sprachen über die nordische Rasse. Ja, ganz sicher. Es kam wie aus heiterem Himmel, und ehe man sich’s versieht –«
»Glaub nur nicht alles, was du hörst, Nick«, riet er mir.
Ich sagte leichthin, ich hätte überhaupt nichts gehört, und einige Minuten später erhob ich mich, um nach Hause zu gehen. Sie begleiteten mich zur Tür und standen Seite an Seite in einem fröhlichen Rechteck aus Licht. Als ich den Motor anließ, rief Daisy gebieterisch: »Warte! Ich habe vergessen, dich etwas zu fragen, etwas Wichtiges. Wir haben gehört, dass du draußen im Westen mit einem Mädchen verlobt bist.«
»Stimmt«, bestätigte Tom freundlich. »Wir haben gehört, du hättest dich verlobt.«
»Eine Verleumdung. Dafür bin ich zu arm.«
»Aber wir haben es gehört«, beharrte Daisy und blühte zu meiner Überraschung noch einmal auf wie eine Blume. »Wir haben es von drei Leuten gehört, es muss also wahr sein.«
Ich wusste natürlich, wovon sie sprachen, aber ich war nicht einmal im Ansatz verlobt. Die Tatsache, dass man in der Gerüchteküche bereits das Aufgebot bestellt hatte, war einer der Gründe, warum ich in den Osten gezogen war. Derlei Gerede ist sicher kein Anlass, einer alten Freundin den Laufpass zu geben, andererseits hatte ich nicht vor, mich in eine Ehe hineintratschen zu lassen.
Das Interesse der beiden rührte mich und ließ sie in ihrem Reichtum weniger unerreichbar erscheinen – dennoch war ich verwirrt und leicht verärgert, als ich davonfuhr. Mir schien, das einzig Richtige für Daisy wäre gewesen, wenn sie auf der Stelle das Haus verlassen hätte, mit dem Kind auf dem Arm – doch offenbar hatte sie nichts dergleichen im Sinn. Was Tom betraf, so überraschte mich weniger der Umstand, dass er »so eine Frau in New York hatte«, als dass er sich von einem Buch hatte deprimieren lassen. Irgendetwas ließ ihn an den Rändern schaler Ideen nagen, als könnte seine beharrliche physische Selbstsucht sein herrisches Herz nicht länger ernähren.
Es war bereits Hochsommer auf den Dächern der Rasthäuser und vor den Werkstätten am Straßenrand, wo neue rote Zapfsäulen in Teichen aus Licht thronten, und als ich mein Grundstück in West Egg erreicht hatte, fuhr ich den Wagen in seinen Unterstand und setzte mich für eine Weile auf eine vergessene Rasenwalze in den Garten. Der Wind war abgeflaut und hatte eine geräuschvolle, lebhafte Nacht hinterlassen, erfüllt vom Flügelschlag in den Bäumen und einem beständigen Orgelton aus den vollen Lungen der Erde, die den Fröschen das Leben einbliesen. Der Schattenriss einer Katze flackerte über das Mondlicht, und als ich den Kopf wandte, um ihm zu folgen, bemerkte ich, dass ich nicht allein war – fünfzig Fuß entfernt war eine Gestalt aus dem Dunkel der Nachbarvilla getreten, stand nun da, die Hände in den Taschen vergraben, und betrachtete die silbrigen Sternensprenkel. Irgendetwas an seinen gemächlichen Bewegungen und am festen Stand seiner Füße auf dem Rasen sagte mir, dass dies Mr Gatsby persönlich sein musste, der herauskam, um nachzusehen, welcher Teil unsres hiesigen Himmels der seinige war.
Ich entschloss mich, ihn anzusprechen. Miss Baker hatte beim Essen seinen Namen erwähnt, das sollte als Anknüpfungspunkt genügen. Doch es kam nicht dazu, denn plötzlich ließ er deutlich erkennen, dass er allein sein wollte – er streckte seine Arme auf seltsame Weise gegen das dunkle Wasser hin aus, und trotz der Entfernung hätte ich schwören können, dass er zitterte. Unwillkürlich blickte ich Richtung Meer – und sah dort nichts als ein einzelnes grünes Licht, winzig und weit entfernt, vielleicht am Ende eines Piers. Als ich mich noch einmal nach Gatsby umschaute, war er verschwunden, und ich war wieder allein in der unruhigen Dunkelheit.
Kapitel 2
Etwa auf halber Strecke zwischen West Egg und New York schließt sich die Autostraße urplötzlich der Eisenbahntrasse an und läuft für eine Viertelmeile neben ihr her, als schreckte sie vor einem bestimmten trostlosen Landstrich zurück. Es ist ein Tal der Asche – eine fantastische Farm, wo Asche wie Weizen gedeiht und sich zu Graten und Hügeln und grotesken Gärten auswächst; wo Asche die Form von Häusern und Schloten und Rauchsäulen annimmt und schließlich, mit übernatürlicher Anstrengung, auch die Form aschgrauer Menschen, die sich wie schon zerfallende Schatten durch die pudrige Luft bewegen. Hin und wieder kriecht eine Reihe grauer Waggons über ein unsichtbares Gleis, stößt ein gespenstisches Kreischen aus und kommt zum Stehen, und augenblicklich schwärmen die aschgrauen Menschen mit bleiernen Spaten aus und wirbeln eine undurchdringliche Wolke auf, die ihre düstere Geschäftigkeit vor allen Blicken verbirgt. Oberhalb der grauen Landschaft aber und noch über den trostlosen Staubschwaden, die beständig darüber hinwegziehen, bemerkt man nach einer Weile die Augen von Doktor T. J. Eckleburg. Die Augen von Doktor T. J. Eckleburg sind blau und riesengroß – mit Augäpfeln, fast einen Meter im Durchmesser. Sie schauen aus keinem Gesicht, sondern hinter einer riesigen gelben Brille hervor, die auf einer nicht vorhandenen Nase sitzt. Offenbar hat irgendein Witzbold von Augenarzt sie dort hingepflanzt, um seine Praxis im Stadtbezirk Queens anzukurbeln, und ist anschließend selbst in ewiger Blindheit versunken, oder er hat sie vergessen und ist fortgezogen. Seine Augen jedoch, ein wenig trüb geworden von vielen farblosen Tagen unter Sonne und Regen, brüten weiter über der düsteren Schutthalde.
Das Tal der Asche wird auf einer Seite von einem kleinen stinkenden Fluss begrenzt, und wenn die Brücke hochgezogen ist, um Lastkähne passieren zu lassen, dürfen die Fahrgäste der wartenden Züge bis zu einer halben Stunde lang auf die trostlose Szenerie starren. Man steht dort eigentlich immer wenigstens eine Minute, und bei einer solchen Gelegenheit traf ich zum ersten Mal auf Tom Buchanans Geliebte.
Dass er eine hatte, schien in seinen Kreisen eine allseits bekannte Tatsache zu sein. Die Leute verübelten es ihm, dass er mit ihr in beliebten Lokalen auftauchte und sie am Tisch zurückließ, während er umherschlenderte und mit wer weiß wem plauderte. Obwohl ich durchaus neugierig auf sie war, legte ich keinerlei Wert darauf, ihr zu begegnen – und doch kam es dazu. Eines Nachmittags fuhren Tom und ich mit dem Zug nach New York, und als wir bei den Aschehalden anhielten, sprang er auf, packte mich am Ellbogen und zerrte mich förmlich aus dem Waggon.
»Wir steigen aus«, drängte er. »Ich möchte, dass du mein Mädchen kennenlernst.«
Ich glaube, er hatte zu Mittag einiges in sich hineingeschüttet, und die Art, wie er auf meiner Gesellschaft beharrte, konnte man geradezu hitzig nennen. Selbstherrlich ging er davon aus, dass ich an einem Sonntagnachmittag nichts Besseres vorhatte.
Wir stiegen über einen niedrigen, weiß getünchten Zaun an der Trasse und gingen unter Doktor Eckleburgs starrem Blick etwa hundert Meter die Straße zurück. Das einzige Gebäude weit und breit war ein kleiner Block aus gelben Ziegeln am Rand der Einöde, der über eine Art schmale Hauptstraße zugänglich war und an rein gar nichts angrenzte. Einer der drei Läden, die er beherbergte, war zu vermieten, der zweite ein Restaurant, das die ganze Nacht geöffnet hatte; der dritte war eine Autowerkstatt – Reparaturen. George B. Wilson. An- und Verkauf –, und ich folgte Tom hinein.
Der Innenraum wirkte dürftig und kahl; nur ein einziges Auto war zu sehen, das staubbedeckte Wrack eines Ford, das sich in eine düstere Ecke duckte. Mir schoss bereits durch den Kopf, dass dieser Schatten von einer Werkstatt eine Attrappe sein müsse und dass sich im Obergeschoss wohl romantische Luxus-Apartments verbargen, als in einer Bürotür der Besitzer erschien und sich die Hände an einem alten Lappen abwischte. Er war ein blonder, kraftloser Mann, blutarm und leidlich gut aussehend. Als er uns bemerkte, sprang ein leiser Schimmer der Hoffnung in seine hellblauen Augen.
»Tag, Wilson, mein Alter«, sagte Tom und schlug ihm jovial auf die Schulter. »Was macht das Geschäft?«
»Kann nicht klagen«, erwiderte Wilson wenig überzeugend. »Wann verkaufen Sie mir den Wagen?«
»Nächste Woche; einer meiner Männer arbeitet noch dran.«
»Lässt sich wohl Zeit damit, was?«
»Nein, tut er nicht«, sagte Tom kalt. »Und wenn Sie so darüber denken, sollte ich ihn wohl besser woanders verkaufen.«
»So meinte ich’s nicht«, erklärte Wilson hastig. »Ich meinte nur …«
Seine Stimme verklang, und Tom schaute sich ungehalten in der Werkstatt um. Dann hörte ich Schritte auf der Treppe, und einen Augenblick später schob sich die üppige Gestalt einer Frau vor das durch die Bürotür hereinfallende Licht. Sie war ungefähr Mitte dreißig und etwas füllig, gehörte aber zu den Frauen, die ihre Rundungen mit Sinnlichkeit zu tragen verstehen. Ihr Gesicht über dem getupften Kleid aus dunkelblauem Crêpe de Chine zeigte nicht den leisesten Anflug von Schönheit, doch sie strahlte eine unvermittelt spürbare Vitalität aus, als herrschte in den Nerven ihres Körpers ein beständiges Glühen. Sie lächelte leise, als sie durch ihren Mann hindurchging wie durch einen Geist, schüttelte Tom die Hand und sah ihm dabei direkt in die Augen. Dann befeuchtete sie ihre Lippen, und ohne sich umzudrehen, sagte sie mit leiser, rauchiger Stimme zu ihrem Mann:
»Hol ein paar Stühle, sei so gut, damit man sich setzen kann.«
»Oh, natürlich«, antwortete Wilson eilig, ging in das kleine Büro und verschmolz augenblicklich mit der Zementfarbe der Wände. Ein weißer, aschfahler Staub bedeckte seinen dunklen Anzug und sein bleiches Haar, so wie er alles in der Umgebung bedeckte – ausgenommen Wilsons Frau, die sich nun dicht an Tom heranschob.
»Ich möchte dich sehen«, sagte Tom eindringlich. »Nimm den nächsten Zug.«
»Ist gut.«
»Wir treffen uns am Zeitungsstand, unten am Bahnsteig.«
Sie nickte und entfernte sich wieder von ihm, gerade als Wilson mit zwei Stühlen aus seinem Büro trat.
Wir warteten auf sie außer Sichtweite, ein Stück die Straße hinunter. Es waren nur noch wenige Tage bis zum Vierten Juli, und ein graues, knochiges Italienerkind legte Knallerbsen in einer Reihe auf die Eisenbahnschienen.
»Grässliche Gegend ist das«, sagte Tom und wechselte einen finsteren Blick mit Doktor Eckleburg.
»Zum Fürchten.«
»Es tut ihr gut, hier mal rauszukommen.«
»Hat ihr Mann nichts dagegen?«
»Wilson? Der glaubt, sie besucht ihre Schwester in New York. Der ist so dämlich, der merkt ja nicht mal, dass er lebt.«
Und so machten Tom Buchanan und sein Mädchen und ich uns gemeinsam auf den Weg nach New York – wenn auch nicht eigentlich gemeinsam, denn Mrs Wilson saß diskret in einem anderen Wagen. So viel Rücksicht nahm Tom dann doch auf die Empfindlichkeiten der East Egger, die vielleicht mit im Zug waren.
Mrs Wilson hatte sich umgezogen und trug jetzt ein gemustertes braunes Musselinkleid, das sich über ihre recht breiten Hüften spannte, als Tom ihr in New York auf den Bahnsteig half. Am Zeitungsstand kaufte sie eine Ausgabe des Town Tattle und ein Filmmagazin, im Drugstore etwas Hautcreme und eine kleine Flasche Parfüm. Oben an der pomphaften, hallenden Zufahrt ließ sie vier Taxis davonfahren, ehe sie sich für einen neuen, lavendelfarbenen Wagen mit grauen Polstern entschied, und in diesem glitten wir schließlich aus dem Bahnhofsgetümmel hinaus in den strahlenden Sonnenschein. Doch schon im nächsten Moment wandte sie sich jäh vom Fenster ab, lehnte sich nach vorn und klopfte an die Trennscheibe.
»Ich möchte einen von den Hunden dort haben«, sagte sie feierlich. »Ich möchte einen für die Wohnung. Es ist schön, einen zu haben – einen Hund.«
Wir setzten zurück und hielten bei einem grauen alten Mann, der eine absurde Ähnlichkeit mit John D. Rockefeller hatte. In einem Korb, der um seinen Hals hing, kauerte ein Dutzend erst kürzlich geborener Welpen unbestimmter Rasse.
»Was sind das für welche?«, fragte Mrs Wilson eifrig, als der Mann ans Taxifenster trat.
»Alle möglichen. Was für einen möchte die Dame denn?«
»Ich hätte gern einen dieser Schäferhunde; Sie haben wohl nicht zufällig einen von der Sorte?«
Der Mann spähte skeptisch in den Korb, tauchte seine Hand hinein und zog am Nackenfell einen zappelnden Welpen hervor.
»Das ist kein Schäferhund«, sagte Tom.
»Nein, ein echter Schäferhund ist er nicht«, sagte der Mann und klang etwas enttäuscht. »Schon eher ein Airedale.« Er strich mit der Hand über den flauschigen braunen Rücken. »Sehen Sie sich dieses Fell an. Ein herrliches Fell. Bei dem brauchen Sie jedenfalls keine Sorge zu haben, dass er sich erkältet.«
»Also, ich finde ihn süß«, sagte Mrs Wilson verzückt. »Was kostet er?«
»Der hier?« Er musterte ihn bewundernd. »Der hier kostet Sie zehn Dollar.«
Der Airedale – irgendwo hatte bei ihm zweifellos ein Airedale mitgemischt, auch wenn die Pfoten überraschend weiß waren – wechselte den Besitzer und machte es sich in Mrs Wilsons Schoß bequem, während sie hingerissen sein wetterfestes Fell streichelte.
»Ist es ein Junge oder ein Mädchen?«, fragte sie sanft.
»Der da? Der ist ein Junge.«
»Das ist eine Hündin«, sagte Tom entschieden. »Hier ist Ihr Geld. Kaufen Sie sich davon die nächsten zehn Hunde.«
Wir fuhren hinüber zur Fifth Avenue, die an diesem sommerlichen Sonntagnachmittag warm und mild war, beinahe ländlich. Es hätte mich nicht überrascht, hinter der nächsten Ecke eine große Herde weißer Schafe zu sehen.
»Haltet mal an«, sagte ich, »ich sollte hier aussteigen.«
»Nein, solltest du nicht«, wehrte Tom eilig ab.
»Myrtle wäre gekränkt, wenn du nicht noch mit ins Apartment hinaufkämst. Stimmt’s, Myrtle?«
»Kommen Sie schon«, drängte sie. »Ich werde meine Schwester Catherine anrufen. Sie ist wunderschön – sagen Leute, die es wissen müssen.«
»Tja, wirklich gern, aber …«
Wir fuhren weiter, glitten wieder hinüber auf die andere Seite des Parks und in Richtung Hunderterstraßen der Westside. In der 158. hielt das Taxi vor einem schmalen Stück eines langen weißen Apartmenthaus-Kuchens. Mit dem Blick einer heimkehrenden Majestät schaute Mrs Wilson sich um, griff nach ihrem Hund und ihren übrigen Einkäufen und stolzierte hinein.
»Ich werde die McKees heraufbitten«, verkündete sie, als wir im Fahrstuhl nach oben fuhren. »Und natürlich meine Schwester anrufen.«
Das Apartment befand sich im obersten Stock – ein kleines Wohnzimmer, ein kleines Esszimmer, ein kleines Schlafzimmer und ein Bad. Das Wohnzimmer war bis an die Türen mit einer Garnitur gobelinverzierter, viel zu großer Polstermöbel vollgestellt, und man konnte sich kaum bewegen, ohne über Szenen mit in den Gärten von Versailles schaukelnden Damen zu stolpern. Das einzige Bild war eine zu stark vergrößerte Fotografie, dem Anschein nach eine Henne auf einem verschwommenen Felsen. Betrachtete man es jedoch aus einiger Entfernung, verwandelte sich die Henne in einen Hut und das Antlitz einer fülligen alten Dame strahlte ins Zimmer herab. Auf einem Tisch lagen mehrere ältere Ausgaben des Town Tattle neben einem Exemplar von Simon Called Peter und einigen Broadway-Skandalblättchen. Mrs Wilson kümmerte sich zunächst um den Hund. Ein wenig diensteifriger Liftboy besorgte eine Kiste voll Stroh und etwas Milch und zusätzlich aus eigenem Antrieb eine Dose mit großen, harten Hundekuchen – von denen einer den ganzen Nachmittag über in der Untertasse mit Milch lag und sich apathisch in seine Bestandteile auflöste. Tom holte inzwischen aus einer verschlossenen Kommode eine Flasche Whiskey hervor.
Ich bin nur zweimal in meinem Leben betrunken gewesen, und an jenem Nachmittag war das zweite Mal; daher liegt ein trüber, dunstiger Schleier über allem, was geschah, obwohl das Apartment noch bis nach acht von freundlichem Sonnenlicht erfüllt war. Mrs Wilson saß auf Toms Schoß und rief mehrere Leute an; irgendwann hatten wir keine Zigaretten mehr, und ich ging los, um im Drugstore an der Ecke welche zu kaufen. Als ich zurückkam, waren die beiden verschwunden, also setzte ich mich diskret ins Wohnzimmer und las ein Kapitel von Simon Called Peter – entweder war es fürchterlich schlecht oder der Whiskey verzerrte die Dinge, denn es ergab nicht den leisesten Sinn für mich.
Kaum waren Tom und Myrtle (nach dem ersten Drink nannten Mrs Wilson und ich uns beim Vornamen) wieder aufgetaucht, als nach und nach schon die Gäste vor der Apartmenttür standen.
Die Schwester, Catherine, war eine schlanke, weltzugewandte Frau um die dreißig mit einem dichten, steifen Schopf roter Haare und einem milchweiß gepuderten Teint. Ihre Augenbrauen waren gezupft und anschließend in etwas kühnerem Winkel nachgezogen worden, doch das Bestreben der Natur, die alte Linienführung wiederherzustellen, gab ihrem Gesicht einen verschwommenen Ausdruck. Wenn sie sich bewegte, war ein stetes Klirren zu hören von unzähligen Emailreifen, die an ihren Armen auf und ab klimperten. Sie rauschte mit derartiger Selbstverständlichkeit herein und blickte mit solcher Besitzermiene auf das Mobiliar, dass ich mich fragte, ob sie hier wohne. Doch als ich sie darauf ansprach, lachte sie unmäßig, wiederholte laut meine Frage und erklärte mir, sie wohne mit einer Freundin in einem Hotel.
Mr McKee war ein blasser, femininer Mann aus der Wohnung ein Stockwerk tiefer. Er hatte sich wohl frisch rasiert, denn auf seiner Wange saß noch ein weißer Schaumfleck, und er begrüßte jeden im Raum höchst ehrerbietig. Er teilte mir mit, er sei in der »Kunstbranche«, und später erfuhr ich, dass er Fotograf war und das unscharf vergrößerte Bild von Mrs Wilsons Mutter gemacht hatte, das wie ein Ektoplasma an der Wand hing. Seine Frau war schrill, träge, hübsch und nicht auszuhalten. Stolz erzählte sie mir, ihr Mann habe sie seit ihrer Hochzeit einhundertsiebenundzwanzigmal fotografiert.
Mrs Wilson hatte sich bereits einige Zeit zuvor umgezogen und trug jetzt ein aufwendiges Nachmittagskleid aus cremefarbenem Chiffon, das ein beständiges Rascheln von sich gab, während sie durch den Raum glitt. Unter dem Einfluss des Kleides hatte sich ihre Ausstrahlung verändert. Die kraftvolle Vitalität, die in der Werkstatt so auffallend gewesen war, verwandelte sich in imposanten Hochmut. Ihr Lachen, ihre Gesten, ihre Bemerkungen gerieten ihr jeden Moment noch affektierter, und während sie sich aufplusterte, wurde der Raum um sie her immer kleiner, bis sie sich auf einem lärmenden, quietschenden Angelpunkt durch die rauchige Luft zu drehen schien.
»Meine Liebe«, rief sie ihrer Schwester in hoher, gezierter Tonlage zu, »die meisten dieser Leute betrügen dich, wo sie können. Die denken doch nur ans Geld. Letzte Woche hatte ich eine Frau hier wegen meiner Füße, und als sie mir die Rechnung gab, hätte man denken können, sie hätte mir den Blinddarm rausgenommen.«
»Wie hieß diese Frau noch gleich?«, fragte Mrs McKee.
»Mrs Eberhardt. Sie kommt zur Fußpflege zu den Leuten nach Hause.«
»Ich mag Ihr Kleid«, bemerkte Mrs McKee, »ich finde es hinreißend.«
Mrs Wilson verschmähte das Kompliment, indem sie verächtlich eine Augenbraue hochzog.
»Das ist bloß ein komischer alter Fetzen«, sagte sie. »Ab und zu zieh ich ihn über, wenn’s mir egal ist, wie ich aussehe.«
»Aber Sie sehen fabelhaft darin aus, Sie wissen schon, was ich meine«, fuhr Mrs McKee fort. »Wenn Chester Sie in dieser Pose vors Objektiv bekäme, könnte er ganz sicher was draus machen.«
Wir alle schauten schweigend auf Mrs Wilson, die sich eine Haarsträhne aus den Augen strich und unsere Blicke mit einem strahlenden Lächeln erwiderte. Mr McKee betrachtete sie eingehend mit schief gelegtem Kopf und bewegte dann langsam eine Hand vor seinem Gesicht hin und her.
»Ich müsste das Licht ändern«, sagte er nach einer Weile. »Ich würde gern die Form der Gesichtszüge herausarbeiten. Und ich würde versuchen, das ganze hintere Haar zu erwischen.«
»Auf keinen Fall würde ich das Licht ändern!«, rief Mrs McKee. »Ich finde es –«
Ihr Mann machte »Sch!« und wir alle blickten wieder auf das Motiv, woraufhin Tom Buchanan geräuschvoll gähnte und aufstand.
»Ihr McKees werdet jetzt erst mal was trinken«, sagte er. »Besorg mehr Eis und Mineralwasser, Myrtle, bevor hier noch alle einschlafen.«
»Ich hatte schon diesem Boy gesagt, er soll Eis holen.« Myrtle runzelte verzweifelt über die Nachlässigkeit der niederen Ränge die Stirn. »Diese Leute! Ständig muss man hinter ihnen her sein.«
Sie schaute mich an und lachte sinnlos. Dann stürzte sie sich auf den Hund, küsste ihn ekstatisch und rauschte in die Küche, als wartete dort ein Dutzend Köche auf ihre Anweisungen.
»Draußen auf Long Island hab ich einige schöne Sachen gemacht«, erklärte Mr McKee.
Tom sah ihn ausdruckslos an.
»Zwei davon haben wir gerahmt unten hängen.«
»Zwei was?«, wollte Tom wissen.
»Zwei Studien. Die eine nenne ich ›Montauk Point – Die Möwen‹ und die andere ›Montauk Point – Das Meer‹.«
Die Schwester, Catherine, setzte sich neben mich auf die Couch.
»Wohnen Sie auch drüben auf Long Island?«, fragte sie.
»Ich wohne in West Egg.«
»Wirklich? Vor ungefähr einem Monat war ich dort auf einer Party. Bei einem Mann namens Gatsby. Kennen Sie ihn?«
»Ich wohne direkt nebenan.«
»Also, es heißt, er wär ein Neffe oder Cousin von Kaiser Wilhelm. Da soll er auch sein ganzes Geld herhaben.«
»Tatsächlich?«
Sie nickte.
»Ich hab Angst vor ihm. Ich will ihm um keinen Preis in die Quere kommen.«
Diese fesselnden Mitteilungen über meinen Nachbarn wurden von Mrs McKee unterbrochen, die plötzlich auf Catherine zeigte:
»Chester, aus ihr könntest du doch bestimmt was machen«, hob sie an, aber Mr McKee nickte nur gelangweilt und wandte sich wieder Tom zu.
»Ich würde gern öfter auf Long Island arbeiten, wenn mich nur irgendwer bei den Leuten dort einführen würde. Einen guten Einstieg, mehr brauche ich gar nicht.«
»Fragen Sie Myrtle«, sagte Tom und lachte laut auf, als Mrs Wilson mit einem Tablett hereinkam. »Sie schreibt Ihnen sicher eine Empfehlung, stimmt’s, Myrtle?«
»Was tue ich?«, fragte sie entgeistert.
»Du schreibst Mr McKee eine Empfehlung für deinen Mann, damit er ein paar Studien von ihm machen kann.« Seine Lippen bewegten sich tonlos, während er überlegte. »›George B. Wilson an der Zapfsäule‹ oder etwas in der Art.«
Catherine beugte sich zu mir herüber und flüsterte mir ins Ohr: »Die beiden können ihre Ehegatten nicht ausstehen.«
»Nicht?«
»Nicht ausstehen.« Sie schaute auf Myrtle, dann auf Tom. »Was ich sagen will, ist, warum mit jemandem zusammenleben, den man nicht ausstehen kann? Wenn ich sie wäre, ich würde mich scheiden lassen und auf der Stelle heiraten.«
»Kann sie Wilson denn auch nicht leiden?«
Die Antwort darauf war unerwartet. Sie kam von Myrtle, die die Frage gehört hatte, und sie war ungestüm und schamlos.
»Da sehen Sie’s!«, rief Catherine triumphierend. Dann senkte sie ihre Stimme wieder. »Eigentlich ist es seine Frau, die ihnen im Weg steht. Sie ist Katholikin, und die halten nichts von Scheidung.«
Daisy war nicht katholisch, und ich war ein wenig entsetzt über die Raffinesse dieser Lüge.
»Und wenn sie irgendwann doch heiraten«, fuhr Catherine fort, »gehen sie für eine Zeit lang in den Westen, bis der Sturm sich gelegt hat.«
»Klüger wär’s, nach Europa zu gehen.«
»Oh, Sie mögen Europa?«, rief sie unvermittelt. »Ich war gerade erst in Monte Carlo.«
»Tatsächlich.«
»Erst letztes Jahr. Ich war mit einer Freundin drüben.« »Für länger?«
»Nein, wir fuhren nach Monte Carlo und wieder zurück. Über Marseille. Bei unserer Ankunft hatten wir zwölfhundert Dollar, aber die haben sie uns an den Spieltischen in nur zwei Tagen abgeknöpft. Die Rückfahrt war fürchterlich, sage ich Ihnen. Gott, wie ich diese Stadt gehasst habe!«
Der Spätnachmittagshimmel erstrahlte hinter dem Fenster einen Augenblick lang im honigsüßen Blau des Mittelmeers – dann rief Mrs McKees schrille Stimme mich wieder ins Zimmer zurück.
»Mir wäre auch beinahe mal ein Malheur passiert«, erklärte sie lebhaft. »Ich hätte beinah irgend so ein Jüdchen geheiratet, das jahrelang hinter mir her war. Ich wusste, er stand unter mir. Alle sagten mir immer wieder: ›Lucille, dieser Mann steht weit unter dir!‹ Aber wenn ich Chester nicht begegnet wäre, hätte er mich gekriegt, ganz sicher.«
»Ja, aber wissen Sie«, sagte Myrtle Wilson und nickte dazu mit dem Kopf, »wenigstens haben Sie ihn nicht geheiratet.«
»Hab ich nicht, nein.«
»Tja, ich hab ihn geheiratet«, sagte Myrtle zweideutig. »Und das ist der Unterschied zwischen ihrem Fall und meinem.«
»Warum eigentlich, Myrtle?«, wollte Catherine wissen. »Kein Mensch hat dich gezwungen.«
Myrtle überlegte.
»Ich habe ihn geheiratet, weil ich dachte, er wäre ein Gentleman«, sagte sie schließlich. »Ich dachte, er wüsste, wie man sich benimmt, dabei war er es nicht mal wert, meine Stiefel zu lecken.«
»Eine Zeit lang warst du verrückt nach ihm«, sagte Catherine.
»Verrückt nach ihm!«, rief Myrtle ungläubig. »Wer sagt, dass ich verrückt nach ihm war? Ich war genauso wenig verrückt nach ihm wie nach diesem Mann da.«
Sie zeigte plötzlich auf mich, und alle sahen mich vorwurfsvoll an. Mit meinem Gesichtsausdruck versuchte ich klarzustellen, dass ich derlei Zuneigung auch nicht erwartete.
»Verrückt war ich nur, als ich ihn heiratete. Ich hab gleich gemerkt, dass es ein Fehler war. Für die Hochzeit hatte er sich bei irgendwem einen Anzug geborgt und mir dann noch nicht mal davon erzählt, und eines Tages, er war nicht da, kam dieser andere und wollte ihn wiederhaben. ›Oh, das ist Ihr Anzug?‹, sagte ich. ›Das höre ich nun wirklich zum ersten Mal.‹ Aber ich gab ihn ihm, und dann legte ich mich hin und heulte mir den ganzen Nachmittag die Augen aus.«
»Sie sollte wirklich zusehen, dass sie von ihm wegkommt«, nahm Catherine an mich gewandt das Gespräch wieder auf. »Seit elf Jahren leben sie jetzt über dieser Werkstatt. Und Tom ist der erste Liebhaber, den sie je hatte.«
Die Flasche Whiskey – eine zweite – fand nun regen Zuspruch bei allen Anwesenden, mit Ausnahme von Catherine, die sich »ohne ebenso wohl fühlte«. Tom läutete nach dem Portier und ließ ihn ein paar hochgelobte Sandwichs bringen, die allein ein vollwertiges Abendessen darstellten. Ich wollte hinaus und ostwärts in Richtung Park durch die sanfte Dämmerung spazieren, doch jedes Mal wenn ich zu gehen versuchte, wurde ich in irgendeine wilde, hitzige Debatte verwickelt, die mich wie mit Stricken auf meinen Stuhl zurückzog. Dennoch, hoch über der Stadt musste unsere Reihe gelber Fenster für den zufälligen Betrachter in den allmählich dunkel werdenden Straßen etwas beitragen zum Geheimnis menschlicher Verborgenheit, und der war ich auch, schaute hinauf und wunderte mich. Ich war drinnen und draußen, zugleich verzaubert und abgestoßen von der unerschöpflichen Vielfalt des Lebens.
Myrtle zog ihren Stuhl dicht an meinen heran, und unversehens verströmte ihr warmer Atem über mir die Geschichte ihrer ersten Begegnung mit Tom.