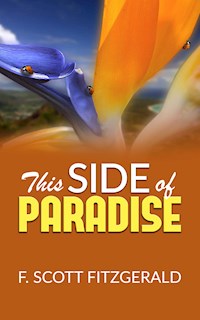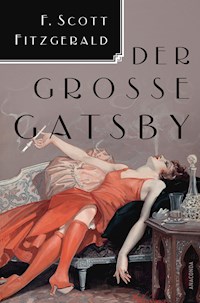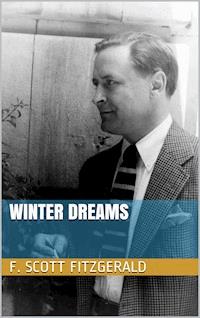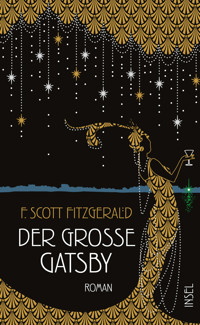Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SK Digital Classics
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
F. Scott Fitzgeralds schillernder Roman "Zärtlich ist die Nacht" entführt uns an die französische Riviera der späten 1920er Jahre, wo der vielversprechende Psychiater Dick Diver mit seiner schönen und reichen Frau Nicole ein Leben in glamouröser Leichtigkeit führt. In ihrem mondänen Strandhaus versammeln sie die High Society des Jazz Age um sich – bis die junge Schauspielerin Rosemary Hoyt in ihrer Villa auftaucht. Je stärker die verhängnisvolle Anziehung zwischen Dick und Rosemary wächst, desto deutlicher bröckelt die Fassade des Ehepaar Divers. Nach und nach enthüllt sich die Wahrheit: Nicoles traumatische Vergangenheit bricht durch. Dicks berufliche Ambitionen verblassen, und aus dem Arzt, der einst seine Patientin heiratete, wird ein Mann, der selbst Halt sucht. Ein präzises Porträt vom Aufstieg und Fall eines Mannes, der zwischen Liebe, Pflicht und Selbstzerstörung seine eigene Identität verliert – erzählt in der geschliffenen Sprache eines der größten amerikanischen Autoren des 20. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
F. Scott Fitzgerald
Zärtlich ist die Nacht
Vollständige deutsche Ausgabe
Copyright © 2024 Novelaris Verlag
ISBN: 978-3-68931-117-9
Inhaltsverzeichnis
Motto
Erstes Buch
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Zweites Buch
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Drittes Buch
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Viertes Buch
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Fünftes Buch
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Cover
Table of Contents
Text
Motto
Already with thee! tender is the night,
But here there is no light,
Save what from heaven is with the breezes blown
Through verdurous glooms and winding mossy ways.
Ode to a Nightingale
Erstes Buch
I
Im Frühling 1917, als Doktor Richard Diver zum ersten Mal nach Zürich kam, war er sechsundzwanzig Jahre alt, ein schönes Alter für einen Mann, ja eigentlich der Höhepunkt der Junggesellenjahre. Selbst während des Krieges war es ein schönes Alter für Dick, der bereits zu wertvoll war und eine zu große Kapitalanlage darstellte, um als Kanonenfutter zu dienen. In späteren Jahren wollte es ihm scheinen, als sei er auch aus dieser Freistatt nicht leichten Kaufes davongekommen, doch wurde er sich über diesen Punkt nie ganz schlüssig – 1917 lachte er über diesen Gedanken und sagte zu seiner Entschuldigung, der Krieg berühre ihn überhaupt nicht. Die Verfügung seiner örtlichen Behörde lautete dahin, daß er sein Studium in Zürich beenden und promovieren solle, wie er es vorhatte.
Die Schweiz war eine Insel, auf der einen Seite von den donnernden Wogen bei Goertz, auf der anderen von der Brandung an der Somme und der Aisne umtobt. Vorläufig schienen sich mehr interessante Fremde als Kranke in den Kantonen aufzuhalten, doch war das lediglich eine Vermutung – die Männer, die in den kleinen Cafés in Bern und Genf miteinander flüsterten, konnten ebenso gut Diamantenhändler oder Geschäftsreisende sein. Jeder indessen hatte die langen Züge mit Blinden, Einbeinigen und Sterbenden gesehen, die zwischen den glitzernden Seen von Konstanz und Neuchâtel aneinander vorbeifuhren. In Bierhallen und Schaufenstern hingen bunte Plakate, auf denen gezeigt wurde, wie die Schweizer 1914 ihre Grenzen verteidigten; Kampfgeist atmende junge und alte Männer starrten von den Bergen auf Franzosen und Deutsche hinab, die nur in ihrer Vorstellung existierten; der Zweck dieser Plakate war, dem schweizerischen Herzen die Gewißheit zu geben, daß es an dem allgemeinen Kampfrausch jener Tage teilhatte. Als das Morden anhielt, verblichen die Plakate, und kein Land war überraschter als die Schwesterrepublik, als die Vereinigten Staaten in den Krieg eintraten.
Doktor Diver hatte bis dahin den Krieg nur am Rande erlebt. 1914 war er ein Oxford Rhodes-Student aus Connecticut. Er kehrte nach Hause zurück, um das letzte Jahr in John Hopkins zu studieren, wo er promovierte. 1916 ging er nach Wien, aus dem Gefühl heraus, der große Freud könne, wenn er sich nicht beeile, eventuell einer Fliegerbombe zum Opfer fallen. Damals schon war Wien eine tote Stadt, aber es gelang ihm, genügend Kohle und Petroleum aufzutreiben, um in seinem Zimmer in der Damenstiftsgasse zu sitzen und an den Broschüren zu schreiben, die er später vernichtete, die jedoch, als er sie von neuem schrieb, das Gerüst zu dem Buch bildeten, das er 1920 in Zürich veröffentlichte.
Die meisten von uns haben eine Zeit in ihrem Leben, die ihnen besonders lieb ist und besonders heroisch erscheint; für Dick Diver war es diese Zeit. Schon darum, weil er keine Ahnung hatte, daß er bezaubernd war, daß die Zuneigung, die er gab und hervorrief, unter gesunden Menschen ungewöhnlich ist. In seinem letzten Jahr in New Haven nannte ihn jemand gesprächsweise »Dick im Glück« – der Name ging ihm nicht aus dem Kopf.
»Dick im Glück, du alter Döskopp«, flüsterte er sich zu, wenn er vor dem letzten brennenden Holzscheit in seinem Zimmer auf und nieder ging. »Du hast das Glück beim Schopf gefaßt. Niemand wußte etwas davon, bevor du kamst.«
Zu Beginn des Jahres 1917, als es schwierig wurde, Kohlen zu bekommen, benutzte Dick als Heizmaterial fast hundert Lehrbücher, die sich bei ihm angesammelt hatten, und bei jedem einzelnen, das er den Flammen überantwortete, freute er sich innerlich über die Feststellung, daß er selbst einen Auszug dessen darstellte, was die Bücher enthielten, und daß er es fünf Jahre später zusammenfassend würde wiedergeben können, sofern sich eine Wiedergabe lohnte. Dies setzte er durch manche Stunde fort, wenn nötig mit einem Teppich um die Schultern, durchtränkt vom sanften Seelenfrieden des Studierenden, der von allen Dingen der Welt dem himmlischen Frieden am nächsten kommt. Doch sollte er, wie nun gezeigt werden wird, ein Ende haben.
Daß er noch eine Zeitlang vorhielt, verdankte er seinem Körper, den er in New Haven beim Rundlauf und jetzt durch das Schwimmen in der winterlich kalten Donau gestählt hatte. Mit Elkins, dem zweiten Sekretär der Gesandtschaft, teilte er sein Zimmer, zwei hübsche Mädchen besuchten sie zuweilen – doch war weder von ihnen noch von der Gesandtschaft zuviel zu spüren. Die Berührung mit Ed Elkins weckte in ihm zum erstenmal schwache Zweifel am Wert seines eigenen Denkens; er konnte nicht sehen, daß es sich grundlegend von Elkins’ Art zu denken unterschied – Elkins, der alle New Havener Außen- und Mittelläufer der letzten dreißig Jahre namentlich aufzählen konnte.
»– Und, ›Dick im Glück‹ kann nicht einer von diesen schlauen Burschen sein; er muß weniger intakt sein, einen kleinen Knacks haben. Und wenn’s das Leben nicht für ihn tut, ist es auch kein Ersatz, sich eine Krankheit, ein gebrochenes Herz oder einen Minderwertigkeitskomplex zu holen, obwohl es hübsch sein muß, an etwas Zerbrochenem herumzudoktern, bis es besser ist als die ursprüngliche Form.«
Er machte sich über seine Gedankengänge lustig, nannte sie gleisnerisch und »amerikanisch« – sein Kriterium für undurchdachtes Wortemachen war, daß er es als amerikanisch empfand. Und doch wußte er, daß er seine Intaktheit mit Unvollkommenheit würde bezahlen müssen.
»Das Beste, was ich dir wünschen kann, mein Kind«, so sagt die Fee Schwarzdorn in Thackerays ›Die Rose und der Ring‹, »ist ein wenig Unglück.«
In gewissen Stimmungen zerpflückte er seine eigenen Gedankengänge: »Konnte ich etwas dafür, daß Pete Livingstone am Wahltag im Umkleideraum saß, als ihn alle wie eine Stecknadel suchten? Und ich wurde gewählt, obwohl ich so wenig Leute kannte? Er war gut und richtig, und ich hätte statt seiner im Umkleideraum sitzen müssen. Vielleicht hätte ich’s, wenn ich geglaubt hätte, Chancen bei der Wahl zu haben. Aber in all den Wochen kam Mercer dauernd in mein Zimmer. Ich nehme an, ich wußte ganz gut, daß ich Aussichten hatte, ganz gut. Aber es wäre mir recht geschehen, wenn ich meine Suppe hätte auslöffeln müssen und einen Konflikt heraufbeschworen hätte.«
Nach den Vorlesungen an der Universität pflegte er diesen Punkt mit einem jungen intellektuellen Rumänen zu erörtern, der ihm versicherte: »Wir haben keinen Beweis dafür, daß Goethe jemals einen ›Konflikt‹ im modernen Sinne gekannt hat oder ein Mann wie Jung, zum Beispiel. Du bist kein romantischer Philosoph – du bist Wissenschaftler: Gedächtnis, Kraft, Charakter – besonders Vernunft. Die Schwierigkeit für dich wird darin bestehen, Selbstkritik zu üben. Ich lernte einmal einen Mann kennen, der zwei Jahre am Gehirn eines Gürteltiers arbeitete, in der Meinung, er werde über kurz oder lang mehr über das Gehirn des Gürteltiers wissen als jeder andere. Ich versuchte, ihn davon zu überzeugen, daß er dabei den menschlichen Bereich aus dem Auge verlor – das Thema war zu fernliegend. Und richtig, als er die Arbeit an die medizinische Zeitschrift einschickte, wurde sie abgelehnt – eine Abhandlung von einem anderen über dasselbe Thema war gerade angenommen worden.«
Dick ging nach Zürich, mit weniger Achillesfersen, als zur Ausstattung eines Tausendfüßlers benötigt werden, aber mit einer Unmenge von Illusionen – Illusionen über ewigwährende Kraft und Gesundheit und über das eingeborene Gute im Menschen; Illusionen über eine Nation, über die Lügen von Generationen von Grenzlandmüttern, die ihren Kindern vorsingen mußten, daß keine Wölfe vor der Hütte lauerten. Nachdem er promoviert hatte, erhielt er den Befehl, sich zu einer Neurologeneinheit zu verfügen, die in Bar-sur-Aube aufgestellt wurde. In Frankreich war die Arbeit zu seinem Ärger mehr verwaltungstechnisch als praktisch. Als Ausgleich fand er genügend Zeit, seinen kurzen Leitfaden zu beenden und Material für sein nächstes Werk zu sammeln. Im Frühling 1919 wurde er entlassen und ging nach Zürich zurück.
Das Vorhergehende klingt nach Biographie, der die Befriedigung des sicheren Wissens fehlt, daß der Held – wie der in seinem Kramladen in Galena herumlungernde Grant – zu einem verwickelten Schicksal berufen ist. Zur Beruhigung sei es gesagt: Dick Divers kritisches Stadium hebt nunmehr an.
II
Es war ein feuchter Apriltag mit schrägen Wolken über dem Albishorn und trägem Wasser tiefer unten. Zürich sieht einer amerikanischen Stadt nicht unähnlich. Dick hatte die ganze Zeit seit seiner Ankunft vor zwei Tagen etwas vermißt und merkte jetzt, es war das Gefühl, das er in engen französischen Gassen gehabt hatte, das Gefühl, daß es weiter nichts gebe. In Zürich gab es eine Menge außer Zürich – die Dächer leiteten die Blicke hinauf zu Kuhweiden mit Glockengeläut, die sich ihrerseits weiter oben in Bergspitzen verwandelten – so war das Leben ein senkrechter Anstieg zu einem Postkartenhimmel. Die Alpenländer, die Heimat des Spielzeugs, der Drahtseilbahnen, der Karussells und des Kuhreigens, waren nichts zum Heimischfühlen wie Frankreich, wo einem französische Weinranken auf der Erde über die Füße wachsen.
In Salzburg hatte Dick einst den aufgesetzten Wert eines gekauften und geliehenen Musik Jahrhunderts empfunden; einmal, als er sich im Universitätslaboratorium in Zürich vorsichtig zur Rinde eines Gehirns vorgetastet hatte, war er sich eher wie ein Spielzeugmacher vorgekommen als wie der Wirbelsturm, der vor zwei Jahren durch die alten roten Gebäude von Hopkins gerast war, ungehindert durch die Ironie der gewaltigen Christusstatue in der Eingangshalle.
Dennoch hatte er sich entschlossen, noch zwei Jahre in Zürich zu bleiben, denn er unterschätzte keineswegs den Wert des Spielzeugmachens, den Wert unendlicher Genauigkeit und unendlicher Geduld.
Heute ging er aus, um Franz Gregorovius in Dohmlers Klinik am Zürichsee zu besuchen. Franz, der als Pathologe in der Klinik wohnte, von Geburt Waadtländer und ein paar Jahre älter war als Dick, erwartete ihn an der Straßenbahn-Haltestelle. Er hatte etwas von Cagliostros dunklem, prächtigem Aussehen, das im Gegensatz zu seinen Augen stand, die denen eines Heiligen glichen. Er war der dritte in der Reihe der Gregoroviusse – sein Großvater war Kraepelins Lehrer gewesen, zu einer Zeit, als die Psychiatrie gerade aus dem Dunkel der Zeiten hervortrat. Charakterlich war er stolz, leidenschaftlich und gutmütig – er hielt sich für einen Hypnotiseur. Wenn sich auch das ursprüngliche Genie der Familie ein wenig erschöpft hatte, würde Franz doch zweifellos ein guter Kliniker werden.
Auf dem Weg zur Klinik sagte er: »Erzähl mir von deinen Erfahrungen im Krieg. Bist du auch so verändert wie die andern? Du hast dasselbe alterslose amerikanische Gesicht wie früher.«
»Ich hab’ nichts vom Krieg gemerkt«, sagte Dick. »Du mußt es aus meinen Briefen gesehen haben.«
»Das macht nichts – wir haben einige Bombenschocks hier, die nur von weitem einen Fliegerangriff gehört haben. Ein paar sind da, die nur davon in der Zeitung lasen.«
»Das hört sich ziemlich unsinnig an.«
»Vielleicht, Dick. Aber wir sind eine Klinik für reiche Leute – wir benutzen das Wort Unsinn nicht. Sei mal ganz offen, kommst du zu mir oder zu dem Mädchen?«
Sie blickten sich von der Seite an; Franz lächelte hintergründig.
»Natürlich habe ich die ersten Briefe gelesen«, sagte er in dienstlichem Baß. »Als die Veränderung begann, hat mich mein Zartgefühl davon abgehalten, noch weitere zu öffnen. In Wirklichkeit war es ja dein Fall geworden.«
»Es geht ihr also gut?« fragte Dick.
»Tadellos. Ich betreue sie, wie ich überhaupt die Mehrzahl der englischen und amerikanischen Patienten betreue. Sie nennen mich Doktor Gregory.«
»Ich werde dir erklären, welche Bewandtnis es mit dem Mädchen hat«, sagte Dick. »Tatsache ist, daß ich sie nur ein einziges Mal gesehen habe. Als ich herauskam, um mich von dir zu verabschieden, kurz bevor ich nach Frankreich ging. Es war das erstemal, daß ich meine Uniform trug, und ich fühlte mich in ihr sehr fehl am Platze – grüßte gemeine Soldaten und lauter so Zeug.«
»Warum hast du sie heute nicht an?«
»Ha! Ich bin doch vor drei Wochen entlassen worden. Hier ist der Weg, auf dem ich das Mädchen zufällig traf. Als ich dich verlassen hatte, ging ich zu deinem Haus am See, um mein Rad zu holen.«
»– zu den Zedern hin?«
»– ein wunderbarer Abend, weißt du – der Mond stand über dem Berg –«
»Dem Kreuzegg.«
»– Ich holte eine Pflegerin und ein junges Mädchen ein. Ich hielt das Mädchen nicht für eine Patientin; ich fragte die Pflegerin nach den Abfahrtszeiten der Straßenbahn, und wir gingen nebeneinander her. Das Mädchen war mit das hübscheste Ding, das ich je gesehen hatte.«
»Sie ist es noch.«
»Sie hatte noch nie eine amerikanische Uniform gesehen, und wir unterhielten uns und dachten uns nichts dabei.« Er hielt inne, da er einen Ausblick wiedererkannte, und fuhr dann fort: »Du mußt bedenken, Franz, daß ich noch nicht so abgebrüht bin wie du. Wenn ich eine so wunderschöne Schale sehe, kann ich nicht umhin, über das, was darin steckt, betrübt zu sein. Das war alles – bis die Briefe kamen.«
»Es war das beste, was ihr passieren konnte«, sagte Franz dramatisch, »ein Zusammentreffen, vom Zufall beschert. Darum habe ich dich abgeholt, obwohl es ein sehr besetzter Tag ist. Ich möchte, daß du zu mir ins Büro kommst und lange mit mir sprichst, bevor du sie siehst. Ich habe sie nämlich nach Zürich geschickt, um Einkäufe zu machen.« Seine Stimme klang gestrafft vor Begeisterung. »Ich habe sie sogar ohne Pflegerin geschickt, mit einer weniger stabilen Patientin. Ich bin unendlich stolz auf diesen Fall, den ich mit deiner zufälligen Hilfe behandelt habe.«
Das Auto war am Ufer des Zürichsees entlanggefahren und dann in eine fruchtbare Landschaft mit Viehweiden und sanften Hügeln voller Chalets eingebogen. Die Sonne schwamm in einem blauen Himmelsmeer, und plötzlich war es ein Schweizer Tal, wie man es sich schöner nicht denken konnte, mit lieblichen Klängen und Gemurmel und dem guten, frischen Duft nach Gesundheit und Frohsinn.
Professor Dohmlers Anstalt bestand aus drei alten und zwei neuen Gebäuden und lag zwischen einer kleinen Anhöhe und dem Ufer des Sees. Bei ihrer Gründung, zehn Jahre zuvor, war sie die erste moderne Klinik für Geisteskrankheiten gewesen; auf den ersten Blick hätte kein Laie eine Zufluchtsstätte für die Gebrochenen, Defekten, Gemeingefährlichen dieser Welt in ihr gesehen, wenngleich zwei Gebäude von verdächtig hohen, weinbewachsenen Mauern umgeben waren. Ein paar Männer harkten in der Sonne Stroh zusammen. Als sie durch die Parkanlagen fuhren, kamen sie hier und da an einer Krankenschwester vorbei, die mit wippender weißer Flügelhaube neben einem Patienten herging.
Nachdem er Dick in sein Büro geführt hatte, entschuldigte sich Franz auf eine halbe Stunde. Allein geblieben, durchschritt Dick den Raum und versuchte, sich Franzens Persönlichkeit aus der Unordnung auf seinem Schreibtisch, aus seinen Büchern und den Büchern, die seinem Vater und Großvater gehört und die sie geschrieben hatten, zu rekonstruieren; auch aus einer riesigen, rötlich kolorierten Photographie des ersteren, die, schweizerischer Sitte folgend, an der Wand hing. Es roch nach Rauch im Zimmer; Dick stieß das französische Fenster auf und ließ einen Streifen Sonnenlicht herein. Unversehens wandten sich seine Gedanken der Patientin, dem jungen Mädchen, zu.
Er hatte ungefähr fünfzig Briefe von ihr bekommen, die sie während eines Zeitraumes von acht Monaten an ihn geschrieben hatte. Im ersten hatte sie, sich entschuldigend, erklärt, sie habe aus Amerika gehört, daß Mädchen an unbekannte Soldaten schrieben. Sie habe Namen und Adresse von Doktor Gregory erhalten und hoffe, er werde nichts dagegen haben, wenn sie ihm zuweilen ein paar Zeilen mit guten Wünschen schicken würde, etc. etc.
Bis dahin war es leicht, den Ton zu erkennen – er stammte aus »Daddy Long-Legs« und »Molly-Make-Believe«, munter-sentimentalen Briefsammlungen, die sich in den Staaten großer Beliebtheit erfreuten. Aber dann hörte die Ähnlichkeit auf.
Die Briefe zerfielen in zwei Kategorien, von denen die erste, bis zur Zeit des Waffenstillstandes ungefähr, einen ausgesprochen pathologischen Charakter trug, wogegen die zweite, die sich von jenem Zeitpunkt bis zur Gegenwart erstreckte, durchaus normal war und einen schön herangereiften Charakter verriet. Auf diese späteren Briefe hatte Dick in den letzten langweiligen Monaten in Bar-sur-Aube schließlich mit Ungeduld gewartet, aber auch aus den früheren Briefen hatte er sich mehr zusammengereimt, als Franz wohl vermutet hätte.
Mon Capitaine:
Als ich Sie in Ihrer Uniform sah, fand ich Sie so schön. Dann dachte ich: Je m’en fiche! auf französisch und auch auf deutsch. Sie fanden mich ebenfalls hübsch, aber das kenne ich von früher und habe es lange ertragen. Wenn Sie wieder mit solchem niederträchtigen und verbrecherischen Benehmen herkommen, das so gar nicht dem entspricht, was man mir beigebracht hat, als gentlemanlike anzusehen, möge Ihnen der Himmel gnädig sein. Immerhin, Sie scheinen ruhiger zu sein als die anderen, ganz sanft, wie eine große Katze. Ich habe immer nur Jungen gern gehabt, die ziemliche Schwächlinge waren. Sind Sie ein Schwächling? Irgendwo gab es welche.
Entschuldigen Sie dies alles, das ist der dritte Brief, den ich Ihnen schreibe, und ich werde ihn sofort abschicken, sonst werde ich ihn nie abschicken. Ich habe auch sehr viel über den Mondschein nachgedacht, und ich könnte eine Menge Zeugen beibringen, wenn ich bloß hier heraus könnte.
Es ist mir gesagt worden, Sie seien Arzt, aber solange Sie eine Katze sind, ist es etwas anderes. Mein Kopf tut so weh, darum entschuldigen Sie; dieser Spaziergang einer gewöhnlichen mit einer weißen Katze ist, glaube ich, eine Erklärung dafür. Ich spreche drei Sprachen, mit Englisch vier, und ich glaube bestimmt, ich könnte mich als Dolmetscherin nützlich machen; wenn Sie nur in Frankreich so etwas vermitteln würden, glaube ich bestimmt, ich könnte alles zwingen, wenn jeder mit Riemen gefesselt würde, wie es am Mittwoch geschah. Jetzt ist es Sonnabend, und Sie sind weit weg, vielleicht tot.
Kommen Sie eines Tages zu mir zurück; denn ich werde immer hier sein auf diesem grünen Hügel. Wenn mir nicht erlaubt wird, an meinen Vater zu schreiben, den ich von Herzen geliebt habe.
Entschuldigen Sie dies. Ich bin heute gar nicht ich selbst. Ich werde schreiben, wenn ich mich besser fühle.
Cheerio
Nicole Warren.
Entschuldigen Sie dies alles.
Captain Diver:
Ich weiß, daß Selbstbetrachtung bei einem so hochgradig nervösen Stadium wie dem meinigen nicht gut ist, aber ich möchte, daß Sie wissen, wie es mit mir steht. Voriges Jahr, oder wann das in Chicago war, als ich so wurde, konnte ich nicht mit Dienstboten sprechen oder auf die Straße gehen; ich wartete ständig auf jemand, der mir Auskunft geben sollte. Es war die Pflicht dessen, der Bescheid wußte. Ein Blinder muß geführt werden. Nur wollte mir niemand alles sagen – sie sagten mir nur die Hälfte, und ich war schon zu verwirrt, um zwei und zwei zusammenzuzählen. Ein Mann war nett – ein französischer Offizier, und er wußte Bescheid. Er gab mir eine Blume und sagte, sie sei »plus petite et moins entendue«. Wir waren Freunde. Dann nahm er sie mir weg. Ich wurde kränker, und niemand war da, der es mir erklären konnte. Sie hatten ein Lied über Jeanne d’Arc, das pflegten sie mir vorzusingen, aber das war pure Niedertracht – es hat mich bloß zum Weinen gebracht, denn damals war mein Kopf noch in Ordnung. Sie machten auch Anspielungen auf Sport, aber damals machte ich mir nichts daraus. Also an dem Tag ging ich zu Fuß den Michigan Boulevard entlang, weiter und weiter, kilometerweit, und schließlich folgten sie mir im Auto, aber ich wollte nicht einsteigen. Schließlich zogen sie mich hinein, und da waren Krankenschwestern. In der Folgezeit wurde mir alles klar, weil ich fühlen konnte, was in anderen vorging. Nun wissen Sie, wie es um mich steht. Und kann es denn gut für mich sein, daß ich hierbleibe, wo die Ärzte beständig Dinge zur Sprache bringen, über die ich doch gerade hier hinwegkommen sollte? Darum habe ich heute meinem Vater geschrieben und ihn gebeten, herzukommen und mich wegzuholen. Es freut mich, daß es Sie interessiert, die Leute zu untersuchen und wegzuschicken. Das muß viel Spaß machen.
Und aus einem anderen Brief:
Sie könnten eigentlich Ihre nächste Untersuchung schwimmen lassen und mir einen Brief schreiben. Man hat mir soeben einige Schallplatten geschickt, damit ich meine Lektionen nicht vergesse; ich habe sie alle zerbrochen, darum will die Schwester nicht mit mir sprechen. Sie waren englisch, so daß die Schwestern sie nicht verstanden hätten. Ein Arzt in Chicago sagte, ich simuliere, aber in Wahrheit meinte er, ich sei eins von Sechslingen, und er hatte noch nie eins gesehen. Aber damals war ich stark damit beschäftigt, verrückt zu sein, darum war es mir gleichgültig, was er sagte; wenn ich stark damit beschäftigt bin, verrückt zu sein, ist es mir gewöhnlich gleichgültig, was man sagt, und wenn ich eine Million Mädchen wäre.
Damals am Abend sagten Sie mir, Sie würden mir beibringen, wie man spielt. Also, ich glaube, Liebe ist das einzige, was von Bedeutung ist oder von Bedeutung sein sollte. Auf alle Fälle freue ich mich, daß Ihr Interesse an den Untersuchungen Sie ausfüllt.
Tout à vous
Nicole Warren.
Andere Briefe waren darunter, deren hilflose Zäsuren dunklere Rhythmen verbargen.
Sehr geehrter Hauptmann Diver:
Ich schreibe Ihnen, weil sonst keiner da ist, an den ich mich wenden kann, und mir scheint, wenn diese absurde Situation jemand einleuchtet, der so krank ist wie ich, so sollte sie erst recht Ihnen einleuchten. Die Geisteskrankheit ist behoben, aber abgesehen davon bin ich völlig niedergebrochen und gedemütigt, und vielleicht wollte man das. Meine Familie hat mich schändlich vernachlässigt, es hat keinen Zweck, sie um Hilfe oder Mitleid zu bitten. Ich habe genug davon, und ich richte nur meine Gesundheit zugrunde und vergeude meine Zeit, wenn ich mir einbilde, daß das, was in meinem Kopf los ist, heilbar ist.
Ich bin hier anscheinend in einer Art Irrenhaus, einfach, weil niemand es für richtig hielt, mir über alles die Wahrheit zu sagen. Wenn ich nur gewußt hätte, was vorging, so wie ich es jetzt weiß, ich glaube, ich hätte es ertragen, denn ich bin ganz hübsch stark; aber die es hätten tun sollen, hielten es nicht für richtig, mich aufzuklären.
Und jetzt, wo ich Bescheid weiß und einen solchen Preis für mein Wissen bezahlt habe, sitzen sie da mit ihren Hundeaugen und sagen, ich solle das glauben, was ich früher geglaubt habe. Besonders einer tut das, aber jetzt weiß ich Bescheid.
Ich bin immerzu einsam, weit weg von Freunden und Verwandten jenseits des Ozeans, und ich wandere halb betäubt durch die Gegend. Wenn Sie mir eine Stellung als Dolmetscherin verschaffen könnten (ich spreche Französisch und Deutsch wie meine Muttersprache, ganz gut Italienisch und etwas Spanisch) oder im Roten-Kreuz-Lazarett oder als Lazarettzug-Schwester, obgleich ich dafür ausgebildet werden müßte, würden Sie mir eine große Wohltat erweisen.
Und dann wieder:
Da Sie meine Erklärung dessen, was los ist, nicht annehmen wollen, könnten Sie mir zum mindesten erklären, was Sie denken; denn Sie haben das gütige Gesicht einer weißen Katze und nicht den komischen Blick, der hier Mode zu sein scheint. Dr. Gregory gab mir ein Photo von Ihnen, nicht so schön, wie Sie in Ihrer Uniform sind, aber Sie sehen jünger darauf aus.
Mon Capitaine:
Es war schön, Ihre Postkarte zu erhalten. Ich freue mich sehr, daß Sie soviel Interesse daran haben, Krankenschwestern zu disqualifizieren – oh, ich habe Ihre Zeilen sehr gut verstanden. Ich dachte nur vom ersten Moment unserer Bekanntschaft an, daß Sie anders wären.
Lieber Capitaine:
Heute denke ich so und morgen so über die Sache. Das ist es, woran ich in Wirklichkeit leide, außer an einem rasenden Trotz und einem Mangel an Gleichmaß. Ich würde jeden Psychiater willkommen heißen, den Sie vorschlagen. Hier liegen sie in ihren Badewannen und singen: »Spiel in deinem eignen Hinterhof«, als ob ich einen Hinterhof zum drin spielen hätte oder als wenn für mich irgendeine Hoffnung darin liegen könnte, rückwärts oder vorwärts zu schauen. Sie haben es wieder in dem Bonbonladen versucht, und ich habe mit dem Gewicht nach dem Mann geworfen und ihn beinahe getroffen, aber sie hielten mich fest.
Ich werde ihnen nicht mehr schreiben. Meine Stimmung ist zu wechselnd.
Dann ein Monat ohne Briefe. Und dann plötzlich die Veränderung.
– Ich komme langsam ins Leben zurück …
– Heute die Blumen und die Wolken …
– Der Krieg ist zu Ende, und ich wußte kaum, daß Krieg war …
– Wie gut Sie gewesen sind! Sie müssen sehr weise sein hinter Ihrem Gesicht einer weißen Katze; allerdings sehen Sie auf dem Bild, das mir Doktor Gregory gab, nicht so aus …
– Heute bin ich nach Zürich gefahren, ein merkwürdiges Gefühl, wieder mal eine Stadt zu sehen.
– Heute waren wir in Bern, es war so hübsch mit den Uhren.
– Heute sind wir so hoch hinaufgekraxelt, daß wir Asphodill und Edelweiß gefunden haben …
Danach kamen die Briefe seltener, aber er beantwortete sie alle. In einem hieß es:
Ich wünschte, jemand würde sich in mich verlieben, wie es die Jungen vor Jahren taten, bevor ich krank war. Doch ich glaube, es werden noch Jahre vergehen, ehe ich an so etwas denken kann.
Aber als Dicks Antwort sich aus irgendeinem Grunde verzögerte, kam ein heftiger Ausbruch von Besorgnis – Besorgnis einer Liebenden: »Vielleicht habe ich Sie gelangweilt« und »Ich fürchte, ich bin zu weit gegangen« und »Nachts habe ich immerzu gedacht, Sie wären krank.«
Tatsächlich war Dick an Influenza erkrankt. Als er genesen war, fiel alles außer der rein formalen Seite seiner Korrespondenz der darauffolgenden Mattigkeit zum Opfer, und kurz danach wurde die Erinnerung an die Briefschreiberin in den Hintergrund gedrängt durch die lebendige Gegenwart einer Telefonistin aus Wisconsin im Hauptquartier von Bar-sur-Aube. Sie hatte rote Lippen wie ein Gesicht auf einem Plakat und war in den Offiziersmessen obszönerweise unter dem Namen »das Schaltbrett« bekannt.
Franz kam, durchdrungen von seiner eigenen Wichtigkeit, ins Büro zurück. Dick dachte, er würde wahrscheinlich ein guter Kliniker werden, denn der klangvolle oder abgerissene Tonfall, mit dem er Pflegepersonal wie auch Patienten in Zucht hielt, entsprang nicht seinem Nervensystem, sondern einer ungeheuren, aber harmlosen Eitelkeit. Seine wirklichen Gefühle waren geordneter, und er behielt sie für sich.
»Nun zu dem Mädchen, Dick«, sagte er. »Natürlich will ich etwas über dich hören und dir von mir erzählen, aber zuerst zu dem Mädchen, weil ich schon so lange darauf gewartet habe, dir von ihr zu berichten.«
Er suchte und fand in einer Kartothek ein Bündel Papiere, aber nachdem er sie schnell durchgesehen hatte, fand er, daß sie ihm im Wege waren, und legte sie auf seinen Schreibtisch. Statt dessen erzählte er Dick die Geschichte.
III
Vor anderthalb Jahren etwa führte Doktor Dohmler einen etwas verworrenen Briefwechsel mit einem amerikanischen Herrn, der in Lausanne lebte, einem Herrn Devereux Warren von der Familie Warren aus Chicago. Eine Zusammenkunft wurde vereinbart, und eines Tages traf Herr Warren mit seiner Tochter Nicole, einem Mädchen von sechzehn Jahren, in der Klinik ein. Das Mädchen war offensichtlich krank, und die Krankenschwester, die mitgekommen war, machte mit ihr einen Spaziergang durch den Park, während Herr Warren den Arzt konsultierte.
Warren war ein auffallend hübscher Mann, dem man seine vierzig Jahre nicht ansah. Er war in jeder Hinsicht ein guter amerikanischer Typ: groß, stattlich, gut gewachsen – »un homme très chic«, wie Doktor Dohmler ihn Franz beschrieb. Das Weiße seiner grauen Augen war von roten Äderchen durchzogen, vom Rudern auf dem Genfer See, und man sah seinem ganzen Gehaben an, daß er die Genüsse dieser Welt zu schätzen wußte. Die Unterhaltung wurde auf deutsch geführt, denn es stellte sich heraus, daß er in Göttingen zur Schule gegangen war. Er war nervös, und augenscheinlich ging ihm seine Mission sehr nahe.
»Doktor Dohmler, meine Tochter ist gemütskrank. Ich habe unzählige Spezialisten befragt und Krankenschwestern für sie gehalten, und sie hat zwei Liegekuren gemacht, aber die Sache ist mir über den Kopf gewachsen, und man hat mir dringend empfohlen, mich an Sie zu wenden.«
»Sehr schön«, sagte Doktor Dohmler. »Wie wäre es, wenn Sie mir alles von Anfang an erzählen würden.«
»Einen Anfang gibt es gar nicht, zumindest hat es, soviel ich weiß, in der Familie auf beiden Seiten keine Geisteskrankheit gegeben. Nicoles Mutter starb, als das Kind elf Jahre alt war, und ich bin sozusagen Vater und Mutter in einer Person für sie gewesen, mit Hilfe von Erzieherinnen – Vater und Mutter in einer Person.«
Er war sehr bewegt, als er das sagte. Doktor Dohmler sah, daß er Tränen in den Augen hatte, und bemerkte zum erstenmal, daß sein Atem nach Whisky roch.
»Als Kind war sie ein entzückendes kleines Ding – jeder war hingerissen von ihr, jeder, der mit ihr in Berührung kam. Sie war schlank wie eine Gerte und vom Morgen bis zum Abend glücklich. Mit Vorliebe las sie oder zeichnete oder tanzte oder spielte Klavier – sie konnte alles mögliche. Oft hörte ich meine Frau sagen, sie sei das einzige von unseren Kindern, das niemals in der Nacht geschrien habe. Ich habe noch eine ältere Tochter, und da war noch ein Junge, der gestorben ist, aber Nicole war – Nicole war – Nicole –«
Er hielt inne, und Doktor Dohmler half ihm.
»Sie war ein ganz und gar normales, strahlendes, glückliches Kind.«
»Ganz und gar.«
Doktor Dohmler wartete. Herr Warren schüttelte den Kopf, stieß einen tiefen Seufzer aus, streifte Doktor Dohmler mit einem schnellen Blick und sah dann wieder zu Boden.
»Ungefähr vor acht Monaten, vielleicht waren es auch sechs oder vielleicht zehn – ich versuche, es mir zu vergegenwärtigen, aber ich kann mich nicht genau entsinnen, wo wir waren, als sie begann, komische Dinge zu tun – verrückte Dinge. Ihre Schwester war der erste Mensch, der mir etwas darüber sagte – denn Nicole war mir gegenüber immer die gleiche«, fügte er ziemlich hastig hinzu, so als hätte jemand behauptet, er trüge die Schuld, »– dasselbe anschmiegsame kleine Mädchen. Die erste Sache betraf einen Kammerdiener.«
»Ganz recht«, sagte Doktor Dohmler und nickte mit seinem ehrwürdigen Haupt, als wenn er, wie Sherlock Holmes, erwartet hätte, daß ein Kammerdiener, und zwar ausgerechnet ein Kammerdiener, in diesem Moment in Erscheinung treten würde.
»Ich hatte einen Kammerdiener, der seit Jahren bei mir war – übrigens ein Schweizer.« Er blickte Doktor Dohmler in Erwartung seines patriotischen Beifalls an. »Sie bildete sich in bezug auf ihn etwas Verrücktes ein. Sie meinte, er stelle ihr nach – natürlich glaubte ich es ihr damals und entließ ihn, aber jetzt weiß ich, daß alles Unsinn war.«
»Was behauptete sie, daß er getan haben sollte?«
»Damit fing es schon an – die Ärzte konnten nichts Bestimmtes aus ihr herauskriegen. Sie blickte sie an, als müßten sie es eigentlich wissen, was er getan hatte. Sicher war nur, daß sie meinte, er habe ihr irgendwelche unschicklichen Anträge gemacht – darüber ließ sie uns nicht im Zweifel.«
»Ich verstehe.«
»Natürlich habe ich über Frauen gelesen, die sich einsam fühlen und sich einbilden, es sei ein Mann unter ihrem Bett und dergleichen, aber wie sollte Nicole auf so etwas kommen? Sie konnte so viele junge Männer haben, wie sie wollte. Wir waren in Lake Forest, einer Sommerfrische bei Chicago, wo wir ein Grundstück haben – und sie war den ganzen Tag draußen und spielte mit den Jungen Golf oder Tennis. Und einige von ihnen waren ziemlich hinter ihr her.«
Die ganze Zeit über, während Warren auf den alten, vertrockneten Knaben, den Doktor Dohmler, einredete, war ein Teil von dessen Hirn in Intervallen mit Chicago beschäftigt. Einstmals, in seiner Jugend, hätte er als Assistent und Dozent an die Universität Chicago gehen können; vielleicht wäre er dort reich geworden und hätte ein eigenes Sanatorium besessen, statt nur kleiner Teilhaber an einer Klinik zu sein. Als er sich das, was er sein eigenes mangelhaftes Wissen nannte, über das ganze Gebiet, über all die Weizenfelder und die endlosen Prärien verteilt dachte, hatte er sich dagegen entschieden. Aber er hatte in jenen Tagen viel über Chicago gelesen, über die großen feudalen Familien, die Armours, Palmers, Fields, Cranes, Warrens, Swifts, McCormicks und viele andere, und seither waren nicht wenige Patienten, die dieser Gesellschaftsschicht angehörten, aus Chicago und New York zu ihm gekommen.
»Es wurde schlimmer mit ihr«, fuhr Warren fort. »Sie hatte so was wie einen Anfall – das, was sie sagte, wurde immer verrückter. Ihre Schwester schrieb einiges davon auf.« Er reichte dem Doktor ein mehrfach gefaltetes Stück Papier. »Fast immer über Männer, die sie anfallen wollten, Männer, die sie kannte oder Männer auf der Straße – alle –«
Er erzählte von seiner Sorge und Not, von dem Schrecken, in den Familien durch solche Begebenheiten versetzt werden, von ihren erfolglosen Bemühungen in Amerika und schließlich davon, daß sie sich viel von einem Ortswechsel versprochen hatten, und wie er darum die Unterseebootblockade durchbrochen und seine Tochter in die Schweiz gebracht hatte.
»– auf einem Kreuzer der Vereinigten Staaten«, erklärte er mit einem Anflug von Stolz. »Das zuwege zu bringen, war mir durch einen Glücksfall möglich. Und ich möchte hinzufügen«, er lächelte wie um Entschuldigung bittend, »daß, wie man sagt, Geld keine Rolle spielt.«
»Natürlich nicht«, stimmte Dohmler trocken bei.
Er hätte gar zu gern gewußt, weshalb und in welchem Punkte der Mann ihn anlog. Oder, wenn er sich darin irren sollte, woher die Atmosphäre von Unaufrichtigkeit kam, die den ganzen Raum und den stattlichen Menschen in gemusterter Wolle durchdrang, der sich mit dem Behagen eines Sportsmannes in seinem Stuhl rekelte. Draußen in der Februarluft, das war eine Tragödie: der junge Vogel mit irgendwie geknickten Flügeln, und hier drin war alles zu durchsichtig, durchsichtig und falsch.
»Ich würde jetzt gern ein paar Minuten mit ihr sprechen«, sagte Doktor Dohmler, ins Englische hinüberwechselnd, als wenn ihn das Warren näherbringen könnte.
Später, als Warren seine Töchter dagelassen hatte und nach Lausanne zurückgekehrt war, und als mehrere Tage vergangen waren, machten der Doktor und Franz folgende Eintragung auf Nicoles Karteiblatt:
»Diagnose: Schizophrenie. Akute Phase im Abnehmen begriffen. Die Angst vor Männern ist ein Symptom der Krankheit und keineswegs angeboren … Die Prognose muß zurückgestellt werden.«
Und dann warteten sie, während die Tage vergingen, mit zunehmender Spannung auf Herrn Warrens versprochenen zweiten Besuch.
Er ließ auf sich warten. Nach zwei Wochen schrieb Doktor Dohmler. Als weiterhin Schweigen herrschte, beging er, was man in jenen Tagen »une folie« nannte und telefonierte das Grand Hotel in Vevey an, Er erfuhr von Herrn Warrens Kammerdiener, daß sein Herr beim Packen sei, um sich nach Amerika einzuschiffen. Als dem Mann zu verstehen gegeben wurde, daß die vierzig Schweizer Franken für den Anruf in den Klinikbüchern erscheinen würden, regte sich in ihm das Blut der Schweizer Garde der Tuilerien, so daß er Herrn Warren an den Apparat rief.
»Es ist – unbedingt notwendig –, daß Sie kommen. Die Gesundheit Ihrer Tochter – alles hängt davon ab. Ich kann keine Verantwortung übernehmen.«
»Aber ich bitte Sie, Doktor, dafür sind Sie doch gerade da. Ich bin dringend nach Hause abgerufen worden!«
Doktor Dohmler hatte noch nie mit jemand gesprochen, der so weit entfernt war, aber er brachte sein Ultimatum telefonisch mit so viel Festigkeit vor, daß der Amerikaner am anderen Ende in seiner Todesangst nachgab. Eine halbe Stunde nach seinem zweiten Eintreffen am Zürichsee war Warren zusammengebrochen, seine schönen Schultern zuckten in dem gutsitzenden Anzug vor verzweifeltem Schluchzen, und seine Augen waren röter als die Sonne über dem Genfer See. Und sie hörten die entsetzliche Geschichte.
»Es geschah eben«, sagte er mit rauher Stimme. »Ich weiß nicht, wie.«
»Als ihre Mutter gestorben war, pflegte die Kleine jeden Morgen zu mir ins Bett zu kommen, manchmal schlief sie bei mir im Bett. Das kleine Ding tat mir leid. Oh, und danach, wenn wir im Auto oder in der Eisenbahn irgendwohin fuhren, pflegten wir uns an der Hand zu halten. Sie sang für mich. Oft sagten wir: ›Nun wollen wir bis heute nachmittag keinen anderen Menschen ansehen – wir wollen nur füreinander da sein – heute vormittag gehörst du mir.‹« Spröder Sarkasmus kam in seinen Tonfall: »Die Leute sagten immer, wie großartig wir als Vater und Tochter wären – und wischten sich gerührt die Augen. Wir waren wie ein Liebespaar – und dann, unversehens, waren wir ein Liebespaar – und zehn Minuten, nachdem es geschehen war, hätte ich mich am liebsten erschossen – das heißt, ich glaube, ich bin so ein verdammt degenerierter Kerl, daß ich nicht den Schneid gehabt hätte, es zu tun.«
»Und dann?« fragte Doktor Dohmler und dachte wieder an Chicago und an einen sanften, blassen Herrn mit einem Klemmer, der ihn vor dreißig Jahren in Zürich geprüft hatte. »Wiederholte sich das?«
»O nein! Sie ist beinahe – sie schien augenblicklich zu erstarren. Sie sagte nur: ›Mach dir nichts draus, mach dir nichts draus, Daddy. Es tut nichts. Mach dir nichts draus.‹«
»Es hatte keine Folgen?«
»Nein.« Er wurde von einem kurzen, krampfhaften Schluchzen geschüttelt und schnaubte sich mehrere Male. »Das heißt, jetzt haben wir Folgen im Überfluß.«
Als Warren mit seiner Geschichte fertig war, lehnte sich Dohmler in seinem Armsessel zurück und sagte empört zu sich selbst: »Bauer!« Es war eins der wenigen handfesten Urteile, die er sich im Verlauf von zwanzig Jahren angemaßt hatte. Dann sagte er:
»Ich möchte gern, daß Sie in einem Hotel in Zürich übernachten und mich morgen früh besuchen.«
»Und was dann?«
Doktor Dohmler spreizte seine Hände so breit auseinander, daß er ein junges Schwein hätte tragen können.
»Chicago«, schlug er vor.
IV
»Nun wußten wir, wo wir standen«, sagte Franz. »Dohmler gab Warren zu verstehen, daß wir den Fall übernehmen würden, wenn er sich damit einverstanden erklärte, sich auf unbegrenzte Zeit, mindestens jedoch auf fünf Jahre, von seiner Tochter fernzuhalten. Nach Warrens anfänglichem Zusammenbruch schien er sich hauptsächlich dafür zu interessieren, ob jemals etwas über die Geschichte nach Amerika durchsickern würde.
Wir stellten einen Behandlungsplan für sie auf und warteten. Die Prognose war schlecht – wie du weißt, ist der Prozentsatz der Heilungen, sogar derjenigen, die nur dem Namen nach Heilungen sind, in diesem Alter sehr niedrig.«
»Die ersten Briefe sahen schlimm aus«, stimmte Dick zu.
»Sehr schlimm – sehr typisch. Ich habe gezögert, ob ich den ersten aus der Anstalt herauslassen sollte, dann dachte ich, es wird Dick gut tun, zu wissen, daß wir hier weitermachen. Es war nett von dir, daß du auf sie geantwortet hast.«
Dick seufzte. »Sie war so ein liebes Ding. Sie fügte eine Menge Photos von sich bei. Und einen Monat lang hatte ich dort nichts zu tun. Alles, was ich ihr schrieb, war: ›Seien Sie brav und tun Sie, was die Ärzte sagen.‹«
»Das genügte schon – so hatte sie draußen jemand, an den sie denken konnte. Eine Zeitlang hatte sie keinen Menschen – nur eine Schwester, an der sie nicht sehr zu hängen scheint. Übrigens hat uns die Lektüre ihrer Briefe hier weitergeholfen – sie waren uns ein Maßstab für ihren Zustand.«
»Das freut mich.«
»Du weißt also, wie die Dinge lagen. Sie fühlte sich mitschuldig – an sich wäre das belanglos, wenn wir nicht ihre äußerste Standhaftigkeit und Charakterfestigkeit wiederherstellen wollten. Zuerst kam dieser Schock, dann wurde sie in eine Pension gesteckt und hörte die Mädchen untereinander reden – und aus purem Selbstschutz nährte sie in sich die Vorstellung, daß sie nicht mitschuldig gewesen sei – und von da war es leicht, in eine Phantasiewelt zu gleiten, in der alle Männer um so schlechter sind, je mehr man sie liebt und ihnen vertraut.«
»Hat sie jemals das – Schreckliche direkt erwähnt?«
»Nein, und offen gesagt, als sie im Oktober etwa begann, einen normalen Eindruck zu machen, befanden wir uns in einer heiklen Lage. Wäre sie dreißig Jahre alt gewesen, hätten wir ihr erlaubt, sich selbst zurechtzufinden; aber sie war so jung, daß wir fürchteten, sie könne sich verhärten, verkrampft, wie alles in ihr war. Darum sagte Doktor Dohmler ganz offen zu ihr: ›Sie haben jetzt Pflichten gegen sich selbst. Glauben Sie nicht, daß für Sie alles zu Ende ist – Ihr Leben befindet sich erst am Anfang‹, und so weiter und so weiter. Sie hat einen sehr gut entwickelten Verstand, darum ließ er sie etwas Freud lesen, nicht zu viel, und es interessierte sie sehr. Tatsächlich wird sie von uns allen hier verhätschelt. Aber sie ist zurückhaltend«, fügte er hinzu; er zögerte: »Wir hätten gern gewußt, ob sie in ihren letzten Briefen an dich, die sie selbst in Zürich aufgab, irgend etwas geschrieben hat, was Aufschluß über ihren Gemütszustand und über ihre Zukunftspläne geben könnte.«
Dick überlegte.
»Ja und nein – ich kann die Briefe herbringen, wenn du es willst. Sie scheint voller Hoffnung und in normaler Weise lebenshungrig zu sein – ja beinahe romantisch. Manchmal spricht sie von der ›Vergangenheit‹, wie Leute es tun, die im Gefängnis waren. Man weiß nie, ob sie auf das Verbrechen oder die Gefangenschaft oder die Erfahrung als solche anspielen. Eigentlich bin ich in ihrem Leben nichts anderes als eine ausgestopfte Figur.«
»Natürlich, ich verstehe deine Lage genau, und ich drücke dir von neuem unsere Dankbarkeit aus. Darum wollte ich dich sprechen, bevor du sie siehst.«
Dick lachte.
»Glaubst du, sie wird mit einem Hechtsprung auf mich losgehen?«
»Nein, das nicht. Aber ich wollte dich bitten, sehr behutsam zu sein. Du besitzt Anziehungskraft auf Frauen, Dick.«
»Dann helfe mir Gott! Also, ich werde behutsam und abstoßend sein – ich werde jedesmal Knoblauch essen, bevor ich zu ihr gehe, und mir Bartstoppeln stehen lassen. Ich werde sie zwingen, Deckung zu nehmen.«
»Nein, nicht Knoblauch!« sagte Franz ernsthaft. »Du wirst doch deiner Karriere nicht schaden wollen? Aber vielleicht scherzt du nur.«
»– und ich kann ein bißchen hinken. Und jedenfalls gibt es da, wo ich wohne, keine richtige Badewanne.«
»Du scherzt wirklich.« Franz entspannte sich oder nahm wenigstens die Haltung eines Menschen an, der sich entspannt. »Nun erzähle mir von dir und deinen Absichten.«
»Ich habe nur eine Absicht, Franz, und zwar die, ein guter Psychologe zu werden, ja vielleicht der bedeutendste, der je gelebt hat.«
Franz lachte vergnügt, aber er sah, daß Dick diesmal nicht spaßte.
»Das ist sehr gut – und sehr amerikanisch«, sagte er. »Für uns ist es schwerer.« Er stand auf und trat an das französische Fenster. »Ich stehe hier und blicke auf Zürich – dort ist der Turm des Großmünsters. In seiner Gruft liegt mein Großvater. Jenseits der Brücke ruht mein Vorfahr Lavater, der in keiner Kirche begraben sein wollte. Nicht weit davon befindet sich das Standbild eines anderen Vorfahren, Heinrich Pestalozzis, und das von Alfred Escher. Und über allem ist immer Zwingli – ich sehe mich ständig einer Ehrenhalle voller Helden gegenüber.«
»Ja, ich verstehe.« Dick erhob sich. »Ich habe nur das Maul vollgenommen. Man fängt doch immer von neuem an. Die meisten Amerikaner in Frankreich sind ganz wild darauf, nach Hause zu fahren; ich nicht – ich beziehe noch bis Schluß des Jahres Militärlöhnung, wenn ich nur an der Universität Vorlesungen höre. Eine großartige Regierung, die ihre künftigen großen Männer kennt! Dann fahre ich auf einen Monat nach Hause und besuche meinen Vater, und dann komme ich zurück – mir ist eine Stellung angeboten worden.«
»Wo?«
»Bei eurer Konkurrenz – Gislers Klinik in Interlaken.«
»Laß die Finger davon«, riet ihm Franz. »Ein Dutzend junger Leute war im Verlauf eines Jahres dort. Gisler selbst leidet an manischen Depressionen, seine Frau und ihr Liebhaber leiten die Klinik – aber du verstehst, das ist natürlich vertraulich.«
»Wie steht’s mit deinem Plan für Amerika?« fragte Dick leichthin. »Wir wollten nach New York gehen und eine mit allen Schikanen ausgerüstete Anstalt für Billionäre gründen.«
»Das war Studentengeschwätz.«
Dick speiste mit Franz, seiner jungen Frau und einem kleinen Hund, der nach verbranntem Gummi roch, in ihrem Häuschen am Rande des Parks. Er fühlte sich irgendwie niedergedrückt, nicht durch die Atmosphäre maßvoller Einschränkung, auch nicht durch Frau Gregorovius – mit ihr hatte er im voraus gerechnet –, sondern durch die plötzliche Einengung des Horizonts, mit der sich Franz anscheinend abgefunden hatte. Für ihn zeichneten sich die Grenzen der Askese anders ab – er konnte sie als Mittel zum Zweck ansehen, ja als ruhmvollen Zweck in sich, aber es fiel ihm schwer, sich vorzustellen, daß man sein Dasein absichtlich auf den Zuschnitt eines ererbten Anzuges einengen konnte. Den häuslichen Gesten Franzens und seiner Frau fehlte es an Anmut und Temperament, wenn sie sich in beengtem Raum bewegten. Die Nachkriegsmonate in Frankreich und die Abwicklungen, bei denen man mit amerikanischer Großzügigkeit mit Geld um sich warf, hatten Dicks Lebensauffassung beeinflußt. Auch hatten Männer und Frauen viel von ihm hergemacht, und vielleicht war, was ihn zum Mittelpunkt der großen Schweizer Uhr zurückgebracht hatte, die intuitive Erkenntnis, daß dies einem ernsthaften Mann nicht eben gut bekam.
Er erreichte, daß Käthe Gregorovius sich bezaubernd vorkam, während ihn der alles durchdringende Blumenkohlgeruch zunehmend beunruhigte. Gleichzeitig verabscheute er sich wegen dieses ersten Stadiums einer ihm bis dahin unbekannten Oberflächlichkeit.
»Mein Gott, bin ich letzten Endes doch wie die anderen?« fragte er sich in Gedanken, als er des Nachts nicht schlafen konnte. »Bin ich wie die anderen?«
Da war unzureichendes Material für einen Sozialisten, aber gutes Material für einen von der Sorte, die auf der Welt die ungewöhnlichsten Aufgaben zu erfüllen hat. In Wahrheit durchlebte er seit einigen Monaten die Trennung vom Land der Jugend, in der es sich entscheidet, ob es sich für etwas zu sterben lohnt, woran man nicht mehr glaubt. In den toten, fahlen Stunden in Zürich, wenn er über eine aufflammende Straßenlaterne hinweg in eine fremde Vorratskammer starrte, pflegte er den Vorsatz zu fassen, gut zu sein, gütig zu sein, tapfer und weise zu sein, aber es war alles sehr schwierig. Er wollte auch geliebt werden, wenn er dazu Zeit finden würde.
V
Die Veranda des Mittelgebäudes erhielt ihr Licht aus den offenen französischen Fenstern, ausgenommen dort, wo die schwarzen Schatten kahler Wände und die phantastischen Schatten von Eisenstühlen unmerklich in ein Gladiolenbeet hinabglitten. Unter den Gestalten, die zwischen den Zimmern hin und her huschten, war Fräulein Warren zunächst nur hin und wieder sichtbar, um dann, als sie Dick bemerkte, völlig in Erscheinung zu treten. Als sie die Schwelle der Glastür überschritt, fing ihr Gesicht den letzten Lichtschein aus dem Zimmer auf und trug ihn mit sich nach draußen. Sie bewegte sich nach einem Rhythmus – diese ganze Woche klang ihr ein Singen im Ohr, Sommergesänge von feurigen Himmeln und wilden Schatten, und seit Dicks Eintreffen war das Singen so laut geworden, daß sie am liebsten eingestimmt hätte.
»Guten Tag, Captain«, sagte sie, ihre Augen mit Mühe von seinen lösend, so als wären sie fest miteinander verhaftet gewesen. »Sollen wir uns hier draußen hinsetzen?« Sie blieb stehen und ließ ihre Blicke eine Weile umherschweifen. »Der reine Sommer.«
Eine Frau war ihr gefolgt, eine untersetzte Frau mit einem Umschlagetuch, und Nicole stellte Dick vor: »Señora –«
Franz entschuldigte sich, und Dick rückte drei Stühle zusammen.
»Was für eine wunderbare Nacht«, sagte die Señora.
»Muy bella«, stimmte Nicole zu, dann zu Dick: »Bleiben Sie lange hier?«
»In Zürich bleibe ich lange, wenn Sie das meinen.«
»Dies ist wirklich die erste richtige Frühlingsnacht«, ließ sich die Señora vernehmen.
»Für immer?«
»Mindestens bis Juli.«
»Ich gehe im Juni von hier fort.«
»Der Juni ist hier ein schöner Monat«, bemerkte die Señora. »Sie sollten den Juni über hierbleiben und erst im Juli fahren, wenn es zu heiß wird.«
»Wohin gehen Sie?« fragte Dick Nicole.
»Irgendwohin, mit meiner Schwester – ich hoffe, irgendwohin, wo etwas los ist, denn ich habe ja so viel Zeit verloren. Aber vielleicht ist man der Meinung, ich sollte zunächst an einen ruhigen Ort – vielleicht Como. Warum kommen Sie nicht auch nach Como?«
»Ach, Como –«, setzte die Señora an.
Im Hause begann ein Trio, »Leichte Kavallerie« von Suppé zu spielen. Das benutzte Nicole, um aufzustehen, und der Eindruck, den ihre Jugend und Schönheit auf Dick machten, wurde immer stärker, bis ihn eine heftige Gefühlswelle durchströmte. Sie lächelte, ein rührend kindliches Lächeln, in dem die ganze verlorene Jugend der Welt lag.
»Die Musik ist zu laut, um sich dabei zu unterhalten. Ob wir nicht etwas herumgehen? Buenas noches, Señora.«
»Gutt Nacht – gutt Nacht.«
Sie gingen zwei Stufen hinab auf den Weg – der im Schatten lag. Sie nahm Dicks Arm.
»Ich habe ein paar Grammophonplatten, die mir meine Schwester aus Amerika geschickt hat«, sagte sie. »Wenn Sie das nächstemal herkommen, werde ich sie Ihnen vorspielen – ich weiß eine Stelle, wo man das Grammophon hinstellen kann, und wo es niemand hört.«
»Fein.«
»Kennen Sie ›Hindostan‹?« fragte sie ernst. »Ich hatte es noch nie gehört, aber es gefällt mir. Dann habe ich noch ›Why do they call them babies?‹ und ›I’m glad I can make you cry‹. Wahrscheinlich haben Sie in Paris nach all diesen Melodien getanzt.«
»Ich war gar nicht in Paris.«
Ihr kremfarbenes Kleid, das beim Gehen manchmal blau und manchmal grau schimmerte, und ihr sehr blondes Haar verwirrten Dick – jedesmal, wenn er sich ihr zuwandte, lächelte sie ein wenig, und ihr Gesicht leuchtete auf wie ein Engelsantlitz, wenn sie in den Bereich einer Bogenlampe kamen. Sie bedankte sich für alles bei ihm, fast, als habe er sie auf eine Gesellschaft mitgenommen, und während Dick allmählich die Übersicht über seine Beziehung zu ihr verlor, wuchs ihre Zuversicht – sie befand sich in einem Zustand der Erregung, der die Erregung der ganzen Welt widerzuspiegeln schien.
»Man läßt mir hier jegliche Freiheit«, sagte sie. »Ich werde Ihnen zwei hübsche Lieder vorspielen: ›Wait till the cows come home‹ und ›Good-bye, Alexander‹.«
Das nächstemal, eine Woche darauf, verspätete er sich, und Nicole erwartete ihn an einer Stelle des Weges, an der er, wenn er von Franzens Hause kam, vorbeikommen mußte. Ihr Haar, über den Ohren zurückgestrichen, fiel so auf ihre Schultern hinab, daß es aussah, als sei ihr Gesicht gerade aus ihm zum Vorschein gekommen, als sei dies genau der Augenblick, in dem sie aus einem Wald in klaren Mondenschein heraustrat. Das Unbekannte hatte sie hervorgebracht: Dick wünschte, sie hätte keine Bindungen, sie wäre weiter nichts als ein verlorenes Kind mit keiner anderen Heimstätte als der Nacht, aus der sie gekommen war. Sie gingen zu dem Versteck, wo sie das Grammophon gelassen hatte, bogen bei der Werkstatt um die Ecke, kletterten auf einen Felsblock und setzten sich hinter eine niedrige Mauer – vor sich endlos wogende Nacht.
Sie waren jetzt in Amerika; selbst Franz, der Dick für einen unwiderstehlichen Schürzenjäger hielt, wäre nie darauf gekommen, daß sie so weit weg waren. Es tat ihnen so leid, Liebling; sie gingen hinunter, um sich in einem Taxi zu treffen, Honey; sie hatten eine Vorliebe für Lächeln und hatten sich in Hindostan kennengelernt, und bald danach mußten sie sich gezankt haben, denn niemand wußte Näheres, und niemand schien sich etwas daraus zu machen – schließlich aber hatte einer von ihnen den anderen weinend zurückgelassen, nur um selbst schwermütig und traurig zu sein.
Die dünnen Klänge, die entschwundene Zeiten und künftige Hoffnungen miteinander verbanden, rankten sich an der wallisischen Nacht empor. Wenn das Grammophon schwieg, ließ sich das eintönige Zirpen einer Grille vernehmen. Nach und nach hörte Nicole auf, den Apparat spielen zu lassen, und sang für Dick.
»Leg einen Silberdollar
auf den Grund,
sieh, wie er rollt,
denn er ist rund –«
Ihren leicht geöffneten Lippen entschwebte kein Atem mehr. Dick stand unvermittelt auf.
»Was ist? Gefällt es Ihnen nicht?«
»Natürlich gefällt es mir.«
»Dieses hab’ ich von unserer Köchin zu Hause gelernt:
›Eine Frau hat erst dann
einen wirklich guten Mann,
wenn sie ihn ausschilt dann und wann … ‹
Gefällt es Ihnen?«
Sie lächelte ihn an und bemühte sich, in ihr Lächeln alles zu legen, was in ihr war, und es auf ihn zu übertragen und brachte sich ihm damit zum Geschenk dar und wollte selbst so wenig dafür, nur einen kleinen Widerhall, nur die Gewißheit, daß auch er innerlich erbebte. Langsam und sacht strömte die Süße der Weidenbäume, die Süße der dunklen Welt in sie ein.
Sie erhob sich ebenfalls, stolperte über das Grammophon und wurde von Dick aufgefangen, wobei sie sich einen Augenblick lang in seine runde Schulterhöhlung schmiegte.
»Ich habe noch eine Platte«, sagte sie. »Haben sie ›So long, Letty‹ gehört? Sicher doch.«
»Nein, wirklich, glauben Sie mir. Ich habe überhaupt nichts gehört.«
Noch gewußt, noch gerochen, noch gespürt, hätte er hinzufügen können; nur Mädchen mit heißen Wangen in heißen, verschwiegenen Zimmern. Die Mädchen, die er 1914 in New Haven gekannt hatte, küßten einen Mann, indem sie »So!« sagten und die Hände gegen seine Brust stemmten, um ihn wegzustoßen. Und hier nun war dieses kaum erst dem Verderben entrissene heimatlose Kind und verkörperte ihm den Inbegriff einer Welt …
VI
Als er sie das nächstemal sah, war es Mai. Der Lunch in Zürich war eine Vorsichtsmaßnahme; offensichtlich strebte die folgerichtige Entwicklung seines Lebens von dem Mädchen fort; doch als ein Fremder vom Nebentisch sie mit Augen anstarrte, die wie ein unerlaubtes Licht beunruhigend glühten, wandte er sich dem Mann in weltmännisch einschüchternder Weise zu und durchkreuzte seinen Blick.
»Er war nur neugierig«, erklärte er munter. »Er hat sich nur Ihre Kleider angesehen. Warum haben Sie so viele verschiedene Kleider?«
»Meine Schwester sagt, wir wären sehr reich«, versetzte sie bescheiden, »seit Großmutter tot ist.«
»Ich verzeihe Ihnen.«
Er war um so viel älter als Nicole, daß ihm ihre jugendlichen Eitelkeiten und Vergnügungen Spaß machten, die Art zum Beispiel, wie sie beim Verlassen des Lokals ganz beiläufig vor dem Spiegel in der Halle stehenblieb, so daß sie sich in dem unbestechlichen Quecksilber wiederfinden konnte. Er war entzückt, wenn sie mit ihren Händen neue Oktaven zu greifen suchte, jetzt, da sie wußte, daß sie schön und reich war. Er gab sich redliche Mühe, in ihr nicht die fixe Idee aufkommen zu lassen, er habe sie wieder zusammengeflickt, und er war froh zu sehen, wie sie Glück und Zuversicht unabhängig von ihm wiedererlangte. Die Schwierigkeit lag darin, daß Nicole möglicherweise mit allen Dingen zu ihm kommen und sie ihm als köstliche Opfergaben, als Zeichen ihrer Anbetung zu Füßen legen könnte.
In der ersten Sommerwoche hatte sich Dick wieder in Zürich eingerichtet. Er hatte seine Broschüren und was er während seiner Dienstzeit geschrieben hatte, so zusammengestellt, daß es ihm bei seiner Durchsicht von »Eine Psychologie für Psychiater« als Vorlage dienen konnte. Er hatte bereits einen Verleger dafür und stand in Beziehung zu einem armen Studenten, der seine deutschen Sprachfehler ausmerzen wollte. Franz hielt die Sache für übereilt, aber Dick wies auf die entwaffnende Anspruchslosigkeit des Themas hin.
»Das ist ein Stoff, den ich nie wieder so gut beherrschen werde«, beharrte er. »Ich habe so eine Ahnung, als sei dies ein Thema, das nur darum nicht grundlegend ist, weil ihm niemals wesentliche Anerkennung zuteil wurde. Die Schwäche dieses Berufs liegt in seiner Anziehungskraft für den etwas bresthaften und schwächlichen Menschen. Innerhalb der Grenzen des Berufs findet er eine Entschädigung darin, daß er sich dem Klinischen, dem Praktischen zuwendet – er hat seine Schlacht kampflos gewonnen. Du hingegen bist ein tüchtiger Mann, Franz, weil das Schicksal dich, bevor du geboren wurdest, für deinen Beruf bestimmt hat. Du kannst Gott danken, daß du keine ›Anfechtung‹ gehabt hast. Ich bin Psychiater geworden, weil in St. Hilda in Oxford ein Mädchen war, das dieselben Vorlesungen hörte wie ich. Vielleicht klingt es banal, aber ich will nicht, daß mir meine gegenwärtigen Gedanken von ein paar Dutzend Glas Bier weggeschwemmt werden.«
»Schon richtig«, versetzte Franz. »Du bist Amerikaner. Du kannst so etwas ohne berufliche Schädigung tun. Ich mag diese Verallgemeinerungen nicht. Bald wirst du kleine Bücher schreiben, betitelt ›Tiefe Gedanken für den Laien‹, die alles so vereinfachen, daß sie garantiert keinerlei Nachdenken verursachen. Wenn mein Vater noch am Leben wäre, Dick, würde er dich ansehen und brummen. Er würde seine Serviette so zusammenfalten und seinen Serviettenring hochhalten, diesen hier«, – er hielt ihn hoch, ein Wildschweinkopf war in das braune Holz geschnitzt, – »und er würde sagen: ›Also, meiner Ansicht nach‹ – dann würde er dich ansehen und denken: ›Was hat es für einen Zweck?‹, würde abbrechen und wieder brummen, und dann wären wir beim Ende des Essens angelangt.«
»Heute bin ich allein«, sagte Dick gereizt. »Vielleicht bin ich es morgen nicht mehr. Und dann werde ich meine Serviette so zusammenfalten wie dein Vater – und brummen.«
Franz wartete einen Moment.
»Was macht unsere Patientin?« fragte er dann.
»Ich weiß nicht.«
»Na, allmählich solltest du über sie Bescheid wissen.«
»Ich habe sie gern. Sie ist anziehend. Was willst du, daß ich mit ihr anfange – Edelweiß suchen gehen?«
»Nein. Da du dich auf wissenschaftliche Bücher legst, dachte ich, daß dir vielleicht ein Gedanke kommen würde.«
»– ihr mein Leben weihen?«
»Du lieber Gott!« Er rief seiner Frau in der Küche zu: »Bitte, bring Dick noch ein Glas Bier.«
»Ich möchte keins mehr, wenn ich noch zu Dohmler soll.«
»Wir finden, das Beste wäre, wir hätten ein Programm. Vier Wochen sind vergangen – anscheinend ist das Mädchen in dich verliebt. Draußen in der Welt ginge uns das nichts an, aber hier in der Klinik haben wir ein Interesse an der Sache.«
»Ich werde tun, was Doktor Dohmler sagt«, erklärte Dick bereitwillig.
Aber er hatte nicht viel Hoffnung, daß Dohmler Licht in die Angelegenheit bringen würde; er selbst war ja das in ihr enthaltene unberechenbare Element. Ohne bewußte Willensäußerung seinerseits war die Sache auf ihn zugekommen. Es erinnerte ihn an ein Vorkommnis in seiner Kindheit; jeder Mensch im Haus suchte nach dem verlorenen Schlüssel des Silberschrankes, während Dick wußte, daß er ihn unter den Taschentüchern im obersten Schubfach seiner Mutter versteckt hatte. Damals hatte er ein Gefühl philosophischer Ruhe empfunden, und das wiederholte sich jetzt, als er sich mit Franz zu Doktor Dohmlers Büro begab.
Der Professor mit seinem schönen Gesicht unter dem glatten Backenbart, das wie die weinbewachsene Veranda eines schönen alten Hauses wirkte, entwaffnete ihn. Dick kannte begabtere Menschen, aber keine Persönlichkeit, die Dohmler qualitativ überlegen gewesen wäre.
– Ein halbes Jahr später dachte er dasselbe, als er den toten Dohmler sah, das Licht der Veranda gelöscht, das Weingerank seines Backenbartes auf seinen steifen weißen Kragen herabfallend und die vielen Schlachten, die sich vor seinen mandelförmigen Augen abgespielt hatten, hinter den dünnen, zarten Lidern für immer verstummt.
»… Guten Morgen, Herr Professor!« Er nahm Haltung an wie beim Militär.
Professor Dohmler faltete seine ruhigen Hände. Franz sprach in Fachausdrücken, halb wie ein Verbindungsoffizier, halb wie ein Sekretär, bis sein Chef ihm die Rede mitten im Satz durchschnitt.
»Wir haben einen bestimmten Weg eingeschlagen«, sagte er sanft. »Jetzt sind Sie es, Doktor Diver, der uns am besten helfen kann.«
Dick fuhr erschrocken hoch und gestand: »Ich bin meiner Sache nicht so sicher.«
»Mit Ihren persönlichen Eindrücken habe ich nichts zu tun«, sagte Dohmler. »Aber ich habe sehr viel mit der Tatsache zu tun, daß diesem sogenannten ›Übergangsstadium‹« – er warf Franz einen kurzen, ironischen Blick zu, den dieser ebenso zurückgab, »ein Ende gemacht werden muß. Fräulein Nicole geht es tatsächlich gut, aber sie ist nicht in der Lage, etwas zu überstehen, was sie vielleicht als Tragödie empfinden könnte.«
Wieder begann Franz zu sprechen, aber Doktor Dohmler gebot ihm mit einer Bewegung Schweigen.
»Ich sehe ein, daß Sie sich in einer schwierigen Lage befunden haben.«
»Ja, das stimmt.«
Jetzt lehnte sich der Professor zurück und lachte, und mit dem letzten Atemzug seines Gelächters sagte er und blickte scharf aus seinen kleinen grauen Augen: »Vielleicht sind Sie selbst gefühlsmäßig engagiert.«
Dick merkte, daß man ihn aufziehen wollte, und lachte ebenfalls.
»Sie ist ein hübsches Ding – jeder ist bis zu einem gewissen Grade empfänglich dafür. Ich habe nicht die Absicht –«
Wieder versuchte Franz zu sprechen – wieder hinderte ihn Dohmler daran, indem er eine Frage direkt an Dick richtete. »Haben Sie daran gedacht, wegzugehen?«
»Ich kann nicht weg.«
Doktor Dohmler wandte sich an Franz: »Dann können wir Fräulein Warren wegschicken.«
»Wie Sie es für gut halten, Herr Professor«, stimmte Dick bei. »Es ist schon eine seltsame Situation!«
Professor Dohmler erhob sich so, wie ein Mann ohne Beine sich an seinen Krücken aufrichtet.
»Aber es ist eine berufliche Situation!« brüllte er.