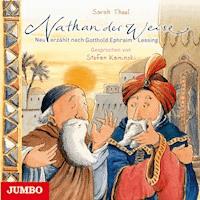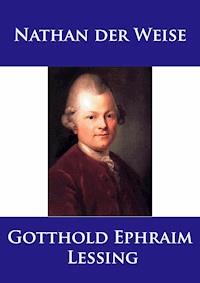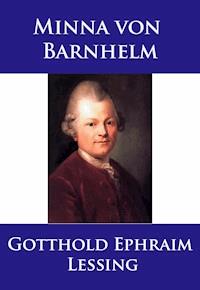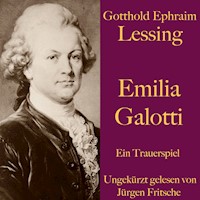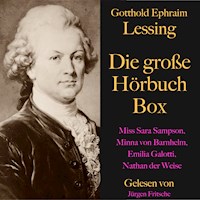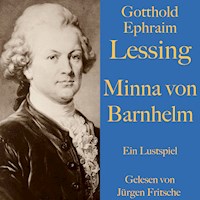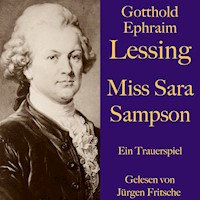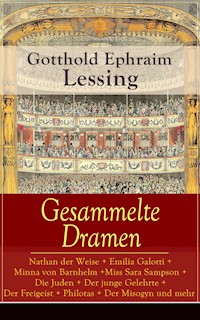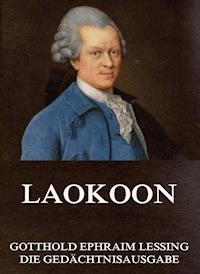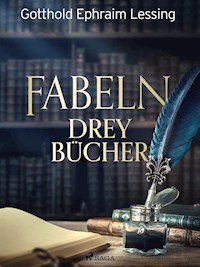
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lessing verfasste zeitlebens nicht nur eigene Fabeln, sondern brachte sich in der theoretischen Debatte um die im 18. Jahrhundert sehr beliebte Gattung auch immer wieder selbst mit ein – nicht selten ging er dabei ziemlich kritisch vor. Auch mit seinem 1759 erschienenen Werk "Fabeln – Drey Bücher" nimmt er eine Sonderrolle ein und setzt sich darin u. a. mit dem wirkungsmächtigen französischen Vorbild Jean de La Fontaine und dessen zahlreichen Nachfolgern im 18. Jahrhundert distanziert auseinander.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 52
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gotthold Ephraim Lessing
Fabeln - Drey Bücher
Saga
Fabeln - Drey Bücher
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1759, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728015506
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Vorrede
Ich warf, vor Jahr und Tag, einen kritischen Blick auf meine Schriften. Ich hatte ihrer lange genug vergessen, um sie völlig als fremde Geburten betrachten zu können. Ich fand, daß man noch lange nicht so viel Böses davon gesagt habe, als man wohl sagen könnte, und beschloß, in dem ersten Unwillen, sie ganz zu verwerfen.
Viel Überwindung hätte mich die Ausführung dieses Entschlusses gewiß nicht gekostet. Ich hatte meine Schriften nie der Mühe wertgeachtet, sie gegen irgend jemanden zu verteidigen; so ein leichtes und gutes Spiel mir auch oft der allzuelende Angriff dieser und jener würde gemacht haben. Dazu kam noch das Gefühl, daß ich itzt meine jugendlichen Vergehungen durch bessere Dinge gutmachen und endlich wohl gar in Vergessenheit bringen könnte.
Doch indem fielen mir so viel freundschaftliche Leser ein. – Soll ich selbst Gelegenheit geben, daß man ihnen vorwerfen kann, ihren Beifall an etwas ganz Unwürdiges verschwendet zu haben? Ihre nachsichtsvolle Aufmunterung erwartet von mir ein anderes Betragen. Sie erwartet, und sie verdienet, daß ich mich bestrebe, sie, wenigstens nach der Hand, recht haben zu lassen; daß ich so viel Gutes nunmehr wirklich in meine Schriften so glücklich hineinlege, daß sie es in voraus darin bemerkt zu haben scheinen können. – Und so nahm ich mir vor, was ich erst verwerfen wollte, lieber soviel als möglich zu verbessern. – Welche Arbeit! –
Ich hatte mich bei keiner Gattung von Gedichten länger verweilet als bei der Fabel. Es gefiel mir auf diesem gemeinschaftlichen Raine der Poesie und Moral. Ich hatte die alten und neuen Fabulisten so ziemlich alle, und die besten von ihnen mehr als einmal, gelesen. Ich hatte über die Theorie der Fabel nachgedacht. Ich hatte mich oft gewundert, daß die gerade auf die Wahrheit führende Bahn des Aesopus, von den Neuern, für die blumenreichern Abwege der schwatzhaften Gabe zu erzählen, so sehr verlassen werde. Ich hatte eine Menge Versuche in der einfältigen Art des alten Phrygiers gemacht. – Kurz, ich glaubte mich in diesem Fache so reich, daß ich vors erste meinen Fabeln, mit leichter Mühe, eine neue Gestalt geben könnte.
Ich griff zum Werke. – Wie sehr ich mich aber wegen der leichten Mühe geirret hatte, das weiß ich selbst am besten. Anmerkungen, die man während dem Studieren macht und nur aus Mißtrauen in sein Gedächtnis auf das Papier wirft; Gedanken, die man sich nur zu haben begnügt, ohne ihnen durch den Ausdruck die nötige Präzision zu geben; Versuchen, die man nur zu seiner Übung waget, – – fehlet noch sehr viel zu einem Buche. Was nun endlich für eines daraus geworden; – hier ist es!
Man wird nicht mehr als sechse von meinen alten Fabeln darin finden; die sechs prosaischen nämlich, die mir der Erhaltung am wenigsten unwert schienen. Die übrigen gereimten mögen auf eine andere Stelle warten. Wenn es nicht gar zu sonderbar gelassen hätte, so würde ich sie in Prosa aufgelöset haben.
Ohne übrigens eigentlich den Gesichtspunkt, aus welchem ich am liebsten betrachtet zu sein wünschte, vorzuschreiben, ersuche ich bloß meinen Leser, die Fabeln nicht ohne die Abhandlungen zu beurteilen. Denn ob ich gleich weder diese jenen noch jene diesen zum Besten geschrieben habe; so entlehnen doch beide als Dinge, die zu einer Zeit in einem Kopfe entsprungen, allzuviel voneinander, als daß sie einzeln und abgesondert noch ebendieselben bleiben könnten. Sollte er auch schon dabei entdecken, daß meine Regeln mit meiner Ausübung nicht allezeit übereinstimmen: was ist es mehr? Er weiß von selbst, daß das Genie seinen Eigensinn hat; daß es den Regeln selten mit Vorsatz folget und daß diese seine wollüstigen Auswüchse zwar beschneiden, aber nicht hemmen sollen. Er prüfe also in den Fabeln seinen Geschmack und in den Abhandlungen meine Gründe. –
Ich wäre willens, mit allen übrigen Abteilungen meiner Schriften, nach und nach, auf gleiche Weise zu verfahren. An Vorrat würde es mir auch nicht fehlen, den unnützen Abgang dabei zu ersetzen. Aber an Zeit, an Ruhe – – Nichts weiter! Dieses Aber gehöret in keine Vorrede; und das Publikum danket es selten einem Schriftsteller, wenn er es auch in solchen Dingen zu seinem Vertrauten zu machen gedenkt. – Solange der Virtuose Anschläge fasset, Ideen sammlet, wählet, ordnet, in Plane verteilet: so lange genießt er die sich selbst belohnenden Wollüste der Empfängnis. Aber sobald er einen Schritt weiter gehet und Hand anleget, seine Schöpfung auch außer sich darzustellen: sogleich fangen die Schmerzen der Geburt an, welchen er sich selten ohne alle Aufmunterung unterziehet. –
Eine Vorrede sollte nichts enthalten als die Geschichte des Buchs. Die Geschichte des meinigen war bald erzählt, und ich müßte hier schließen. Allein, da ich die Gelegenheit mit meinen Lesern zu sprechen, so selten ergreife, so erlaube man mir, sie einmal zu mißbrauchen. – Ich bin gezwungen, mich über einen bekannten Skribenten zu beklagen. Herr Dusch hat mich durch seine bevollmächtigten Freunde, seit geraumer Zeit, auf eine sehr nichtswürdige Art mißhandeln lassen. Ich meine mich, den Menschen; denn daß es seiner siegreichen Kritik gefallen hat, mich, den Schriftsteller, in die Pfanne zu hauen, das würde ich mit keinem Worte rügen. Die Ursache seiner Erbitterung sind verschiedene Kritiken, die man in der Bibliothek der schönen Wissenschaften und in den Briefen die neueste Litteratur betreffend über seine Werke gemacht hat und er auf meine Rechnung schreibet. Ich habe ihn schon öffentlich von dem Gegenteile versichern lassen; die Verfasser der Bibliothek sind auch nunmehr genugsam bekannt; und wenn diese, wie er selbst behauptet, zugleich die Verfasser der Briefe sind: so kann ich gar nicht begreifen, warum er seinen Zorn an mir ausläßt. Vielleicht aber muß