
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Fairiegolden Town-Reihe
- Sprache: Deutsch
Mit farbig gestaltetem Buchschnitt – nur in limitierter Erstauflage der gedruckten Ausgabe (Lieferung je nach Verfügbarkeit)
Ihr ganzes Leben steht Bria, Prinzessin der Diebe, im Schatten ihrer berühmten Mutter. Um endlich ernst genommen zu werden, macht sie sich auf, um den Siegelring eines gefährlichen Clanführers zu stehlen. Dabei gerät sie in einen Schmelzkessel aus Intrigen, Ungerechtigkeiten und Machthunger. Doch sie erfährt auch Freundschaft, Mitgefühl und Liebe. Und mehr über sich selbst, als sie je hatte wissen wollen. Schließlich muss Bria sich entscheiden, ob sie als gefeierte Heldin zu ihrer Gilde zurückkehrt oder alles riskiert und ihrem Herzen in ein Abenteuer folgt, das mit irdischen Waffen nicht zu bestehen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Willkommen in der magischsten Stadt Englands!
Nach dem Krieg zwischen Menschen und Fairies liegt Liverpool fest in der Hand von Samuel Everett. Kompromisslos hält seine Gang einen fragilen Frieden aufrecht, sodass Menschen und Fairies gemeinsam in der Stadt leben können. Dafür ist Samuel jedes Mittel recht – selbst seinen Vater hat er aus dem Weg geschafft.
Sams Siegelring lockt die junge Diebin Bria O’Toole nach Liverpool. Seit Jahren kämpft sie erfolglos um die Anerkennung ihrer Gilde. Doch wenn es ihr gelingt, den Ring zu stehlen, wird man sie endlich respektieren. Um an ihr Ziel zu gelangen, muss Bria allerdings viel mehr in die Waagschale werfen, als sie geahnt hatte. Ein gestohlener Kuss ist nur der Anfang.
Als ein Schiff mit einer zerstörerischen Fracht Kurs auf Liverpool nimmt, bricht Chaos aus, und plötzlich ist nicht nur Brias Leben, sondern die gesamte Stadt in höchster Gefahr.
Die Autorin
Jennifer Benkau wurde im April 1980 in der Klingenstadt Solingen geboren. Nachdem sie in ihrer Kindheit und Jugend Geschichten in eine anachronistische Schreibmaschine hämmerte, verfiel sie pünktlich zum Erwachsenwerden in einen literarischen Dornröschenschlaf, aus dem sie im Dezember 2008 von ihrer ersten Romanidee stürmisch wachgeküsst wurde. 2013 erhielt sie den DeLiA-Literaturpreis für die Dystopie Dark Canopy. Sie lebt mit ihrem Mann, vier Kindern, zwei Hunden und einem Pferd zwischen Düsseldorf und Köln. Fairiegolden Town – Die Prinzessin der Diebe ist der Auftakt zu ihrer atemberaubenden neuen Fantasy-Saga.
JENNIFER BENKAU
FAIRIEGOLDEN TOWN
DIE PRINZESSIN DER DIEBE
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe 02/2025
Redaktion: Marion Meister
Copyright © 2025 by Jennifer Benkau
Copyright © 2025 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Umschlaggestaltung: Das Illustrat GbR, München, unter der Verwendung mehrerer Motive von Shutterstock
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-32128-4V002
www.heyne.de
Für die Fairies unter euch. Strahlt in eurem hellsten Licht. Strahlt in eurer Dunkelheit. Aber strahlt!
INHALTSWARNUNG
Dieses Buch enthält sensible Themen, die bei manchen Menschen ungewollte Reaktionen auslösen können.
Diese sind:
Körperliche, seelische und (angedeutete) sexuelle Gewalt(Angedeutete) Gewalt an Kindern Diskriminierung, Folter, FeuerTodI
Das junge Ding hatte gegen den Dämon nicht die geringste Chance.
Er beobachtete die Fee schon seit Tagen, wie sie mit ihrem Körbchen am Arm das Ufer entlang tappte und nach bestimmten Pflanzen Ausschau hielt, die sie abzupfte und mit sich nahm. Vermutlich war sie eine Kräuterkundige, die daraus Elixiere filterte oder Salben anrührte. Vielleicht auch eine Köchin, die mit dem Grünzeug ihre Speisen schmackhaft würzte. Die Magie der Feen war heutzutage nicht mehr so stark ausgeprägt, wie bei manch anderen Fairies, aber sie verlieh ihnen besondere Talente, von denen sie nahezu besessen waren.
Der Dämon interessierte sich nicht für die Pflanzen, die sie suchte. Er hatte nur Augen für die köstliche junge Fee.
Verglichen mit anderen ihrer Art war sie eher klein und gedrungen. Ihre langen rotgoldenen Locken wirkten windzerzaust und verhedderten sich gelegentlich in den grünlich schillernden Flügeln. Jeder davon war größer als die Fee selbst, und ihre Beschaffenheit war fein und filigran wie ein Gewebe aus Spinnfäden, durch das man gerade so hindurchschauen konnte.
Ob sie damit zu fliegen vermochte? Oder war sie zu schwer? Feen maßen heutzutage annähernd so viel wie ein kleiner Mensch. Die meisten schafften es, sich für ein paar Meter vom Boden zu lösen, elegante Flieger wie die winzigen Elfen waren sie jedoch nicht.
Ab und an blieb die Fee mit der unteren Schwinge an hohen Gräsern hängen und schimpfte dann leise vor sich hin, bis eine Libelle oder ein springender Fisch im Wasser ihre Aufmerksamkeit wieder auf sich zog, und sie weiterlief. Von Pflanze zu Schmetterling, von Gras zu Stein, von Frosch zu Pflanze.
Fairies aller Arten besaßen ein unstetes Wesen, was sie ständig von ihren frisch geschmiedeten Plänen abbrachte. Feen bildeten da keine Ausnahme. Aber diese hier wirkte besonders flatterhaft. Ihre halblange Hose war voller Flecken, als kippten ihr häufiger mal die Krüge um, oder als fiel ihr oft das Essen in den Schoß.
Die Dörfer in dieser Gegend waren nie mit Reichtum beschenkt worden, und nach dem unseligen Krieg hatte kaum jemand noch genug, um mehr als überleben zu können. Einen ebensolchen Eindruck erweckte auch die Fee. Verschlissen war ihr Hemd, fast schon fadenscheinig die Hose zwischen den Schenkeln. Ihre Stiefel hatten Löcher und wurden von Flicken und schlechten Nähten zusammengehalten.
Stets kam die Fee zum Fluss, wenn die Mittagssonne am höchsten stand, saß eine Weile im Gras, um sich von dem weiten Weg in der Hitze zu erholen, und schlenderte dann am Ufer entlang. Manchmal umspielte das Wasser ihre Sohlen und färbte das rissige Leder ihrer Stiefel dunkel. Aber obschon ihr Tropfen von der Stirn perlten und sich Schweißränder unter ihren Armen ausbreiteten, wagte sie es nie, die Stiefel auszuziehen und auch nur bis zu den Knöcheln in einen niedrigen Teil des Wassers zu treten, um sich abzukühlen.
Sie wusste sicher, warum sie an diesem Ort immerzu allein war. Die Gerüchte, die sich um die Stromschnellen rankten, die sich dort bildeten, wo der Fluss tief und dunkel war, und das Wasser durch einen Felstunnel rauschte, um auf der anderen Seite aufgewühlt und schaumbedeckt wieder aufzutauchen – sie kannte sie gewiss. Jeder hier kannte sie, sogar die wenigen Menschen, die die Geschichten nur flüsternd weitererzählten.
Das Dorf der Fee war klein. Vielleicht hatte sie ein paar der Fairies gekannt, die hier verschwunden waren. Ganz bestimmt hatte sie das.
II
Das junge Ding hieß Rory.
Rory – so behaupteten die anderen Feen aus ihrem Dorf – war von ganz und gar gewöhnlichem Geiste. Damit meinten sie, dass sie nicht die Klügste war. Nicht die hellste Kerze im Kronleuchter. Nicht der leuchtendste Stern am Himmel.
Darüber hinaus war Rory nicht hübsch. Ihr Gesicht war zu breit, ihre Brüste zu klein, ihre Ohren zu groß und ihr Po zu dick. Ihre Flügel waren grünlich, statt in verschiedenen Farben zu schimmern.
Hochgeboren war sie auch nicht, und arm noch dazu, denn die Eltern waren im Krieg gefallen und die Werkstatt der Familie erst geplündert und dann bis auf die Grundmauern ausgebrannt worden.
Rory war unscheinbar und normal – und genau das hatte einen seltsamen Effekt auf die anderen Feen ihres Dorfes. Die Frauen sagten, Rory müsse heiraten, um versorgt zu sein – denn was hatte sie sonst zu erwarten vom Leben? Und die Männer meinten allesamt, es müsse doch ein Leichtes sein, Rory zur Frau zu bekommen.
Ständig bemerkte Rory die Blicke auf ihrem Körper. Spürte den kurzen, bedrohlichen Moment, wenn aus harmlosem, neugierigem Interesse mehr wurde. Wenn sie zu ihr kamen, um sie um einen Tanz, um ein gemeinsames Essen oder einen unverfänglichen Spaziergang zu bitten, dann wusste Rory, dass sie nicht mehr ohne einen Streit aus der Situation gelangen würde.
Denn sie war nur Rory. Nicht reich, nicht klug, nicht schön. Wie konnte sie nur Nein sagen? War ihr nicht klar, dass sie einen Mann brauchte? Wusste sie etwa nicht, dass sie keinen Besseren würde finden können? Bildete sie sich denn ein, ein verarmtes, dummes und hässliches Ding wie sie hätte noch Ansprüche zu stellen?
Die Wahrheit war, dass Rory keinerlei Ansprüche an die Männer stellte, außer dem einen: Sie wollte gern in allen Belangen in Ruhe gelassen werden, die eine körperliche Annäherung oder gar Verbindung zur Folge hatten. Das war nicht ihr Ding. Am liebsten wollte sie ihrem Tagewerk nachgehen, Spaziergänge machen, Vögel und Schmetterlinge sehen, herzhaftes Essen und ab und zu einen vollen Krug Wein genießen, den einen oder anderen Tanz tanzen – ob allein, mit anderen Frauen oder Männern war ihr gleich –, und sich am Ende eines jeden Tages in ihr schmales Bett kuscheln, in dem außer für sie nur für die übellaunige Katze Platz war, die das Fußende zu ihrer Nachtstatt erkoren hatte, auch wenn zu ihrem Ungemach eine Fee mit dickem Hintern mit im Bett lag.
Doch langsam musste Rory einsehen, dass das Ziel – ihre Ruhe – wohl erst dann zu erreichen war, wenn sie eine alte Vettel geworden war. Die wurden weder vom Getratsche der anderen Frauen noch von paarungswilligen Feenmännern belästigt. Etwa dreißig Jahre galt es also, den aktuellen Zustand zu ertragen.
Nun … die Vorstellung war schrecklich. Dreißig Jahre waren eindeutig zu lang! Und genau deshalb war Rory hier, am Flussufer stromaufwärts von den Stromschnellen der tanzenden Schuhe.
So hieß der Ort, weil dort die Schuhe derer auftauchten, von denen ansonsten nie wieder etwas gefunden wurde. Nicht das kleinste bisschen, kein Leichnam, weder Knochen, Kleid noch Haar. Doch zwischen den Felsen und Kieseln hingen sie: Die Schuhe und Stiefel junger Männer und Frauen, und wurden vom Wasser munter hin und her bewegt, ganz so, als würden sie tanzen.
Niemand aus dem Dorf oder den umliegenden Orten kam noch her. Weder Mensch noch Fairie. Niemand außer Rory. Denn hier war man allein.
Wenn nicht … ja, wenn nicht gerade ein Dämon geschmeidig wie ein großer Fisch durchs Wasser auf sie zuglitt.
III
Crocell staunte schon seit Jahren über die Arglosigkeit, die wie eine Plage über die Erde gekommen war.
In der Neuen Welt erinnerte sich kaum jemand an Dämonen. Nicht einmal an ihn, den Duke über die Höllenwasser und einen Dämon des ersten Lichts – einen Dämon, der älter war als die Erde selbst. Dass die Menschen rasch und nur allzu willig vergaßen, hatte er gewusst. Da waren sie ihren Schöpfern, den Engeln, ganz ähnlich. Wie schnell jedoch auch die Fairies ihn vergessen hatten, war verblüffend, floss in ihren Adern doch noch ein Tropfen dämonisches Blut. Aber kaum, dass die Herrscher über Himmel und Hölle die Irdischen einmal ein paar Jahrhunderte nicht spürbar heimsuchten, hieß es gleich, es gäbe sie nicht mehr – es habe sie womöglich nie gegeben, man fand schließlich keinerlei Beweise für ihre Existenz.
Crocell gab sich selten Mühe, seine Natur zu verbergen. Er hinterließ deutliche Spuren, aber für die fand man andere Erklärungen und machte sich keine Sorgen. Die wenigen, die auf der richtigen Spur waren, wurden verlacht.
Wobei Crocell zugeben musste, dass das Wissen, wer die Knaben und Mädchen verschwinden ließ, dem Feenvolk am Fluss natürlich auch nicht geholfen hätte. Vielleicht aber wäre seine kleine Fee dann nicht hergekommen, weil sie auf die Warnungen der Alten gehört hätte. Sie wäre Crocell dann niemals aufgefallen. Niemals begegnet. Wie schade …
Er suchte nicht nach gewöhnlichen Feen wie ihr. Nicht nach verarmten Heilermädchen oder heruntergekommenen Kräutersammlerinnen, von denen es seit dem Krieg Tausende auf jedem Kontinent gab.
Was ihn interessierte, waren Heldinnen und Krieger, Waffenschmiede und Meisterinnen an den Schwertern. Unzählige von ihnen hatte er in den Jahrtausenden mit sich genommen, die meisten davon hatte er auf Schlachtfeldern gefunden. Nur ein winziger Bruchteil war gut genug gewesen, die Prüfungen zu bestehen, um von ihm der Sterblichkeit entbunden und zum Dämon gemacht zu werden, damit er ihm fortan dienen konnte.
48 Legionen befehligte der Duke über die Höllenwasser. Und nur die allerbesten derer, die er mit sich nahm, fanden in einer davon ihren Platz. Alle anderen dienten seinen Soldatinnen und Soldaten als Futter und Zeitvertreib in den langen Jahrhunderten des Friedens. Man musste sie bei Laune halten und trainieren – wer wusste denn schon, wann ein neuer Dämonenkrieg ausbrach? Nicht einmal Gott selbst hatte eine Ahnung. Crocell bezweifelte, dass es ihn interessierte.
Die Fee mit dem Weidenkörbchen war weder eine Anwärterin auf einen Platz in einer von Crocells Legionen, noch wollte er sie verfüttern.
Irgendetwas hatte sie an sich. Etwas, das Crocell anlockte. Ihn neugierig machte.
Er wollte sie für sich. Einfach so. Nur, um den Geschmack ihrer harmlosen Naivität zu schmecken. Nur, um nicht zu vergessen, wie es war, selbst ein Leben auszulöschen.
Und weil er ihr nichts Böses wollte – nichts unnötig Böses jedenfalls – würde er sie schnell töten. Ein liebes und argloses Ding wie sie hatte es nicht verdient, länger zu leiden, als es unvermeidlich war, wenn man nun mal unfreiwillig aus dem Leben schied.
Langsam schwamm er näher, tauchte durch die Untiefen in die seichteren Bereiche des Flusses und glitt hinter das Schilf, um sie nicht zu erschrecken. Das Wasser plätscherte sanft, als sein Kopf die Oberfläche durchbrach.
Wie alle Fairies hatte auch diese hier einen unruhigen Geist und dafür gute Ohren. Sie wandte sich blitzschnell in seine Richtung und lauschte.
»Bist du es?«, fragte sie in das Rauschen der Strömung.
Wen mochte sie meinen? Sie hatte nicht ein einziges Mal jemanden hier getroffen oder sich nach einer zweiten Person auch nur umgesehen.
»Sag schon, mein schönes Flusswesen.« Ihre Stimme klang hoch, aber ein wenig rau dabei. »Bist du es wieder?«
Ein Lächeln breitete sich ungewollt auf Crocells Gesicht aus. Sie schien ihn bereits zuvor bemerkt zu haben. Das wurde immer besser.
»Ich bin es, kleine Fee. Darf ich näherkommen?«
Sie lachte auf, überraschend laut und ausgelassen. Die Sonne spielte dabei in ihrem Haar und ließ das Licht Wellen darin schlagen wie in einem rotgoldenen Meer. »Darauf warten wir doch beide seit Tagen, in denen wir uns heimlich beobachtet haben. Also, ja. Warum denn nicht?«
Er lugte am Schilf vorbei, sodass sie einen kurzen Blick auf sein schwarzes Haar, sein schmales Gesicht, die hohe Stirn und eines seiner großen, dunklen Augen erhaschen konnte. Seine Gestalt wirkte attraktiv auf Männer und Frauen, auf Menschen wie Fairies. Auch wenn die Vorlieben sich jedes Jahrhundert änderten, blieb die Faszination seiner Erscheinung immer bestehen. »Du weißt doch nicht, wer ich bin.«
Sie stellte ein Bein vor das andere. Was bei manchen aussah wie ein Versuch, besonders anziehend zu wirken, erinnerte bei ihr eher an die verlegene Bewegung eines Kindes, das nicht stillzustehen vermochte. »Ich weiß genug.«
»Wirklich? Was glaubst du zu wissen?« Er tauchte unter und schwamm zu ihr ans Ufer, wo er langsam erneut den Kopf aus dem Wasser hob. »Und warum nennst du mich dein Flusswesen?«
»Du bist ein Wesen«, sagte sie schlicht. »Und du kommst aus dem Fluss. Was bist du, wenn kein Flusswesen?«
»Was macht mich zu deinem Flusswesen?«
Sie lachte wieder. Leiser dieses Mal. »Ist denn außer uns noch jemand hier?«
»So einfach machst du es dir, meine kleine Fee?«
»So einfach ist es.«
Er legte die Hände auf einen warmen Stein am Ufer und verschränkte die langen Finger. Sie alle liebten seine Hände. Sie waren schmal und gleichmäßig, mit unscheinbaren Perlmuttnägeln, ohne den geringsten Hinweis auf seine dämonische Art. Auch seine Rückenlinie war unauffällig und sein Po teilte sich in zwei schlanke Beine. Durch die glitzernde Wasseroberfläche ließ er sie einen Blick darauf werfen. Zeigte sich ihr verführerisch und aufreizend, um dann eine Spur seiner dunklen Seele in sein Lächeln zu legen. Und dazu eine Idee seiner Gefährlichkeit in seine raunende Stimme. »Du weißt nicht, was ich bin.«
»Ich sagte schon«, erwiderte die Fee, »dass ich genug weiß. Du bist meine Freiheit.«
Er hob den Kopf. Was für eine interessante Antwort. Er wollte mehr hören, wollte eine Erklärung, wollte eine Lösung für das Rätsel, das sie war.
Natürlich hatte sie recht! Er würde sie in eine Freiheit führen, die kein irdisches Leben jemals geben konnte. Aber das konnte sie unmöglich meinen. Sie war keine von denen, die sich nach dem Tod verzehrten.
»Das musst du mir erklären.«
»Ich heiße Rory.« Kurz huschte ihr Blick zu einem Vogel, der im Sand am gegenüberliegenden Ufer nach einem Wurm pickte und dann aufflog und über den Fluss davonsegelte. Sie schaute ihm mit einem Lächeln hinterher. Dann erinnerte sie sich offenbar wieder an das Gespräch, denn sie sah Crocell an – mit demselben weichen Blick wie den kleinen Vogel.
Damit hatte sie im Grunde recht. Auch Crocell pickte eigentlich nur im Sand nach Würmern.
»Du«, sagte sie, »bist der Grund, warum ich an diesem Ort allein bin, nicht wahr?«
»Ja, das bin ich.«
»Und dadurch bin ich frei.«
»Frei … wovon?«
»Von den Frauen, die sagen, ich müsse einen Mann nehmen. Von den Männern, die sagen, sie müssten mich nehmen, damit ich eine Frau werde. Aber wenn Frauen Mädchen einreden, sie dürften nicht frei sein, dann will ich keine Frau sein.«
Arme, kleine Fee. Wie alle Dämonen neigte Crocell nicht zu Mitleid, auch wenn ihm Mitgefühl nicht fremd war. Aber mit ihr litt er.
Er fand die Vorstellung, ein Mann würde seine kleine Fee nehmen, um mit ihr zu machen, was immer er wollte, ganz und gar abscheulich.
So weit würde es nicht kommen. Er würde sie töten. Rasch und mit wenig Schmerzen. Vielleicht würde er ihr die Kehle herausreißen. Dann verblutete sie in Sekunden. Schon war sie frei. Für immer.
»Hast du denn gar keine Angst?«, fragte er leise.
»Ich bin sehr vorsichtig.« Sie sank in die Hocke, um ihm noch näher zu sein, und senkte die Stimme, bis sie flüsterte. »Ich kenne das Geheimnis.«
Crocell neigte den Kopf und legte die Wange auf seinen Händen ab. Die Strömung streichelte seine nackte Haut. Der Tag war herrlich, er fühlte sich wundervoll. »Verrätst du es mir?«
Rory nickte. »Es sind die Schuhe.«
»Die … Schuhe? Bist du dir sicher?«
»Ja!« Begeisterung leuchtete aus ihren blauen Augen und aus der Röte ihrer Wangen. »Die Fairies, die herkamen und nie zurückkehrten, verschwanden ohne ihre Schuhe. Wir haben die Schuhe in den Stromschnellen wiedergefunden. Demnach muss ich nichts anderes tun, als meine Schuhe anzulassen. So kann mir nichts geschehen.«
Güte brannte in diesem Feenkind. Sie war so naiv, so vertrauensselig, dass es ihn fast schmerzlich anrührte.
Es wäre eine Schande, sie in dieser schlechten Welt zurückzulassen. Er tat etwas Gutes, indem er sie mitnahm, die Engel würden ihn dafür segnen.
Nun, das vermutlich nicht – aber sie müssten es eigentlich tun, würden sie sich einmal an ihre eigenen Gesetze halten.
Aber er wollte ihren Körper nun nicht länger zerstören. Ihr weder das Herz noch die Kehle herausreißen. Er würde sie in die Arme nehmen und ins Wasser tragen, tief hinab zum Grund, wo der Fluss am schönsten war, und dort fest an sich drücken, bis sie für immer schlief.
»Meine kleine Fee.« Crocell stemmte sich aus dem Fluss. Rorys Blick glitt zusammen mit Wassertropfen über seine Schultern, seine glatte Brust und seinen Bauch. Sie benetzte die Lippen mit der Zunge, bis sie feucht glänzten, und er beschloss, sie zu küssen, während er sie ertränkte. Aber nur, wenn sie es wollte! Sicher war ihr letzter Kuss auch ihr erster.
Er rutschte mit dem Po auf den Stein, den die Sonne ihm aufgewärmt hatte. Nun konnte sie ihn ansehen. Bis hin zu den Füßen, die wie alles an ihm schlank und schön und harmlos wirkten. Fast alles. Den einzigen Hinweis auf seine Art verbarg er, indem er die Beine kreuzte und sie nicht sehen ließ, was dazwischen war. Nämlich gar nichts – erfahrungsgemäß Menschen gegenüber nicht ganz einfach zu erklären, was wiederum Crocell in all den Jahrtausenden noch nicht hatte einsehen wollen. Warum musste er sich für etwas rechtfertigen, was er nicht hatte, nicht wollte und auch nicht brauchte?
»Die Schuhe, Rory? Bist du sicher? Das kann unmöglich schon alles sein.«
Ein wenig unbeholfen rutschte sie näher und plumpste neben ihm auf den Stein, die Beine unter dem Po, sodass sie nicht ins Wasser hingen wie seine. Die Sonne zauberte Blüten aus Licht in das Grün ihrer Flügel. Ihr Körbchen mit den Pflanzenteilen darin stellte sie auf ihren Oberschenkeln ab, zupfte die Stoffverkleidung zurecht und hielt den Henkel fest, als gäbe er ihr Sicherheit.
Crocell befand, dass sie sicher war. Sicher in den nächsten Minuten im Jenseits.
»Es gibt selbstverständlich auch noch einen Zauber.«
Er lachte leise. Einen Zauber. Ja, natürlich. Einst hatten die Dämonen den Fairies einen Tropfen Magie in ihr Blut gegeben, um sie von den Menschen zu unterscheiden. Diese Magie verlieh ihnen ihre besonderen Talente. Seitdem die Dämonen sich aus dem irdischen Leben zurückgezogen hatten, dachten die Fairies allerdings, sie wären nun die Herrscher über die Magie. Sie überschätzten sich maßlos, indem sie ihren Glücks-, Gesundheits- und Schutzzaubern mehr Macht einredeten als diese wirklich hatten. »Ein Schutzzauber vor Gefahren?«
Sie wiegte den Kopf. »Nicht direkt. Ich zeige ihn dir.«
Und dann entschied sie über ihr Schicksal und nahm seine Hand. Sie lächelte fein, er schmeckte fast schon den Kuss, und sie murmelte drei Worte in ihrem melodischen Feendialekt, wiederholte sie daraufhin und wiederholte sie …
Crocell erstarrte.
Doch es war zu spät, zu erschrecken.
Es war. Tatsächlich. Zu spät.
IV
Rory wiederholte die magischen Worte ein drittes Mal.
Neunmal Magie.
Eine magische Gabe.
Dämonisches Blut.
Und ehe Crocell, Dämon des ersten Lichts, Duke der Höllenwasser, Herrscher über 48 Dämonenlegionen, sichs versah, war er von Magie gebannt. Die Illusion seines makellosen Körpers löste sich auf und sein mächtiger Geist war in dem Weidenkorb einer Fee gefangen.
Behutsam zupfte Rory das rot karierte Leinenfutter zurecht und zog das Bändchen zu.
»Sei mir nicht böse, mein schöner Dämon. Ich sagte es ja: Du bist meine Freiheit.«
Nein, Rory hatte eigentlich nicht den Anflug einer Chance gegen einen Dämon. Sie wäre tot, wäre sie eine Köchin, Heilkundige oder Kräutersammlerin. Doch Rory war nichts dergleichen, und Crocell hatte den Fehler gemacht, dies nicht zu erkennen.
Rory war eine Korbflechterin.
Und ihre Magie, allein für sich ganz schwach und unbedeutend, besaß verbunden mit ihrem Talent der Korbweberei und dem festen Willen, eines Tages frei zu sein, genug Macht, um eine Welt ins Wanken zu bringen.
Und einen Dämon in ihrem Korb zu fangen.
»Auf geht es, mein Schöner«, flüsterte sie und stand auf, den Korb in beiden Händen haltend. »Willst du wissen, wohin wir nun fahren?«
Denn zu bleiben war keine Option. Die Fairies würden es einen Frevel nennen, was sie tat, und sich vor Angst in die Hosen machen. Sie musste fort aus ihrem Dorf, weit weg von all den kleinen, verschlafenen Orten, in eine große Stadt, in der alles möglich war. Und in der sie mit Menschen handeln konnte, deren Gier größer war als jede Vorsicht. Den Menschen in New York oder Boston konnte sie nicht trauen.
»Vermutlich würden Menschen mich bestehlen, niederschlagen und sich nehmen, was mir gehört«, überlegte sie laut.
Crocell antwortete nicht. Ob aus Schock, durch die Nachwirkungen der magischen Formel oder weil er beleidigt war, vermochte Rory nicht zu sagen. Sie besaß keinerlei Erfahrung darin, einen Dämon zu fangen, und die uralten Lieder und halbvergessenen Geschichten, die sie zu dem Zweck studiert hatte, endeten an dem Punkt, an dem Rory nun stand. Dabei ging das Abenteuer doch in diesem Moment erst los.
»Wir holen mein Geld – alles, was ich heimlich angespart habe – und nehmen ein Schiff, du und ich.« Sie sah über das Land hinweg, über Hügel und Wiesen. Nicht in die Richtung der Berge, wo ihr Dorf lag, sondern zur Küste, wo der Hafen sein musste, den sie noch nie gesehen hatte, obschon es nur eine Tageswanderung war. Die Sehnsucht schmerzte nun nicht länger. Sie zerrte an ihr, denn endlich lag die Freiheit vor ihr.
»Wir beide fahren nach England, mein Dämon. Denn dort, so heißt es, herrscht Handel zwischen den Völkern. Wir fahren in die Fairiegolden Town.«
KAPITEL 1
BRIA
Hoch die Tassen! Auf die Prinzessin der Diebe! Die – womit haben wir so viel Ehre nur verdient? – endlich nach Haus zurückgekehrt ist!«
Krüge und Gläser wurden in die Luft gehalten, um scheppernd und klirrend gegeneinanderzustoßen, sodass Bier überschäumte, Wein über die Ränder schwappte und die verlogenen Glückwunschrufe in Grölen und Gelächter untergingen.
Auch Bria hob ihr Glas, senkte es aber wieder, ohne zu trinken.
Auf das Zuhause, das mich nie wollte, ihr Bloody Bugger, dachte sie. Auf eure blöden Gesichter, wenn ich das nächste Mal zurückkehre und euch euer Spott im Hals stecken bleibt.
Ihre Mutter hatte es gut gemeint, das Fest zu geben. Es war so lange her, dass sie Stolen Costessy verlassen hatte – sie mussten eigentlich vergessen haben, Bria zu verachten.
Bria hatte es von Anfang an besser gewusst.
Sie saß auf einem Stuhl, den jemand auf eine Tischplatte inmitten der Taverne gestellt hatte, von wo sie all ihre Gäste überblicken konnte, wie diese tranken, schwatzten und tanzten, und immer wieder anstießen. Auf ihr Wohl – zumindest sagten sie das.
Was sie ihr tatsächlich wünschten, war allerdings etwas anderes.
Obschon sie über ihnen thronte, schaffte es die gesamte Kaschemme voller Leute, die ihr zu Ehren gekommen waren, auf sie herabzusehen. Sie zu verspotten und zu verhöhnen, und dabei auf Kosten von Brias Mutter zu fressen und zu saufen, so viel in ihre Plauzen passte.
Eine Gruppe Frauen und Männer, die seit Jahren an der Seite ihrer Mutter für die Gilde arbeiteten, stach besonders hervor. Sie saßen an einem Tisch in der Ecke und warfen Bria immer wieder spöttische Blicke zu, während sie sich mit gebratenem Fleisch vollstopften.
»Schaut euch unser kleines Mädchen an«, flüsterte George Gray seinem Nachbarn zu und trank sein Ale fast in einem Zug aus. Zu hören war er natürlich nicht, aber Bria vermochte, von den Lippen zu lesen – ein kleines Talent, von dem kaum jemand wusste. »Noch mal eine Lehrzeit von vier Jahren und sie wird vielleicht endlich erwachsen.«
Bria unterdrückte die aufsteigende Wut. Eine Szene machte es selten besser, sie hatte es oft versucht und damit am Ende bloß ihre Mutter beschämt. Die Musik war laut genug, um die Stimmen zu übertönen, und links von ihr machte Thomason Warrick Anstalten mit ihr zu flirten. Sicher nicht ohne Hintergedanken – und die hatten nicht mal was mit den Innenseiten von Brias Schenkeln zu tun –, aber Thomason war hinreichend hübsch, um eine Nacht lang darüber hinwegzusehen, dass sein Interesse nicht vorrangig Bria galt. Doch ihre Aufmerksamkeit huschte ungewollt immer wieder zu Grays Tisch, wo sich die Diebe darüber austauschten, was sie, ihre Kinder oder Kindeskinder in Brias Alter schon alles erreicht hatten. Was sie alles gestohlen hatten. Und auch wenn da sicher eine Menge Großkotzigkeit im Spiel war, war der Vorwurf hinter all den Worten durchaus berechtigt.
Brias Mutter, die sagenumwobene Farne O’Toole – die Königin der Diebe – hatte Bria ausgebildet und sie sämtliche Fähigkeiten einer überragenden Diebin gelehrt. Einer Meisterdiebin. Anschließend hatte sie Bria in die Lehre zur Goldschmiedin nach Cambridge geschickt – wieder mit dem Ziel, eine bessere Diebin aus ihr zu machen – die beste womöglich. Doch bis heute hatte sie nicht zugelassen, dass Bria ihr Können endlich unter Beweis stellte.
Bria war zweiundzwanzig Jahre alt. Eine Frau, sollte man meinen. Aber in den Augen der Gilde – die einzigen Menschen, auf deren Meinung sie etwas gab – war sie bloß ein Wildfang, der nicht erwachsen werden wollte.
Als hätte sie ihre Gedanken gespürt, sah Farne zu Bria auf und forschte in ihrer Miene. Gleich würde sie sich wieder erkundigen, warum Bria so verstimmt wirkte, warum sie ihre Feier denn nicht genoss. Als würde ihre Mutter nicht selbst sehen, wie wenig Bria in ihrem Heimatort respektiert wurde. Wie groß die Verachtung war. Noch immer.
Farne ignorierte diesen Umstand seit Jahren, und Bria gab sich alle Mühe, sich nicht anmerken zu lassen, dass sie darunter litt.
Natürlich war es richtig, dass sie für ihren Fehler büßen musste – aber sollte das denn nie ein Ende haben?
Sie hatten alle darauf gehofft, die harten Jahre in Cambridge würden dazu führen, dass ihre Gilde sie endlich akzeptierte. Dass die Menschen mehr in ihr sehen würden als das impulsive Kind, das sie gewesen war. Aber nein. Dazu musste sie wohl erst beweisen, dass sie wirklich eine von ihnen war.
Nun gut. Das konnten sie haben!
Bria strich die weiße Strähne zurück, die sich wie eine Mahnung aus ihrem braunen Haar gelöst und nach vorn gedrängt hatte, und ordnete ihren langen weiten Rock mit dem schwarzen Rüschensaum. Ihr Bein wippte im Takt zur Musik und die glänzenden Ringe an ihrem Knöchel klimperten bei jeder Bewegung wie goldene Fußfesseln. Ophelia hatte sie ihr geschenkt – sie waren Teil einer fetten Beute, die sie im letzten Winter gemacht hatte. Ophelia galt als die Geliebte ihrer Mutter, aber sie war viel mehr als das. Für Bria war sie ebenso sehr eine Mutter wie Farne. Leider hatten sich die beiden gegen Bria verschworen. Sie behüteten sie wie zwei Hennen ihr einziges Ei. Wenn die Aufmerksamkeit der einen kurz nachließ, stand die andere parat. Es war ihnen gewiss bewusst, dass sie dem Unmut der anderen damit noch Zunder gaben, aber aus irgendeinem Grund kamen sie einfach nicht aus ihrer Haut.
Das Lied verklang und die Musiker reichten eine Flasche herum. Die Wirtin eilte zwischen den Tischen umher und tauschte leere Krüge gegen volle. Sie war trotz ihrer stattlichen Größe die Einzige, die sich nicht regelmäßig den Kopf an den niedrigen schwarzen Balken anstieß. Im Vergleich mit Cambridge erschien Stolen Costessy wie aus der Zeit gefallen. Kerzenlicht, statt Elektrizität. Pferde und Eselwagen vor den Häusern, statt Automobile und Straßenbahnen. Die Taverne mit ihren Lehmwänden und niedrigen Decken sah vermutlich noch genau so aus wie im Mittelalter.
Nicht selten fühlte es sich auch genau so an. Würde jemand rufen: »Hey, lasst uns doch mal wieder wie früher ’ne Hexe verbrennen, Fairies gibt es hier ja keine mehr, nehmen wir doch Sabria O’Toole!« – man würde vermutlich Beifall klatschen.
»Hübschen Plunder macht sie ja, unser Goldstückchen«, las Bria auf George Grays Lippen, während er sich zu Jon Warrick beugte. »Aber ich wette, auf der Straße ist sie schneller tot, als dein Thomason braucht, um ein Mädchen abzuschleppen.« Gray schlug Thomasons Vater anerkennend auf die Schulter und beide Männer sowie die anderen an ihrem Tisch schüttelten sich schier aus vor Lachen.
Es reichte langsam! Es mochte nichts bringen, Paroli zu bieten. Aber es brachte ja auch nichts, es nicht zu tun.
»Gray!«, rief Bria durch die gesamte Taverne. »Deine Wette! Ich nehme sie an.«
Sofort nahm die Lautstärke ab, auch wenn längst nicht alle bemerkt hatten, dass die Gefeierte auf ihrem eigenen Fest eine Wette einging. Dafür war der Alkoholpegel zu weit angestiegen. Einige hatten es jedoch mitbekommen und raunten einander etwas zu, oder stießen ihre Nachbarn an.
Auch Farne und Ophelia wurden still. In Farnes Miene war wie immer nichts zu lesen. Ophelia dagegen schien mit sich zu ringen.
In ihrem Kopf hörte Bria Ophelias Wispern: Lass dir nichts gefallen! Aber eine Wette an einem Ehrentag?
Bria hatte sich immer heimlich darüber amüsiert, wie abergläubisch die Gilde der Diebe war. Wetten an Feiertagen brachten Unheil, wie schwarze Katzen, bestimmte Kalendertage oder sonstiger harmloser Unsinn.
»Um was wetten wir denn?« Bria stellte ihr Glas neben ihren nackten Füßen auf dem Tisch ab.
Von George Gray war nicht viel zu erwarten, er aalte sich unbehaglich auf seinem Stuhl herum. Markige Töne zu spucken war die eine Sache. Vor der Königin der Diebe auf das Ableben ihrer Tochter zu wetten, offenbar eine andere.
Die Musiker wollten weiterspielen, aber Bria wies sie mit einem Handzeichen an zu warten. Sie stand auf und trat in die Mitte der langen Holztafel. »Ich schlage Folgendes vor: Ich gehe in eine große Stadt. Nach London vielleicht, oder nein. Ich gehe nach Liverpool. Und ich gehe als Diebin. Wenn du gewinnst und ich sterbe, darfst du in meine Goldschmiede gehen und dir den dicksten Klumpen Gold aussuchen. Er soll dir gehören.«
»Woran soll er denn erkennen, ob es echtes Gold ist?«, mischte sich eine dünne ältere Frau ein. Natürlich! Grays Schwester Leese, die schon vor Jahren, bevor Bria Stolen Costessy verlassen hatte, von allen nur die Miese-Leese genannt worden war.
»Rattengold löst sich nach zwei bis drei Wochen in seine Bestandteile auf – Farbe und Kohle. Er soll einfach warten, bis meine Leiche kalt ist.«
Gelächter brandete auf und die Flötenspielerin flötete eine Art hellen Tusch.
Es tat gut, das Lachen zu kontrollieren, statt verlacht zu werden. Eine seltene und zu kurze Wohltat. Bria machte sich nichts vor, es war ihr nur gelungen, weil die Leute gesoffen hatten wie die Löcher.
»Wenn ich aber zurückkehre – und zwar lebendig und mit Beute –, dann wirst du, Gray, meine nächste Festlichkeit austragen. Und zwar nicht in dieser mickrigen Taverne hier«, sie warf der Wirtin ein entschuldigendes Lächeln zu, »nichts für ungut, Mecki. Sondern in Liverpool!« Bei jedem Wort applaudierten mehr Leute und für das finale Crescendo atmete Bria noch mal tief durch. »Und ihr seid alle eingeladen!«
Die Taverne bebte vor Lachen, Jubel und den Fäusten und Stiefelsohlen, die auf Tische und Bodendielen polterten.
Sie alle wussten, dass es ein Spektakel für den Moment war. Gray hatte nicht das Geld für ein solches Fest und darüber hinaus traute ohnehin niemand Bria einen großen Coup zu. Sie jubelten, weil sie sternhagelvoll waren – und das waren sie, weil Farne O’Toole es so wollte. Nur sternhagelvoll verspotteten und beleidigten sie Bria nicht auf die bösartige, rachsüchtige Weise, sondern auf eine erbärmlich harmlose.
Bria fixierte Gray durch den schummrigen Schankraum, und der hatte keine andere Wahl, als die Arme zu heben und eine Faust in die Handfläche zu schlagen: Das Zeichen der Zustimmung und einer gemeinsamen Abmachung, die nun galt.
Wetten während einer Feier mochten ein schlechtes Omen sein. Aber sich auf eine Wette nicht einzulassen, wenn man sie selbst vorgeschlagen hatte, war schlimmer, denn es war ein Zeichen von Feigheit.
Bria war stolz, die Stimmung in der Taverne gedreht zu haben, doch dieser Stolz spiegelte sich nun nicht unbedingt in der Mimik ihrer Mutter. Farne sah sie mit einem Blick an, wie damals, als Bria ihrer Urgroßmutter den Gehstock gestohlen hatte, um ein Steckenpferd daraus zu basteln. Es hatte ein Geschenk werden sollen, und Bria war so sicher gewesen, es würde der Granny gefallen. Sie hatte Pferde so gemocht …
Wie auch immer. Die Sorgen ihrer Mütter würden ihr nicht länger im Weg sein. Der Zeitpunkt war gekommen, ihre Pläne in die Tat umzusetzen.
»Spielt Musik«, rief sie den Männern und Frauen an den Instrumenten zu. »Spielt schnell und spielt laut, denn das ist mein Fest und ich will nun tanzen!« Sie tanzte schon, bevor die Saiten gezupft und die Trommeln geschlagen wurden, tanzte in einer Drehung über den Tisch und blieb vor Thomason Warricks Platz stehen.
Offenbar gefiel es Thomason, wie sich der Abend entwickelte. Begeisterung ließ seine Augen fiebrig glänzen.
Er war mit seinem welligen blonden Haar und den funkelnden blauen Augen mit Abstand der attraktivste Mann in ganz Stolen Costessy, wenn nicht gar in der gesamten Grafschaft Norfolk. Mit ihm zu tanzen, bedeutete eine Kriegserklärung an die Frauen, die glaubten, hier das Sagen zu haben, allen voran Scarlett Gray, Georges Nichte. Farne hatte ihre Tochter nie gegen andere Kinder und Jugendliche verteidigt, sie und Ophelia waren fest davon überzeugt, dass Bria das selbst lernen müsse – was Bria jedoch nie gelungen war. Scarlett und ihre Freundinnen hatten schon im Mädchenalter die Spitze der Nahrungskette gebildet, und sie würden ihr spätestens ab jetzt das Leben erneut zur Hölle machen. Bria kannte das alles zur Genüge. Sei es das Getuschel, die Lügen, die sie verbreiteten, oder die kleinen Missgeschicke, die immer dafür sorgten, dass ausgerechnet Brias Korb umfiel, dass jemand sie anstieß und schubste oder dass sich ein klebriges Getränk ganz aus Versehen über Brias Rock ergoss.
Allerdings war Scarlett bedauernswerterweise heute nicht eingeladen. Und Bria würde bald nicht mehr hier sein. Wenn sie mit Beute von ihrem großen Coup zurückkehrte, würde es niemand mehr wagen, sie zu beleidigen.
»Tanz mit mir!«, sagte sie und hielt Thomason die Hand hin.
Er zögerte nicht, ergriff sie und lächelte dabei dieses Lächeln, das schön genug war, um – so behauptete man – Höschenstoff in seine Fasern zerfallen zu lassen. Ein kraftvoller Sprung und er stand neben ihr auf dem Tisch und zog sie an sich. Das war es, was ihn zu so einem guten Dieb machte. Sein Charme, sein Lächeln und die geschmeidige Stärke seines Körpers.
»Ich dachte, du fragst nie«, raunte er ihr zu, während sie leichtfüßig über den Tisch tanzten. Die Musiker schienen ihre Freude daran zu finden, sie spielten immer lauter.
»Ich wollte es spannend machen. Und dafür sorgen, dass uns alle zusehen.«
»Ich habe natürlich gerade nur Augen für dich, aber ich vermute mal, das könnte dir gelungen sein.«
»Da kannst du Gift drauf nehmen.« Mit den nackten Zehen stieß Bria einen Krug um, weil er ihr im Weg war. »Und nun entspann dich. Du brauchst nicht versuchen, mich rumzukriegen.«
»Nicht? War ich schon erfolgreich? So schnell?«
Bria lachte leise. »Nein. Aber ich weiß, worauf du wirklich scharf bist. Auf meine Mutter.«
»Ähm … Bria? Das klingt seltsam.«
»Sie ist es, die du willst. Wage es nicht, mir etwas anderes vorzumachen.« Sie stieß sich von ihm ab, wirbelte in einer Drehung herum und schmiegte sich wieder an seine Brust, wo sie leise genug sprechen konnte, damit nur er sie hörte. »Du willst über mich in ihren inneren Zirkel und an ihrem Erfolg lecken. Das kannst du vergessen.«
Darauf schwieg er zunächst, was Bria imponierte. Wenn er versucht hätte, sich herauszureden, hätte sie das abgestoßen. Sie hatte nichts gegen Lügen – Lügen waren das beste Werkzeug aller Diebe. Aber sie mussten gut sein. Scharf, präzise und effizient.
»Warum tanzen wir, wenn du es doch weißt?«, fragte Thomason schließlich, und war damit genau da, wo Bria ihn haben wollte. Er wusste, dass sie sich nicht benutzen ließ, und war trotzdem neugierig genug, nicht beleidigt abzurauschen.
»Weil ich einen Plan habe. Für mich … und vielleicht für dich. Wenn du willst.«
»Hat er mit Sex zu tun?«
»Nein. Nicht in dieser Nacht.«
»Schade. Wenigstens mit Rummachen?«
»Thomason, du wirst so schnell vermutlich nicht mal einen Kuss von mir bekommen. Aber etwas viel … Besseres.«
»Was?«
Sie knuffte ihn heftig in den Brustmuskel.
»Au. Was soll das jetzt?«
Bria schnaubte empört. »Du hättest jetzt sagen können, es gäbe ja wohl nichts Besseres. Ein wenig bemühen musst du dich schon. Ich meine – hallo? Ich habe eine Idee, die am Ende dazu führen wird, dass du nie wieder am Erfolg eines anderen Diebes lecken musst. Du hast dann deinen eigenen, und er wird reichen, um dich daran ein Leben lang zu berauschen. Thomason?«
»Hmm?«
»Sie werden dann an deinem lecken wollen.«
Thomason unterbrach den Tanz. »Was hast du vor? Planst du einen Coup?«
Sie sah ihm in die Augen. Aufpassen, Bria. Darin könnte man sich wahrhaftig ein wenig vergessen. »Ich plane nicht nur einen Coup. Ich plane den einen Coup. Meinen Coup.«
KAPITEL 2
KAYLEIGH
Und weil es von so großer Wichtigkeit ist, wiederhole ich es. Wir erwarten absolute Diskretion.«
Vermutlich hatte man Kayleigh darum zu so später Stunde abgeholt und hergebracht. Der Kunde sollte ein Mann sein, hatte man ihr gesagt. Er ließ sich bislang von seiner Sekretärin, einer Dame in züchtiger Bluse, einem bodenlangen, engen Rock und einer noch viel längeren Schärpe aus Parfümduft vertreten. Die auf Hochglanz polierte Kutsche mit den zwei prächtigen Rappen davor und dem schweigsamen Kutscher auf dem Bock, hatten Kayleigh annehmen lassen, in ein herrschaftliches Anwesen gebracht zu werden. Altmodisch, aber edel. Vielleicht gar in ein Schloss? In manchen Ecken des Landes stand an jeder Wegekreuzung ein Schloss. In den Vororten von Liverpool allerdings nicht.
Dies hier war jedenfalls kein Schloss.
Es war ein unaussprechlich hässlicher Klotz aus verrußten Backsteinen inmitten von Dutzenden solcher Klötze. Fünfzig Fuß breit, fünfzig Fuß hoch und ganz bestimmt auch fünfzig Fuß tief. Die Fenster waren vergittert und dunkel verhangen, und als der Kutscher ihr die Tür aufsperrte, tat sich noch eine weitere auf.
»Das hier ist kein Gefängnis, oder?« Kayleigh lächelte, als sei es ein Scherz. Hoffentlich sah man ihr ihre Nervosität nicht an.
»Nein«, sagte die Frau mit rauchiger Stimme.
Kayleigh schämte sich für ihre Erleichterung. Was war schon dabei, Menschen zu behandeln, die einsaßen? Auch die brauchten Heilung, und Ärztinnen und Ärzte waren sicherlich unerschwinglich für sie.
Ob sich in diesen Zeiten überhaupt noch jemand um Gefangene kümmert?, überlegte sie, während sie der Sekretärin, die mit klappernden Sohlen voraneilte, an einem Empfangstresen vorbei durch einen Korridor folgte.
Von innen hatte das Gebäude etwas von einem Schloss. Marmorböden, stuckverzierte Decken, schwere Samtvorhänge vor jedem Fenster. Wie ungewöhnlich. Ein versteckter Liverpooler Schlossklotz. Alles etwas angestaubt, aber das mochte durch die Dunkelheit so wirken.
Es war ihre erste Reise in eine große Stadt, und auch wenn es sie bisher nur in diesen Vorort verschlagen hatte, war Kayleigh jetzt schon nicht mehr sicher, ob sie diese Aufgabe würde durchstehen können. Es war nicht einmal so sehr die zwielichtige Kundschaft, die ihr Angst machte. Auch nicht das Wissen, dass überall Diebe umherstreiften, die es auf ihr Geld, ihre Heilmittel, ihren Wagen oder – die Vorstellung tat körperlich weh – auf ihre beiden Pferde abgesehen hatten.
Es war das Heimweh nach ihrer Familie. Als Tinkerin gehörte es dazu, nach bestandener Ausbildung mindestens ein Jahr lang allein zu reisen. Hätte Kayleigh einen Weg gefunden, ihre volle Anerkennung auf einem anderen Weg zu erlangen – sie wäre nicht hier. Oder nur im Kreise ihrer Tante und ihrer drei Schwestern. Ob diese sie ebenso vermissten, wie Kayleigh sie? Ein furchtbarer Gedanke – es sollte ihnen gut gehen!
Reiß dich zusammen, mahnte sie sich. Mach das Beste draus, schlecht wird es von allein.
Überall in diesem Gebäudeklotz standen Merkwürdigkeiten herum. Abgedeckte Kästen, mal ganz klein auf Podesten, dann groß wie Särge. Gebilde hinter weißen Tüchern, die an deformierte Gespenster erinnerten. Unter eine verrutschte Decke konnte Kayleigh einen Blick erhaschen. Ein ausgestopftes löwenähnliches Tier war zu erkennen – jedoch hatte es sechs klapperdürre Beine.
»Die Herrschaften haben ein Faible für missgestaltete Kreaturen.« Die Frau ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie diese Vorliebe nicht teilte. »Dieses widerliche Geschöpf da haben sie vor wenigen Monaten auf einer Reise nach Fernost erlegt.«
Das arme Tier. Erst kam es krank zur Welt, dann wurde es abgeknallt und am Ende musste es sich demütigen lassen.
Hinter einer weiteren Tür verstummte das Geklapper der Schuhe und Kayleighs flache Sandalen sanken in weichen Teppich.
»Mylord?« Die Bedienstete knickste vor einem Schreibtisch, hinter dem ein großer, hagerer Mann mit grauem Gesicht saß. Optisch erinnerte er Kayleigh ein wenig an ihren Vater mit dem kurzen, aber dichten, dunklen Bart und der Zigarre im Mundwinkel. Doch die Ähnlichkeiten waren rein äußerlicher Natur, denn wo ihr Vater sanft und gutmütig war, verströmte dieser Mylord auf den ersten Blick bloß harte Kälte.
»Die Tinkerin ist da, Mylord.«
Kayleigh räusperte sich. »Guten Abend, Sir. Mein Name ist Kayleigh of the Lanes. Sie haben nach mir schicken lassen?«
Der Mann stellte sich nicht vor, aber das hatte die andere Frau Kayleigh schon angekündigt.
Er zog an seiner Zigarre. »Deine Tante?«
Kayleigh konnte nicht widerstehen, sich dümmer zu stellen als sie war. »Ist wohlauf, vielen Dank, Sir.«
Er schnaubte missbilligend. »Ich will wissen, warum sie nicht hier ist. Ich habe nach ihr rufen lassen.«
»Sie reist, Sir.«
»Sie reist. So.«
So. Eine Menge Menschen verstanden nicht, warum es den Tinkern so wichtig war, im Land umherzufahren, mal dort zu leben und mal wo anders, mal von der einen zu lernen, mal den anderen zu unterrichten. Die meisten fragten auch nicht nach den Gründen. Aber nur wenige schafften es, so viel Verachtung für eine andere Art zu leben in eine einzige Silbe zu verpacken.
»Dann und wann werden die Dienste meiner Tante auch im Norden gebraucht«, sagte Kayleigh, um Freundlichkeit bemüht. Es war nie von Vorteil, mit den Kunden zu streiten. Nicht, bevor sie bezahlt hatten.
»Nur brauche ich sie hier.«
»Sie würden anders denken, wohnten Sie im Norden, Sir.« Ein kleines Schulterzucken musste drin sein. Das war doch nicht zu provokant, oder? »Aber Sie können sicher sein, dass ich in den Heilkünsten ebenso gut ausgebildet wurde, wie meine Tante Abigail«, ergänzte sie schnell. »Von ihr habe ich alles gelernt.«
»Dann hoffe ich, dass es für meine Zwecke reicht«, murmelte der Mann. Er klang seltsam besorgt dabei, und Kayleighs Neugierde wuchs. Wer mochte ihre Hilfe brauchen? Der Mann selbst? Er wirkte nicht krank, aber so manche Krankheit tarnte sich hundsgemein. Seine Frau vielleicht? Ein Elternteil oder gar ein Kind?
»Nun gut, also komm«, sagte der Mann und deutete zu einer schmalen Tür hinter sich. Die Sekretärin bekam ein Handzeichen und trippelte davon. »Ich muss aber daran erinnern, dass ich mich auf absolute Verschwiegenheit verlasse. Die Sache ist ein wenig … heikel.«
Auweia. Das konnte nur eines bedeuten: Eine Geschlechtskrankheit.
Kayleigh spürte den Drang zu schlucken, wollte sich aber nicht als unerfahren verraten und kämpfte dagegen an. »Das ist kein Problem, Sir. Machen Sie sich keine Gedanken. Wir Tinkerinnen schweigen. Und vertrauen Sie mir – wir haben alles schon gesehen.«
»Daran hege ich Zweifel.« Er hielt Kayleigh die Tür in das Hinterzimmer auf, und – bei der Weisheit der Sterne! – er hatte recht!
Das vermeintliche Hinterzimmer war ein Saal, groß genug, um sämtliche Bewohner eines Dorfes darin zusammentrommeln zu können. Eher schien das Büro ein Hinterzimmer dieses Saales zu sein. Der Raum lag im Dunkeln, nur in der Mitte glomm bläuliches Licht. Es kam von drei deckenhohen Säulen, einer Art gläserner und mit Wasser gefüllter Zylinder, in deren Böden Gaslichter das Innere beleuchteten. Zwei der Säulen beherbergten bunte Fische in großer Zahl. Zwischen aufsteigenden Blasen schwammen sie hin und her, stießen ans Glas und flüchteten eilig in die andere Richtung, wo alsbald die nächste Grenze wartete. Dass sie in den Zylindern sehr unvorteilhaft untergebracht waren, zeigte sich spätestens bei einem Blick nach oben. Knapp zwei Fuß unter der Decke endete der Wasserstand und an der Oberfläche dümpelten einige tote oder halbtote Fische, die krampfhaft ihre Kiemen bewegten, beim Versuch, das Wasser zu atmen.
Kayleigh sank Traurigkeit in den Bauch. Traurigkeit und Scham, denn sie ahnte schon, dass sie nicht hier war, um den armen Fischen helfen zu dürfen.
Ohnehin schienen diese nur ein dekoratives Element für den dritten Zylinder zu sein, der geringfügig weiter war. In diesen hätte ein Mann mit breiten Schultern gerade eben hineingepasst.
Was sich allerdings darin befand …
Kayleigh keuchte auf und wich einen Schritt zurück. Ihr Herz raste und all ihre Instinkte schrien: Verschwinde hier! Hau ab, egal wohin, aber flieh!
»Und?«, fragte der namenlose Mann mit aufgesetzter Langeweile und zog an seiner Zigarre. »Wirklich schon mal eine gesehen?«
Ja. Ja, das hatte sie. Aber das war fast zwanzig Jahre her.
Kayleigh war so klein gewesen, dass sie sich kaum erinnerte. Sie erinnerte sich nur an die Schreie. An die Todesschreie ihrer Schwester, als die Meerjungfrau sie am Hals gepackt und mit sich gerissen hatte. Einen Augenblick später war Eilis unter der Wasseroberfläche gewesen.
Blut hatte sich ausgebreitet. Eine riesige Wolke aus Blut. In Kayleighs Erinnerung war das ganze Meer voller Blut. Und alles war still.
KAPITEL 3
BRIA
Lass uns vor die Tür gehen«, sagte Bria.
Thomason hielt sie noch immer wie zum Tanzen an sich gezogen, obwohl sie nun schon eine Weile stillstanden.
»Die Tischplatte in einer Taverne voller Diebe ist ein denkbar schlechter Ort, um einen wahnwitzig guten Diebeszug zu besprechen.«
Außerdem starrte Farne sie an. Sie trug ihre übliche undurchdringliche Maske zur Schau, aber Bria wusste um die Besorgnis dahinter.
Keine Angst, Mom. Ich weiß selbst, dass dieser Mann kein Interesse an mir hat.
Thomason war einfach ein wenig klüger als die meisten hier. Er nutzte jeden Vorteil, der sich bot. Selbst wenn er dazu mit Bria O’Toole tanzen, oder sich fortan dafür verspotten lassen musste, mit ihr in die Nacht verschwunden zu sein.
Ein paar Leute brüllten ihnen zotige Bemerkungen nach, als sie vom Tisch kletterten und sich einen Weg durch die Menge nach draußen bahnten. Thomason bekam von einem älteren Mann Ratschläge, die nicht danach klangen, als hätte der Kerl selbst auch nur den Hauch einer Erfahrung.
»Lies ein Anatomiebuch, statt meinen Freund zu belästigen!«, rief Bria ihm zu und stieß die Tür auf. Ein lauer Wind empfing sie, und sie atmete tief durch, erleichtert, frische Luft in die Lunge zu bekommen. Noch angenehmer war die Ruhe. Sie merkte erst jetzt, wie sehr der Lärm in der Taverne sie gestresst hatte. Der Nachtwind flüsterte in den Baumkronen und die Grillen zirpten.
»Lass uns ein Stück gehen«, bat Bria und tappte auf nackten Füßen über die kühle Straße in Richtung Waldrand. Bald hatten sie den Lichtschein der Laternen verlassen, die an der Außenfassade der Taverne leuchteten. Und viel länger konnte Bria sich auch nicht mehr beherrschen.
Ihre Idee musste endlich aus ihr raus! Es war schwer genug zu wissen, dass sie nicht sofort würden aufbrechen können.
»Ich plane diese Aktion bereits eine ganze Weile«, begann sie, während ihre Finger nervös am Stoff ihres Rockes herumnestelten. »Aber bisher habe ich mit niemandem darüber gesprochen.«
»Nicht mal mit deiner Mutter?«, erkundigte sich Thomason überrascht.
»Ich bitte dich. Sie ist der Grund, aus dem ich noch nie etwas Nennenswertes gestohlen habe.«
»Nicht, dass ich deinen Plan nicht gern hören würde. Und vielleicht bin ich auch dabei. Aber ich frage mich, warum du ausgerechnet mit mir eine Allianz eingehen willst. Wir kennen uns kaum.«
Das war nicht ganz richtig. Bria wusste alles über Thomason Warrick, was für sie relevant war. »Du bestiehlst durch Täuschung und Einbrüche – aber du bist ein Phantom. Keine Kämpfe, keine Sichtungen. Ich mag deinen Stil und du bist unglaublich verwegen. Ich will mit jemandem arbeiten, der gut ist. Und …«
»Und?«
Sie hatten den Waldrand erreicht. Die Nacht war noch empfindlich kalt und der Boden klamm, aber Bria zitterte nicht allein deshalb. »Und ich mag deinen moralischen Kompass. Er zeigt in dieselbe Richtung wie meiner.«
Es gab jede Menge Diebe, die klauten, was sie in die Finger bekamen. Aber die besten unter ihnen, die Künstlerinnen und Künstler, nahmen gezielt von denen, die ohnehin viel zu viel hatten, und bedachten immer auch jene, auf deren Kosten die Reichen es sich bequem machten.
Thomason nickte nachdenklich. »Und deinen Coup, den machen nur wir beide? Nicht mal deine Freundinnen wissen Bescheid?«
Freundinnen? Welche Freundinnen?
Hatte Thomason mit der feinen Beobachtungsgabe etwa nicht gemerkt, dass sie so etwas nicht hatte? Nie gehabt hatte? »Die Mädchen, die du dafür gehalten hast, wurden allesamt von meiner Mutter bezahlt, um mich von schlimmer Gefahr fernzuhalten. Sie wird vielleicht auch dir Geld bieten, und ich möchte dich bitten, es zu nehmen. Wir werden es brauchen.«
Er lachte, ließ sich auf einen Findling sinken und sah zu ihr auf. »Das klingt gefährlich – für mich.«
»Meine Mutter ist es doch, die predigt, wir sollen den Reichen nehmen und den Armen geben. Nun, sie ist zweifellos die reichste Frau von Stolen Costessy. Und ich …«, sie krempelte ihre Rocktaschen nach außen, »hab fast nichts.«
Wieder lachte Thomason.
Das Gespräch lief unerwartet gut. Damit hatte sie kaum zu rechnen gewagt.
»Wenn wir zurückkommen, Thomason Warrick, sind wir noch immer keine reichen Leute.« Sie senkte die Stimme zu einem Flüstern. »Aber jeder Dieb im Land wird unsere Namen kennen.«
»Was willst du stehlen? Kronjuwelen des Königs von England? Alte Zauberspruch-Folianten der Fairie-Königin?«
»Nein. Beides wurde schon von anderen geklaut. Ich will etwas, an das sich noch niemand gewagt hat.« Sie griff sich ins Dekolleté und zupfte etwas heraus, was den ganzen Abend in ihrem BH gesteckt hatte. Es hatte ihre Haut unterm Busen eingedellt und der nachlassende kleine Druckschmerz ließ sie aufseufzen. »Hier. Sieh es dir an.«
Thomason nahm das rundliche warme Ding an sich, tastete es in der Dunkelheit mit den Fingern ab und hielt es ins schwache Licht der Sterne.
»Ein Siegelring.« Seine tonlose Stimme verriet bereits, dass er eine Idee hatte, wem der Ring gehören könnte. Sie gefiel ihm aber nicht.
»Ich habe ihn nachgearbeitet, damit wir ihn austauschen können«, sagte Bria und konnte kaum verhindern, dass in ihren Worten der Stolz auf ihr Werk mitklang. Sie hatte nicht umsonst vier Jahre bei der Besten gelernt und ihre wahre Berufung unterdrückt. »Der echte ist das perfekte Beutestück. Er hat überhaupt keinen materiellen Nutzen. Niemand hat ohne den Ring auch nur einen Penny weniger. Aber der symbolische Wert ist unermesslich! Es ist noch nie jemandem gelungen, die Skysons zu bestehlen. Und weil es eine Verbrechergang ist, wird uns absolut niemand den Diebstahl übelnehmen. Alle werden es als Heldentat feiern!«
»Das ist wirklich dein Ernst?« Thomasons gute Laune war wie weggeblasen. »Du willst den Siegelring des Cormorants klauen? Den Ring des Anführers der Skysons?«
»Ja.« Ja, natürlich. Was denn sonst?
»Woher weißt du, dass dein Duplikat gut genug ist? Hast du den echten mal gesehen?«
»Bloody Bugger, dann gehört er jetzt mir. Der Vater meiner Lehrmeisterin hat das Original entworfen und gefertigt. Er besitzt noch alle seine Entwürfe und Aufzeichnungen. Sagen wir besser: Er besaß sie, bis ich kam.«
»Und wie willst du ihn austauschen?«
»Das kriegen wir heraus. Wir recherchieren vor Ort und finden ihre Schwachstellen. Genau dafür brauche ich dich.«
»Bria. Diese Gang kontrolliert ganz Liverpool – etwas, das nicht mal der Krieg vermochte. Die Polizei kuscht vor diesen Leuten, das menschliche Militär hält sich komplett raus, selbst die Faires schleimen sich bei ihnen ein.«
»Deshalb ja, Thomason!« Begriff er denn gar nichts?
»Das sind unfassbar brutale und skrupellose Verbrecher. In deren Köpfen herrscht noch immer Krieg. Und ihr Anführer ist der schlimmste von allen, Sabria O’Toole. Es heißt, er habe seinen Vater getötet und in Brocken an dessen eigene Hunde verfüttert.«
Bria schluckte. Sie kannte die Gerüchte natürlich, aber … »Ich habe ja nicht vor, mich mit ihm anzulegen. Ich will nur den Ring. Er wird es gar nicht merken.«
»Mit dem Ring«, sagte Thomason und wog das Duplikat in seiner Handfläche, »brennen sie ihren Opfern ihr Zeichen ein, bevor sie die Leichen entsorgen.«
»Ja, das ist verdammt schaurig.« Aber sie würde sich trotzdem nicht mehr von ihrem Plan abhalten lassen. »Aber damit ist es dann wohl vorbei, wenn ich mit dem Cormorant fertig bin. Cormorant … Findest du nicht auch, dass es … irgendwie lächerlich klingt, sich nach einem Vogel zu benennen?«
»Vogel hin oder her. Es ist zu groß. Es ist viel zu groß.«
»Ich brauche etwas Großes!« Es war frustrierend, erkennen zu müssen, dass er die Dringlichkeit nicht verstand. »Du hast doch gesehen, wie sie mich anschauen. Hier und anderswo. Wie sie mich messen, an dem, was meine Mutter erreicht hat. Sie hat mich besser ausgebildet, als je ein Dieb ausgebildet wurde, und dieses Erbe ist Segen und Fluch. In der Gilde hassen sie mich! Sie neiden mir die Tatsache, dass meine Mutter mich beschützt. Sie neiden mir meine Ausbildung.«
Er schnaubte. »Du weißt, dass es nicht allein das ist.«
»Nein, das ist es nicht. Sie werfen mir vor, dass ich den Brand damals überlebt habe. Ich lebe. Und andere nicht. Sie neiden mir mein Leben, samt der Narben und der Schmerzen darunter.«
Er sagte nichts, aber sie hörte, was er dachte: Du hast das Feuer gelegt, Bria. Du hast es verursacht. Und als Einzige überlebt.
Aber, verdammt, sie war ein kleines Kind mit einem Zündholz in der Hand gewesen. Nicht einmal drei Jahre alt. Warum lief ihr diese Schuld bis heute nach, wohin sie auch ging?
»Weißt du was, Thomason? Ich kann es ihnen nicht mal verübeln. Ich würde mich auch verachten, wäre ich nicht ich. Aber denk allein an Scarlett Gray, die vermutlich in diesem Moment die wildesten Gerüchte über dich verbreiten wird, weil du es gewagt hast, mit mir zu tanzen.«
»Scarlett!« Thomas sprach den Namen wie einen Seufzer aus. »Sie war doch nicht mal auf deinem Fest.«
»Na und? Sie weiß trotzdem längst Bescheid, glaub mir. Allein der Respekt vor meiner Mutter hält sie und ihre Gefolgschaft davon ab, mir zu beweisen, dass ich nicht mehr wert bin als der Dreck unter ihren Sohlen. Manchmal …«, sie musste schlucken, »habe ich Angst, was passiert, sollten Farne und Ophelia einmal nicht von einem Beutezug wiederkommen. Was machen Scarlett und die anderen mit mir, sollte die Königin der Diebe … fallen?«
Thomason seufzte. »Du wirst ihren Respekt schon noch bekommen.« Im Grunde wusste er gewiss, dass Bria recht hatte. Dementsprechend lahm klang seine Antwort. »Ausbildung hin oder her – du hast keine Erfahrung. Ich helfe dir, aber lass uns zunächst einen Coup planen, der nicht ganz so verrückt ist.«
»Er ist nicht verrückt. Er ist großartig. Nichts anderes außer einer großartigen Beute wie dieser Ring wird dazu führen, dass ich von der Gilde akzeptiert werde. Wenn ich warte, wird ihn jemand anders stehlen, das weißt du so gut wie ich.«
»Dann wird jemand anders mit dem Brandzeichen der Skysons in der Stirn kalt in der Themse treiben.«
»Im Mersey!«
»Was?«
»In Liverpool fließt der River Mersey.«
Er lachte freudlos. »Das klingt natürlich gleich besser.«
»Ich bin die Prinzessin der Diebe, Thomason, aber dieser Titel ist reiner Hohn. Ich habe es satt, den Schutz meiner Mutter zum Überleben zu brauchen. Sie werden mir eine Krone aus Scheiße aufsetzen und mich endgültig verbrennen, sollte der Tag kommen, an dem Farne es nicht mehr verhindern kann.«
Brias Hoffnung, er würde widersprechen, war nicht groß gewesen. Doch nun, da er resigniert zu Boden blickte, zerbrach sie vollends. Thomason kannte die Stimmung in Stolen Costessy viel besser als sie. Und er wusste, dass sie recht hatte.
»Trotzdem bin ich raus. Ich helfe dir, ich helfe dir wirklich gern Sabria. Ich bin dein Komplize. Aber nicht, wenn du nach diesem Ring greifst.«
Damit gab er ihn Bria zurück. Ihre Fingerspitzen fuhren über das Siegel. Es zeigte das Meer, gut zu tasten waren die Wellen und die scharfe Linie des Horizonts. Dahinter stiegen schemenhaft umrissene Gestalten zum Himmel hoch und lösten sich auf, bevor sie ihn erreichen konnten. Geister. Tote. Mordopfer der Gang. Es waren viele und ihre Seelen schienen verloren. Zerfasert zu nichts, irgendwo zwischen Himmel und Meer.
Thomason griff nach ihrer Hand. »Wir finden etwas anderes, Bria. Etwas ebenso Gutes, das weniger selbstmörderisch ist.«
»Bist du sicher?«
»Ja. Vollkommen sicher.«
»Gut.« Ja, gut, denn Bria war sich alles andere als sicher. Sie wusste nur, dass sie ihren Beutezug unternehmen würde, mit oder ohne ihn. Vielleicht hatte er recht und sie würde nicht weit kommen. Vielleicht hatte er recht und die Sache war ihr wirklich zu groß. Aber das würde sie schon rechtzeitig merken, und dann konnte sie immer noch umkehren. Jetzt war dieser Punkt noch nicht erreicht – im Gegenteil.
Der Siegelring des Cormorants rief mit säuselnder Stimme ihren Namen. Und sie würde ihm folgen.
»Lass uns zurückgehen«, sagte sie und zog Thomason auf die Füße. »Wir sollten uns beeilen, bevor irgendjemand anfängt, Strampelhosen für unser erstes Kind zu stricken.«
Er grinste. »Denkst du, die haben sich schon auf einen Namen geeinigt?«
»Ja, und angesichts des Pegels werden wir damit klarkommen müssen, dass unser Erstgeborenes Brandy oder Gin heißen wird.«
»Gott bewahre uns. Wir müssen uns beeilen und das Schlimmste verhindern. Nur eine Frage noch, Bria. War das mit dem Kuss vorhin dein letztes Wort?«
Sie versetzte ihm einen Klaps gegen den Hinterkopf. »Du musst jetzt stark sein, Thomason. In Liverpool, weißt du – da hätte ich dich geküsst.«
»Mist, verdammter.«
»Und zwar wo immer du hättest geküsst werden wollen.«
»Scheiße, Bria.«
»Immer noch so sicher?«
Er lachte. Es klang unglücklich und gequält. »Der Tag mag kommen, an dem mein Schwanz über meine Coups entscheidet, wenn du so weitermachst. Aber dann …«
»Dann will ich dich nicht mehr, Thomason. Schon gut.«
KAPITEL 4
KAYLEIGH
Brauchst du einen Drink, Tinkermädchen?«
Kayleighs Mund war staubtrocken. Dennoch schüttelte sie den Kopf. Sie trat einen Schritt vor, und so schwer es ihr auch fiel, sie riss sich zusammen und betrachtete das Wesen in seinem Gefängnis.
Der schlanke Fischschwanz allein war so lang, wie ein Mann groß war. Nur ein spärlicher Rest des perlmuttartigen Schimmers auf den cremefarbenen Schuppen war noch zu erkennen. Überwiegend war der Glanz erloschen, die Fischhaut stumpf und an mehreren Stellen fehlten Schuppen, was an das löchrige Fell eines räudigen Hundes erinnerte. Der Schwanz ging in den dünnen – besser gesagt mageren – Oberkörper einer Frau über. Ihre Haut war bläulich wie die einer Wasserleiche, die Arme hingen herunter und ihre Silhouette nebst den kleinen, schlaffen Brüsten ließ vermuten, dass das Wesen so gut wie verhungert war.
Das Haar der Meerjungfrau umfloss sie in langen Strähnen, die Kayleigh an die gezackte Rückenlinie von Raubfischen erinnerten. Sie wurden zum Ende schlanker und feiner und endeten mit den gleichen, in der Strömung wehenden Flossenbarthaaren, wie auch die Schwanzflosse. Um das Haar von Meermenschen rankten sich besondere Mythen. Die Literatur beschrieb es mal als Strähnen, die sich von allein zu Zöpfchen fanden, mal als Wasserpflanzen und dann wieder als Tentakel. Nun aber, da Kayleigh die Meerjungfrau aus der Nähe betrachtete, schien ihr eine andere Theorie wahrscheinlicher, die sie bisher für vollkommen absurd gehalten hatte.
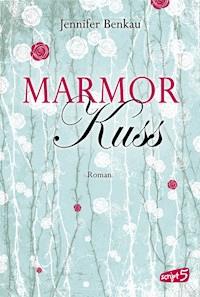











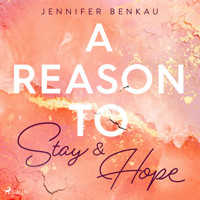
![Die Seelenpferde von Ventusia. Wüstentochter [Band 2 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/951159023fcc1fbce23b219e5bb9ea3d/w200_u90.jpg)

![Die Seelenpferde von Ventusia. Sturmmädchen [Band 3 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5301e0aef492f4b62003660f83fe52a5/w200_u90.jpg)
![Die Seelenpferde von Ventusia. Windprinzessin [Band 1 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/25fb250af2dc0456b6868226a45dcce5/w200_u90.jpg)












