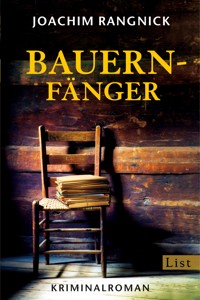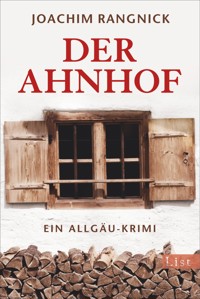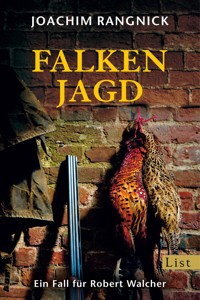
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Für Recherchen zu einem Artikel begibt sich Robert Walcher verdeckt in üble Kreise – undin höchste Gefahr. Kurz entschlossen rettet er zwei junge Mädchen vor Menschenhändlern,doch nun steht er ganz oben auf der Abschussliste eines skrupellosen Verbrecherrings. Kommissar Brunner unternimmt alles, um Walcher und seine Familie zu schützen, doch die Kontaktedes in ganz Europa agierenden Kartells reichen bis in die heile Welt des Allgäus undhinauf in höchste Kreise.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Ein neuer Auftrag führt Journalist Robert Walcher in eine Welt, die im idyllischen Allgäu nicht ferner erscheinen könnte: Er ermittelt in einem Fall von Menschenhandel und begibt sich selbst undercover in einen Kreis aus Männern, die mit jungen Frauen handeln wie mit Waren. Männer, die keine Skrupel kennen und die ihresgleichen schützen und dafür über Leichen gehen.
Das bekommt auch Walcher zu spüren: Zum Schein geht er auf ein Geschäft ein und kann so zwei Mädchen vor einem weiteren Martyrium bewahren. Durch seine Kontakte zur Szene gelingt es ihm bald, auch andere Mädchen zu retten. Bis er schließlich ins Visier des Menschenhändlerrings gerät, der sich seine lukrativen Geschäfte von Walcher nicht kaputtmachen lassen will.
Walchers Leben und die Unversehrtheit seiner Adoptivtochter Irmi sind in höchster Gefahr, und nicht jeder, der Walcher vermeintlich unterstützt, tut dies aus lauteren Motiven …
Wieder einmal hält das Böse im Allgäu Einzug – und Robert Walcher ermittelt unter Lebensgefahr für sich und seine Familie.
Der Autor
Joachim Rangnick ist studierter Grafiker. Heute schreibt er erfolgreich Kriminalromane. Er lebt in Weingarten. Falkenjagd ist der dritte Fall von Robert Walcher.
Von Joachim Rangnick sind in unserem Hause bereits erschienen:
Der Ahnhof
Bauernfänger
Winterstarre
Besuchen Sie uns im Internet:www.list-taschenbuch.de
Falkenjagd erschien 2007 unter dem TitelFrische Hühnchen im Selbstverlag.
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Überarbeitete Neuausgabe im List TaschenbuchList ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin. 1. Auflage September 2012 © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2012 Umschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, München Titelabbildung: © Andy Whale / Getty Images Satz und eBook bei LVD GmbH, Berlin
ISBN 978-3-8437-0286-7
Nestwärme
Die Schmerzen erstreckten sich über ihren ganzen Körper. Im Gesicht, auf der Brust, auf dem Rücken und am Gesäß waren sie erträglich. Aber ihr Unterleib brannte so, wie der Pfarrer das Höllenfeuer beschrieben hatte. Rodica dachte an ihren Unfall mit dem Fahrrad ihres Bruders vor drei Jahren, als sie barfuß von den Pedalen abgerutscht und mit voller Wucht auf die Querstange geschlagen war. Sie erinnerte sich genau daran, wahrscheinlich auch deshalb, weil sie mehrere Tage geblutet hatte.
Damals war sie elf Jahre alt. Seitdem blutete sie jeden Monat, und sie glaubte, es läge daran, dass die Wunde immer wieder aufplatzte. Sie hatte sich nie getraut, mit ihrer Mutter darüber zu sprechen. Mit dem Vater sowieso nicht. Der hätte sie vermutlich geschlagen, wie er fast täglich ihre ältere Schwester Ewa schlug, die als Blitzableiter der Familie herhalten musste. Ewa war geistig behindert. An ihr durften sich selbst die beiden jüngeren Brüder austoben, und manchmal schlug auch die Mutter zu, wenn Ewa ihr gerade im Weg war oder nur dastand und träumte. Ewa weinte dann still vor sich hin, aber das tat sie sowieso die meiste Zeit.
Der Vater hatte sich nie groß um Rodica gekümmert, das war nichts Ungewöhnliches, aber seit einigen Wochen verhielt sich auch die Mutter seltsam und abweisend. Rodica verstand das nicht. Immer wieder grübelte sie, ob sie irgendetwas falsch gemacht hatte, konnte sich aber an nichts erinnern. Angefangen hatte es an dem Tag, an dem das Schuljahr und damit ihre Schulzeit zu Ende war. Bilbor, das kleine rumänische Dörfchen, bot keine Berufsaussichten, und auch in der fünfzehn Kilometer entfernten Kreisstadt Vatra Dornei gab es keine Lehrstellen für arme Dörflerkinder. Die wenigen Ausbildungsplätze schacherten sich die Mitglieder alter Seilschaften untereinander zu, denn die beiden großen Fabriken, ein Chemiewerk und ein Produktionsbetrieb für Elektromotoren, früher die größten Arbeitgeber der Stadt, verfielen mit dem Ende der Ära Ceau¸sescu noch schneller. Wurde doch einmal eine Hilfskraft gesucht, so meldeten sich auf die Stelle zwei Drittel der Einwohner des ganzen Distrikts. Für ein Mädchen blieb nur die Einheirat in eine der wenigen wohlhabenden Familien oder die Auswanderung in den Westen, aber Ersteres gelang armen Schluckern selten, und für Letzteres fehlte den meisten das Reisegeld.
Rodica war ein hübsches Mädchen mit großen strahlenden Augen und pechschwarzem Haar. Für ihre vierzehn Jahre war sie körperlich reifer als andere Mädchen ihres Alters. An einem regnerischen Morgen geschah dann, was Rodica zunächst einmal als ein kleines Wunder ansah. Ein großes schwarzes Auto hielt vor dem winzigen Häuschen der Nanescus. Zwei Männer stiegen aus, gut gekleidet in schwarzen Hosen und schwarzen Lederjacken.
Mutter und Vater tranken mit ihnen in der Küche Schnaps, plauderten und lachten von Zeit zu Zeit ein schrilles, aufgesetztes Lachen. Die Geschwister waren aus dem Haus geschickt worden, nur Rodica nicht, sie sollte im Schlafzimmer warten. Dort saß sie über eine Stunde lang auf dem Bett, das sie mit Ewa teilte, dann kam die Mutter und befahl ihr barsch: »Zieh dein gutes Kleid an und die Schuhe, kämm dein Haar, pack Unterhosen und Hemden ein, aber nur die besseren, und lass deiner Schwester noch was übrig. Du wirst mit Roman Miklos mitgehen. Er ist ein alter Freund von Vater, er hat ein Geschäft und Arbeit für dich. Sei brav und ordentlich, dann wird’s dir gutgehen«, sagte sie. Mehr nicht.
Rodica putzte sich heraus und ging dann brav zum Auto. In ihrer Tragetasche steckten eine Haarbürste, zwei T-Shirts, eine Strickjacke und vier Unterhosen, ihr ganzer Besitz. Bevor sie einstieg, lief sie hastig noch mal ins Haus zurück, sie hatte ihren kleinen Teddybären vergessen.
Roman Miklos gab sich als freundlicher Mann, der andere, der Fahrer, sprach wenig. Sie fuhren den Rest des Tages und in die halbe Nacht hinein, bis sie in Bukarest ankamen. Rodica war noch nie in der Hauptstadt gewesen und kannte sie nur aus Schulbüchern. Und gelegentlich, wenn sie bei Nachbarn fernsehen durfte, hatte sie auch etwas über diese große Stadt gesehen. Herr Miklos besaß eine riesige Wohnung mit vielen Zimmern und einem Salon. Im Badezimmer, das allein schon größer war als das größte Zimmer der Nanescus zu Hause, gab es eine Badewanne, eine Dusche, zwei Waschbecken, eine Toilette und ein niedriges Becken, wie sie es noch nicht gesehen hatte. Aus ihm sprudelte das Wasser wie bei einem Springbrunnen in die Höhe, wenn man an den Hähnen drehte.
Rodica durfte duschen, obwohl es schon mitten in der Nacht war, und wurde dann von Miklos in ein Zimmer geführt, in dem sie schlafen sollte. Mit einer kleinen Kamera machte er von Rodica ein Foto, was sie aufregend fand. »Für die Eltern«, meinte Miklos, bevor er ihr eine gute Nacht wünschte und das Zimmer verließ. Das Bett war weich, und das Bettzeug duftete nach Blumen. So schliefen Prinzessinnen, hatte sich Rodica immer vorgestellt.
Ihre Träume von dem guten Leben, das nun für sie begonnen hatte, dauerten noch den nächsten Tag und eine weitere halbe Nacht. Dann wurde sie jäh aus dem Schlaf gerissen.
Herr Miklos forderte sie auf, freundlich wie immer, sich anzuziehen und mit den beiden Männern zu gehen, die im Flur warteten. Die Männer wirkten ungeduldig und stanken nach Kneipe und parfümiertem Haaröl. Herr Miklos sagte nur: »Geh mit ihnen und mach keinen Ärger.«
In jener Nacht fuhren sie in einem klapprigen alten Wagen durch die Dunkelheit. Erst in den frühen Morgenstunden hielten sie irgendwo auf dem flachen Land vor einem halbzerfallenen Gehöft. Während der ganzen Fahrt sprachen die beiden kein Wort mit Rodica, außer einem »Halt’s Maul« auf ihre Frage, wohin sie denn fahren würden. Rodica war müde, durstig und verängstigt. Mit einer Handbewegung deutete der Fahrer zur offenstehenden Stalltür: »Wenn du musst, dann mach’s im Stall, drinnen ist das Klo verstopft.«
Rodica nickte und rannte in die Scheune, schon seit Stunden musste sie zur Toilette, hatte sich aber nicht getraut, die Männer um einen Halt zu bitten. Der eine von ihnen war schon im Wohngebäude verschwunden, die Haustür stand jedenfalls offen, der andere wartete auf sie und winkte ihr herzukommen. Rodica folgte ihm ins Haus. Hinter der Eingangstür blieb er stehen, ließ sie an sich vorbeigehen, legte ihr dann eine Hand auf die Schulter und dirigierte sie den langen dunklen Flur entlang ganz bis ans Ende und dort durch eine Tür in einen kleinen Raum. Viel sehen konnte Rodica nicht, nur durch einen schmalen Spalt in den geschlossenen Fensterläden fiel etwas Licht. Außer einer Matratze auf dem Holzboden mit einem Haufen Decken und Kissen drauf war das Zimmer leer. Es stank penetrant nach Erbrochenem.
»Schlaf«, befahl der Mann und stieß sie grob ins Zimmer.
Rodica stolperte hinein und hörte, wie der Türschlüssel im Schloss herumgedreht wurde.
Der Lichtstreifen am Fenster zog sie an, und sie tastete sich an der Wand entlang darauf zu. Aber sie konnte das Fenster und die Läden nicht öffnen. Dort, wo der Griff sein sollte, war nur ein fingerdickes Loch im Holz. Ein wenig frische Luft kam aber durch einen kleinen Spalt herein. Rodica sog die frische Luft ein und stierte durch den Spalt, bis ihre Augen in dem grellen Licht schmerzten. Blind tappte sie zur Matratze, legte sich darauf und rollte sich zusammen wie ein Igel. Leise kamen ihre Tränen. Sie verstand das alles nicht, wünschte sich, bei der Mutter zu sein, selbst der Vater wäre ihr lieb gewesen. Irgendwann schlief sie darüber ein.
Als sie Stunden später jemand an der Schulter rüttelte, schreckte sie auf und wusste erst nicht, wo sie war. Ein Mann stand über sie gebeugt, es war keiner von den beiden im Auto. Der Mann lehnte sich zu ihr herunter und strich ihr mit der Hand durch die Haare.
»Schönes Täubchen, schönes Täubchen«, flüsterte er. Sein Atem roch nach Schnaps und Zigaretten. Rodica kannte das von ihrem Vater und den anderen Männern aus dem Dorf, sie rochen alle so, wenn man ihnen zu nahe kam, das war für sie noch nichts Beunruhigendes.
Aber dann schob der Mann seine Hand zwischen ihre Beine. Rodica erstarrte vor Angst, sie verstand nicht. Einmal hatte ihr der Nachbarsjunge einen flüchtigen nassen Kuss auf die Lippen gepresst. Sie ahnte nicht, was dieser Mann von ihr wollte.
Er küsste sein »Täubchen«, zerrte ihr die Kleider vom zitternden Körper und versuchte sie zu streicheln. Aber Rodica schrie, weinte, wehrte sich, hysterisch vor Angst und Scham. Da schlug er zu, mit der flachen Hand auf ihren Hinterkopf, wo die Haare Blutergüsse verdeckten. Wieder und wieder schlug er sie und flüsterte dabei, dass nur ein braves Täubchen ein schönes Täubchen sei. Nicht nur an diesem Tag kam er, sondern ebenso am nächsten und übernächsten. So lange, bis das Täubchen ihn küsste und dabei lächelte. Da brachte er Schokolade und süße Cola und eine neue Jeans und ein T-Shirt und neue Schuhe. Rodica hatte begriffen, aber ihre Kinderseele versteckte sich wie ein kleiner Vogel in dem schützenden Nest ihrer Erinnerungen.
Jeswita Drugajew
Bei St. Margrethen, kurz vor dem Grenzübergang nach Österreich, rief Walcher die Großeltern Armbruster an, bei denen er seine Tochter Irmi abgeliefert hatte. Statt der geplanten einen Stunde hatte sich das Gespräch in Zürich auf über drei Stunden ausgedehnt. Deshalb würde er erst gegen einundzwanzig Uhr bei den Armbrusters eintreffen können.
Die Großmutter versprach, es Irmi auszurichten, und Walcher hoffte, dass sie es auch tatsächlich tat. In der letzten Zeit wurde die gute Oma Armbruster ein wenig vergesslich.
Das Gespräch in Zürich war durch die Vermittlung seines Freundes Johannes zustande gekommen, mit dem er gelegentlich zusammenarbeitete und der über Walchers neue Recherche informiert war.
Jeswita Drugajew hatte mitten in Zürich auf dem Limmat Quai einen Verkehrspolizisten um Hilfe angefleht. Dass der Polizist bruchstückhaft verstand, was sie sagte – er lernte seit zwei Jahren Russisch an der Volkshochschule –, war ein glücklicher Zufall. Er nahm sie mit auf die Wache und meldete den Vorfall der Fremdenpolizei. Die Polizistin samt einer Dolmetscherin, die kurz darauf eintrafen und Drugajew befragten, brachten die Russin in das Frauenstift, ein ehemaliges Zisterzienserkloster, in dem der Psychosoziale Dienst ein Übergangswohnheim unterhielt. Für die Behandlung von Asylsuchenden und Migranten entsprach das nicht dem offiziell vorgeschriebenen Weg der Züricher Verwaltungsbürokratie, sondern war der Sympathie und dem Verständnis beider Beamtinnen für Jeswita Drugajew zuzuschreiben, nachdem diese ihnen die letzten Stationen ihres Lebens geschildert hatte. Eine Mitarbeiterin des Psychosozialen Dienstes wiederum war eine Bekannte von Johannes’ Freundin Marianne. So gelangte die Information zu Walcher, und auf demselben Weg retour wurde ihm das Gespräch mit der Russin ermöglicht.
Jeswita Drugajew und die Dolmetscherin, die auch für den Psychosozialen Dienst arbeitete, trafen sich mit Walcher am Zollikerberg, in dem winzigen Besprechungszimmer eines Wohnheims, an dem bestenfalls der Blick auf den Zürichsee eine Erwähnung wert war.
Auf einem wackeligen, altersschwachen Tisch standen drei verschrammte Tassen und eine verbeulte Thermoskanne mit Tee. Drei Waffeln lagen abgezählt auf einem Unterteller. Zucker gab es nicht und deshalb wohl auch keine Löffel. Der Tee erinnerte Walcher an seine Mandeloperation, den unangenehmsten Krankenhausaufenthalt während seiner Kindheit. Vermutlich sollten mit dem dünnen Früchtetee und der ärmlichen Zimmerausstattung Asylsuchende abgeschreckt werden. Aber Jeswita Drugajew passte in das Zimmer.
Sie trug Fundstücke aus der Kleidersammlung. Nur die edlen Schuhe standen in krassem Kontrast zu den billigen, ausgewaschenen Cordjeans und der violetten, mit Rüschen besetzten Bluse.
Jeswita Drugajew sprach leise und ruhig, als sie nach der Begrüßung fragte: »Also, was wollen Sie hören?«
Walcher versuchte ein Lächeln: »Alles, was Sie mir erzählen wollen … von Ihrer Heimat, Ihren Eltern, Ihren Geschwistern, Schule, mich interessiert alles, bis hin zu den Menschen, von denen Sie verschleppt wurden, von deren Organisation, alles, was Sie darüber wissen.«
Jeswita Drugajew nickte mehrmals. Sie wirkte auf Walcher klar und geradeheraus, wie eine Person, die wusste, was sie wollte. Wenn er die geschwollene Augenbraue, den gelblich-blauen Bluterguss auf dem Wangenknochen, die aufgeplatzte und schlecht verheilte Lippe der jungen Frau ignorierte, würde er sie als hübsch bezeichnen.
»Es war ein Tag vor meinem Geburtstag. Sechzehn Jahre war ich, da wurde ich von der Arbeitsvermittlung abgeholt, bei der ich mich gemeldet hatte. Ich wollte nach England, später nach Amerika. Das lief alles illegal, weil ich dort niemals eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen hätte. Meine Eltern wussten Bescheid. Sie waren sehr traurig, aber verstanden, dass ich in den Westen wollte. Wir lebten außerhalb von Kolomna, das ist ein kleines Drecksnest nahe bei Moskau, zu fünft in drei Zimmern. Wir konnten uns zwar ernähren, mehr aber nicht. Ich träumte von schicken Kleidern, Schuhen und der großen Welt. Ja, und auf dem Weg dorthin geschah es dann … Schon in der ersten Nacht … Sie hielten mir einen Lappen auf den Mund, und an mehr kann ich mich nicht erinnern. Erst als ich wieder aufgewacht bin … Das war furchtbar … Ich habe geglaubt, ich bin verrückt geworden oder so, aber es war alles Wirklichkeit. Gefesselt auf einem Bett und nackt … Ich habe mich so geschämt … Sie haben mich berührt … Immer wieder … ›Turnstunde‹ haben sie es genannt und dabei laute Musik gespielt und gesoffen … Zu dritt waren sie.«
Die Dolmetscherin war bleich geworden und mit einem geflüsterten: »Entschuldigung« aus dem Zimmer gehetzt.
Jeswita lächelte Walcher an, es war ein seltsames Lächeln. Mit einem harten, holprigen Akzent sagte sie auf Deutsch: »Ist schwer sich vorstellen, auch schwer erinnern.«
Walcher nickte nur. Vielleicht hätte er etwas sagen sollen oder fragen, aber ihm fiel nichts ein, und so lauschten beide dem leisen Singen der Teekanne, in dem Zimmer, das nun noch trauriger wirkte.
Die Dolmetscherin kam zurück und entschuldigte sich nochmals. »Mein Magen, ich höre so etwas ja nicht zum ersten Mal, aber jedes Mal aufs Neue wird mir davon elend«, erklärte sie. »Wir können weitermachen.«
Jeswita erzählte, wie sie nach Minsk in die Domskaja 122 und dann nach Berlin, Schleizer Straße 7a in Hohenschönhausen, nach Hamburg-Fuhlsbüttel in den Deichweg 12 und von dort weiter nach Frankfurt in die Heinrich-Steiger-Straße 16, draußen in Niederrad, ganz in der Nähe des Golfplatzes, verschleppt worden war, weitergereicht von einem Händlerring an den nächsten.
»Nein, nicht Puff«, fügte sie zwischendurch wieder auf Deutsch ein, bevor sie auf Russisch fortfuhr. »Alles immer privat. Solange man gut aussieht und frisch ist, wird man zu Herren aus besseren Kreisen gebracht. Die zahlen gut. Aber von dem Geld bekommst du keinen Cent. Nach einem halben Jahr siehst du aus wie ein Stück Scheiße, und dann erst geben sie dich in einen Puff, aber der ist ebenfalls privat. Dazwischen nehmen sie dich selbst, wie es ihnen gerade in den Sinn kommt. Manche prügeln nur, die wollen nichts sonst von dir. Dann jagen sie dich in Wohnheime von Asylanten, da bist du dann noch einmal eine Stufe tiefer gelandet.
Vor zwei Tagen sollte ich mit einem Transport in die Türkei gebracht werden, aber an der Grenze ging was schief. Der Fahrer hat sich verfahren und war plötzlich in der Schweiz, weil er nicht kontrolliert wurde. Dann hat er es aber gemerkt, und sie haben sich nicht mehr getraut, nach Österreich zurückzufahren.
Wir waren vier Frauen. Da haben sie dann telefoniert, und viele Stunden später kamen Kerle mit Autos, und jeder nahm sich eine Frau und fuhr davon. Meiner war ein Albaner, er brachte mich hierher und drohte mir, dass er mich aufschlitzen würde, wenn ich auch nur eine falsche Bewegung mache. Ich hatte mir aber vorgenommen, jetzt oder nie. In der Türkei hast du überhaupt keine Chance mehr, dachte ich mir. Als er mich aus dem Auto zerrte, folgte ich noch, tat dann aber so, als würde ich ohnmächtig werden. Da kamen gleich viele Menschen, um zu helfen. Er bekam es wohl mit der Angst zu tun und verschwand. Sein Auto hat das deutsche Kennzeichen F-PK 2004. Am Telefon hat er sich mit Rodusch gemeldet, er wollte sich mit einem aus Zürich in der Schöntal-Straße treffen.«
Jeswita sprang auf, fischte aus ihrer Jackentasche eine einzelne Zigarette und zündete sie an. Tief inhalierte sie den Rauch und stieß ihn aus, während sie weitersprach.
»Ich habe es so satt, wie ein Tier behandelt zu werden, das man einsperren darf und zwingt, in eine Zimmerecke zu machen. Einen Tag lang habe ich es mir verkniffen, dann konnte ich nicht länger einhalten und habe dabei geweint vor Wut und Hass auf diese Schweine, die einen quälen und dann auch noch demütigen. Vier Mädchen waren wir, ganze drei Tage in einem Zimmer eingesperrt ohne Toilette, ohne Essen und Trinken. Eine Bestrafung wäre es, sagten sie. Bestraft dafür, weil sich eine von uns aus dem Fenster gestürzt hatte. Das war in Hamburg.«
Jeswita Drugajew verfügte über ein außerordentliches Erinnerungsvermögen. Sie erinnerte sich präzise an alles, was um sie herum geschehen war, nannte die Namen der Männer und Frauen, mit denen sie in den vergangenen zwei Jahren Kontakt gehabt hatte, die Orts- und Straßennamen, wo sie gewohnt hatte.
»Wohnen«, dachte Walcher und spürte, wie der Stein in seinem Magen immer größer wurde.
Drei Stunden lang erzählte Jeswita Drugajew, dann war sie mit ihren Kräften am Ende. Sie verstummte, ihr Blick schweifte in die Ferne, und sie begann leise zu weinen. Die Dolmetscherin streichelte Jeswitas Hand und weinte auch.
Walcher wurde plötzlich klar, dass ihm diese Recherche weit mehr unter die Haut gehen würde, als er befürchtet hatte. Als Mann schämte er sich dafür, was Männer dieser Frau angetan hatten, als Journalist forderte er von sich Sachlichkeit und Distanz, auch zwang er sich – gewissermaßen als Selbstschutz – zu Gefühllosigkeit. Aber das hatte bei ihm bisher noch nie funktioniert, und so fühlte er sich wie gelähmt und hilflos. Die Geräusche des normalen Lebens, die durch das offene Fenster hereinwehten, klangen unwirklich und irgendwie gedämpft. Auch die Zeit schien in diesem armseligen Zimmer einfach stehengeblieben zu sein. Noch immer streichelte die Dolmetscherin Jeswitas Hand und sprach leise auf sie ein. Es klang wie ein Gesang, und manchmal lächelte Jeswita und nickte. Walcher steckte sein Aufnahmegerät ein, zog aus seiner Hemdtasche eine Visitenkarte, kontrollierte, ob er die Rückseite nicht beschrieben hatte, und legte sie vor Jeswita auf den Tisch. Dann bedankte er sich und versprach, alles zu tun, damit wenigstens der eine oder andere dieser Menschenschänder aus dem Verkehr gezogen würde. Dabei kam er sich vor wie ein Politiker, der seine Worthülsen unters Volk streut, auch am Schluss fiel ihm nur eine Floskel ein: »Vielen Dank für Ihr Vertrauen.« Fehlte nur noch, dass er ihr einen Geldschein auf den Tisch legte. Er nahm die Visitenkarte noch einmal und schrieb Johannes’ Namen und Telefonnummer auf die Rückseite.
»Ich kenne mich mit den Schweizer Gesetzen nicht aus, aber vielleicht können meine Schweizer Freunde Ihnen weiterhelfen, wenn es Probleme geben sollte.«
Als er bereits an der Tür war, drehte er sich um, ging zurück und drückte Drugajews Schulter. Eine knappe Geste, warf er sich vor, als er auf der Heimfahrt noch einmal über sein Verhalten nachdachte. Aber sie konnte bereits ausreichen, um Distanz zu verlieren.
An diesem Abend war Walcher wortkarg wie selten, was Irmi zu der Frage veranlasste, ob er nur müde sei oder ob er etwas besonders Deprimierendes erlebt hätte. Irmi besaß feine Sensoren für Stimmungen, das konnte Walcher schon häufig feststellen, seit er sie vor einem Jahr bei sich aufgenommen hatte.
Nach dem tödlichen Verkehrsunfall ihrer Eltern, Irmi war zehn Jahre alt, war sie von ihrer Patin, Lisa Armbruster, adoptiert worden, und Walcher als Lisas Lebenspartner hatte damals die Adoptionspapiere mit unterschrieben. Drei Jahre später kam auch Lisa bei einem Verkehrsunfall um, jedenfalls wurde das als offizielle Todesursache angegeben, obwohl sie in Wirklichkeit ermordet worden war. Mit dem Einverständnis des Jugendamtes, der leiblichen Großeltern Brettschneider und von Lisas Eltern, den Armbrusters, übernahm Walcher die Rolle eines Pflegevaters. Bisher hatte er seine Entscheidung nicht in Frage gestellt und Irmi wohl auch nicht.
Nicht zuletzt dank Irmis offener und direkter Art, die sie vermutlich als Reaktion auf ihre Schicksalsschläge und die kontinuierlich stattfindende Aufarbeitung mit einer Therapeutin entwickelt hatte, kamen die beiden sehr gut miteinander aus. Walcher erzählte ihr deshalb ausführlich von dem Interview und auch, dass er mit Recherchen über diese Form der Sklaverei begonnen hatte.
»Verstehe«, sagte Irmi nur.
Beide schwiegen eine Weile. Dann nahm Irmi ein Heft vom Tisch und schlug es auf.
Sie zog die Stirn kraus. »Vielleicht kann dich meine Vier minus in Mathe etwas aufmuntern.«
Einkaufsliste
Walcher saß in der Küche, vor sich die alte Schiefertafel, auf der während der Woche die Einkaufsliste für den Großeinkauf am Samstag entstand. Er las Schnürsengeln, Esigurge, Joekurt, stutzte und überlegte, ob Irmi ihn damit nur foppen wollte oder er sich um ihr Deutsch kümmern sollte.
Am unteren Rand der Tafel hatte sie die Silhouette eines Hundes gezeichnet, wahrscheinlich weil das Hundefutter für Rolli, ihren Labrador, knapp wurde. Vor drei Monaten hatte Irmi, unterstützt von ihrem Quartett der Omas und Opas, den Welpen heimgebracht und damit die Bewohner des Hofes auf vier Lebewesen erhöht. Walcher, Irmi, Rolli und der stinkende Kater, den Walcher treffend Bärendreck getauft hatte. Während Rolli sich in kurzer Zeit zu einem stubenreinen und halbwegs folgsamen Familienmitglied entwickelte, blieb der Kater nämlich bei seiner für Katzen ungewöhnlichen Neigung, sich in möglichst frisch ausgebrachter Gülle zu wälzen. Nur der Hund bewunderte den Kater wegen seines grässlichen Gestanks, schnupperte und leckte den Stinker mit unsäglicher Inbrunst ab, wenn der, von einer Jauchetour zurück, auf der Suche nach einem ruhigen Schlafplatz durch das Haus strich.
Meist nutzte Bärendreck die Wehrlosigkeit von Walcher oder Irmi aus, wenn sie schliefen. Dann schlich er sich ins Bett und kuschelte sich genussvoll in das warme, weiche Bettzeug. Die Flüche am Morgen oder auch schon mal einen unsanften Tritt nahm er billigend in Kauf, was er durch seine Wiederholungstaten eindringlich demonstrierte.
Für Walcher und Irmi bedeutete es jedes Mal zusätzliche Wascharbeit, denn das Bettzeug stank danach unerträglich.
Eigentlich wollte Walcher nur ein paar Gedanken notieren, aber die Tafel war voll, und auf der Rückseite stand ein Sinnspruch des ehemaligen Besitzers, mit spitzem Griffel in feinster Sütterlin geschrieben: Hausierer und Vorarlberger werden vom Hof gejagt.
Die Schiefertafel hatte Walcher auf dem Dachboden gefunden und die beschriebene Seite mit einer Lackschicht geschützt. Irmis Einkaufsliste wollte er auch nicht löschen, also hängte er die Tafel zurück an ihren Platz an der Wand neben der Küchentür und stieg die Treppe hinauf in sein Arbeitszimmer, um sich Stift und Papier zu holen.
Er bemühte sich, leise zu sein, es war inzwischen kurz nach 23 Uhr, und Irmi schlief schon. Walcher vergewisserte sich wegen des lauernden Katers, dass ihre Zimmertür geschlossen war.
Rolli begrüßte ihn mit freudigem Schwanzwedeln, als Walcher wieder herunterkam. Dem Hund war das obere Stockwerk verboten, was er erstaunlich schnell kapiert hatte, weshalb er brav unten an der Treppe wartete.
»Braver Hund«, lobte ihn Walcher und holte sich aus dem von ihm sogenannten Giftschrank im Wohnzimmer die Karaffe mit Sherry und ein Glas und setzte sich dann an den Küchentisch. Nach dem ersten Schluck betrachtete er traurig Glas und Karaffe, es würde einer der letzten Schlucke sein. Das Sherryfass im Gewölbekeller unter der Küche gab allerhöchstens noch eine letzte Füllung her. Mit einem Seufzer zückte er den Filzstift.
Leere Blätter hatten für ihn etwas faszinierend Aufforderndes, und er begann geradezu lustvoll zum wiederholten Mal seine Strategie zur weiteren Beschaffung von Informationen zu überarbeiten. Das tat er häufig in der ersten Phase einer Recherche.
»Haben Sie Interesse und Zeit, über Menschenhandel mit dem Schwerpunkt auf Kindesmissbrauch zu recherchieren und ein Dossier darüber zu schreiben?« Das stand vor nunmehr gut drei Monaten in der E-Mail von Rolf Inning, dem Ressortleiter »Gesellschaft« des Magazins Weltchrist, mit dem Walcher bereits seit mehreren Jahren zusammenarbeitete. Und weil er Interesse hatte, vereinbarten sie ein Arbeitsgespräch in Frankfurt, auch wenn der Verlag seinen Sitz in Hamburg hatte. Inning begründete dies mit Sparmaßnahmen sowie damit, dass Günther Auenheim anwesend sein würde. »GAU, wie wir ihn intern nennen«, hatte Inning vertraulich am Telefon erklärt, »ist der Enkelsohn des Verlagsgründers und mischt sich gelegentlich in unser Tagesgeschäft ein, vermutlich um zu demonstrieren, dass er nicht bloß ein paar Aktien geerbt hat. Sie werden ihn kennenlernen. Er wohnt in Frankfurt am Main, daher der Treffpunkt, kostengünstig, gewissermaßen auf halbem Weg zwischen Bodensee und Nordsee.«
Walcher fuhr zu dem Treffen nach Frankfurt und nahm danach den Auftrag für die Reportage an, auch wenn er Günther Auenheim grässlich fand. Auenheim kleidete sich wie ein Verleger alter Schule: dunkler Nadelstreifenanzug mit Weste, Krawatte und Einstecktuch. Wer seine Brille stets griffbereit an einer goldenen Kette um den Hals baumeln hat, trägt vermutlich auch Sockenhalter, hatte Walcher etwas boshaft vermutet.
Die locker nach hinten gebürsteten geölten Haare waren etwas zu lang, aber gepflegt. Der akkurate Kinnbart, der einer Ziege Ehre gemacht hätte, reichte fast bis hinab zum Krawattenknoten. Auenheim hatte sich in epischer Breite über die Verantwortung eines Verlegers ausgelassen, der Gesellschaft kulturell und moralisch auf die Sprünge zu helfen, und Walcher einen Schnellhefter mit Kopien von Statistiken, Berichten, Artikeln, Kontaktadressen und eigenen Notizen übergeben, die er selbst bereits zum Thema Menschenhandel und Pädophilie zusammengetragen hatte.
»Ich hätte gern selbst darüber geschrieben«, erklärte er, »aber meine Zeit reicht dafür einfach nicht aus. Bitte halten Sie mich regelmäßig über den Fortgang Ihrer Recherche auf dem Laufenden.«
Dann hatte er sich verabschiedet: »Sie entschuldigen, aber Termine, Termine«, und war ebenso hektisch davongeeilt, wie er zuvor mit einer halben Stunde Verspätung zu ihrem vereinbarten Treffen in die Lobby des Intercity-Hotels gehetzt war.
Ungeachtet dieses seltsamen Treffens war Walcher höchst motiviert an die Arbeit gegangen, denn das Thema Menschenhandel stand bereits seit einiger Zeit in seinem eigenen Themenspeicher.
Zunächst meldete er in Rom eine E-Mail-Adresse an, die er von Weiler aus verwalten konnte. Ein raffiniertes Sicherheitsprogramm, das er von seinem Freund Hinteregger erhalten hatte, schützte ihn vor Zugriffen, sollte jemand herauszufinden versuchen, wer sich hinter dieser Adresse verbarg. Eine durchaus sinnvolle Vorsichtsmaßnahme für Recherchen in diesem Milieu. Dann hatte er zu zwei Händleradressen Kontakt aufgenommen, denn wie sollte er sonst die Leute und ihre Organisationen kennenlernen, wenn nicht über Handelsbeziehungen? Mit einem Händlerring in Frankreich und einem Vermittler in Norditalien, beides Adressen aus Auenheims Unterlagen, stand er seit nunmehr vier Wochen in Kontakt. Er gab sich ihnen gegenüber ebenfalls als Händler aus und stand nun bei beiden unter Zugzwang. Sie würden demnächst Ware gegen Geld gewechselt sehen wollen, zu lange schon hielt Walcher sie mit immer neuen Ansprüchen an die Kinder, die er vermeintlich kaufen wollte, hin.
Er fragte wiederholt an, erhielt Mails mit Fotos der »Ware« und antwortete bisher immer mit: »Nicht gut genug«. Diese Tour konnte er nicht länger fahren. Ihm war klar, dass er sich den Händlern zeigen und nun endlich Ware ordern musste.
SOWID
»Perverses Schwein«, keifte die Stimme als Antwort auf Walchers Hinweis, dass er beabsichtige, ein Kind zu kaufen, dann brach die Telefonverbindung ab. Walcher war kurz vor der Lautstärke zurückgeschreckt, aber das hinderte ihn nicht, auf die Wahlwiederholungstaste zu drücken. Beharrlichkeit hielt er immer schon für eine der wichtigsten Eigenschaften eines Journalisten, und außerdem musste er sich eingestehen, nicht den intelligentesten Gesprächseinstieg gewählt zu haben.
»Hier SOWID, Sie sprechen mit Frau Weinert, was kann ich für Sie tun?«, meldete sich die Stimme erneut, allerdings nun in einem normalen Tonfall. Offensichtlich hatte sich Frau Weinert sehr rasch wieder beruhigt. Diesmal brüllte Walcher seinerseits in den Hörer: »Hören Sie mich doch bitte erst einmal an, bevor Sie mein Trommelfell malträtieren. Ich bin Journalist und recherchiere über Menschenhandel.«
»Das hätten S’ ja gleich sagen können«, klang es nun deutlich freundlicher aus dem Hörer. »Entschuldigen S’ bitte meine Reaktion, aber es melden sich bei uns tatsächlich des Öfteren Männer, die anfragen, ob wir ihnen nicht eine Frau beschaffen könnten. Ausgerechnet wir! Einen Moment bitte. Ich verbind’ Sie mit Frau Dr. Hein, sie ist die Leiterin unserer Münchner Niederlassung. Adieu, und nehmen Sie’s nicht persönlich.«
Es knackte in der Leitung, eine von diesen grässlichen Warteschleifen-Melodien ertönte, dann eine Stimme, die so unglaublich erotisch nach Cognac, Zigaretten und Nachtleben klang, dass Walcher einen Moment lang abgelenkt war. Für eine Organisation, die sich dem Schutz von Frauen verschrieben hatte, für seinen Geschmack eine etwas gewagte Stimme.
»Hallo, hören Sie?«, holte ihn die rauchige Stimme in die Wirklichkeit zurück, und Walcher erklärte sein Vorhaben.
Frau Dr. Heins Antwort war kurz und präzise.
»Das hört sich gut an, da können wir mitmachen. Kommen Sie doch am besten einfach bei uns vorbei, dann gehen wir alle Fragen durch. Würde es Ihnen gleich morgen passen, so um elf Uhr?«
Walcher sagte zu und bekam noch von Frau Dr. Hein die besonders tückischen Einbahnstraßen erklärt, um problemlos das Büro der SOWID in einem Innenhof in der Adalbertstraße in München zu finden.
Rodica II
Sie saß Ewa gegenüber, ihrer geistig behinderten Schwester, die sie traurig aus einem Auge anblickte, denn das andere war unter dunkel verfärbter, geschwollener Haut verborgen. Der Vater wurde immer gewalttätiger.
»Komm mit mir«, rief Rodica, »auch wenn es hier nicht viel besser ist, vielleicht ist das Leben ja so.« Rodica streckte der Schwester die Hand entgegen und spürte den Druck warmer Finger. Aber der Druck wurde fester und fester und begann zu schmerzen, und die Hand zerrte Rodica mit sich, heraus aus ihrem Traum in die Wirklichkeit.
»Auf, du kleine Schlampe«, brüllte eine rohe Stimme, die unmöglich ihrer Schwester gehörte. »Los, los, wir machen eine kleine Ausfahrt, zieh dein neues Zeug an, los, los.«
Verschlafen zog sich Rodica bei Kerzenlicht ihre neuen Sachen an. Viele Kleider besaß sie ohnehin nicht. Die Tragetasche mit dem wenigen, das sie besaß, hatten sie ihr abgenommen, bis auf den Teddy, der steckte in ihrer Hosentasche.
Kurz nur, auf dem Weg zum Auto, konnte sie die klare Nachtluft einatmen und in den Himmel hinaufsehen. Er war schwarzblau und übersät mit funkelnden Sternen und sah genau so aus, wie das Gewölbe in der kleinen Seitenkapelle ihrer Dorfkirche bemalt war. Den Herrgott konnte sie aber nirgends entdecken. Der schlief wahrscheinlich, denn sonst hätte er dies alles nicht zugelassen, dachte Rodica. Dann wurde sie zusammen mit zwei anderen Mädchen auf die Rückbank eines Autos gestoßen, und die Fahrt begann.
Rodica kannte die Mädchen nicht, hatte aber seit Tagen wieder und wieder ihre Schreie und ihr Weinen gehört. Sie nannten einander ihre Namen und fragten sich flüsternd, woher sie kamen und ob sie wüssten, warum sie so schlimm geschlagen wurden und was die Männer noch alles von ihnen wollten. Valeska und Doru gingen noch in die Grundschule, also waren sie noch jünger als sie, überlegte Rodica. Was passierte hier? War das die Welt der Erwachsenen, oder waren diese Männer jene bösen Räuber aus den Märchen, an die ausgerechnet sie geraten waren?
Die Mädchen schluchzten und weinten still. Irgendwann schliefen sie ein, aber es war kein guter Schlaf. Oft schreckten sie auf, aus wirren Träumen und von Angst getrieben.
München
Frau Dr. Hein entsprach nicht annähernd der Vorstellung, die er sich nach ihrer Stimme von ihr gemacht hatte, konstatierte Walcher. Am ehesten hätte man sie als distinguiert bezeichnen können. Freundlich und sachlich erklärte sie die Ziele des überparteilichen, überkonfessionellen und international tätigen Vereins. Neben der jeweils aktuellen Hilfe für Frauen in Notsituationen konzentrierten sie sich verstärkt auf die Prävention, damit Frauen nicht länger Opfer von Menschenhändlern wurden.
»SOWID, Solidarity with Women in Distress«, erläuterte sie, »existiert seit dreißig Jahren. Ich bin seit zehn Jahren aktiv dabei und habe zunehmend den Eindruck, dass sich die Situation der Frauen weltweit nicht verbessert, sondern ständig verschlechtert. Und ich spreche nicht nur von jenen Ländern, in denen sich die Rolle der Frau seit dem Mittelalter so gut wie nicht verändert hat.
Ich mache keinen großen Unterschied, ob ein Mann eine Frau gegen zwei Ziegen eintauscht oder mit einem guten Einkommen lockt. Oder ob die Eltern ihrer Tochter zwei Ziegen mitgeben, damit sie einen Mann bekommt. Letztlich stellt sich die Frage, warum die Frau immer noch als Objekt gehandelt wird. Weil sie während der Kinderaufzucht versorgt sein muss, oder warum? Also dazu braucht sie sicher keinen Mann!«
Dr. Hein brach ab, fragte Walcher, was er trinken wollte, und holte ihm das gewünschte Wasser.
»Gut, ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, Sie sind sicher nicht gekommen, um von mir einen Vortrag über das Selbstverständnis der Frau zu hören. Bleiben wir bei unserem Vereinsthema: Missbrauch. Millionen offen zugängliche Seiten im Internet finden Sie allein in Deutschland unter den Stichwörtern »Frauen und Sex« oder »Sextourismus« oder »Heiratsvermittlung exotischer Frauen«. Unser ach so zivilisiertes Deutschland unterscheidet sich in der Behandlung der Frau als käufliches Objekt nicht wesentlich von Indien, zum Beispiel.«
Dr. Hein schüttelte den Kopf und holte tief Luft. Sie stand auf und zog einen Ordner aus dem Regal.
»Hier habe ich die Zahlen für die Region München und nur von Januar bis Juli dieses Jahres. Über 200 Frauen, die durch diese Tür hier gegangen sind, weil sie in der einen oder anderen Weise Opfer von Männern waren. Nun rechnen Sie diese Zahl mal auf Deutschland hoch. Aber das sind nur die nackten Zahlen. Hier«, sie klappte den Ordner auf, hielt ihn Walcher hin und blätterte, »hier sehen Sie, dass hinter diesen Zahlen Menschen aus Fleisch und Blut stecken, Frauen und Mädchen hauptsächlich, und hie und da ein Junge.«
Die Aufnahmen ähnelten denen von Unfallopfern oder hätten aus einer gerichtsmedizinischen Sammlung über Folterfolgen stammen können. Platzwunden, Hämatome, Schnitte und Stiche, Brandwunden, die den Körpern mit glimmenden Zigaretten und erhitzten Metallgegenständen beigebracht worden waren. Entzündungen, eiternde Geschwüre als Folgen langer Fesselung, ja sogar Buchstaben als Brandmale fehlten in der Sammlung nicht.
»Hören Sie auf, bitte«, bat Walcher, »geben Sie mir Kopien mit, und räumen Sie mir das Recht ein, die Bilder zu veröffentlichen.«
Dr. Hein nickte und setzte sich wieder. »Wissen Sie, der Wandel im Denken muss viel, viel früher einsetzen. Schon bei der Erziehung der Jungen. Viele Mütter behandeln ihre Söhne wie Kopien ihrer Väter oder Ehemänner im Kleinformat. Und die Väter halten sich tunlichst aus der Erziehung heraus, wohl weil sie befürchten, dass ihnen eine Einmischung als Rivalität gegenüber dem eigenen Sohn ausgelegt würde. So wachsen die Jungs in dem Bewusstsein auf, die Nummer eins, Prinzen, die Krone der Schöpfung zu sein. Später dann scheren sie alles über einen Kamm und prahlen mit allem gleich, ob sie sich nun eine Frau nehmen oder ein großes Auto zulegen, ihre Trinkfestigkeit unter Beweis stellen oder Krieg spielen. Natürlich ist daran nicht nur die Erziehung der Mütter schuld, aber ich glaube wirklich, dass sie einen großen Anteil an dieser Entwicklung haben, solange sie den Mann als das besondere Vaterwesen sehen. Und darauf zu hoffen, dass die Männer selbst etwas dagegen tun, also darauf warten wir ja nun wirklich erfolglos seit einigen Jahrhunderten … Da wäre mir dann doch eine drastische Lösung des Problems lieber, nämlich gut die Hälfte der Männer zu kastrieren. Das hätte dann auch gleich noch den Nebeneffekt, wirkungsvoll der Übervölkerung unserer Erde entgegenzuwirken … Aber lassen Sie uns über Ihr Vorhaben sprechen«, schloss Dr. Hein und lächelte Walcher auffordernd an.
Walcher brauchte erst einmal einige Sekunden, um von Dr. Heins Anklage auf den Grund seines Besuches umzuschalten. »Es gibt auch Männer«, gab er mit einem dünnen Lächeln Dr. Hein zurück, »die sexuellen Missbrauch in jeder Form ablehnen, und zwar nicht nur aus Angst vor drohender Kastration …«
»Sie sind Journalist«, unterbrach ihn Dr. Hein, und es klang nicht nur wie eine Feststellung.
»Mir geht es nur um eine reißerische Story, wollten Sie das damit sagen?« Walcher ging nicht auf ihr Achselzucken ein. »Natürlich geht es mir um die Story, natürlich verdiene ich Geld damit, aber gleichzeitig will ich etwas bewegen. Ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich ein politischer Mensch bin. Aber hören Sie mich erst mal an.«
Weil Dr. Hein schwieg und nur nickte, erzählte Walcher, was er vorhatte.
Dr. Hein hörte Walcher zwar zu, ohne ihn zu unterbrechen, schüttelte aber einige Male den Kopf und sah ihn äußerst skeptisch an.
»Sie können das Risiko einschätzen, denke ich, also spare ich mir meinen Kommentar. Ich … wir werden Sie aus zwei Gründen unterstützen. Zum einen, weil ich hoffe, dass Sie es schaffen, bis in die inneren Strukturen einer dieser Banden vorzudringen, und zum anderen, weil unsere Organisation es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Opfern zu helfen. Wenn Sie uns also Nachricht geben, dass Sie ein Kind oder eine Jugendliche oder eine erwachsene Frau gekauft haben – wie furchtbar das klingt –, dann tun wir alles, was wir in solchen Fällen sonst auch tun.« Dr. Hein streckte wie eine Predigerin beide Arme in die Höhe. »Wir übernehmen die betreffende Person und bringen sie kurzzeitig in einem unserer Häuser unter, wo sie psychologisch und medizinisch betreut wird. Handelt es sich um ein Kind, so finden wir heraus, ob es zu seiner Familie zurückkehren kann. Wenn nicht, suchen wir auf der verdammten weiten Welt irgendwo eine Pflegefamilie oder eine Institution, die das Kind aufnimmt. Wir sorgen für seine Ausbildung und kümmern uns später auch um einen Arbeitsplatz; der einzige Weg, um diese bedauernswerten Geschöpfe aus dem Teufelskreis herauszunehmen. Natürlich geschieht das alles in Zusammenarbeit mit allen zuständigen Behörden. Ausländerbehörde, Sozialamt, Jugendamt, Fürsorge, Arbeitsamt, Gesundheitsamt. Sie glauben ja nicht, mit wie vielen Behördenmenschen wir oft zusammenarbeiten müssen. Aber ich will mich nicht beklagen, denn seit immer mehr bekannte Persönlichkeiten SOWID-Mitglieder werden, ziehen auch immer mehr Beamte mit«, erläuterte Dr. Hein mit einem entwaffnenden Lächeln. »Bei den Frauen der mächtigen Männer dieser Erde gehört es inzwischen zum guten Ton, dass sie Mitglied in unserem Verein sind. Das meine ich übrigens nicht zynisch, denn ich bin geradezu dankbar für derartige Image- und Kapitalverstärkung, schaffen sie doch endlich eine sichere Basis für unsere Arbeit.«
Nach einer Pause fügte Dr. Hein noch hinzu: »Ich rate Ihnen auch dringend, im Vorfeld bereits die jeweiligen Behörden einzuschalten, als Rückversicherung für Sie selbst gewissermaßen, aber das ist Ihnen sowieso klar.« Ihr Blick und ihre Mimik drückten allerdings das Gegenteil aus, womit sie Walcher aber unrecht tat, denn der plante als Nächstes, mit Kommissar Brunner über seine geplanten Aktionen zu sprechen. Außerdem saß er ja mit der SOWID-Leiterin bereits zusammen.
»Dann benötige ich von Ihnen noch eine schriftliche Zusicherung, über diesen speziellen Fall unserer Kooperation absolutes Stillschweigen zu bewahren und unseren Verein in keiner Ihrer Publikationen zu erwähnen. Wenn auch nur einer dieser Zuhälter oder Menschenhändler erfährt, dass wir aktiv Frauen oder Kinder freikaufen, dass sie also nicht nur aus ihrer Not heraus Zuflucht bei uns suchen, dann knallen die uns einfach über den Haufen. Vor allem die Verbrecher aus den GUS-Staaten gehen mit besonderer Brutalität vor. Das sind Barbaren, und sie wissen, dass sie nur schwer zu fassen sind. Die haben außerdem voreinander größeren Respekt als vor der Polizei dort oder hierzulande.«
Irmi
Es war später Nachmittag geworden, als Walcher von der Landstraße in den Feldweg abbog, der zu seinem Hof führte. Die Verkehrslage in und um München hatte ausgereicht, um seine Vorfreude auf sein Zuhause in echtes Glücksgefühl zu verwandeln. Der Hof war sein privates Paradies, versteckt auf dem langgestreckten Bergrücken über Weiler. Erst wer von der Landstraße aus den holprigen Feldweg am Hang hinauffuhr, konnte ihn entdecken. Es kam aber nur höchst selten vor, dass sich ein Fremder hier herauf verirrte. Zudem steckten die meisten Wagen schon nach wenigen Metern auf dem hohen Mittelstreifen fest. Pferdewagen, Traktoren und Auswaschungen nach Regengüssen hatten den Weg in vielen Jahrhunderten so geformt.
Oben auf dem Bergrücken bot sich dem Betrachter ein faszinierender Ausblick auf die grünen, runden Wiesenhügel des Allgäus mit seinen Waldeinsprengseln und den wehrhaften Felsspitzen und Graten der Alpen im Hintergrund. Gründe genug, für diesen Ausblick Eintritt zu verlangen. Wegen eben dieser phantastischen Lage hatte Walcher das alte, total heruntergekommene Bauernhaus gekauft – zugegeben, nicht zuletzt auch wegen des Kellergewölbes mit den fast burgdicken Mauern, wie man sie sonst nur in herrschaftlichen Häusern und Schlössern antraf. Walcher konnte jederzeit das Gefühl von Geborgenheit wieder wachrufen, das er empfunden hatte, als er zum ersten Mal in dem Keller stand.
Hat sich doch gelohnt, die Schinderei, dachte er, als er sich dem Hof näherte. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Nicht protzig, sondern schlicht und solide präsentierte sich der Hof, sein Hof. Vor dem Haus stand der alte Opel Olympia von den Armbrusters.
Walcher war kaum ausgestiegen, als Rolli um die Hausecke jagte, ihn stürmisch begrüßte und ebenso stürmisch zur Terrasse begleitete, auf der Irmi und die Großeltern saßen.
Oma Armbruster las in einem Geo-Magazin, während ihr Mann mit Irmi über den Matheaufgaben brütete. Bärendreck lag der Länge nach ausgestreckt im Gras und genoss auf Katzenart die Sonnenstrahlen und Nähe zu seiner Familie. Walcher setzte sich zu ihnen und hatte wie immer das Gefühl, zu Hause zu sein.
Als Irmi ihre Hausaufgaben erledigt und Walcher von seiner Fahrt nach München erzählt hatte, brachen die Armbrusters auf. Dabei ließ es sich der alte Armbruster natürlich wieder mal nicht nehmen, über den »saumiserablen« Feldweg zu schimpfen, der längst einmal ordentlich aufgefüllt gehörte. Aber es hörte ihm keiner so richtig zu, auch Walcher nicht.
»Praktisch, einen mathematisch begabten Großvater zu haben«, meinte Irmi, während sie den beiden nachwinkte.
»Dann fehlt nur noch einer, der dein Deutsch aufmöbelt«, stellte Walcher fest.
Irmi wusste sofort, was er damit sagen wollte. »Schnürsengel, Esigurge und so, die Einkaufsliste, aber das war doch ein Gag«, grinste sie und freute sich, dass er darauf hereingefallen war.
»Hab ich mir beinahe gedacht«, lächelte Walcher, »dann fällt Nachhilfe Deutsch aus, dafür könnten wir aber mit Rolli ein bisschen arbeiten. Wie wär’s mit einem Spaziergang?«, schlug er vor.
Mäßig begeistert stimmte Irmi zu. Walcher hatte ein Buch über Hundetraining besorgt, nach dem sie bei Rollis Erziehung vorgingen. Kurz darauf schallten »Sitz! Platz! Steh! Komm, braver Hund!« durch den Allgäuer Abend. Erst nach einer Stöckchenwurfrunde um den Hof herum trat Ruhe ein.
Sie saßen dann noch auf der Bank neben der Haustür und sahen der Sonne zu, wie sie hinter dem Scherenschnitt der Alpengrate versank. Irmi stoppte die Zeit und erklärte dabei, dass nicht die Sonne unterging, sondern sich die Erde weiterdrehte. Das hätte ihr Opa Brettschneider erzählt. Als Irmi auf ihre Uhr sah, sprang sie hektisch auf, beinahe hätte sie eine Soap im Fernsehen verpasst, die nun schon seit zehn Minuten lief. »Ich kann sonst in der Schule nicht mitreden«, beugte sie eventuellen Argumenten Walchers vor und stürmte ins Wohnzimmer. Sekunden später hörte Walcher durch das offene Fenster das grausame Gestammel eines verliebten Assistenzarztes, der die Rolle eines Bayern in Hamburg spielen musste, seinen sächsischen Dialekt aber nicht verleugnen konnte. Walcher flüchtete erst in die Küche und dann mit einem Glas Rotwein an den PC in seinem Arbeitszimmer.
Im Mailordner hatten sich 45 E-Mails angesammelt, die meisten davon überaus lästige Spam-Mails, die sich immer raffinierter tarnten, sogar schon als Mahnungen der Steuerbehörden. Walcher löschte sie mit einem stillen Fluch auf die Technik und die Unverfrorenheit der Versender.
Susanna wollte wissen, ob es ihm gutginge, und forderte ihn auf, sich wieder einmal zu melden. Prompt beschlich Walcher ein schlechtes Gewissen. Seit Susanna ihn auf dem Hof besucht hatte, schob er eine Entscheidung über ihre Beziehung hinaus und beantwortete ihre Mails und Anrufe zurückhaltend und vage. Er mochte sie sehr, aber irgendwie passte sie nicht in seine Welt. Oder besser gesagt, noch nicht. Aber das musste er ihr bald erklären, sonst lief er Gefahr, sie zu verlieren. Deshalb fragte er sie, ob er sie in Frankfurt besuchen könnte.
Auch Johannes hatte ihm geschrieben und wollte wissen, was die Besprechung in München ergeben hatte. Ruf mich an, Johannes, hieß es am Schluss seiner Mail.
Mit Johannes verband Walcher seit ihrem gemeinsamen Studium der Journalistik und Kommunikationswissenschaften in Hamburg eine unaufgeregte, aber stabile Freundschaft.
Mal hörten sie monatelang nichts voneinander, mal unterstützten sie sich bei ihren Recherchen, mal arbeiteten sie gemeinsam an einem Projekt und telefonierten dann fast täglich miteinander. Walcher nahm sich vor, Johannes später am Abend anzurufen.
Die wichtigste Mail aber öffnete er zuletzt. Der Menschenhändler aus Frankreich lud ihn zu einer Weinprobe ins Burgund ein. Jetzt wurde es ernst. Walcher prostete dem Bildschirm zu: »Monsieur le Comte, je viens!«
Kommissar Brunner
»Wenn ein Journalist mich aus freien Stücken besuchen kommt, dann ist er entweder scharf auf ein geistiges Getränk, was noch das einfachste Problem wäre, oder er hat einen Anschlag auf mich vor.«
Unaufgefordert schenkte Kommissar Brunner aus seiner Bar, die ein auf antik gemachter riesiger Globus verbarg – für das Büro eines Kriminalbeamten ein recht ungewöhnliches Möbelstück –, zwei Williams in Schnapsgläser und reichte Walcher eines davon.
Es war der gleiche ausgezeichnete Williams, den Walcher schon bei der ersten Begegnung mit Brunner kosten durfte. Vier Monate war das her. Damals hatte ihn der Kommissar in sein Büro mitgenommen, nachdem er in einem Haus in Lindau drei Leichen entdeckt und der Polizei gemeldet hatte. Die beiden hatten sich im Laufe der Ermittlungen zu dem Fall kennen- und schätzen gelernt. Von einer Freundschaft zu sprechen, wäre allerdings zu hoch gegriffen, aber sie waren sich auf Anhieb sympathisch. Auch war Brunner, offensichtlich ausgestattet mit dem Instinkt eines Polizisten, immer zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen, um Walcher zur Seite zu stehen, wenn »so richtig die Post abging«, wie es der Kommissar formulierte.
»Oder hat der Herr Walcher mir etwa wieder einmal ein paar Leichen zu bieten?«, wollte Brunner wissen, nachdem er genussvoll einen Schluck Williams getrunken hatte.
»Keine Leichen, aber ich brauche trotzdem Ihre Hilfe, ich will nämlich ein Kind kaufen«, erwiderte Walcher im selben trockenen Ton und stellte sein leeres Glas auf Brunners Schreibtischplatte.
Kopfschüttelnd setzte sich Brunner auf die lederne Eckcouchgarnitur, ebenfalls ein Möbelstück, das in einem deutschen Beamtenzimmer überraschte, nicht nur weil es gut die Hälfte des Büros ausfüllte.
»Ich bin weder bei der Sitte, noch bin ich daran interessiert, ein Kinderschutzprogramm aufzulegen oder etwas in der Art«, fuhr er fort. »An was für einer Scheiße sind Sie denn da wieder dran? Pädophilie? Grässlich, Sie lassen wohl nichts aus. Noch einen?«
»Nein danke«, lehnte Walcher ab, es war erst vier Uhr nachmittags, viel zu früh für ein Gelage, außerdem brauchte er einen besonders klaren Kopf, um Brunner zu überzeugen.
Walcher setzte sich zu ihm auf die Couch und schilderte, an welchem Thema er arbeitete. Er berichtete von seinem Gespräch mit SOWID und zeigte ganz beiläufig einige der Fotos, die ihm Frau Dr. Hein mitgegeben hatte. Auch seinen Auftrag, über das Thema eine umfangreiche Reportage zu schreiben, erwähnte er, und dass er bereits mit zwei Händlern in Verbindung stand und die Möglichkeit hätte, sich in einen Händlerring einzuschleichen. Aber dazu müsse er sich eben als ein Kunde mit ernsthaften Absichten ausweisen.
»Oh Mann, Sie wollen Maulwurf spielen, den Helden mimen als Undercoveragent, Sie wollen sich wieder mal in die Arbeit der Kripo einmischen. Ja, haben Sie von Ihrem Ding da in Irland denn nicht genug, verdammt noch mal! In Deutschland gibt es massenhaft Sonderkommissionen der LKAs und des BKA, was wollen Sie da auch noch mitmischen, eine Bürgerinitiative gründen oder was? Warum gehen Sie nicht zu einer der unzähligen Beratungsstellen für Opfer von Menschenhändlern, da kriegen Sie doch Ihre Story ohne großen Aufwand zusammen!« Brunner redete sich in Rage und schimpfte vor sich hin, als wäre er allein in seinem Büro. »Wahnsinn, dieser Mann ist in höchstem Maße suizidal, er gehört in die Klapse oder am besten gleich ins Loch, wegen Störung des öffentlichen Friedens.«
Dann sprang Brunner von der Couch hoch und baute sich drohend vor Walcher auf. »Tag für Tag werden Hunderte von Typen wie Sie auf dieser Welt von ebendiesen Verbrechern abgeknallt, und das weiß der Herr Walcher, und trotzdem entwickelt er den Ehrgeiz, auch zu diesen Bedauernswerten gehören zu wollen. Warum bloß bin ich nicht bei der Landpolizei geblieben?« Brunner holte tief Luft, fuchtelte noch ein wenig in der Luft herum und fuhr in normal sachlichem Ton fort, so als hätte er nicht gerade laut und fast brüllend eine Standpauke gehalten. »Lassen Sie uns die Details durchsprechen. Wo soll die Aktion denn starten?«
»Frankreich«, strahlte Walcher den Kommissar an und bat nun doch um einen kleinen Williams, nachdem sich Brunner gewissermaßen als Verbündeter erklärt hatte.
»So eine Sache gehört zwar nicht in mein Ressort, aber da Sie ohnehin bald erschossen werden, kann die Mordkommission auch gleich Ihren Fall in die Hand nehmen«, sprach’s und stieß auf Walchers Wohl an.
Über drei Stunden saßen die beiden zusammen. Brunner war für einen kleinstädtischen Kommissar erstaunlich gut über das Thema Menschenhandel informiert. Als Walcher dies erwähnte, auch um Brunner etwas zu schmeicheln, wurde der Kommissar plötzlich sehr weich und sehr persönlich.
»Ja, wissen Sie, meine Frau brachte eine Tochter mit in unsere Ehe. Ich hab das Mädchen adoptiert und auch in meinem Herzen als mein Kind angenommen. Sie war sechzehn, als sie an einem ganz gewöhnlichen Montag nicht mehr nach Hause kam. So wie bei den Fällen, die ich ständig bearbeite. Später stellte sich heraus, dass sie an eine Sekte geraten war. Damals aber hab ich selbst erfahren, wie es sich anfühlt, wenn die eigene Tochter von einem Tag auf den anderen spurlos verschwindet. Nun, Sophie lebt heute in Amerika, hat Mann und zwei Kinder und führt ein ganz normales Leben. Sie tauchte ein halbes Jahr nach jenem Montag wieder auf, als ob nichts gewesen wäre. Sie hatten sie auf die Straße geschickt zum Betteln. Von ihrem Guru gab’s Streicheleinheiten oder Prügel, je nachdem, was sie täglich zusammengebettelt hatte.«
Brunner stellte sein leeres Glas in die Weltkugelbar zurück und sah Walcher in die Augen. »Ich war damals sogar in der Kirche und hab gebetet, dass sie heil zurückkommt. Ich weiß also, wovon ich rede! Aber was das Vorgehen in unserem Fall angeht« – sehr zu Walchers Freude sprach er bereits im Plural –, »so müssen wir die Kollegen in Frankreich erst einmal außen vor lassen. In dem Geschäft existieren die unglaublichsten Verbindungen. Geben Sie mir rechtzeitig eine Info, bevor Sie einkaufen fahren, ich bereite vor, was wir besprochen haben, und aktiviere meine Kontakte beim BKA. Nur eine Bedingung habe ich.«
Brunner legte eine bedeutungsvolle Pause ein und sah sein Gegenüber fast herausfordernd an. Walcher machte eine auffordernde Geste, als wollte er sagen: nur zu, heraus damit.
»Wenn Sie in dieser Sache irgendetwas unternehmen, ohne mich vorher zu informieren, dann war’s das, dann bin ich draußen, haben Sie verstanden, draußen. Dann nehme ich erst wieder die Ermittlungen auf, wenn ein Herr Walcher nicht mehr auftaucht. Ist das klar, mein Herr? »
Walcher nickte, lächelte und rief: »Aber selbstverständlich, Herr Kriminalhauptkommissar.«
Hinteregger
Nach dem Treffen mit dem Kommissar schrieb Walcher eine Mail an Hinteregger. Als Leiter der Sicherheitsabteilung der Saveliving Company, eines gewaltigen, global agierenden Mischkonzerns, besaß Hinteregger erstaunliche Verbindungen zu weltweit führenden Persönlichkeiten, und, was nicht weniger interessant war, er verfügte über modernste technische Hilfsmittel, mit denen er die meisten Datenbanken dieser Welt anzapfen konnte.
Das hörte sich futuristisch an, aber entsprach den Tatsachen, denn zur Company gehörten die führenden Unternehmen der digitalen Kommunikationstechnologie, bei denen die meisten Geheimdienste ihre Hard- und Software einkauften. Über diesen für Walcher äußerst nützlichen Umstand hinaus hatten sich die beiden angefreundet, als Walcher in den Prozess des Generationswechsels der Saveliving Company verwickelt worden war.
Lieber Freund, schrieb er, du solltest ein wachsames Auge auf mich haben, meine jetzige Recherche konzentriert sich auf ein besonders schmutziges Geschäft, nämlich Menschenhandel und zwar insbesondere den mit Kindern zu Zwecken des sexuellen Missbrauchs. Wann treffen wir uns? Irmi fragt nach dir, Bärendreck liebt dich, und unser neues Familienmitglied »Rolli«, ein Labrador, würde dich auch gerne begrüßen. Von mir als Lockmittel will ich ja gar nicht reden, aber vielleicht von einem herausragenden Burgunder, den ich bei einer Exkursion einzukaufen gedenke.
Also? Ich freue mich auf dich und deine Antwort.
Eine knappe halbe Stunde später kam bereits die Antwort.
Hi, Freund Walcher, sitze auch gerade amPCund frage mich, was du da wieder ausheckst. Werde immer nervös, wenn du dich über einen längeren Zeitraum nicht meldest. Dass du dich dem Thema Menschenhandel zuwendest, war leider irgendwann einmal zu erwarten, so weit kenne ich dich jainzwischen. Du solltest allerdings noch vorsichtiger sein als bei deinen bisherigen Recherchen, soweit ich sie kenne. Bei Kindesmissbrauch wird auf allen Ebenen, vor allem in den höchsten Kreisen, allzu gern weggeschaut. In denUSAgibt es derzeit geradezu eine Pädophilenwelle. Dito Europa. Schau ins Internet. Unglaublich. Oder die Belgier damals, die im Fall mehrerer verschwundener Kinder fast ein Jahr gebraucht haben, um überhaupt Ermittlungen in Gang zu bringen. Dabei ist das nur die Spitze des Eisbergs, die Fälle eben, die an die Öffentlichkeit dringen. Möglich macht das alles ein bestens organisiertes System.
Also, halte mich unbedingt immer auf dem Laufenden, mit wem und wo du was vorhast. Ist das klar??!! Ach ja, noch etwas. Wenn du Mails verschickst, vermeide Begriffe wie Menschenhandel, Pädophilie, Kinderhandel etc.; du läufst sonst Gefahr, ins Fadenkreuz der internationalen Fahndung zu geraten. Unsere Computerexperten haben gerade ein Programm entwickelt, das aus den täglich über Milliarden von Mails zielsicher diejenigen herausfischt, in denen bestimmte Schlüsselbegriffe vorkommen. Und zwar, das ist das Besondere an diesem Programm, erkennt es nicht nur die Begriffe selbst, sondern »liest« auch den Kontext. Schreibe in Zukunft deine Mails an mich als Re-Mail in eine alte Mail von mir. Die ist durch ein spezielles Programm geschützt. Wir wollen uns ja schließlich nicht selber in die Karten sehen lassen. Dies hierzu. Mitte August werde ich zwei Wochen in Italien sein. Da sind Schulferien! Die hast du natürlich bestimmt wieder vergessen. Also biete Irmi endlich mal etwas und kommt mich besuchen. Habe ein nettes Häuschen gemietet, ganz nah am Wasser.
Ich umarme dich, E. H.
Ein gutes Gefühl, Hinteregger im Rücken zu wissen, dachte Walcher und kündigte seinem Freund an, ihm alle wichtigen Details sofort zu schicken, sobald er mehr über die Leute im Burgund erfahren hatte. Die Einladung nach Italien nahm er schon einmal herzlich an, auch wenn er erst noch mit Irmi darüber sprechen wollte. Vermutlich würde sie begeistert sein, denn außer dass sie gemeinsam Ferien machen wollten, hatten sie noch nichts besprochen. Und Walcher gab zu, dass er sich wirklich noch keine großen Gedanken gemacht hatte.
Die Spedition
Nikolas Bromadin, wie üblich der Letzte, schaltete das Licht im gesamten Bürotrakt aus, ging hinaus und schloss die Tür hinter sich ab. Der Hof mit den sechs Laderampen und die Lagerhalle blieben auch über Nacht von grellem Scheinwerferlicht angestrahlt. Zwei Sattelschlepper wurden gerade entladen, ein weiterer würde im Laufe der Nacht eintreffen.
Nikolas war stolz auf das Speditionsunternehmen, das er zusammen mit Jirji, seinem Bruder, und Onkel Edwin seit fünf Jahren betrieb und immer weiter ausgebaut hatte.
Von Deutschland aus transportierten sie Güter aller Art in abgelegene Orte der GUS-Staaten, die anzufahren für die großen Spediteure unrentabel war, und hatten mit dieser Spezialisierung bisher gute Geschäfte gemacht. Auf den Fahrten zurück nach Deutschland übernahmen sie als Subunternehmer Aufträge anderer Speditionen oder Fracht von Kleinunternehmen, die sich Kontakte zum Westen aufgebaut hatten. Nikolas wäre zufrieden mit der Entwicklung seines Unternehmens, hätte es da nicht die Geldgier des Bruders und des Onkels gegeben.
So bescheiden und sparsam, wie er selbst lebte, so verschwenderisch gingen Jirji und Onkel Edwin mit dem Geld um. Sie verprassten es und gaben ständig mehr aus, als sie sich als Geschäftsführer an Gehältern selbst ausbezahlten. Die beiden steuerten die Zentrale in Gorki und führten sich auf wie Großfürsten, während Nikolas in Berlin gemeinsam mit seiner Freundin Marita den weitaus größeren Arbeitsanteil erledigte.
Im Gegensatz zu der Villa in Gorki hausten Nikolas und Marita in einem heruntergekommenen Plattenbau im Stadtteil Schwanebeck. Jirjis und Onkel Edwins verschwenderischer Umgang mit Geld hätte ihn kaltgelassen, wenn die beiden nicht auch noch vor einem halben Jahr mit diesem lukrativen Zusatzgeschäft begonnen hätten. Nikolas war die Sache nicht geheuer. Die immer größer werdende Zahl an Sondertransporten bereitete ihm, dem soliden Kaufmann, mehr und mehr Kopfzerbrechen. Zum einen fürchtete er die Behörden, zum anderen widersprachen diese Sondertransporte seiner Auffassung von Rechtschaffenheit. Allerdings häuften gerade diese Privattransporte auf seinem Sparkonto atemberaubend schnell Geld an, so viel, wie er sonst nie hätte ansparen können. So hielten seine Moralanwandlungen in etwa so lange vor wie Eiswürfel in einem Gin Tonic. Außerdem war er bisher noch nie mit dem Transportgut in Berührung gekommen. Nur einmal hatte er einen Blick in eine der verborgenen Transportkabinen geworfen, ungefähr so flüchtig, wie man auf einer Bäderausstellung einen Blick in eine Duschkabine wirft. Trotzdem hatte ihn das Bild einige Tage lang verfolgt. Der Kabinenraum war achtzig Zentimeter tief gewesen und so breit wie der Auflieger. Die Trennwand zum Laderaum hatte wie eine ganz normale Wand aus Aluminium ausgesehen. Man stieg von unten her durch eine raffiniert getarnte Bodenluke ein, denn manchmal schoben die Zöllner große Spiegel unter die Trucks, um nach Verstecken zu suchen. Im Inneren hatte eine beängstigende Enge geherrscht. Fünf Kojen übereinander, aus Holzlatten gezimmert, jeweils sechzig Zentimeter hoch. Den Reisenden blieb nichts anderes übrig, als sofort in die Kojen zu kriechen, denn neben der Einstiegsluke war nur noch Platz für ein chemisches Klosett.
Nikolas schauderte es bei der Vorstellung, in diesem Verschlag stunden-, ja tagelang über Straßen gerüttelt zu werden. In den sargähnlichen Kojen brannte zwar immer Licht, es war auch eine Lüftung installiert, aber eine Fahrt darin musste eine Tortur ohnegleichen sein. Wer noch dazu auch nur ansatzweise unter Klaustrophobie litt, durchlitt da drinnen vermutlich Höllenqualen. Von den Lagerarbeitern wusste keiner, dass es in zwei der Trucks diese Verstecke gab. Nur die Fahrer waren eingeweiht und profitierten natürlich in Form barer Münze.
Nikolas wusste wenig über die Transporte. Er redete sich ein, dass diese Leute freiwillig in den Westen wollten. Über das Syndikat wusste er nichts, außer, dass es viele kriminelle Organisationen in der Heimat gab, denen man ständig Gelder für alle möglichen Schutzversprechen bezahlen musste. Nikolas ahnte auch nicht, dass die Immobiliengesellschaft, an die er jeden Monat die Miete für das Speditionsgebäude überwies, zu jenem Syndikat gehörte, von dessen schmutzigem Geld sein Bankkonto derart rasant anwuchs.
Rodica III
Sie waren ohne Pause bis Sonnenaufgang gefahren. Verschlafen und mit verspannten Muskeln wurden sie aus dem Auto getrieben. Sie sahen Wiesen, die mit Steinen eingefasst waren, und ein paar Bäume, aber keinen Garten und auch keinen Park. Das erste Mal in ihrem Leben standen die Mädchen auf einem Parkplatz an einer Autobahn.
Die beiden Männer führten sie zu einem Häuschen, in dem es zwei Toiletten und ein Waschbecken gab. Es stank entsetzlich darin, Fliegen in Geschwaderstärke surrten durch die Luft, und aus dem Hahn kam nur tropfenweise Wasser. Doch sie mussten so dringend, dass sie einfach auf die Haufen von Kot machten, die bereits den Boden bedeckten. Dann wurden die Mädchen von den Männern wieder zum Wagen getrieben. Dort bekamen sie eine Flasche mit süßem Sprudel, die sie, durstig wie sie waren, sofort austranken. Aber mehr gab es nicht, obwohl Rodica dem Älteren der beiden mit flehenden Augen die leere Flasche hinhielt. »Später«, knurrte er nur.