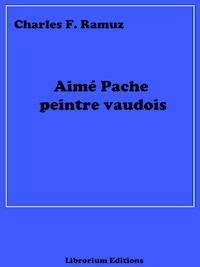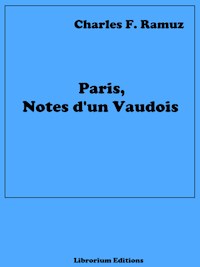17,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limmat Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein schlichtes Holzkreuz schmückt Farinets Grab in Saillon, das am Rande des Kirchenbezirks liegt, wie es sich gehört für einen, der seine individuelle Freiheit höher schätzte als Staat und Gesetz. Als der junge Mann im abgelegenen Tal mit der Geldfälscherei begann, ging es ihm nicht um persönliche Bereicherung, er wollte geben, schenken, Freude bereiten. Dieses Angebot nahmen die Leute gerne an, sie hielten Farinets Gold sowieso für echter als das der Regierung. Von Männern geschätzt, von Frauen verehrt, fand er Unterschlupf vor der Staatsgewalt, bis er von seiner Freundin aus Enttäuschung verraten wurde. Er hat etwas Anarchisches, dieser Farinet, wie ihn Ramuz beschreibt. Ein Verführer ist er, einer, der keine Grenzen anerkennen mag, der mit Bick auf die Berge ausruft: "Aber, was ist Freiheit? ... Freiheit ist: zu tun, was man will, wie man's will, wann man Lust hat." Heute ziert Farinet die "Bank"-Noten alternativer Tauschkreise, während Ramuz auf dem echten Geld abgebildet ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Charles-Ferdinand Ramuz wurde 1878 in Lausanne geboren. Nach dem Gymnasium schrieb er sich 1896 in der philosophischen Fakultät der Universität Lausanne ein. Während eines Aufenthalts in Karlsruhe fasste er den Entschluss, Schriftsteller zu werden und seine Studien in Paris fortzusetzen, um eine Doktorarbeit über den Dichter Maurice de Guérin zu schreiben. Im Krieg begegnete er Igor Strawinsky; aus ihrer Zusammenarbeit entstand die «Histoire du Soldat». Ab 1926 veröffentlichte der Pariser Verlag Grasset seine Werke. 1940/41 erschien, initiiert von seinem Lausanner Verleger Henry-Louis Mermod, die Gesamtausgabe in 20 Bänden. 1936 erhielt Ramuz den Grossen Preis der Schweizerischen Schillerstiftung. Er starb 1947 in Pully bei Lausanne. Viele seiner Romane wurden verfilmt, u. a. «Derborence», «Farinet oder das falsche Geld», «Rapt», «Die grosse Angst in den Bergen», «Krieg im Oberland», «Wenn die Sonne nicht mehr wiederkäme», «Adam und Eva». Fast sechzig Jahre nach seinem Tod erschienen 2005 zwei Bände mit 22 Romanen von Ramuz in der renommierten Bibliothek de la Pléiade in Paris.
Charles Ferdinand Ramuz
Farinet oder das falsche Geld
Aus dem Französischen von Hanno Helbling
I
Und Vater Fontana spricht weiter auf die zwei Männer ein, mit leiser Stimme, im Café Crittin in Mièges.
«Ja …»
Langsam ging sein Kopf auf und ab.
Ardèvaz und Charrat hießen die beiden.
«Ja», fährt Fontana fort, «denn das sage ich euch, sein Gold ist besser als das Gold der Regierung. Und ich sage, er hat das Recht, falsches Geld zu machen, wenn es echter ist als das echte. Was macht den Wert der Münzen aus – die Bilder, die drauf sind?, die Frauenzimmer, die nackten Weiber, oder die angezogenen, oder die Kronen, die Wappen? Oder vielleicht die Inschriften? Oder etwa die Zahlen», sagte er, «die Zahlen, die von der Regierung draufgetan werden? Wer kümmert sich um die Inschriften? Niemand, und um die Zahlen auch niemand. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Regierung euch den Wert und das Gewicht falsch angäbe, genauso wie irgendein Privater. Fragt nur die Leute, die sich auskennen. Die Regierung sagt euch: ‹Dieses Stück hat so viel gegolten; nun, von jetzt an gilt es so viel …› Das ist vorgekommen, das kann wieder vorkommen. Da ist Farinet anständiger als die Regierungen, ihm zahlt man das, was an dem Geld dran ist, ihnen zahlt man, was draufsteht …»
Er hatte immer lauter geredet und es selbst nicht gemerkt; dann ist er auf einmal still und wirft einen Blick über die linke Achsel, zur Tür hin.
Offenbar hatte er Angst, es sei einer hereingekommen und er habe nicht aufgepasst, während er seine Sache vortrug; aber er sieht durch die Rauchwolken, dass niemand gekommen ist; es war auch erst fünf Uhr, zu früh für die meisten Kunden, die waren jetzt eher im Weinberg, auf dem Feld oder im Garten; und das Lokal war leer, mit seinen zwei Tischreihen, die bis zum Fenster liefen, durch eine Art Nebel, in dem man nicht deutlich sah. Fontana war beruhigt, er zog an der Pfeife, immer zweimal, mit eingezogenen Backen.
Er nimmt sein Glas, trinkt den andern zu.
Die beiden hatten nichts gesagt. Auch sie zogen an ihren Pfeifen mit den Messingdeckeln; sie wiegten die Köpfe von Zeit zu Zeit.
Sie hatten die Ellbogen auf dem Tisch, sie schwiegen. Offenbar warteten sie, bis Fontana fortfahren würde; er war noch nicht fertig. Fontana merkt das; er blickt noch einmal vorsichtig über die Achsel; vor sich hat er die Wand und rechts auch die Wand; trotzdem senkt er noch die Stimme, um ganz auf der Hut zu sein (dabei weiß er, dass auf den Wirt Verlass ist, dass er zu Farinet hält, falls nämlich der Wirt ihn hören sollte), und sagt:
«Und wenn ihr meint, Farinet sei ein Anfänger, meinetwegen, aber von wem hat er das Geheimnis, wer hat ihm die Schlupfwinkel gezeigt? Vater Sage hatte Papiere, und er hat sie mir sogar gezeigt, ich habe sie gesehen. Von Paris kam das, ja, von Paris, und von Genf. Zertifikate nennt man die. Er hatte von seinem Pulver dorthin geschickt, zur Begutachtung; und auf seinen Papieren, da stand nun …»
Er hält ein; dann spricht er die drei Worte deutlich aus, einzeln:
«Es – war – echt.»
Er hält ein.
«Das stand auf diesen Papieren, und das sind Herren, begreift ihr, das sind Leute, die immerhin mehr verstehen als wir, das sind Leute vom Fach, Gelehrte, die Bücher schreiben, Philosophen. Die haben gesagt: ‹Das ist reines Gold, und nichts als reines Gold.› Sie haben es geschrieben. Es steht auf den Zertifikaten. Und die Zertifikate, begreift ihr, die hat Farinet jetzt … Der Unterschied ist nur, dass Sage sein Pulver für sich behielt, und er hat Münzen draus gemacht, aber das ist seine Sache. Wenn die nicht immer schön herauskommen, so liegt das daran, dass er nicht alle Werkzeuge hat, die man braucht. Aber der Gehalt ist da. Und ich sage euch, es ist gut, so etwas unter dem Strohsack zu haben oder unter einem Stein im Garten, für alle Fälle. Etwas, das nicht alt wird, das nicht verfault, nicht verdirbt, das sich nicht verfärbt, das sein Gewicht behält, etwas Festes, wo alles andere eben nicht fest ist; etwas, das nicht nur von heute ist, oder von gestern oder von morgen, sondern von immer, so alt wie die Welt und so lange da wie die Welt … Und dann hätte man Gold in der Gemeinde, man würde es lassen, wo es ist, man würde nichts damit machen! Ist das eine Idee? … Ich habe jedenfalls davon; das gebe ich offen zu. Ich habe für hundert Franken davon. Und du, Ardèvaz?»
Ardèvaz nickt; er hatte auch davon.
«Siehst du. Und du, Charrat?»
Charrat lächelt.
«Oh!, jeder hat davon; die Sache ist schon richtig.»
«Und ist es dann richtig, dass er im Gefängnis sitzt und dass man ihn drinlässt?», sagt Fontana. «Diebe steckt man ins Gefängnis. Er ist das Gegenteil von einem Dieb. Frag nur den Patron …»
Er ruft:
«He! Patron!»
Er sagte:
«Wir fragen ihn, ob er nicht auch davon hat, und wie viel. Er hat nämlich am meisten davon. Seit ihm Farinet mit seinem Geld zahlt … Crittin hat mindestens für tausend Franken … Wir fragen ihn. Wir sind hier unter uns, lauter Freunde und Vertrauensleute … He, Patron! Warum kommt er nicht?»
Es war wirklich merkwürdig, dass Crittin noch nicht da war und wie sonst ein Glas mit uns trank; Ardèvaz steht auf.
Ardèvaz öffnet die Tür zum Hausgang.
Aber in diesem Augenblick war die Tür zur Straße hin aufgegangen, am anderen Ende des Hausgangs; und eine Frau war hereingekommen, eine nicht mehr sehr junge Frau, wie es schien, einen Hut auf dem Kopf, einen Koffer in der Hand, ganz schwarz angezogen, aber weiß von Staub bis an die Knie, sie sieht Ardèvaz, sie bleibt stehen …
An dem Tag, in Mièges, unterhalb der Felsen, etwas erhöht über der Rhone-Ebene, hinter den Mauern von Mièges, die weiß in der Sonne standen – in diesem Hausgang, eine Frau kommt herein, sie sieht Ardèvaz; aber da war, im selben Augenblick, Crittin aus seiner Küche getreten.
«Ah, Sie sind es … Ich habe Sie erwartet …»
Während er auf sie zuging, dann Ardèvaz sah:
«Bleib … Das ist Joséphine … Kennst du sie nicht mehr? … Sie war hier angestellt, vor zwei Jahren.»
Er sagte zu Joséphine:
«Kommen Sie einen Moment herein … Es sind Kunden da, die Sie kennen …»
Und wie er sie hereingeführt hat:
«Nun, Fontana, erinnern Sie sich? Und du, Charrat …? Joséphine …»
«Ah!», sagt Fontana, «natürlich.»
Und er gibt ihr die Hand:
«Wie geht’s? … Sie kommen scheint’s von weit her … Ah, von Sion … Ah», sagt er. «Und wie geht’s da, in Sion?»
Sie sagt:
«Es geht gut.»
Und mehr sagt sie nicht; denn Crittin fragte sie nun, ob sie nicht auf ihr Zimmer wolle.
Er begleitet sie bis zum Zimmer, dann kommt er zurück ins Lokal; und hier sagt er, und es tönt sonderbar:
«Ja, ich habe sie wieder kommen lassen … Denn ich glaube, etwas wird passieren. Und bald», sagt er, «aber redet nicht davon …»
Und Fontana:
«Farinet, ja … Wir sprachen von ihm …»
Aber Crittin blinzelt ihm zu.
II
Und wirklich, in dieser selben Nacht, die Uhr der Kathedrale hatte kurz vorher zwölfmal geschlagen, war Farinet ohne Geräusch von seinem Strohsack aufgestanden und aus dem hölzernen Rahmen gestiegen, der an der Mauer festgemacht war.
Eben noch hatte der Aufseher seine Runde gemacht und war vor der eisengepanzerten Tür gestanden, hatte das vergitterte Guckloch geöffnet und ihn dort liegen gesehen, musterhaft unter der Decke; dann war auch er schlafen gegangen.
Kurz nach den zwölf mitternächtlichen Glockenschlägen hatte er sich aufgesetzt. Farinet auf seinem Strohsack.
Eine ganze Weile hatte er sich nicht gerührt. Er war vorsichtig und berechnend; immer, in allem. Lange war er unbeweglich dagesessen, um sicher zu sein, dass alles ruhig war in dem Käfig (so nannten die Leute im Land das Gefängnis).
Er hatte nichts gehört. Er hatte nur noch die Decken zurückschlagen müssen.
Kurz nach Mitternacht steht er auf; er geht mit bloßen Füßen zum Fenster, zu der vergitterten Mauerscharte, er packt einen der Stäbe und zieht sich hinauf; dann machte er sich, ins Gemäuer geduckt, wie ein Kaminfeger in den Rauchfang, an seine Arbeit.
Man hat nie herausgebracht, wie er sich die Metallfeile beschafft hatte. Offensichtlich hatte er sie schon benutzt; die Gitterstäbe waren zu drei Vierteln durchgesägt. Und nun ließ die Feile wieder ihr Husten hören, oder einen keuchenden Laut, wie wenn einer Asthma hat; von Zeit zu Zeit hielt er an, aber alles blieb still in dem Käfig, und das Feilen begann von neuem.
So war die erste Stange bald durchgefeilt, dann die zweite. Sie waren immerhin beide solid, mit Hammer und Amboss geschmiedet, in der alten Zeit (als man noch wusste, was Schmiedearbeit war): Trotzdem waren sie nun entzwei, am oberen Ende, direkt am Stein, die eine wie die andere; denn Farinet hatte beschlossen, ihnen so viel Länge wie möglich zu lassen, damit sie sich eher bogen. Er hält sich wieder einen Augenblick ganz still, er muss warten, bis das schwere Klopfen seines Herzens zum Schweigen kommt. Er leckte den salzigen Schweiß von den Mundwinkeln; hinten rann er ihm den Nacken hinunter, er klebte ihm das Hemd auf die Haut. Der Mondschein schnitt jetzt seinen Körper in zwei Hälften, auf der Höhe des Gürtels; der untere Teil stand im Licht; der untere Teil des Körpers war wie Eis, der Kopf und die Hände waren wie Feuer. Macht nichts, man wird ihnen zeigen, wer man ist! Er wartet geduldig, solange es sein muss, er horcht mit dem einen Ohr auf die Geräusche, die drinnen im Gefängnis laut werden könnten, mit dem anderen Ohr auf die Töne, die von draußen hereindringen oder hereindringen könnten; aber er hört nur ein Pferd, das da unten hustete, auf der anderen Seite der Hofmauer; und dann die Uhr der Kathedrale, die eins schlug.
Er hält sich mit beiden Händen an einer der Stangen fest; er lässt sich nach hinten fallen …
Ah!, und die meinten, sie hätten mich! Die Stange gab nach unter seinem Gewicht; die meinten, sie könnten mich noch sechs Monate in ihrem Käfig behalten; sie wussten nicht, wer ich bin.
Der italienische König auch nicht, Umberto der Erste: Jetzt weiß er’s. Farinet war an der zweiten Stange, er merkte nicht einmal, dass ihm das Blut über den Arm rann bis unter die Achsel; die zweite Stange gab auch nach. Beide bildeten jetzt Haken, die sich abwärts bogen, und über sich gaben sie genauso viel Raum frei, wie einer brauchte, um durchzuschlüpfen; knappen Raum freilich, ganz knappen sogar, der Körper ging da nur flach durch, aber Farinet kannte sich aus! Wenn einer von Kind auf in den Bergen herumgestiegen ist, weiß er Bescheid; und die Freiheit wartete auf ihn, ganz nahe war sie und kam bis zu ihm herein mit dem Mondlicht und sagte zu ihm: «Fast bist du so weit, Farinet, nur ein wenig streng dich noch an, ja, so …» Sie sagte zu ihm: «Jetzt musst du bloß noch das Seil festmachen … Ja, so … Zwei Knoten machst du. Hab keine Angst.»
Er hatte keine Angst. Denn man mochte ihn gern, und die Dinge mochten ihn auch. Er hatte nicht sein Leintuch in Streifen reißen müssen wie so viele Gefangene, von denen man in den Büchern liest; er hatte ein Seil, ein richtiges, ein Seil aus gutem Hanf, so lang, wie er es brauchte, ungefähr acht Meter. Man mochte ihn gern, man sorgte für ihn. Und er sah, dass auch die Dinge ihn gern hatten; denn gerade als er nun das Seil mit einem doppelten Knopf am Gitter befestigt hatte, war eine Wolke vor den Mond getreten. Das Gefängnis steht oben auf dem Stadthügel, mit seinen hohen, nackten Mauern; man hätte ihn leicht bemerken können, als dunklen Schatten vor der hellen Fassade, wenn der Mond darauf schien, aber der scheint jetzt nicht. «Ich will dir nicht im Weg sein», hatte er gesagt und war im selben Augenblick hinter einer dicken schwarzen Wolke verschwunden. Farinet lässt sich hinunter, der Mauer nach, in tiefdunkler Nacht, nicht zu bemerken. Er muss nur dem Seil bis zum Ende folgen, um Boden zu finden. Er dachte nichts mehr, es geht alles sehr rasch. Die Bewegungen, die er machte, schien ein anderer für ihn zu machen; sie folgen einander so schnell, dass er sie nicht einmal wahrnahm. Wie er unten angelangt ist, machen seine Schritte kein Geräusch. Es ist, als wäre er auf dem Grund eines Sodbrunnens, es war der Rundgang, ein kurzer Weg: höchstens fünf Schritte; er macht sie geräuschlos, in tiefster Dunkelheit. Der Mond dort über allen Kirchtürmen von Sion und dem Bischofssitz sagte: «Ich bleibe im Versteck»; und er kommt mit seinen geräuschlosen Schritten zur Umfassungsmauer, fünf oder sechs Meter hoch ist sie, aber er kennt sich aus. Das ist so, wie wenn er Gold suchte, wenn er Gämsen verfolgte, und hinter einer Biegung brach der Weg ab; es ging nicht weiter, es ging nicht zurück, auch hinunter nicht: auf diesen handbreiten Vorsprüngen, denen man folgt, bis sie plötzlich nicht mehr da sind in der Leere, wo man die Kühe sieht zwischen den Beinen hindurch, nicht größer als Marienkäferchen, vierhundert Meter tiefer. Und da (er lachte in sich hinein), da meinen sie, mit ihrem bisschen Mauer halten sie mich auf, und der Große Maurer hat’s nicht gekonnt. Oder fragt doch den italienischen König, Umberto den Ersten, ihr wisst schon, als der mich behalten wollte. Der hatte auch Mauern, und was haben sie ihm genützt? Mit den Fingerspitzen findet er über seinem Kopf eine Ritze; mit den Zehenspitzen findet er eine andere Ritze in der Mauer der Regierung. Er drückt sich an den Stein, so eng er kann, den Arm hinaufgestreckt. Der andere Arm sucht weiter oben, findet auch Halt, und der erste kommt ihm nach; er zieht sich hoch, hilft mit dem Knie nach. So gelangt er auf die Mauer, während Sion schlief; er greift mit dem linken Arm hinüber und legt sich flach auf die Mauer. Geschafft! Der italienische König … Zwei, drei Wörter, immer dieselben, tönten in seinem Kopf, während ein warmer Strom von den Schläfen zu den Ohren floss, laut, aber angenehm jetzt; als ob man ihm Bravo zuriefe. Der italienische König … der italienische König …
Das Pferd hustete wieder.
Dann schlägt auch die Turmuhr wieder.
Diesmal schlug die helle Glocke, die tiefere war für die Stundenschläge da, die helle für die halben Stunden. Da erinnerte sich Farinet, dass seine Arbeit noch nicht ganz zu Ende war.
Er war die Rebhänge hinaufgestiegen, dann hatte er sich unter einem Apfelbaum ins Gras fallen lassen.
Er atmete die Luft der Freiheit ein, so tief er konnte. Er streckte die Hand aus, er spürt unter seiner Hand und durch den Stoff seiner Hosen das nasse Gras, er hebt den Kopf, und da sieht er die Sterne wieder, er kann jetzt den Himmel wieder von einem Ende zum andern sehen, und das ist gut, das ist schön.
Er war anfangs sehr rasch gegangen, eher gelaufen als gegangen, war die steinige Halde hinaufgeklettert, zwischen den Rebstöcken mit ihren Schossen, die man eben erst aufgebunden hatte, oder unten in den Gräben, die man für das Absenken zieht und die ihm nun gute Verstecke boten; er hatte keine Zeit gehabt, etwas zu denken, wie er da in seinen Sträflingshosen rannte, er war nur besorgt, dass niemand diese Hosen sah, und er war sparsam mit dem Atem, aber jetzt hat er einen Ast des Apfelbaums über sich, und ein anderer hängt vor ihm herab und verdeckt ihn.
Er blickt sich um; er sah, wie gleich vor ihm die steile Böschung anfing und im Gewirr der Rebstöcke abfiel; unten kam dann der breite, flache Talboden, wo die Rhone fließt; und Sion, die ganze Stadt, lag zwischen ihm und der Rhone.
Das Ganze zeigte sich ihm nach und nach, da die Augen sich anpassten in der völligen Dunkelheit (die ihm lieb war), wie eingemeißelt ins schwarze Gestein, bis zu den Höhen von Valère und Tourbillon, die doch weniger hoch waren als der Ort, wo er saß. Die Kirche, die auf der einen steht, und das Schloss auf der anderen lagen beide unter ihm, so hoch war er schon gestiegen. Er musste jetzt lachen, wie er so dasaß und sich verwunderte: eine ganze Stadt, mit einem Bischof, einer Regierung, mit einem Schloss, zwei Schlössern, mit Türmen, mit sieben oder acht Kirchen, mit einem Gericht, mit Richtern, mit einem gefällten Urteil, mit Polizisten und Gefängniswärtern, all das und sie alle zusammen hatten ihn nicht zurückhalten können; und er war allein gegen sie alle. Er war allein, sie waren vier- oder fünftausend. Das kam aber daher, dass ihre Gerechtigkeit nichts taugte, dass sie ungerecht ist. Doch für unsereinen gibt es den Geschmack an der Freiheit. Sie haben ihr kleines Leben dort unten, ihr enges Leben, ihr falsches Leben (er schaute noch immer von oben ins Tal), sie liegen in ihren Betten, während er das Gras unter seiner Hand spürte, ganz nass wurde es, und Blumen waren darin, die gut zu riechen begannen. Adieu, ihr da unten, ihr andern!, jeder hat sein Leben. Sie sind noch zwei Stunden lang tot, und ich habe Zeit, solange sie tot sind. Sie haben versucht, mich am Leben zu hindern, weil ich mein Leben habe, mein eigenes …
Vorwärts!, ruft er sich zu, vorwärts!, und weiter so; für jetzt aber Ausruhen, denn alles geht gut – war eben gut berechnet.
Er tastet seinen Körper ab im hohen Gras: berührt die bloßen Füße, die Knie, die dicken gestreiften Uniformhosen, den verkrusteten Hanfstoff seines Sträflingshemds – da drunter bin aber ich, ich bin das …
Er lässt sich zurückfallen. Er lässt sich mit dem ganzen Körper gegen die gute Erde zurückfallen, überall spürt er sie. Er fügt sich ganz ihr an, mit dem Hinterkopf, mit dem Nacken, mit beiden Schultern, mit den Schenkeln und Waden, mit den Fersen.
Er sieht, dass sich drunten im Käfig noch nichts gerührt hat.
Er sieht auch, dass die Sterne allmählich bleich werden, zwischen den Ästen des Baums und dort vorn am Himmel, der sich zu lichten beginnt; und darunter sieht er die Berge, es werden mehr, da die Nacht vergeht.
Er hat sich aufgesetzt. Er versucht sie zu zählen. Sie stechen überall hervor wie Zähne aus dem Kiefer, mit ihren Spitzen, die weiß sind, immer weißer werden, immer mehr werden, einer vor dem andern, im Halbkreis; da einer, ein anderer dort, sind es zwanzig, dreißig, hundert, fünfhundert?, ihm wird schwindlig, aber er lacht: «Das gehört mir, wieder mir …» Er blickt auf das Land, das von neuem lebendig wird, hier und dort unten, weiter weg, rechts und links, auf allen Seiten: die Grashalme, die sich abzeichnen, die Dächer, die auseinander treten; ein Kirchturm, drei Kirchtürme, vier, fünf, die Rhone, die Straße im Tal; mir gehört das. Und dann alle Berge über ihm, und die Sterne erlöschen einer nach dem andern. Da kräht der Hahn, während oben im Tal, über den weißen Bergen, ein bleicher Nebel zum Himmel stieg.
Er war aufgestanden.
Er ging rasch. Er spürte die Steine nicht, er spürte weder Stoppeln noch Dornen. Er dachte nur: «Aufpassen», denn er sah auch die Löcher, aus denen seine Knie hervorkamen, er sah auf seine Hosen und auf ihre Farbe, sie hatten jetzt eine Farbe, man konnte sehen, dass sie gelb waren mit einem breiten schwarzen Streifen. Aber es gibt nicht viele Dörfer an diesen steilen Hängen, auf diesem Land, das karg ist und zu abschüssig und das noch dazu die Sturzbäche von der Höhe des Bergzugs herab mit ihren Schluchten zerschneiden. Er kannte hier alle Wege, alle Verstecke; er kannte jedes einzelne Haus, jeden Heustock; alle Böden, bewohnt oder nicht bewohnt, bebaut oder nicht bebaut. Und er war ja auch nicht mehr weit vom Ziel.
Noch einmal kommt er zu einem Tobel; nur dem Weg weicht er noch aus, der es auf einer Brücke überquerte. Er hält sich bergwärts, klettert eine Halde empor, die eine Hecke nach oben abschloss; er geht bis an die Hecke heran.
Hundert Meter weiter vorn stand ein Haus.
Die Sonne traf jetzt das Dach, die Schieferplatten glänzten in ihrem Licht.
Und nun dringt auch ein schwacher blauer Rauch aus der Öffnung des Kamins, dessen Deckel offen steht, steigt fröhlich in die vergoldete Luft; und ein Laufhund lag vor der Tür an einer viel zu schweren Kette.
Hinter der Hecke hervor pfeift Farinet dreimal durch die Finger. Er pfeift auf eine bestimmte Art, dreimal, hinter seiner Hecke, und der Mann, der unter der Haustür erschienen war, stellt seinen hölzernen Eimer auf einmal hin und dreht den Kopf in die Richtung, aus der die Pfiffe gekommen waren, und geht dann in dieser Richtung; der Hund wollte ihm folgen und winselte, er hieß ihn schweigen.
III
Ein paar Monate vorher waren die Zeitungen des Landes voll gewesen von ihm und von seiner Geschichte (übrigens gab es nur zwei oder drei, und sie erschienen nur einmal in der Woche).
Das war gewesen, als man ihn wegen der Herstellung von falschem Geld vor Gericht gestellt hatte.
Man hatte in den Zeitungen sein Geburtsdatum mitgeteilt; er war achtundzwanzig. Er war in Bourg-Saint-Pierre geboren, einem Dorf, das hinten in einem der Täler liegt, welche linker Hand von der Rhone abzweigen und sich nach Süden hin tief in den Berg eingraben. Er war der Älteste, er hatte zwei Brüder und zwei Schwestern. In den Zeitungen wurde erzählt, dass sein Vater ihn, als er noch klein war, kaum vierzehn Jahre alt, mit in die Berge nahm; er war weit herum als Schmuggler bekannt (die Grenze war dort ganz nahe). Dem kleinen Maurice wurde ein Sack aufgeladen, während der Vater einen Tragkorb voll Tabak auf dem Rücken trug. So war Maurice Farinet, wie man nun sagte, dazu abgerichtet worden, die Gesetze und die Regierung beizeiten zu verhöhnen; schon mit sechzehn, hieß es, hatte er sein eigenes Gewehr. Und er machte Gebrauch davon, ohne Patent. Denn der Vater betrieb nicht nur Schmuggel. Er sagte: «Mit welchem Recht kann die Regierung uns zwingen, dafür zu zahlen, dass wir Tiere totschießen, die auf Gemeindegebiet sind und darum uns gehören?» Es kam vor, dass er ein wenig zu viel trank, wenn er von seinen Expeditionen zurückkam, in einem der Cafés, die am Weg lagen; dann saß er vor einem Liter Fendant, voll von der Kraft, die im Wein ist: «Mit welchem Recht? Darum habe ich jedenfalls nie bezahlt …» Zu seinem Sohn sagte er: «Du bezahlst mir auch nichts … Nie … Schwör mir’s.» Und Maurice schwor es gern, denn er war derselben Meinung wie sein Vater.
Nur dass man dann zwei oder drei Jahre später Farinet, den Vater, in der Gegend der Tour Penchée am Fuß einer Felswand gefunden hatte. Er war mit Blut bedeckt, Schädel und Körper zerschmettert von einem Sturz über mehr als hundert Meter. Man hat nie herausgebracht, ob einer ihn dort abgeschossen hatte (denn Feinde hatte er) oder ob er nicht einfach ausgeglitten war im Gestein, trotz seinem scharfen Auge und seinem sicheren Fuß und obwohl er wie keiner sonst alle Berge der Umgegend bis in die hintersten Winkel kannte. Er war jenes Mal allein ausgezogen, und Männer, die etwas weiter unten im Wald arbeiteten, sagten später, sie hätten im Laufe des Tages mehrere Schüsse gehört, aber vielleicht hatte er selber sie abgegeben. Man hat es nie herausgebracht. Er hinterließ jedenfalls eine Frau und fünf Kinder.
So hatte Maurice, der Älteste, sein Leben selber verdienen müssen.
Er ließ sich als Saisonarbeiter dingen. Im Winter ging er als Holzfäller in den Wald; im Herbst half er im Tal unten bei der Weinlese. Viele Männer kommen dann für einen oder zwei Monate aus den Bergen herab und sind Kelterer oder Brententräger, das bringt ihnen ein wenig Geld ein. So war Maurice, als er gegen zwanzig ging, von einem Mann in Dienst genommen worden, der Romailler hieß und einer der vier Gemeinderäte von Mièges war.
Das wurde in den Zeitungen unter anderem mitgeteilt; nicht mitgeteilt wurde, aus welchen Gründen er nach der Weinlese nicht mehr nach Hause zurückgekehrt war (und er war nie mehr zurückgekehrt). Sein Vater hatte kein Geld hinterlassen und geringen Besitz, mit dem seine Mutter und die andern vier Kinder sich durchschlagen mussten; und dort oben fehlte es bald an Arbeit und bald an Geld. Seine Brüder waren groß geworden, man brauchte ihn nicht mehr. In Mièges hatte er inzwischen Sage kennen gelernt, einen alten Mann, der in den Bergen alle möglichen Kräuter und Pflanzen sammelte und sie an die Apotheker verkaufte. Der alte Sage war über siebzig; er brauchte einen Gehilfen.
Vater Sage wohnte in einem kleinen Haus, das auf dem Grund der alten Stadtmauer, etwas außerhalb des Ortes, stand; er lebte seit langem allein, denn er galt so ein wenig als Wasserfinder und Hexenmeister, und neben seinen Pflanzen suchte er Gold. Man behauptete sogar, er habe welches gefunden. Anscheinend gab es auf der Höhe des Gebirgszuges nördlich über Mièges, auf über 2500 Metern, eine Ader, die der alte Sage entdeckt hatte; und die hatte er Farinet schließlich gezeigt. Die Zeit verging; der alte Sage hatte keine Kinder, keine Familie, er sagte sich: «Er kann mein Sohn sein. Ich vermache ihm mein Haus und zeige ihm, wo ich mein Pulver finde.» Und Farinet begann nun auch, sich Pulver zu holen. Nur begnügte sich der alte Sage damit, sein Gold zu horten, viele kleine Scheiben und gelbe Kiesel, so wie sie waren, in ein Kästchen einzuschließen, Farinet war anschlägiger, er verfiel darauf, eine Gipsform zu basteln und ein Lötrohr zu kaufen. Und als der Alte gestorben war, hatte er angefangen, seine Stücke in Umlauf zu setzen. Es gab ganz in der Nähe, in der Schlucht der Salenche, eine schöne trockene Höhle, die mit dem Keller des Hauses in Verbindung stand; dort hatte er seine Werkstatt eingerichtet, um vor Überraschungen sicher zu sein. Er war beliebt bei den Leuten, weil sie seinem Gold trauten und weil er freigebig war.
Nur hatte er einmal zu seinem Unglück die Grenze überschritten, als er viele Münzen abzusetzen hatte; weil sie einen ziemlich großen Betrag ausmachten, hatte er zu seinem Unglück gemeint, er würde sie in Aosta leichter umwechseln können, auf italienischem Boden, jenseits des Großen Sankt Bernhards.
In Aosta hatten sie ihn erwischt.
Die Polizei hatte keine Nachsicht gezeigt, der Richter erst recht nicht. Er war zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt worden: Mehr als zwei davon hatte er abgesessen, bevor er entweichen konnte.