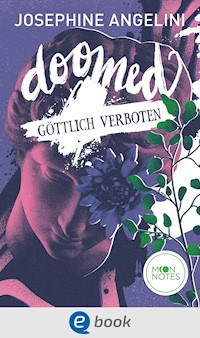9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Zwei Herzen, zerrissen zwischen zwei Welten. Die Göttlich-Saga entwickelt sich dramatisch, und Helens Schicksal gleicht einer antiken Tragödie. Verdammt zu einer Liebe, die nicht sein darf, und hin und her gerissen zwischen Fluch und Gefühlen, zwischen Highschool und Unterwelt, muss Helen gleich zweifach durch die Hölle gehen. Nachts schlägt sie sich durch die Götterwelt, aber noch schlimmer quält sie tags, dass Lucas und sie sich unmöglich lieben dürfen. In der Unterwelt aber trifft Helen auf Orion, und je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen, desto näher kommen sie sich. Doch dann geschieht etwas, das ausgerechnet Orion und Lucas zum Zusammenhalt zwingt: Die vier Scion-Häuser werden vereint, ein neuer Trojanischer Krieg scheint unausweichlich … Helen und Lucas - die göttliche Fortsetzung. - Der schön gestaltete Relaunch des US-amerikanischen Megaerfolgs von Josephine Angelini. - Band 2 der Göttlich-Neuauflage im hippen Look: für noch mehr Style in deinem Bücherregal. - Romantasy verknüpft mit griechischer Mythologie und einer Liebe zwischen Todfeinden. - Freue dich schon jetzt auf Band 3 Unleashed. Göttlich verliebt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch
IN DER UNTERWELT IST DIE ZEIT FÜR IMMER.
Helen muss die Hölle gleich zweifach durchstehen: Nachts schlägt sie sich durch die Unterwelt, noch schlimmer quält sie tags, dass Lucas und sie sich unmöglich lieben dürfen. In der Unterwelt trifft Helen auf Orion. Je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen, umso näher kommen sie sich.Dann geschieht etwas völlig Unerwartetes, das ausgerechnet Orion und Lucas zum Zusammenhalten zwingt: Die vier Häuser Scion werden vereint und ein neuer Trojanischer Krieg scheint unausweichlich!Eine packende Saga um eine Liebe, die nicht sein darf.
Für meinen Mann mit all meiner Liebe
Prolog
Am Montag fiel die Schule aus. Teile der Insel waren immer noch ohne Strom und im Ortskern waren einige Straßen wegen der Sturmschäden unpassierbar.
Ja, klar doch, dachte Zach, als er das Haus verließ. Es war der »Sturm«, der die halbe Stadt demoliert hat, nicht diese Familie von Freaks, die so schnell rennen, dass sie sogar Autos überholen.
Nur um von seinem Dad wegzukommen, joggte er ein paar Blocks. Es war ihm unheimlich auf die Nerven gegangen, sich immer wieder anhören zu müssen, wie sich sein Vater darüber beschwerte, dass die Mannschaft das Footballtraining verpasste, obwohl es ihn doch eigentlich nur ärgerte, dass er einen Tag ohne seine drei Starspieler verbringen musste – die unglaublichen Delos-Jungs.
Zach ging die India Street hinunter, um sich wie Dutzende anderer Gaffer die zerstörten Stufen des Athenäums anzusehen. Es hieß, dass es in der vergangenen Nacht einen Kurzschluss in einer elektrischen Leitung gegeben habe, die dann gerissen und so heiß geworden sei, dass der Asphalt geschmolzen sei. Zach sah das Loch im Boden und auch die gerissene Stromleitung, aber er wusste, dass die Leitung dies unmöglich verursacht haben konnte.
Genauso sicher wusste er, dass das durchgebrannte Leuchtschild über der Tür des Mädchenumkleideraums nicht drei Meter entfernt einen riesigen Brandfleck ins Gras geschmort haben konnte.
Warum kapierten das die anderen nicht? Waren sie so von den Delos-Kids geblendet, dass sie bereitwillig übersahen, dass die Marmorstufen der Bibliothek ganz bestimmt nicht vom Wind zerbrochen waren? Sahen die denn nicht, dass mehr dahintersteckte? Für Zach lag das klar auf der Hand. Er hatte versucht, Helen zu warnen, aber sie war zu sehr in Lucas verknallt, um zu erkennen, was los war. Zach wusste zwar, dass sie ihnen auf eine gewisse Weise ähnlich war, aber er hatte es trotzdem versucht. Leider galt für sie dasselbe wie für den Rest der Insel – und seinen Dad. Sie alle waren von dieser Familie geblendet.
Zach wanderte durch die Stadt und starrte gereizt die Dummköpfe an, die der geschmolzene Asphalt total aus dem Häuschen brachte, bis Matt ihn entdeckte und zu sich winkte.
»Ist das nicht irre?«, sagte Matt, als Zach zu ihm ans Polizeiabsperrband trat. »Es heißt, dass das die Starkstromleitung gewesen ist, die auf die Insel führt. Echt unglaublich, was?«
»Wow. Ein Loch. Wie unglaublich«, höhnte Zach sarkastisch.
»Findest du das nicht interessant?«, fragte Matt und hob eine Braue.
»Ich glaube nur nicht, dass eine Stromleitung so was verursacht.«
»Was soll es denn sonst gewesen sein?«, fragte Matt auf seine gewohnt analytische Art und deutete auf die Zerstörungen, die sich vor ihnen ausbreiteten.
Zach lächelte ein wenig. Matt war klüger, als die meisten Leute ahnten. Er sah gut aus, trug die richtigen Klamotten, war Kapitän des Golfteams und stammte aus einer alten und angesehenen Familie. Außerdem besaß er die Begabung, auch mit den angesagten Leuten reden zu können, und das sogar über interessante Dinge wie etwa Sport. Zach vermutete sogar, dass Matt zu den beliebtesten Schülern gehören könnte, wenn er nur wollte, aber aus irgendeinem Grund hatte Matt seinen Platz im »Ich-bin-cool-Team« aufgegeben und sich stattdessen zum Oberstreber gewandelt. Das musste etwas mit Helen zu tun haben.
Zach hatte immer noch nicht herausgefunden, wieso Helen mit den Strebern abhing, obwohl sie hübscher war als jeder Filmstar und jedes Supermodel, das er je gesehen hatte. Die Tatsache, dass sie trotzdem das Mauerblümchen spielte, war ein weiterer Teil des Geheimnisses, das sie umgab, und steigerte außerdem ihre Attraktivität. Sie war die Art Frau, für die Männer alles taten. Zum Beispiel, ihren gesellschaftlichen Status aufgeben, stehlen oder sogar kämpfen …
»Ich war nicht dabei«, beantwortete Zach endlich Matts Frage. »Aber für mich sieht es so aus, als hätte das jemand mit Absicht gemacht. Als wäre derjenige überzeugt, nie erwischt zu werden.«
»Du glaubst wirklich, jemand hat … was? Die Bücherei in Schutt und Asche gelegt, ein Starkstromkabel mit bloßen Händen durchgerissen und damit ein eins zwanzig tiefes Loch in den Asphalt gebrannt … und das alles nur aus Jux?«, fragte Matt ihn gelassen. Er verengte die Augen und bedachte Zach mit einem leicht amüsierten Lächeln.
»Keine Ahnung«, musste Zach zugeben. Dann kam ihm ein Gedanke. »Aber vielleicht weißt du es. Schließlich hängst du in letzter Zeit dauernd mit Ariadne ab.«
»Ja, und?«, konterte Matt ruhig. »Was hat das damit zu tun?«
Wusste Matt, was Sache war? Hatten die Delos-Kids Matt eingeweiht, während sie ihn im Dunkeln ließen? Zach musterte Matt einen Moment lang, kam dann aber zu dem Schluss, dass Matt sich einfach nur für diese Delos-Familie einsetzte, wie es auch jeder andere tat, sobald Zach auch nur andeutete, wie merkwürdig diese Sippe war.
»Wer sagt, dass es etwas damit zu tun hat? Ich meine doch nur, dass ich noch nie ein gerissenes Starkstromkabel gesehen habe. Du etwa?«
»Dann sind also die Polizei und die Typen vom Wasser- und Elektrizitätswerk und alle anderen, die für die Bewältigung von Naturkatastrophen ausgebildet sind, auf dem Holzweg, und du hast recht?«
So wie Matt es hinstellte, kam sich Zach fast ein bisschen albern vor. Er konnte schließlich nicht behaupten, dass eine Familie von Supermännern dabei war, die Insel zu übernehmen. Das würde sich total verrückt anhören. Also heuchelte Zach Desinteresse, sah über die Straße auf die demolierten Stufen des Athenäums und zuckte mit den Schultern.
Dabei fiel ihm jemand auf, eine besondere Person wie Helen – und wie diese verdammten Delos-Kids. Nur, dass dieser Typ anders war. Er hatte etwas Nichtmenschliches an sich. Wenn er sich bewegte, musste man unwillkürlich an ein Insekt denken.
»Wie auch immer. Im Grunde ist es mir egal, was hier passiert ist«, behauptete Zach und gab sich gelangweilt. »Noch viel Spaß beim Reinstarren in das Loch.«
Er setzte sich in Bewegung, denn er wollte nicht noch mehr Zeit mit jemandem verschwenden, der so eindeutig auf der Seite der Delos war. Er wollte wissen, wo dieser Freak hinging, und vielleicht auch herausfinden, was sie alle vor ihm verbargen.
Er folgte dem Fremden bis zu einer traumhaften Jacht im Hafen. Sie sah aus wie aus einem Märchen. Hohe Masten, Deck aus Teakholz, Fiberglasrumpf und rote Segel. Zach ging mit offenem Mund darauf zu. Diese Jacht war das Schönste, das er je gesehen hatte, mit Ausnahme eines Gesichts … ihres Gesichts.
Zach spürte, wie ihm jemand auf die Schulter tippte, und als er sich umdrehte, wurde die Welt um ihn herum dunkel.
1
Blut quoll unter Helens zerrissenen Fingernägeln hervor, sammelte sich an ihrer Nagelhaut und floss von dort in kleinen Rinnsalen über ihre Fingerknöchel. Trotz ihrer Schmerzen umklammerte sie den Vorsprung mit der linken Hand noch fester, damit sie die rechte an der Kante vorwärtsschieben konnte. Sand und Blut drohten ihre Fingerspitzen abrutschen zu lassen, und ihre Hände waren mittlerweile schmerzhaft verkrampft. Sie krallte sich mit der rechten Hand fest, hatte aber nicht mehr die Kraft, sich noch ein Stück weiter zu ziehen.
Mit einem Keuchen rutschte Helen wieder zurück und hing nur noch mit einer Hand am Sims. Das Beet mit den toten Blumen sechs Stockwerke unter ihr war mit moosigen Ziegelsteinen und Dachschindeln übersät, die von der baufälligen Villa abgestürzt und unten zerschellt waren. Auch ohne hinunterzusehen, wusste sie, was ihr passieren würde, wenn sie an diesem bröckelnden Fenstersims den Halt verlor. Noch einmal versuchte sie, ein Bein aufs Sims hochzuschwingen, aber je mehr sie strampelte, desto unsicherer wurde ihr Griff.
Ein Schluchzer entrang sich ihren aufgebissenen Lippen. Sie hing nun schon an diesem Sims, seit sie in dieser Nacht in die Unterwelt hinabgestiegen war. Es kam ihr vor, als wären seitdem Stunden vergangen, vielleicht sogar Tage, und sie war mit ihrer Kraft am Ende. Helen schrie frustriert auf. Sie musste von dieser Kante herunter und die Furien finden. Sie war der Deszender und dies war ihre Aufgabe. Die Furien in der Unterwelt aufspüren, sie irgendwie besiegen und die Scions von ihrem Einfluss befreien. Eigentlich sollte sie diesen Kreislauf der Rache beenden, der die Scions zwang, einander zu töten, und was tat sie stattdessen? Sie hing an diesem blöden Fenstersims.
Sie wollte nicht abstürzen, aber ihr war auch klar, dass sie die Furien nie finden würde, wenn sie sich noch eine Ewigkeit an dieses Sims klammerte. Und in der Unterwelt dauerte jede Nacht eine Ewigkeit. Sie musste diese Nacht beenden und dann in einer neuen Ewigkeit einen weiteren, hoffentlich erfolgreicheren Versuch starten. Und wenn sie es nicht schaffte, sich hochzuziehen, blieb nur ein Ausweg.
Die Finger von Helens linker Hand zuckten und begannen abzurutschen. Sie versuchte, sich einzureden, dass es besser war, nicht dagegen anzukämpfen, sondern sich einfach fallen zu lassen, denn dann wäre es wenigstens vorbei. Trotzdem mobilisierte sie alle Kraftreserven ihrer rechten Hand, um sich festzuklammern. Helen hatte zu viel Angst loszulassen. Vor Anstrengung biss sie sich auf die ohnehin schon blutige Lippe, aber die Finger ihrer rechten Hand glitten unaufhaltsam ab. Sie konnte sich nicht mehr halten.
Als sie auf dem Boden aufschlug, hörte sie, wie ihr linkes Bein brach.
Helen presste sich hastig die Hand auf den Mund, um in ihrem stillen Zimmer auf Nantucket nicht loszuschreien. Sie schmeckte den groben Staub der Unterwelt an ihren verkrampften Fingern. Im matten blaugrauen Licht der einsetzenden Morgendämmerung lauschte sie, wie ihr Vater aufstand. Zum Glück schien er nichts mitbekommen zu haben und ging schließlich nach unten, um das Frühstück vorzubereiten wie sonst auch.
Helen blieb im Bett, zitterte wegen des gebrochenen Beins und der gezerrten Muskeln und wartete darauf, dass sich ihr Körper selbst heilte. Tränen rannen ihr übers Gesicht und hinterließen heiße Spuren auf ihrer kalten Haut. Es war eiskalt in ihrem Zimmer.
Aus Erfahrung wusste Helen, dass sie etwas essen musste, um die Heilung abzuschließen, aber mit einem gebrochenen Bein konnte sie nicht nach unten gehen. Also zwang sie sich, ruhig liegen zu bleiben und zu warten. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie sich wieder bewegen, aufstehen und hinuntergehen konnte. Bis es so weit war, würde sie liegen bleiben und behaupten, sie hätte verschlafen. Sie würde ihr verletztes Bein vor ihrem Vater verstecken, so gut es ging, und beim Frühstück lächeln und mit ihm plaudern wie gewohnt. Und sobald sie etwas gegessen hatte, würden ihre Verletzungen vollends heilen.
Es würde ihr schon bald besser gehen, versicherte sie sich selbst und weinte so leise sie konnte. Sie musste nur durchhalten.
Jemand wedelte Helen mit der Hand vor der Nase herum.
»Was?«, fragte sie erschrocken. Sie sah sich zu Matt um, der ihr mit diesem Zeichen bedeutete, wieder auf die Erde zurückzukehren.
»Tut mir leid, Lennie, aber ich kapier das immer noch nicht. Was ist ein Rogue-Scion?«, fragte er mit gerunzelter Stirn.
»Ich bin ein Rogue«, antwortete sie, ein wenig zu laut. Sie war einen Moment lang in ihre eigenen Gedanken vertieft gewesen und hatte noch nicht wieder in die Unterhaltung zurückgefunden.
Helen setzte sich aufrechter hin, sah sich um und musste feststellen, dass alle anderen sie anstarrten. Mit Ausnahme von Lucas. Er betrachtete die Hände in seinem Schoß und seine Lippen waren fest zusammengepresst.
Helen, Lucas, Ariadne und Jason saßen nach der Schule am Küchentisch der Delos und versuchten, Matt und Claire alles zu erklären, was sie über Halbgötter wissen mussten. Die beiden waren Helens beste Freunde, und obwohl beide kluge Köpfe waren, gab es in Helens Vergangenheit doch vieles, das sie nicht wussten. Und nach allem, was Matt und Claire für sie getan hatten, verdienten sie Antworten. Immerhin hatten sie vor sieben Tagen ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um Helen und der Familie Delos zu helfen.
Sieben Tage erst, dachte Helen und zählte sie an den Fingern ab, um sich zu vergewissern, dass es stimmte. Nach dieser ganzen Zeit in der Unterwelt kommt es mir eher vor wie sieben Wochen.
»Es klingt kompliziert, aber das ist es eigentlich nicht«, sagte Ariadne, als klar wurde, dass Helen nicht weitersprechen würde. »Es gibt vier Häuser und diese vier Häuser sind seit dem Trojanischen Krieg verfeindet. Deswegen stacheln uns die Furien an, jemanden von einem anderen Haus zu töten. Es geht dabei um Blutrache.«
»Vor einer Million Jahren hat jemand aus dem Haus von Atreus jemand aus dem Haus von Theben umgebracht, und man erwartet von euch, dass ihr diese Blutschuld bezahlt?«, fragte Matt voller Zweifel.
»So ungefähr. Allerdings war es viel mehr als nur ein Toter. Du darfst nicht vergessen, dass wir hier vom Trojanischen Krieg reden. Da sind viele Leute gestorben, sowohl Halbgott-Scions als auch Normalsterbliche wie du«, erklärte Ariadne mit einem entschuldigenden Grinsen.
»Ich weiß, dass der Krieg eine Menge Leben gekostet hat, aber was bringt euch diese Blut-für-Blut-Geschichte eigentlich?«, hakte Matt nach. »Das endet doch nie. Das ist doch Irrsinn.«
Lucas lachte humorlos, schaute von seinem Schoß auf und sah Matt in die Augen. »Du hast recht. Die Furien treiben uns in den Wahnsinn, Matt«, sagte er ruhig und geduldig. »Sie verfolgen uns, bis wir daran zerbrechen.«
Helen kannte diesen Tonfall. Sie nannte ihn insgeheim Lucas’ Professorenstimme. Wenn er so dozierte, hätte sie ihm den ganzen Tag zuhören können, auch wenn sie inzwischen wusste, dass dieses Verlangen falsch war.
»Sie bringen uns dazu, dass wir einander umbringen wollen, um einer verdrehten Form von Gerechtigkeit Genüge zu tun«, fuhr Lucas im selben gemessenen Ton fort. »Einer ermordet jemanden aus unserem Haus, wir revanchieren uns mit dem Mord an einem seiner Angehörigen, und so geht das nun schon seit dreieinhalbtausend Jahren. Und wenn ein Scion jemanden aus seinem eigenen Haus umbringt, wird er zum Ausgestoßenen.«
»Wie Hector«, bemerkte Matt zögerlich. Den Namen ihres Bruders und Cousins laut auszusprechen, ließ den Fluch der Furien sofort wieder aufflammen und brachte den Delos-Clan in Rage. Matt hatte es nur gewagt, um ganz sicherzugehen. »Er hat euren Cousin Kreon getötet, weil Kreon eure Tante Pandora umgebracht hat, und jetzt verspürt ihr den unwiderstehlichen Drang, ihn zu töten, obwohl ihr ihn immer noch liebt. Also für mich hat das nicht das Geringste mit Gerechtigkeit zu tun.«
Helen sah sich um und stellte fest, dass Ariadne, Jason und Lucas mit den Zähnen knirschten. Jason war der Erste, der sich wieder in den Griff bekam.
»Deswegen ist das, was Helen tut, so wichtig«, erklärte er. »Sie geht in die Unterwelt, um die Furien zu besiegen und dieses sinnlose Töten zu beenden.«
Matt hätte gern noch weitere Fragen gestellt. Er verstand die Sache mit den Furien immer noch nicht recht, aber er merkte natürlich, dass dieses Thema alle anderen am Tisch sehr belastete. Claire wollte aber noch einige Punkte geklärt wissen.
»Okay. Das ist dann also ein Ausgestoßener. Aber Rogues wie Lennie sind Scions, deren Eltern aus verschiedenen Häusern stammen, aber nur ein Haus kann sie für sich beanspruchen, richtig? Das bedeutet, dass sie dem anderen Haus gegenüber immer noch diese Blutschuld haben?« Claire versuchte, sich möglichst vorsichtig auszudrücken, weil sie wusste, wie schwer das für Helen war, aber sie musste es aussprechen. »Du wurdest von deiner Mutter Daphne beansprucht. Oder vielmehr von ihrem Haus.«
»Dem Haus von Atreus«, bestätigte Helen deprimiert und musste wieder daran denken, wie ihre lange verschollene Mutter vor neun Tagen wiederaufgetaucht war und ihr mit einer sehr unerfreulichen Neuigkeit das Leben ruiniert hatte.
»Und dein richtiger Vater – nicht Jerry, obwohl ich gestehen muss, Lennie, dass Jerry für mich immer dein richtiger Dad sein wird«, verkündete Claire entschieden, bevor sie zum Thema zurückkam. »Dein biologischer Vater, den du nie kennengelernt hast und der vor deiner Geburt starb …«
»Gehörte zum Haus von Theben.« Einen Moment lang trafen sich die Blicke von Helen und Lucas, doch dann wendete sie schnell die Augen ab. »Ajax Delos.«
»Unser Onkel«, fügte Jason hinzu und schloss Ariadne und Lucas in seinen Blick ein.
»Richtig«, bestätigte Claire unbehaglich. Sie schaute von Helen zu Lucas, doch beide wichen ihr aus. »Und da ihr beide zu verfeindeten Häusern gehört, wolltet ihr euch anfangs gegenseitig umbringen. Bis ihr …« Sie verstummte.
»Bis Helen und ich die Blutschuld zwischen unseren Häusern damit beglichen haben, dass wir beinahe füreinander gestorben sind«, beendete Lucas ihren Satz mit bleierner Stimme und schien damit alle zu warnen, bloß nicht nach der besonderen Beziehung zwischen ihm und Helen zu fragen.
Helen hätte sich am liebsten ein Loch in den Fliesenboden der Küche gegraben und wäre darin verschwunden. Sie spürte, wie die unausgesprochenen Fragen der anderen auf ihr lasteten.
Sie fragten sich, wie weit Helen und Lucas gegangen waren, bevor sie von ihrer Verwandtschaft erfahren hatten. Waren es wirklich nur Küsse gewesen oder sehr viel mehr?
Und: Wollen sie es immer noch tun, obwohl sie jetzt wissen, dass sie Cousin und Cousine sind?
Und: Tun sie es vielleicht immer noch? Es wäre kein Problem für sie, weil sie ja beide fliegen können. Vielleicht schleichen sie sich jede Nacht raus und …
»Helen? Wir müssen zurück an die Arbeit«, sagte Cassandra, und der Befehlston in ihrer Stimme war nicht zu überhören. Sie war an der Küchentür aufgetaucht und stemmte eine Faust in ihre jungenhaft schmale Hüfte.
Als Helen vom Küchentisch aufstand, erhaschte Lucas ihren Blick und schenkte ihr ein winziges, aufmunterndes Lächeln. Helen erwiderte es kaum wahrnehmbar, und als sie Cassandra in die Bibliothek der Delos folgte, fühlte sie sich schon bedeutend ruhiger und selbstsicherer. Cassandra schloss die Tür, und die beiden Mädchen machten sich erneut auf die Suche nach irgendetwas, das Helen ihre Mission erleichtern würde.
Helen kam um die Ecke und musste feststellen, dass ihr ein Regenbogen aus Rost den Weg versperrte. Ein Wolkenkratzer war so über die Straße gebogen, als hätte ihn eine Riesenhand geknickt wie einen Getreidehalm.
Helen wischte sich den juckenden Schweiß von der Stirn und suchte nach dem sichersten Weg über den rissigen Beton und den umgestürzten Stahl. Es würde schwierig werden hinüberzuklettern, aber auch alle anderen Gebäude dieser verlassenen Stadt zerfielen unter dem gnadenlosen Heranrücken der sie umgebenden Wüste. Es war sinnlos, es woanders zu versuchen. Alle Straßen waren mit irgendwelchem Schutt versperrt, und außerdem wusste Helen ohnehin nicht, in welche Richtung sie sollte. Ihr blieb nichts anderes übrig, als weiter voranzugehen.
Mit dem beißenden Geruch von rostendem Metall in der Nase stieg sie über ein scharfkantiges Gitter. Plötzlich ertönte ein tiefes, fast klagendes Ächzen. Ein Bolzen sprang heraus und über ihr löste sich ein Eisenteil. Rost und Sand rieselten auf sie herab. Instinktiv riss Helen die Hände hoch, um sich zu schützen, aber hier in der Unterwelt hatte sie keine Scion-Kräfte. Sie landete schmerzhaft auf dem Rücken, langausgestreckt unter dem schweren Eisenteil. Es lag auf ihrem Bauch und sie konnte sich nicht rühren.
Helen versuchte, sich darunter herauszuwinden, aber sie hatte solche grauenhaften Schmerzen im Becken, dass sie die Beine nicht bewegen konnte. Es war eindeutig etwas gebrochen – das Becken, die Wirbelsäule, vielleicht auch beides.
Helen kniff die Augen zusammen und schützte sie mit einer Hand vor der Helligkeit. Sie schluckte gegen ihren Durst an. Sie saß in der Falle wie eine Schildkröte auf dem Rücken. Am Himmel stand keine einzige Wolke, die ihr etwas Erleichterung verschaffte.
Es gab nur diese gleißende Helligkeit und die unbarmherzige Hitze …
Helen trottete aus Miss Bees Sozialkundeunterricht und unterdrückte ein Gähnen. Ihr Kopf fühlte sich so ausgestopft und heiß an wie ein Thanksgiving-Truthahn in der Röhre. Der Schultag neigte sich dem Ende zu, aber das war kein Trost. Helen sah hinunter auf ihre Füße und musste daran denken, was sie erwartete. Sie stieg jede Nacht in die Unterwelt hinab und landete in einer grässlichen Landschaft nach der anderen. Sie hatte keine Ahnung, wieso sie an manchen Orten mehrmals war und an anderen nur einmal, aber sie vermutete, dass es etwas mit ihrer Stimmung zu tun hatte. Je missgelaunter sie beim Einschlafen war, desto schlimmer war ihr Erlebnis in der Unterwelt.
Helen, die sich immer noch auf ihre Füße konzentrierte, spürte plötzlich, wie jemand auf dem vollen Schulflur ihre Finger streifte. Sie schaute auf und direkt in Lucas’ juwelenblaue Augen. Da atmete sie scharf ein, ähnlich einem kurzen Seufzer der Überraschung, und konnte den Blick nicht von ihm abwenden.
Lucas sah sie sanft und ein wenig neckisch an und sein Mund verzog sich zum Anflug eines geheimen Lächelns. Da sie sich immer noch in verschiedene Richtungen bewegten, drehten beide beim Gehen den Kopf, um den Augenkontakt nicht zu verlieren. Ihr identisches Lächeln wurde mit jedem Moment, der verging, deutlicher. Helen warf verspielt ihre Haare zurück, beendete damit den kurzen Flirt und setzte ihren Weg mit einem breiten Grinsen im Gesicht fort.
Ein Blick von Lucas, und sie fühlte sich stärker. Wieder lebendig. Sie konnte ihn beim Weggehen leise lachen hören, sehr zufrieden, als wüsste er genau, welche Wirkung er auf sie hatte. Auch Helen musste kichern und schüttelte über sich selbst den Kopf. Und dann fiel ihr Blick auf Jason.
Er und Claire waren ein paar Schritte hinter Lucas gegangen und er hatte alles beobachtet. Seine Lippen waren sorgenvoll verkniffen und sein Blick wirkte traurig. Er bedachte Helen mit einem missbilligenden Kopfschütteln. Sie starrte schnell wieder auf den Boden und wurde knallrot.
Sie waren verwandt, das wusste Helen. Es war falsch, mit ihm zu flirten. Aber sie fühlte sich besser, wenn sie es tat – was sonst nichts anderes vermochte. Sollte sie das alles durchstehen und dann auch noch auf Lucas’ tröstendes Lächeln verzichten? Helen ging zu ihrer letzten Schulstunde, setzte sich an den Tisch und kämpfte beim Auspacken ihrer Hefte mit den Tränen.
Lange Splitter umgaben Helen und zwangen sie, ganz stillzuhalten, um nicht von einem von ihnen aufgespießt zu werden. Sie war im Stamm des einzigen Baumes gefangen, der in diesem trockenen, dürren Buschland wuchs. Wenn sie zu tief einatmete, stachen ihr die Splitter in die Haut. Ihre Arme waren hinter ihrem Rücken eingeklemmt und die Beine so schmerzhaft verdreht, dass ihr Oberkörper vornüberhing. Ein langer Holzsplitter war direkt auf ihr rechtes Auge gerichtet. Wenn sie bei dem Versuch, sich zu befreien, den Kopf nach vorn bewegte – oder auch nur vor Erschöpfung ein wenig zusammensackte –, würde sie sich das Auge ausstechen.
»Was soll ich denn tun?«, fragte sie niemand Bestimmten wimmernd. Helen wusste, dass sie auf sich allein gestellt war.
»Was soll ich denn tun?«, schrie sie plötzlich, und an Brust und Rücken brannte ein Dutzend kleiner Stichwunden.
Das Schreien half nicht, aber das Wütendwerden schon. Es half ihr, sich auf das Unvermeidliche vorzubereiten. Sie hatte sich selbst in diese Lage gebracht, natürlich unabsichtlich, und sie wusste, wie sie wieder herauskam. Normalerweise befreiten Schmerzen sie aus der Unterwelt. Sofern sie nicht starb, war Helen ziemlich sicher, dass sie die Unterwelt verlassen und in ihrem Bett aufwachen würde. Sie würde verletzt sein und Schmerzen haben, aber sie wäre zumindest wieder draußen.
Sie starrte den langen Splitter vor ihrem Auge an und wusste, was sie zu tun hatte. Allerdings wusste sie nicht, ob sie dazu fähig war. Als die Wut, die sie angefeuert hatte, wieder nachließ, weinte sie verzweifelte Tränen, die ihr über die Wangen liefen. Sie hörte ihre eigenen, halb erstickten Schluchzer in dem engen Baumstamm-Gefängnis. Minuten vergingen und Helens Arme und Beine verkrampften sich in ihrer unnatürlichen Haltung.
Die Zeit würde nichts an der Situation ändern. Tränen würden nichts an der Situation ändern. Sie hatte nur eine einzige Wahl und sie konnte es entweder sofort tun oder nach weiteren qualvollen Stunden. Helen warein Scion und damit Zielscheibe der Furien. Sie hatte nie eine andere Wahl gehabt als diese eine. Und mit diesem Gedanken kam die Wut zurück.
Mit einer gezielten Bewegung ruckte sie ihren Kopf nach vorn.
Lucas konnte den Blick nicht von Helen abwenden. Sogar von der anderen Seite der Küche aus konnte er sehen, dass die dünne Haut über ihren hohen Wangenknochen so blass war, dass sie durch die darunter liegenden Adern bläulich wirkte. Er hätte schwören können, dass ihre Arme mit verblassenden Blutergüssen übersät gewesen waren, als sie am Morgen gekommen war, um mit Cassandra in der Bibliothek zu arbeiten.
Helen hatte inzwischen einen verstörten und gehetzten Ausdruck im Gesicht. Sie sah noch verängstigter aus als ein paar Wochen zuvor, als sie alle geglaubt hatten, dass Tantalus und die fanatischen Hundert Cousins hinter ihr her waren. Cassandra hatte kürzlich eine Vision gehabt, dass die Hundert zurzeit ihre ganze Energie darauf verwandten, Hector und Daphne zu finden, und dass Helen nichts zu befürchten hatte. Aber wenn es nicht die Hundert waren, die Helen so verstört hatten, musste es etwas in der Unterwelt sein. Lucas fragte sich, ob sie da unten gejagt oder vielleicht sogar gefoltert wurde.
Diese Vorstellung zerriss ihn innerlich. Es kam ihm vor, als säße in seinem Brustkorb ein wildes Tier, das sich durch die Rippen nach draußen fraß. Er musste die Zähne fest zusammenbeißen, um das gereizte Knurren zu unterdrücken, das in ihm aufstieg. Er war in letzter Zeit so wütend und das beunruhigte ihn. Aber noch schlimmer als diese ständige Gereiztheit war die Sorge um Helen.
Zusehen zu müssen, wie sie beim kleinsten Laut zusammenzuckte oder plötzlich mit großen Augen erstarrte, versetzte ihn in Panik. Es war Lucas ein körperliches Bedürfnis, Helen zu beschützen. Es fühlte sich fast wie ein Ganzkörper-Tic an, der ihm zuschrie, sich zwischen sie und die Gefahr zu werfen. Aber er konnte ihr bei dieser Sache nicht helfen. Er konnte nicht in die Unterwelt hinabsteigen, ohne vorher zu sterben.
An diesem Problem arbeitete er noch. Es gab nur wenige Personen, die in die Unterwelt gehen konnten und überlebten – in der gesamten Geschichte der griechischen Mythologie waren es höchstens eine Handvoll Leute. Aber er würde auf jeden Fall weiter nach einer Lösung suchen. Lucas war schon immer gut darin gewesen, Probleme zu lösen – vor allem vermeintlich »unlösbare«. Was vermutlich der Grund war, wieso es ihn so quälte, Helen in diesem Zustand zu sehen.
Er konnte diese Aufgabe nicht für sie bewältigen. Sie war dort unten auf sich allein gestellt, und es gab nichts, was er dagegen tun konnte.
»Sohn. Warum setzt du dich nicht zu mir?«, fragte Castor und riss Lucas damit aus seinen Gedanken. Sein Vater deutete auf den Stuhl zu seiner Rechten. Inzwischen hatte sich auch der Rest der Familie zum sonntäglichen Abendessen eingefunden.
»Das ist Cassandras Platz«, lehnte Lucas mit einem Kopfschütteln ab, obwohl er in Wirklichkeit gedacht hatte, dass es Hectors war. Lucas konnte es nicht ertragen, einen Platz einzunehmen, der nie hätte frei werden dürfen. Also setzte er sich stattdessen links von seinem Vater auf die Bank.
»Also wirklich, Dad«, scherzte Cassandra und nahm den Platz ein, den sie automatisch übernommen hatte, nachdem Hector für den Mord an Tantalus’ einzigem Sohn Kreon zum Ausgestoßenen geworden war. »Das war doch wohl kein Wink mit dem Zaunpfahl, oder?«
»Müsstest du das nicht als Erste wissen? Was für ein Orakel bist du eigentlich?«, neckte Castor sie und pikte ihr in den Bauch, bis sie quietschte.
Lucas erkannte natürlich, dass sein Vater die seltene Gelegenheit nutzte, mit Cassandra herumzualbern, weil diese Zeiten fast vorbei waren. Als Orakel entfernte sich seine kleine Schwester immer weiter von der Familie und der ganzen Menschheit. Schon bald würde sie nichts Menschliches mehr haben und nur noch das kalte Instrument der Parzen sein, und dann spielte es auch keine Rolle mehr, wie sehr ihre Familie sie liebte.
Castor ergriff jede Chance, mit seiner Tochter zu scherzen, aber diesmal merkte Lucas, dass er nicht mit ganzem Herzen dabei war. Er war mit seinen Gedanken woanders. Aus irgendeinem Grund wollte er nicht, dass Lucas sich auf seinen gewohnten Platz setzte.
Einen Augenblick später erkannte er den Grund, denn Helen setzte sich auf den Platz, der quasi durch Gewohnheitsrecht ihrer geworden war. Als sie über die Bank stieg und sich neben ihn setzte, blieb Lucas das Stirnrunzeln seines Vaters nicht verborgen.
Lucas ignorierte die Missbilligung seines Vaters und genoss es stattdessen, Helen neben sich zu spüren. Obwohl sie offensichtlich unter dem litt, was in der Unterwelt geschah, erfüllte ihre Anwesenheit Lucas mit neuer Kraft. Ihre Figur, ihr weicher Arm, der ihn manchmal streifte, wenn sie Teller herumreichten, ihre klare, helle Stimme, wenn sie sich an der Unterhaltung beteiligte – alles an Helen berührte ihn im tiefsten Innern und besänftigte das wilde Tier in seiner Brust.
Er wünschte nur, dasselbe auch für sie tun zu können. Beim Essen fragte Lucas sich wieder, was Helen wohl in der Unterwelt erlebte, aber ihm war auch klar, dass er sie erst danach fragen konnte, wenn sie allein waren. Vor der Familie konnte sie lügen, aber bei ihm war das unmöglich.
»Hey«, rief er ihr später zu und hielt sie auf dem Flur auf. Sie erstarrte kurz, aber als sie sich ihm zuwendete, wurden ihre Züge wieder weicher.
»Hey«, hauchte sie zur Antwort und trat näher an ihn heran.
»Schlimme Nacht?«
Sie nickte und rückte noch näher, bis er den Mandelduft der Seife riechen konnte, mit der sie sich gerade die Hände gewaschen hatte. Lucas vermutete, dass ihr nicht klar war, welche Anziehungskraft sie aufeinander ausübten, aber er wusste es.
»Erzähl mir davon.«
»Es ist einfach nur hart«, versuchte sie, seine Frage mit einem Schulterzucken abzutun.
»Beschreib es.«
»Da war dieser Felsen.« Sie verstummte, rieb sich die Handgelenke und schüttelte mit verkniffener Miene den Kopf. »Ich kann nicht. Ich will so wenig wie möglich daran denken. Es tut mir leid, Lucas. Ich will dich damit nicht verärgern«, sagte sie hastig, als sie sein frustriertes Gesicht bemerkte.
Er sah sie einen Moment lang an und fragte sich, wie es möglich war, dass sie seine Gefühle so falsch deutete. Er versuchte, ihr die nächste Frage möglichst ruhig zu stellen, aber sie hörte sich doch harscher an, als er beabsichtigt hatte.
»Tut dir da unten jemand weh?«
»Außer mir ist da unten niemand«, antwortete sie. Aber etwas an ihrem Tonfall verriet Lucas, dass diese Einsamkeit sogar schlimmer war als jede Art von Folter.
»Du hast dich verletzt.« Er streckte die Hand nach ihr aus und folgte mit einem Finger der Kontur der verblassten Prellungen, die er dort gesehen hatte.
Ihr Gesicht war verschlossen. »In der Unterwelt habe ich keine Superkräfte. Aber es heilt alles, wenn ich aufwache.«
»Rede mit mir«, lockte er sie aus der Reserve. »Du weißt, du kannst mir alles erzählen.«
»Ich weiß, dass ich das kann, aber wenn ich es tue, werde ich es bereuen«, stöhnte sie, allerdings mit einem Anflug von Humor. Das gab Lucas genug Hoffnung für einen weiteren Versuch, denn er wollte sie unbedingt wieder lächeln sehen.
»Was? Raus damit!«, verlangte er grinsend. »Wie schmerzhaft kann es schon sein, mit mir darüber zu reden?«
Ihr Lächeln erlosch und sie sah ihn an. Ihr Mund öffnete sich ein wenig, sodass er den glatten inneren Rand ihrer Unterlippe sehen konnte. Er erinnerte sich noch gut daran, wie es sich angefühlt hatte, sie zu küssen, und erstarrte – um sich bloß nicht über sie zu beugen und diesen süßen Geschmack noch einmal zu kosten.
»Grauenvoll schmerzhaft«, wisperte sie.
»Helen! Wie lange brauchst du, um auf die Toilette –« Cassandra verstummte abrupt, als sie Lucas den Flur hinunter verschwinden sah und Helen mit hochrotem Kopf in Richtung Bibliothek eilte.
Helen rannte durch das Zimmer mit der halb abgelösten Blumentapete und machte einen Bogen um die verrotteten Fußbodendielen rund um die feuchte, schimmelige Couch. Es kam ihr vor, als würde das Ding sie hasserfüllt anstarren, als sie daran vorbeilief. Sie war schon ein Dutzend Mal hier gewesen, vielleicht sogar öfter. Aber diesmal nahm sie weder die linke noch die rechte Tür, weil sie bereits wusste, dass sie ins Nirgendwo führten. Sie erkannte, dass sie nichts mehr zu verlieren hatte, und steuerte den Wandschrank an.
In der Ecke hing ein vermoderter alter Wollmantel. Der Kragen war mit Schuppen übersät und der Mantel roch wie ein kranker alter Mann. Er bedrängte sie, als versuchte er, sie aus seinem Reich zu vertreiben. Helen ignorierte den ekelhaften Mantel und durchsuchte den Wandschrank, bis sie eine weitere Tür in einer der Seitenwände entdeckte. Die Öffnung war gerade groß genug für ein Kleinkind. Sie ließ sich auf die Knie nieder und plötzlich gruselte sie sich furchtbar vor dem alten Mantel, der zu beobachten schien, wie sie sich bückte, als wollte er ihr in den Ausschnitt starren. Sie kroch durch die winzige Öffnung.
Der nächste Raum war ein staubiges Ankleidezimmer, in dem der Geruch von jahrhundertealten schweren Parfüms hing. Aber wenigstens gab es hier ein Fenster. Helen rannte darauf zu und hoffte, dass sie hinausspringen und sich so aus dieser schrecklichen Falle befreien konnte. Voller Hoffnung riss sie die schimmelnden Vorhänge zur Seite.
Das Fenster war zugemauert. Sie schlug mit den Fäusten auf das Mauerwerk ein, anfangs waren es nur leichte Schläge, aber mit zunehmender Wut schlug sie härter dagegen, bis ihre Fingerknöchel vollkommen zerschunden waren. In diesem Labyrinth aus Zimmern war alles vermodert und verrottet – bis auf die Ausgänge. Die waren so massiv wie in Fort Knox.
Es kam Helen vor, als würde sie bereits tagelang in diesem Haus festsitzen. Sie war mittlerweile so verzweifelt, dass sie sogar schon die Augen geschlossen hatte in der Hoffnung, einzuschlafen und in ihrem eigenen Bett wieder aufzuwachen. Es hatte nicht geklappt. Helen hatte noch nicht herausgefunden, wie sie die Unterwelt betreten und wieder verlassen konnte, ohne sich dabei jedes Mal halb umzubringen. Sie hatte Angst, dass sie diesmal wirklich sterben würde, und wollte nicht darüber nachdenken, was sie tun musste, um sich zu befreien.
Weiße Punkte tanzten vor ihren Augen und sie war nun schon mehrmals fast vor Durst und Erschöpfung in Ohnmacht gefallen. Sie hatte so lange kein Wasser mehr getrunken, dass allmählich sogar der zähflüssige Glibber, der aus den Wasserleitungen dieses Höllenlochs quoll, halbwegs appetitlich aussah.
Merkwürdig war, dass Helen in diesem Teil der Unterwelt größere Angst hatte als je zuvor, auch wenn sie hier nicht in unmittelbarer Gefahr schwebte. Sie hing nicht an einer Klippe oder war in einem Baumstamm gefangen oder mit den Handgelenken an einen Felsen gekettet, der sie bergab mitriss und in eine Schlucht zu stürzen drohte.
Sie war einfach nur in einem Haus, einem nie endenden Haus ohne Ausgänge.
Die Besuche in den Bereichen der Unterwelt, bei denen sie nicht in unmittelbarer Gefahr schwebte, dauerten gewöhnlich am längsten und entpuppten sich auf Dauer als die schlimmsten. Durst, Hunger und die quälende Einsamkeit waren die härtesten Prüfungen. Die Hölle brauchtegar kein Feuer, um ihr zuzusetzen. Die endlose Zeit und das Alleinsein reichten vollkommen aus.
Helen setzte sich unter das zugemauerte Fenster und versuchte, sich vorzustellen, wie es sein würde, den Rest ihres Lebens in einem Haus zuzubringen, in dem sie unerwünscht war.
Während des Footballtrainings fing es an zu schütten und ab dem Zeitpunkt war an ein sinnvolles Training nicht mehr zu denken. Die Spieler fanden Spaß daran, einander umzurennen und durch den Matsch zu schlittern, was dem Rasen natürlich gar nicht gut bekam. Schließlich gab Coach Brant es auf und schickte die Mannschaft nach Hause. Als sie ihre Sachen packten, beobachtete Lucas den Coach unauffällig, denn ihm war nicht verborgen geblieben, dass ihr Trainer an diesem Tag nicht mit ganzem Herzen dabei gewesen war. Sein Sohn Zach hatte die Mannschaft am Tag zuvor verlassen. Wie man hörte, hatte der Coach das persönlich genommen, und Lucas fragte sich, wie schlimm der Streit zwischen den beiden wohl gewesen war. Zach hatte an diesem Tag in der Schule gefehlt.
Lucas konnte sich vorstellen, wie Zach sich fühlte. Er wusste, wie es war, wenn der eigene Vater von einem enttäuscht war.
»Luke! Lass uns abhauen! Ich erfriere!«, brüllte Jason. Er riss schon auf dem Weg zum Umkleideraum seine Ausrüstung herunter, und Lucas musste rennen, um ihn einzuholen.
Sie fuhren ohne Umweg nach Hause und stürmten nass und hungrig in die Küche. Helen und Claire waren schon dort und natürlich auch Lucas’ Mutter. Die Mädchen trugen noch ihren durchweichten Laufdress, und während sie sich abtrockneten, sahen sie Noel erwartungsvoll an. Im ersten Moment war Helen alles, was Lucas wahrnahm. Ihre Haare waren zerzaust und auf ihren langen nackten Beinen glitzerten die Regentropfen.
Dann hörte er ein Flüstern im Ohr und blanker Hass durchfuhr ihn. Seine Mutter war am Telefon. Und die Stimme am anderen Ende gehörte Hector.
»Nein, Lucas, nicht!«, warnte Helen mit zittriger Stimme. »Noel, leg auf!«
Lucas und Jason stürmten von den Furien getrieben auf die Stimme des Ausgestoßenen zu. Helen trat vor Noel. Sie hob einfach nur die Hände, als wollte sie damit »Stopp« signalisieren, und die zwei rannten gegen sie wie gegen eine Ziegelmauer. Beide wurden so heftig zurückgeworfen, dass sie auf dem Boden landeten und nach Luft schnappten. Helen wich keinen Zentimeter zurück.
»Es tut mir so leid!«, beteuerte Helen und beugte sich besorgt über sie. »Aber ich konnte nicht zulassen, dass ihr euch auf Noel stürzt.«
»Du brauchst dich nicht zu entschuldigen«, schnaufte Lucas und rieb sich die schmerzende Brust. Er hatte nicht gewusst, dass Helen so stark war, aber er war ausgesprochen froh darüber. Seine Mutter sah zwar schockiert aus, aber ihr und Claire war nichts passiert. Und das war das Wichtigste.
»Mmhm«, machte Jason, was ausdrücken sollte, dass er derselben Meinung war wie Lucas. Claire hockte sich neben ihn und klopfte ihm mitfühlend auf die Schulter. Er setzte sich auf und versuchte, wieder zu Atem zu kommen.
»Ich habe euch beide nicht so früh erwartet«, stammelte Noel. »Er ruft immer an, wenn er weiß, dass ihr beim Training seid …«
»Es ist nicht deine Schuld, Mom«, versicherte Lucas ihr. Er zog Jason auf die Füße. »Alles okay, Cousin?«
»Nein«, antwortete Jason ehrlich. Er atmete noch ein paarmal tief ein, aber eigentlich war es nicht der Stoß gegen die Brust, der ihm am meisten wehtat. »Ich hasse das.«
Die Cousins tauschten einen gequälten Blick. Beide vermissten Hector und litten darunter, was die Furien ihnen antaten. Dann fuhr Jason abrupt herum und verschwand durch die Hintertür hinaus in den Regen.
»Jason, warte«, rief Claire und rannte ihm nach.
»Ich habe nicht so früh mit euch gerechnet«, sagte Noel mehr zu sich selbst als zu ihrem Sohn, als bräuchte sie diese Rechtfertigung. Lucas ging zu seiner Mutter und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn.
»Mach dir keine Sorgen. Es wird alles wieder gut«, versicherte er ihr mit erstickter Stimme.
Er musste hier weg. Immer noch mit diesem Kloß im Hals verzog er sich nach oben, um sich umzuziehen. Schon auf dem Flur vor seinem Zimmer streifte er sich das Hemd über den Kopf und hörte plötzlich Helens Stimme hinter sich.
»Ich fand eigentlich immer, dass du gut lügen kannst«, sagte sie leise. »Aber als du ›Es wird alles wieder gut‹ gesagt hast, habe nicht einmal ich es geglaubt.«
Lucas ließ das durchweichte Hemd auf den Boden fallen und drehte sich zu Helen um, denn nach dem Schreck in der Küche konnte er ihr nicht widerstehen. Er zog sie an sich und legte das Gesicht an ihren Hals. Sie schmiegte sich an ihn, stützte sein Gewicht, während sich seine breiten Schultern um sie legten, und sie hielt ihn in den Armen, bis er sich genug beruhigt hatte, um zu sprechen.
»Ein Teil von mir will losziehen und ihn suchen. Ihn jagen«, gestand er, denn es gab niemand außer Helen, dem er diese Gefühle anvertrauen konnte. »Jede Nacht träume ich davon, wie ich ihn auf den Stufen der Bücherei mit bloßen Händen töte. Ich sehe mich, wie ich wieder und wieder auf ihn einschlage, und dann wache ich auf und denke, dass ich ihn diesmal wirklich umgebracht haben könnte. Und dann bin ich erleichtert …«
Helen fuhr ihm über das nasse Haar, strich es glatt und ließ die Hände über seinen Nacken, die Schultern, die harten Rückenmuskeln wandern und zog ihn enger an sich. »Ich beende das«, versprach sie. »Das schwöre ich, Lucas, ich werde die Furien finden und aufhalten.«
Lucas zog sich weit genug zurück, sodass er Helen ansehen konnte, und schüttelte den Kopf. »Nein, ich wollte dich nicht noch mehr unter Druck setzen. Es ist schon schlimm genug für mich, dass das alles auf dir lastet.«
»Ich weiß.«
Mehr sagte sie nicht. Kein Selbstmitleid, kein »Bedauere mich«. Sie akzeptierte ihr Schicksal – einfach so. Lucas sah sie an und ließ die Finger über ihr perfektes Gesicht wandern.
Er liebte ihre Augen. Sie veränderten sich ständig, und Lucas hatte im Kopf längst eine Liste erstellt, was welche Farbe bedeutete. Wenn sie lachte, waren ihre Augen hell bernsteinfarben, wie Honig in einem Glas, das auf einer sonnigen Fensterbank steht. Wenn er sie küsste, wurden sie dunkler und nahmen die Farbe von mahagonifarbenem Leder an, allerdings mit roten und goldenen Funken. Gerade jetzt wurden ihre Augen dunkel – eine Einladung ihrer Lippen an seine.
»Lucas!«, brüllte sein Vater. Helen und Lucas sprangen auseinander und fuhren herum zu Castor, der mit weißem Gesicht und starrer Körperhaltung am oberen Treppenabsatz aufgetaucht war. »Zieh dir ein Hemd an und komm in mein Arbeitszimmer. Helen, geh nach Hause.«
»Dad, sie hat nicht …«
»Sofort!«, schrie sein Vater. Lucas hatte ihn noch nie so wütend erlebt.
Helen ergriff die Flucht. Sie drückte sich mit gesenktem Kopf an Castor vorbei und rannte aus dem Haus, bevor Noel fragen konnte, was los war.
»Hinsetzen.«
»Es war meine Schuld. Sie hat sich Sorgen um mich gemacht«, begann Lucas, sich zu verteidigen.
»Das ist mir egal«, sagte Castor, und sein Blick bohrte sich in die Augen seines Sohnes. »Es ist mir egal, wie unschuldig es begonnen hat. Geendet hat es jedenfalls damit, dass du halb nackt die Arme um sie gelegt hast und ihr nur zwei Schritte von deinem Bett entfernt wart.«
»Ich hatte nicht vor, sie –« Lucas konnte diese Lüge nicht zu Ende führen. Er hatte vorgehabt, sie zu küssen, und wenn er erst damit angefangen hätte, hätten ihn nur Helen oder eine Flutwelle dazu bringen können, wieder aufzuhören. Ehrlich gesagt störte es Lucas schon lange nicht mehr, dass irgendein Onkel, den er nie kennengelernt hatte, Helens Vater war. Er liebte sie, und daran würde sich nichts ändern, egal, wie oft ihm alle sagten, wie falsch das war.
»Lass mich dir etwas erklären.«
»Wir sind Cousin und Cousine, ich weiß«, unterbrach ihn Lucas. »Glaubst du, ich weiß nicht, dass sie genauso eng mit mir verwandt ist wie Ariadne? Aber es fühlt sich nicht danach an.«
»Mach dir nichts vor«, sagte Castor düster. »Inzest gab es bei Scions schon seit Ödipus. Und es gab auch in diesem Haus schon andere, die sich in ihre Cousins oder Cousinen verliebt haben – wie du und Helen.«
»Was ist aus ihnen geworden?«, fragte Lucas vorsichtig. Er ahnte bereits, dass ihm die Antwort seines Vaters nicht gefallen würde.
»Das Ergebnis war immer dasselbe.« Castor fixierte seinen Sohn. »Wie Ödipus’ Tochter Elektra leiden die Kinder von eng verwandten Scions immer an unserem größten Fluch. Wahnsinn.«
Lucas setzte sich aufrechter hin und suchte fieberhaft nach einem Ausweg aus diesem Dilemma. »Wir – wir müssen doch keine Kinder kriegen.«
Es gab kein Warnzeichen, keinen Hinweis darauf, dass Lucas es zu weit getrieben hatte. Ohne einen Ton von sich zu geben, stürzte sich sein Vater auf ihn wie ein wütender Stier. Lucas sprang auf, wusste aber nicht, was er tun sollte. Er war doppelt so stark wie sein Vater, aber er wehrte sich nicht, als Castor ihn an den Schultern packte und gegen die Wand stieß. Castor starrte ihm so wütend in die Augen, dass Lucas einen Moment lang davon überzeugt war, dass sein Vater ihn hasste.
»Wie kannst du so selbstsüchtig sein?«, knurrte Castor voller Verachtung. »Es gibt nicht einmal mehr genug Scion-Partner für jeden von euch, und du entscheidest einfach, dass ihr keine Kinder wollt. Wir reden hier von der Erhaltung unserer Art, Lucas!« Um seine Worte zu unterstreichen, stieß er Lucas so heftig gegen die Wand, dass sie zu bröckeln begann. »Die vier Häuser müssen überleben und getrennt bleiben, damit der Waffenstillstand gesichert ist und die Götter auf dem Olymp bleiben, denn andernfalls müsste jeder Sterbliche auf diesem Planeten darunter leiden.«
»Das weiß ich!«, brüllte Lucas. Der Putz von der beschädigten Wand rieselte auf sie herab und erfüllte die Luft mit seinem Staub. Lucas versuchte, sich aus dem Griff seines Vaters zu befreien. »Aber es gibt doch genügend andere Scions, die die Art erhalten können! Was ist schon dabei, wenn Helen und ich keine Kinder wollen?«
»Helen und ihre Mutter sind die Letzten ihres Hauses! Helen muss einen Erben hervorbringen, um das Haus von Atreus zu erhalten und die Häuser voneinander getrennt zu halten; nicht nur für diese Generation, sondern für alle, die noch kommen!«
Castor brüllte immer noch. Er schien den weißen Staub und den bröckelnden Putz nicht wahrzunehmen. Es war fast, als würde alles, woran sein Vater bisher geglaubt hatte, auf Lucas’ Kopf prasseln und ihn ersticken.
»Der Waffenstillstand hält nun schon viele Tausend Jahre und er muss noch viele Tausend weitere Jahre bestehen, sonst machen die Götter des Olymp Sterbliche und Scions wieder zu ihren Spielzeugen – brechen Kriege vom Zaun, vergewaltigen Frauen und verhängen schreckliche Flüche, wie es ihnen gefällt«, fuhr Castor unbarmherzig fort. »Du glaubst vielleicht, dass ein paar Hundert von uns ausreichen, unsere Art und den Waffenstillstand zu erhalten, aber das reicht nicht aus, um die Götter zu überdauern. Wir müssen bestehen bleiben, und um das zu erreichen, muss sich jeder Einzelne von uns fortpflanzen.«
»Was erwartest du von uns?« Jetzt schrie Lucas zurück, stieß seinen Vater von sich und löste sich von der eingedrückten und fast durchbrochenen Wand. »Ich werde tun, was für mein Haus nötig ist, und das wird Helen auch tun. Wir werden Kinder von anderen bekommen, wenn es das ist, was von uns erwartet wird – auch das werden wir irgendwie überleben! Aber verlang nicht, dass ich mich von Helen fernhalte, denn das kann ich nicht. Wir werden mit allem fertig, nur damit nicht.«
Sie funkelten einander an, außer Atem und mit weißem Staub bedeckt, der ihnen auf der verschwitzten Haut klebte.
»Ist es so einfach für dich zu entscheiden, womit Helen fertigwird und womit nicht? Hast du sie dir in letzter Zeit mal angesehen?«, fragte Castor grob und ließ seinen Sohn mit angewiderter Miene los. »Sie leidet, Lucas.«
»Das weiß ich! Denkst du, ich würde nicht alles tun, um ihr zu helfen?«
»Alles? Dann halt dich von ihr fern.«
Es schien, als wäre Castors Ärger plötzlich verraucht, und statt zu schreien redete er nun ganz ruhig mit Lucas.
»Ist dir in den Sinn gekommen, dass das, was sie in der Unterwelt zu tun versucht, nicht nur für Frieden zwischen den Häusern sorgen, sondern auch Hector wieder in die Familie zurückbringen kann? Wir haben so viel verloren. Ajax, Aileen, Pandora.« Castors Stimme brach beim Namen seiner kleinen Schwester. Ihr Tod war für sie beide noch viel zu nah. »Helen muss etwas ertragen, das sich keiner von uns vorstellen kann, und sie braucht ihre ganze Kraft, um es durchzustehen. Um unser aller willen.«
»Aber ich kann ihr helfen«, beteuerte Lucas, der seinen Vater auf seiner Seite wissen wollte. »Ich kann ihr zwar nicht in die Unterwelt folgen, aber ich kann ihr zuhören und sie unterstützen.«
»Du denkst, dass du ihr hilfst, aber du bringst sie um«, widersprach Castor und schüttelte traurig den Kopf. »Du hast vielleicht deinen Frieden mit den Gefühlen gemacht, die du für sie hast, aber sie kommt nicht damit zurecht, was sie für dich empfindet. Ihr seid verwandt und ihre Schuldgefühle zerreißen sie. Wieso bist du der Einzige, der das nicht erkennt? Es gibt tausend Gründe, aus denen du dich von ihr fernhalten musst, aber wenn sie dir alle egal sind, dann halte dich wenigstens fern von Helen, weil es für sie das Beste ist.«
Lucas wollte widersprechen, aber er konnte es nicht. Er musste wieder daran denken, wie Helen gesagt hatte, dass sie »es bereuen« würde, wenn sie ihm von der Unterwelt erzählte. Sein Vater hatte recht. Je näher sie sich kamen, desto mehr tat er Helen weh. Von allen Argumenten, die sein Vater vorgebracht hatte, traf ihn dieses besonders hart. Er schlurfte zur Couch und ließ sich in die Polster fallen, damit sein Vater seine zitternden Knie nicht sah.
»Was soll ich denn tun?« Lucas wusste nicht weiter. »Es ist wie Wasser, das bergab fließt. Sie treibt einfach auf mich zu. Und ich kann sie nicht wegstoßen.«
»Dann errichte einen Staudamm.« Castor seufzte, setzte sich Lucas gegenüber und rieb sich den Mörtelstaub vom Gesicht. Er sah jetzt viel kleiner aus. Als hätte er den Kampf verloren, obwohl er doch eigentlich gewonnen und Lucas alles genommen hatte. »Du musst derjenige sein, der es beendet. Keine vertraulichen Gespräche, keine Flirts in der Schule und keine verstohlenen Plaudereien auf dunklen Fluren mehr. Du musst sie dazu bringen, dass sie dich hasst, mein Sohn.«
Helen und Cassandra arbeiteten in der Bibliothek und versuchten, etwas – irgendetwas – zu finden, das Helen in der Unterwelt helfen konnte. Es war ein frustrierender Nachmittag. Je mehr die Mädchen lasen, desto überzeugter waren sie, dass mindestens die Hälfte der Texte über den Hades von mittelalterlichen Schreiberlingen stammte, die auf Drogen gewesen sein mussten.
»Hast du im Hades je sprechende Skelette toter Pferde gesehen?«, fragte Cassandra skeptisch.
»Nö. Keine sprechenden Skelette. Pferde eingeschlossen«, antwortete Helen und rieb sich die Augen.
»Dann kann dieser Schwachsinn wohl auf den ›Der Typ war eindeutig high‹-Stapel wandern.« Cassandra legte die Schriftrolle weg und musterte Helen einen Moment lang. »Wie fühlst du dich?«
Helen zuckte mit den Schultern und schüttelte den Kopf, denn sie wollte nicht darüber reden. Seit Castor sie und Lucas vor seinem Zimmer erwischt hatte, war sie auf Zehenspitzen durchs Haus geschlichen, wenn sie zu ihren Studien mit Cassandra kam. Die Nächte hatte sie eingesperrt im Höllenhaus verbracht.
Normalerweise konnte Helen sich in der Unterwelt darauf verlassen, mindestens ein oder zwei Nächte pro Woche einen endlosen Strand entlangzulaufen, der niemals ans Meer führte. Der endlose Strand war nervig, weil sie nie irgendwo ankam, aber verglichen mit den Aufenthalten im Höllenhaus war der Strand der reinste Urlaub. Sie wusste nicht, wie lange sie es noch ertragen konnte, und sie konnte mit niemandem darüber reden. Wie sollte sie auch den perversen Wollmantel und die widerlichen pfirsichfarbenen Vorhänge erklären, ohne sich lächerlich zu machen?
»Ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause, etwas essen«, sagte Helen und versuchte, nicht an die Nacht zu denken, die ihr bevorstand.
»Aber es ist Sonntag. Da isst du doch mit uns, oder?«
»Ach, ich fürchte, das würde eurem Dad nicht recht sein.« Und Lucas wohl auch nicht, fügte sie in Gedanken hinzu. Er hatte sie nicht mehr angesehen, seit sie von Castor erwischt worden waren. Helen hatte ihm auf dem Schulflur zwar mehrmals zugelächelt, aber er war an ihr vorbeigegangen, als wäre sie gar nicht da.
»Das ist doch Unsinn«, wehrte Cassandra ihren Einwand energisch ab. »Du gehörst zur Familie. Und wenn du nicht mit uns zu Abend isst, wird meine Mutter beleidigt sein.«
Sie ging um den Tisch herum, nahm Helen bei der Hand und führte sie aus der Bibliothek. Helen war von dieser untypisch herzlichen Geste so verblüfft, dass sie wortlos gehorchte.
Es war schon später, als die Mädchen gedacht hatten, und Jason, Ariadne, Pallas, Noel, Castor und Lucas saßen bereits am Tisch. Cassandra setzte sich auf ihren Stammplatz an der Seite ihres Vaters. Der einzige freie Platz war auf der Bank zwischen Ariadne und Lucas.
Als Helen über die Bank stieg, stieß sie Lucas versehentlich an, und beim Hinsetzen streifte sie seinen Arm.
Lucas erstarrte und versuchte, ihr auszuweichen.
»Tut mir leid«, murmelte Helen verlegen und bemühte sich, den Arm wegzuziehen, aber es war einfach zu wenig Platz auf der voll besetzten Bank. Sie spürte sein Unbehagen, griff unter dem Tisch nach seiner Hand und drückte sie kurz, als wollte sie fragen: »Was ist los mit dir?«
Lucas riss seine Hand weg. Der Blick, mit dem er sie bedachte, war so voller Hass, dass ihr das Blut in den Adern gefror. Im Raum wurde es still, und alle hörten auf, sich zu unterhalten. Sie alle hatten nur noch Augen für Helen und Lucas.
Ohne Vorwarnung stieß Lucas die Bank weg und Helen, Ariadne und Jason landeten auf dem Boden. Lucas baute sich über Helen auf und starrte auf sie herab. Sein Gesicht war verzerrt vor Wut.
Sogar als sie noch von den Furien besessen gewesen waren und sich bis aufs Blut bekämpft hatten, hatte Helen nie Angst vor Lucas gehabt. Aber jetzt sahen seine Augen so schwarz und fremd aus – als wäre er gar nicht mehr er selbst. Helen wusste, dass das kein Lichtreflex war. In Lucas war ein Schatten herangewachsen, der das Leuchten seiner blauen Augen ausgelöscht hatte.
»Wir halten uns nicht an den Händen. Du redest nicht mit mir. Du siehst mich nicht einmal mehr an, hast du das KAPIERT?«, fuhr er sie gnadenlos an. Seine Stimme schwoll von einem rauen Flüstern zu heiserem Geschrei an. Helen war so geschockt, dass sie auf dem Fußboden vor ihm wegrobbte.
»Lucas, das reicht!« Fassungslosigkeit war aus Noels entsetzter Stimme herauszuhören. Sie erkannte ihren Sohn ebenso wenig wieder wie Helen.
»Wir sind keine Freunde«, knurrte Lucas. Er ignorierte seine Mutter und beugte sich immer noch drohend über Helen. Sie schob ihren zitternden Körper auf der Flucht vor ihm mit den Fersen über den Boden und ihre Turnschuhe machten klägliche Quietschgeräusche auf den Fliesen.
»Luke, was zur Hölle soll das?«, schrie Jason ihn an, aber auch das ignorierte Lucas.
»Wir hängen nicht zusammen ab oder albern herum oder teilen Dinge miteinander. Und falls du dir JEMALS einbildest, du hättest das RECHT, neben mir zu sitzen …«
Lucas bückte sich, um Helen zu packen, aber sein Vater hielt von hinten seine Oberarme fest, um zu verhindern, dass er ihr etwas antat. Und dann sah Helen Lucas etwas tun, was sie nie für möglich gehalten hätte.
Er fuhr herum und schlug seinen Vater. Der Schlag war so heftig, dass Castor durch die halbe Küche geschleudert wurde und in den Schrank mit den Tassen und Gläsern über der Spüle krachte.
Noel schrie auf, als die Glas- und Porzellansplitter in alle Richtungen flogen. Sie war die einzige Normalsterbliche in einem Raum mit kämpfenden Scions und lief Gefahr, ernsthaft verletzt zu werden.
Ariadne sprang vor Noel und beschützte sie mit ihrem Körper, und Jason und Pallas warfen sich auf Lucas und versuchten, ihn zu Boden zu ringen.
Helen war klar, dass ihre Anwesenheit seine Wut nur noch mehr anstachelte, und so rappelte sie sich auf, hastete zur Hintertür, wobei sie auf den Scherben ausrutschte, und sprang in den Himmel.
Auf dem Flug nach Hause horchte sie in der dünnen Luft hoch oben auf die Geräusche ihres Körpers. Körper sind nicht leise. Nimmt man sie mit an lautlose Orte wie die Unterwelt oder die Atmosphäre, hört man alle möglichen Schnauf- und Brodelgeräusche. Aber Helens Körper war totenstill. Sie konnte nicht einmal ihren Herzschlag hören. Nach allem, was sie gerade erlebt hatte, hätte es schlagen müssen wie verrückt, aber alles, was sie spürte, war ein fast unerträglicher Druck, als würde ein Riese auf ihrer Brust knien.
Vielleicht schlug ihr Herz nicht mehr, weil es in der Mitte durchgebrochen und stehen geblieben war.
»Ist es das, was du wolltest?«, schrie Lucas seinen Vater an, während er darum kämpfte, sich zu befreien. »Meinst du, dass sie mich jetzt genug hasst?«
»Lasst ihn los!«, befahl Castor Pallas und Jason.
Die beiden zögerten, ließen Lucas aber nicht sofort frei. Sie sahen zuerst Castor an, um sich zu vergewissern, dass er es ernst meinte. Er nickte ihnen zu, bevor er sein Urteil sprach.
»Verlass dieses Haus, Lucas. Ich will dich nicht mehr sehen, bis du gelernt hast, deine Kräfte zu kontrollieren, wenn deine Mutter im Raum ist.«
Lucas erstarrte. Er schaute gerade rechtzeitig auf, um zu sehen, wie Ariadne einen Tropfen Blut von Noels Gesicht wischte und ihre glühenden Hände die Schnittwunde sofort verheilen ließen.
Eine alte Erinnerung – noch aus der Zeit, bevor er sprechen konnte – stürzte auf Lucas ein. Selbst als Kleinkind war er stärker gewesen als seine Mutter, und während eines Trotzanfalls hatte er sie weggestoßen, als sie ihn mit einem Küsschen hatte beruhigen wollen. Damals hatte er ihr die Lippe blutig geschlagen.
Lucas erinnerte sich an die Laute, die sie damals ausgestoßen hatte – Laute, die ihn noch heute mit Scham erfüllten. Er hatte diesen Augenblick sein ganzes Leben bedauert und seine Mutter seitdem nie härter angefasst als das Blütenblatt einer Rose. Aber jetzt blutete sie wieder. Seinetwegen.
Lucas befreite seine Arme aus dem Griff von Pallas und Jason, stieß die Hintertür auf und flog in den dunklen Nachthimmel. Es war ihm egal, wohin der Wind ihn trug.
2
Helen atmete flach und hastig. Sie war nun schon die fünfte Nacht in Folge an derselben Stelle der Unterwelt gelandet und wusste, dass sie sich möglichst wenig bewegen durfte, um nicht so schnell im Treibsand zu versinken. Selbst wenn sie normal atmete, zog es sie tiefer in die Grube.
Ihr war vollkommen klar, dass sie die Qual nur verlängerte, aber sie konnte den Gedanken einfach nicht ertragen, schon wieder in dem ekligen Sand zu versinken. Treibsand ist nichts Sauberes. Er ist voll von den modernden Leichen seiner früheren Opfer. Während Helen tiefer und tiefer hinabgezogen wurde, spürte sie, wie die verwesten Körper aller möglichen Kreaturen gegen sie stießen. In der vergangenen Nacht hatte ihre Hand irgendwo in der widerwärtigen Masse ein Gesicht gestreift – das Gesicht eines Menschen.
Eine Gasblase blubberte an die Oberfläche und verbreitete eine stinkende Wolke. Helen musste sich übergeben. Wenn sie gleich unterging, würde der stinkende Sand in ihre Nase dringen, ihre Augen verkleben und ihren Mund füllen. Obwohl Helen erst bis zum Bauch im Treibsand steckte, wusste sie, dass es jeden Moment passierte. Sie fing an zu weinen. Sie hielt es nicht länger aus.
»Was soll ich denn sonst tun?«, schrie sie und sank ein bisschen tiefer.
Sie wusste, dass es sinnlos war, wild herumzustrampeln, aber vielleicht schaffte sie es diesmal, das trockene Riedgras auf der anderen Seite des Lochs zu erreichen und sich daran festzuhalten, bevor der schlammige Sand sie verschluckte. Sie watete vorwärts, aber mit jeder Bewegung zog es sie tiefer in den Sand. Als sie schließlich bis zur Brust eingesunken war, konnte sie sich nicht mehr bewegen. Der Druck des Treibsands presste die Luft aus ihrer Lunge, als würde ein schweres Gewicht auf ihrer Brust lasten – es war, als kniete ein Riese auf ihr.
»Ja, ich hab’s kapiert!«, schluchzte sie. »Ich lande hier, wenn ich beim Einschlafen aufgewühlt bin. Aber wie soll ich beeinflussen, wie ich mich fühle?«
Der Treibsand reichte schon bis zu ihrem Hals. Helen legte den Kopf in den Nacken und reckte das Kinn nach oben, als würde bloße Willenskraft ausreichen, sie an der Oberfläche zu halten.
»Ich kann das nicht länger allein machen«, schrie sie in den klaren Himmel. »Jemand muss mir helfen.«
»Helen!«, rief eine tiefe, unbekannte Stimme.
Es war das erste Mal, dass Helen in der Unterwelt eine Stimme hörte, und im ersten Moment war sie überzeugt, dass sie halluzinierte. Sie reckte immer noch krampfhaft den Kopf hoch, konnte ihn aber nicht drehen, ohne dabei im Treibsand unterzugehen.
»Greif nach mir, wenn du kannst«, sagte der junge Mann mit gepresster Stimme, als hinge er bereits über dem Rand des Lochs, um so dicht wie möglich an sie heranzukommen. »Komm schon, streng dich an! Gib mir deine Hand!«
In diesem Moment füllte der Sand ihre Ohren, und sie konnte nicht mehr hören, was er ihr zuschrie. Alles, was sie noch sehen konnte, war das Aufblitzen von etwas Goldenem – ein helles Leuchten, das ihr in dem matten, unheilvollen Licht der Unterwelt vorkam wie der rettende Lichtstrahl eines Leuchtturms. Aus dem Augenwinkel erhaschte sie einen flüchtigen Blick auf ein markantes Kinn und einen wohlgeformten Mund. Und dann spürte Helen unter der Oberfläche des Treibsands, wie eine warme, starke Hand ihre ergriff und daran zog.
Helen wachte in ihrem Bett auf und schreckte hoch. Hektisch kratzte sie sich den Schlamm aus den Ohren. Das Adrenalin ließ ihr Herz immer noch rasen wie verrückt, aber sie zwang sich, stillzuhalten und zu horchen.