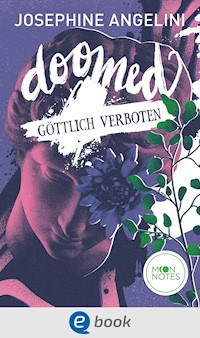23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die 16-jährige Helen lebt bei ihrem Vater auf Nantucket und langweilt sich. Ihre Freundin Claire hofft, dass nach den Ferien endlich etwas Aufregendes passiert. Und tatsächlich: Als die Familie Delos auf die Insel zieht, sind alle hin und weg von den extrem attraktiven Neuankömmlingen. Nur Helen verspürt von Anfang an Misstrauen. Zugleich plagen sie düstere Albträume, in denen drei unheimliche Frauen Rache nehmen wollen. Es scheint eine Verbindung zwischen ihnen und Lucas Delos zu geben. Nach und nach entdeckt Helen, was dahintersteckt… Die Gesamtausgabe von Fates & Furies von Josephine Angelini. Der Sammelband umfasst die drei Einzelbände: Fates & Furies 1. Starcrossed Fates & Furies 2. Torn Fates & Furies 3. Unleashed
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch
Die 16-jährige Helen lebt bei ihrem Vater auf Nantucket – und langweilt sich. Ihre Freundin Claire hofft, dass nach den Ferien endlich etwas Aufregendes passiert. Und tatsächlich: Als die Familie Delos auf die Insel zieht, sind alle hin und weg von den extrem attraktiven Neuankömmlingen. Nur Helen verspürt von Anfang an Misstrauen. Zugleich plagen sie düstere Albträume, in denen drei unheimliche Frauen Rache nehmen wollen. Es scheint eine Verbindung zwischen ihnen und Lucas Delos zu geben. Nach und nach entdeckt Helen, was dahintersteckt …
Die Gesamtausgabe von »Fates & Furies« von Josephine Angelini.
Der Sammelband umfasst die drei Einzelbände:
Fates & Furies 1. Starcrossed
Fates & Furies 2. Torn
Fates & Furies 3. Unleashed
… für meinen geliebten Mann
1
»Aber wenn du mir jetzt ein Auto kaufst, gehört es dir, wenn ich in zwei Jahren aufs College gehe. Und dann ist es praktisch immer noch neu«, sagte Helen optimistisch. Leider fiel ihr Vater nicht darauf herein.
»Lennie, nur weil der Bundesstaat Massachusetts meint, dass Sechzehnjährige schon Auto fahren dürfen …«, begann Jerry.
»Fast siebzehn«, betonte Helen.
»… bedeutet das nicht, dass ich derselben Meinung sein muss.« Er stand bereits auf der Gewinnerseite, aber so leicht gab Helen nicht auf.
»Weißt du, die alte Karre hält höchstens noch ein oder zwei Jahre.« Helen startete einen neuen Versuch und bezog sich dabei auf den uralten Jeep Wrangler ihres Vaters, der vermutlich schon vor der Burg geparkt hatte, in der die Magna Charta unterzeichnet worden war. »Und denk doch nur an das ganze Spritgeld, das wir sparen würden, wenn wir einen Hybrid kaufen oder gleich ein Elektroauto. Das ist die Zukunft, Dad.«
»Mm-hm«, war alles, was ihr Vater dazu sagte.
Jetzt hatte sie verloren.
Helen Hamilton stöhnte leise und schaute über die Reling der Fähre, die sie zurück nach Nantucket brachte. Sie sah sich schon ein weiteres Jahr im November mit dem Rad zur Schule fahren und um eine Mitfahrgelegenheit betteln, wenn der Schnee zu hoch lag. Allein der Gedanke ließ sie schaudern und sie versuchte sich abzulenken. Wie so oft starrten einige der Touristen auf der Fähre sie an und Helen wandte so unauffällig wie möglich das Gesicht ab. Wenn Helen in den Spiegel schaute, sah sie zwei ganz gewöhnliche Augen, eine Nase und einen Mund – aber die Fremden von außerhalb starrten sie trotzdem immer an, was wirklich lästig war.
Zu Helens Glück waren die meisten Touristen auf der Fähre, um die schöne Aussicht zu genießen und nicht ihren Anblick. Sie waren so versessen darauf, vor dem Herbst noch eine Ladung Inselfeeling mitzunehmen, dass sie die Umgebung mit ständigen Aaahs und Ooohs bestaunten. Helen konnte alldem nichts abgewinnen. Soweit es sie betraf, war es das Letzte, auf einer kleinen Insel aufzuwachsen, und sie konnte es nicht erwarten, endlich aufs College zu gehen, weit weg von der Insel, von Massachusetts und wenn möglich auch der ganzen Ostküste.
Es war aber nicht so, dass Helen ihr Zuhause hasste. Sie kam sogar hervorragend mit ihrem Vater aus. Ihre Mutter hatte sie verlassen, als Helen noch ein Baby gewesen war, doch Jerry hatte schnell gelernt, seiner Tochter genau das richtige Maß an Aufmerksamkeit zu schenken. Er war nicht ständig um sie herum, aber dennoch war er da, wenn sie ihn brauchte. Und obwohl sie sich über die Sache mit dem Auto ärgerte, wusste sie auch, dass sie sich keinen besseren Vater wünschen konnte.
»Hey, Lennie! Was macht der Ausschlag?«, rief eine Stimme, die sie nur zu gut kannte. Es war Claire, ihre beste Freundin seit dem Babyalter. Sie stieß die schwankenden Touristen mit ein paar geschickt platzierten Schubsern zur Seite.
Die meerestrunkenen Tagesausflügler wichen Claire aus, als wäre sie ein Stürmer beim Football und kein zierliches Persönchen, das auf Plateausandalen dahergetrippelt kam. Sie glitt mühelos durch den Touristenschwarm und stellte sich neben Helen an die Reling.
»Giggles! Wie ich sehe, warst du auch für den ersten Schultag einkaufen«, sagte Jerry und umarmte Claire mitsamt ihren Taschen und Tüten.
Claire Aoki, von ihren Freunden Giggles genannt, war ein echtes Schlitzohr. Jeder, der nur ihre eins fünfundfünfzig Körpergröße und ihre asiatische Zartheit wahrnahm, ohne ihren scharfen Verstand und ihr freches Mundwerk zu erkennen, lief Gefahr, furchtbar unter den Angriffen einer deutlich unterschätzten Gegnerin zu leiden. Der Spitzname »Giggles« war gewissermaßen ihr Markenzeichen. Sie hatte ihn schon, seit sie ein Kleinkind war. Zur Verteidigung ihrer Familie und ihrer Freunde muss gesagt werden, dass es fast unmöglich war, sie nicht Giggles zu nennen. Claire hatte mit Abstand das sympathischste Lachen des Universums. Es klang niemals gezwungen oder gar schrill und zauberte absolut jedem in Hörweite ein Lächeln auf die Lippen.
»Na klar, Erzeuger meiner besten Freundin«, sagte Claire und erwiderte Jerrys Umarmung mit echter Zuneigung, ohne darauf einzugehen, dass er schon wieder den ungeliebten Spitznamen verwendet hatte. »Darf ich mal ein paar Worte mit deinem Nachwuchs wechseln? Tut mir leid, dass ich so unhöflich bin, aber es geht wirklich um hochgeheime, brisante Dinge. Ich würde es dir ja sagen …«, fügte sie hinzu.
»… aber dann müsstest du mich töten«, beendete Jerry den Satz scharfsinnig. Er verzog sich zum Getränkestand, um sich eine von den zuckrigen Limos zu kaufen, solange seine Tochter, die Chefin der Ernährungspolizei, gerade nicht hinsah.
»Was hast du da alles in deinen Tüten?«, fragte Claire. Sie schnappte sich Helens Einkäufe und begann, darin herumzuwühlen. »Jeans, Strickjacke, Unter… wie jetzt? Du nimmst deinen Dad mit zum Unterwäschekaufen?«
»Was hatte ich denn für eine Wahl?«, beschwerte sich Helen und entriss ihrer Freundin die Tüte. »Ich brauchte neue BHs! Außerdem ist mein Dad in den Buchladen gegangen, solange ich alles anprobiert habe. Aber es ist trotzdem total peinlich, Unterwäsche zu kaufen, auch wenn er in einem anderen Geschäft auf mich wartet«, gestand sie und wurde ganz rot dabei.
»Aber so schlimm kann das gar nicht sein. Schließlich kaufst du nichts, was auch nur entfernt sexy ist. Meine Güte, Lennie, so was trägt meine Oma!« Claire hielt eine weiße Baumwollunterhose hoch. Helen schnappte hektisch nach dem Omaschlüpfer und ließ ihn in den Tiefen ihrer Einkaufstüte verschwinden, während Claire in ihr berühmtes Lachen ausbrach.
»Ich weiß, ich bin mit der Streberseuche infiziert«, konterte Helen, die Claire ihre Stichelei wie gewöhnlich längst verziehen hatte. »Hast du keine Angst, dich bei mir mit dem Loservirus anzustecken?«
»Ich bin so umwerfend, dass ich immun dagegen bin. Außerdem steh ich auf Streber. Die kann man so schön ärgern. Und ich finde es klasse, wie du jedes Mal rot wirst, wenn ich von Unterhosen anfange.«
Claire wurde gezwungen, ein Stück zur Seite zu rücken, weil sich ein fotografierendes Touristenpaar neben sie gedrängt hatte. Sie nutzte das Schwanken der Fähre und knuffte die beiden mit einem ihrer Ninja-Schubser. Sie taumelten von der Reling weg, lachten über die »raue See« und hatten nicht einmal gemerkt, dass Claire sie berührt hatte. Helen spielte mit dem Herzanhänger an der Kette, die sie immer trug, und duckte sich ein wenig, um auf Augenhöhe mit Claire zu sein, die wesentlich kleiner war als sie.
Helen war furchtbar schüchtern, und sie fand es besonders schrecklich, immer noch zu wachsen, obwohl sie mit ihren eins achtundsiebzig Körpergröße schon genügend auffiel. Sie hatte Jesus, Buddha, Mohammed und Wischnu angefleht, ihr Wachstum endlich zu stoppen, aber sie spürte nachts immer noch die ziehenden Schmerzen in Knochen und Muskeln, die einen weiteren Wachstumsschub ankündigten. Eines hatte sie sich fest vorgenommen: Sobald sie die Zwei-Meter-Marke überschritt, würde sie über das Geländer des Leuchtturms in Siasconset steigen und sich in die Tiefe stürzen.
Die Verkäuferinnen erzählten ihr ständig, was für ein Glück sie hatte, aber eine passende Hose fanden sie trotzdem nicht für sie. Helen hatte sich mittlerweile damit abgefunden, dass sie Jeans kaufen musste, die viel zu groß waren, wenn sie die richtige Länge haben sollten. Wenn sie aber welche wollte, die ihr nicht vom Po fielen, musste sie in Kauf nehmen, dass ihr eine sanfte Brise um die Knöchel wehte. Helen war ziemlich sicher, dass die »so neidischen« Verkäuferinnen nicht mit nackten Knöcheln herumliefen. Oder mit Jeans, in denen man ihren Po halb sah.
»Mach keinen Buckel«, fuhr Claire sie automatisch an, als sie sich wieder umdrehte und Helen an der Reling hängen sah. Helen gehorchte ebenso automatisch.
Claire hatte einen Fimmel, was die Haltung betraf. Sie hatten nie darüber gesprochen, aber Helen nahm an, dass das an Claires superkorrekter japanischer Mutter lag und an der noch viel korrekteren, kimonotragenden Großmutter.
»Okay! Jetzt zu den wirklich wichtigen Themen«, verkündete Claire. »Du kennst doch diesen zig Millionen teuren Kasten, der mal diesem Football-Typen gehört hat?«
»Der in ’Sconset? Klar. Was ist damit?«, fragte Helen, die an den Privatstrand denken musste, der zum Anwesen gehörte. Insgeheim war sie froh darüber, dass ihr Dad in seinem Laden nicht genug verdiente, um ein Haus zu kaufen, das dichter am Wasser stand.
Als Helen noch klein war, war sie beinahe ertrunken und seitdem der festen Überzeugung, dass der Atlantik sie umbringen wollte. Diesen paranoiden Gedanken behielt sie natürlich für sich … aber sie war auch eine lausige Schwimmerin. Sie konnte zwar ein bisschen herumpaddeln, aber selbst das klappte nicht richtig. Irgendwann sank sie immer wie ein Stein, egal, wie salzhaltig das Meer angeblich war und wie sehr sie sich bemühte.
»Es ist endlich verkauft, an eine Großfamilie«, sagte Claire. »Oder zwei Familien. Ich weiß nicht genau, wie die zusammenhängen, aber anscheinend sind es zwei Väter, die Brüder sind. Sie haben beide Kinder, also sind die alle Cousins?« Claire runzelte die Stirn. »Auf jeden Fall haben die Leute, die da eingezogen sind, einen Haufen Kinder, die alle ungefähr im selben Alter sind. Und sie haben zwei Jungs, die in unsere Klassenstufe kommen.«
»Lass mich raten«, erwiderte Helen, ohne eine Miene zu verziehen. »Du hast deine Tarotkarten befragt und festgestellt, dass sich beide Jungs unsterblich in dich verlieben und sich einen tragischen Kampf auf Leben und Tod liefern werden.«
Claire trat Helen gegen das Schienbein. »Nein, du doofe Nuss. Es ist für jede von uns einer da.«
Helen rieb sich das Bein und tat so, als würde es wehtun. Aber selbst wenn Claire mit aller Kraft zugetreten hätte, war sie nicht stark genug, um auch nur einen blauen Fleck zu verursachen.
»Einer für jede von uns? Das war’s? Sonst ist bei dir doch immer alles hochdramatisch«, ärgerte Helen sie. »Das ist viel zu einfach. Das klappt nie. Aber wie wäre es damit?«, stichelte sie weiter. »Wir verlieben uns beide in denselben Jungen oder den falschen – jedenfalls in den, der nichts von uns wissen will –, und dann kämpfen wir beide auf Leben und Tod.«
»Wovon redest du eigentlich?«, fragte Claire zuckersüß, betrachtete konzentriert ihre Fingernägel und heuchelte Unverständnis.
»Gott, Claire, das ist ja alles so vorhersehbar«, warf Helen ihr lachend an den Kopf. »Jedes Jahr staubst du diese alten Tarotkarten ab, die du damals auf dem Schulausflug nach Salem gekauft hast, und sagst jedes Mal etwas total Verblüffendes voraus. Aber das Einzige, was mich jedes Mal verblüfft, ist die Tatsache, dass du zu Beginn der Winterferien immer noch nicht ins Langeweile-Koma gefallen bist.«
»Warum wehrst du dich dagegen?«, protestierte Claire. »Du weißt, dass uns irgendwann etwas Aufregendes passieren wird. Du und ich, wir sind viel zu toll, um ganz normal zu sein.«
Helen zuckte mit den Schultern. »Ich bin sehr zufrieden damit, ganz normal zu sein. Ehrlich gesagt, wäre es für mich ein echter Schock, wenn du mit deinen verrückten Vorhersagen ausnahmsweise einmal richtigliegen würdest.«
Claire legte den Kopf zur Seite und starrte sie an. Helen strich sich das Haar hinter dem Ohr hervor, um ihr Gesicht zu verbergen. Sie hasste es, wenn man sie ansah.
»Das weiß ich. Ich glaube nur, dass du niemals ganz normal sein wirst«, sagte sie nachdenklich.
Helen wechselte das Thema. Sie plauderten über ihre Stundenpläne, das Lauftraining und ob sie sich einen Pony schneiden sollten oder nicht. Helen fand, dass ihr eine neue Frisur guttun würde, aber Claire war strikt dagegen, dass sie ihren langen blonden Haaren mit einer Schere zu Leibe rückte. Plötzlich fiel ihnen auf, dass sie, ohne es zu merken, zu dicht an den Teil der Fähre gekommen waren, den sie die »Perversen-Zone« nannten, und zogen sich eilig zurück.
Beide hassten diesen Bereich der Fähre, aber für Helen war es besonders schlimm. Er erinnerte sie an diesen ekligen Typen, der sie einen Sommer lang verfolgt hatte, bis er eines Tages von der Fähre verschwunden war. Aber anstatt erleichtert zu sein, dass er sie nicht mehr belästigte, hatte sie das Gefühl gehabt, selbst etwas falsch gemacht zu haben. Sie hatte nie mit Claire darüber gesprochen, aber da war dieser helle Blitz gewesen, und dann hatte es nach verbrannten Haaren gerochen. Und dann war der Kerl einfach weg gewesen. Helen wurde bei dem Gedanken daran immer noch ganz schlecht. Sie zwang sich zu einem Lächeln und ließ sich von Claire in einen anderen Bereich der Fähre ziehen.
Jerry tauchte beim Anlegen wieder auf und sie gingen von Bord. Claire winkte zum Abschied und versprach, Helen am nächsten Tag bei der Arbeit zu besuchen, aber da es der letzte Tag der Sommerferien sein würde, rechnete Helen nicht wirklich damit.
Helen arbeitete in den Ferien ein paar Tage in der Woche für ihren Vater, der Mitbesitzer des Inselladens war. Abgesehen von der Morgenzeitung und einer Tasse Kaffee, bekam man im News Store auch Karamellbonbons, Gummitierchen und Toffees, die in echten Kristallgläsern gelagert wurden, und Lakritzschnüre, die halbmeterweise verkauft wurden. Außerdem hatten sie immer frische Blumen, handgemachte Grußkarten, Andenken und anderen Schnickschnack für die Touristen und normale Sachen wie Milch und Eier für die Einheimischen.
Vor etwa sechs Jahren hatte der News Store sich vergrößert und Kate’s Cakes war in den hinteren Teil des Ladens eingezogen. Seitdem brummte das Geschäft. Kate Rogers war ein Genie, wenn es ums Backen ging. Sie konnte einfach aus allem Pasteten, Kuchen, Torteletts, Plätzchen oder Muffins zaubern. Sogar allgemein verhasste Gemüsesorten wie Rosenkohl und Brokkoli mussten sich von Kates Zauber geschlagen geben und wurden als Füllung in Croissants zu echten Hits.
Kate war Anfang dreißig, kreativ und intelligent. Sofort, nachdem sie Jerrys Geschäftspartnerin geworden war, hatte sie den hinteren Teil des News Store umgebaut und ihn in einen Treffpunkt für die Schriftsteller und Künstler der Insel verwandelt. Irgendwie hatte sie es geschafft, ohne dass es versnobt wirkte. Kate sorgte gezielt dafür, dass alle, die Kuchen und guten Kaffee mochten – Anzugträger ebenso wie Künstler, einheimische Handwerker ebenso wie Manager –, kein Problem damit hatten, sich zu ihr an den Tresen zu setzen und in Ruhe die Zeitung zu lesen. Kate hatte eine ganz besondere Art, jedem das Gefühl zu geben, dass er willkommen war. Helen vergötterte sie.
Als Helen am nächsten Tag zur Arbeit erschien, versuchte Kate gerade, eine Lieferung Mehl und Zucker zu verstauen. Es war mitleiderregend.
»Lennie! Ein Glück, dass du so früh kommst. Könntest du mir vielleicht helfen …?« Kate deutete auf die Zwanzig-Kilo-Säcke.
»Klar, kein Problem. Reiß doch nicht so an dem Sack herum, du ruinierst dir noch den Rücken«, warnte Helen angesichts von Kates fruchtlosen Versuchen. »Warum hat Luis das nicht gemacht? Hat er heute Vormittag nicht gearbeitet?«, fragte Helen und bezog sich damit auf einen ihrer Mitarbeiter.
»Die Lieferung kam erst, als Luis schon weg war. Ich wollte die Säcke stehen lassen, bis du kommst, aber dann ist ein Kunde beinahe darüber gestolpert, und ich musste wenigstens so tun, als würde ich das Zeug wegräumen.«
»Ich kümmere mich um das Mehl, wenn du mir dafür etwas zu essen machst«, bot Helen an und bückte sich nach dem ersten Sack.
»Abgemacht«, erwiderte Kate erleichtert. Helen wartete, bis sie sich umgedreht hatte, hob sich den Sack Mehl mühelos auf die Schulter und ging in die Küche, öffnete den Sack und füllte das Mehl in die Plastiktonne, die Kate dort benutzte. Während Helen die übrigen Säcke ins Lager trug, schenkte Kate ihr eine dieser leckeren rosa Limonaden aus Frankreich ein, einem der vielen Länder, die Helen unbedingt einmal sehen wollte.
»Es stört mich gar nicht so sehr, dass du für eine so dünne Person so unnatürlich stark bist«, bemerkte Kate, als sie für Helen ein paar Kirschen wusch und etwas Käse als Snack aufschnitt, »aber was mich total nervt, ist, dass du nicht mal außer Atem bist. Nicht mal bei dieser Hitze.«
»Und wie ich außer Atem bin«, log Helen.
»Du seufzt. Das ist etwas ganz anderes.«
»Ich habe einfach nur eine größere Lunge als du«, protestierte Helen.
»Aber du bist auch größer als ich und brauchst deswegen mehr Sauerstoff. Oder etwa nicht?«
Sie stießen mit ihren Gläsern an, tranken ihre Limonade und einigten sich auf ein Unentschieden. Kate war etwas kleiner und runder als Helen, aber keineswegs zu klein oder dick. Helen fand, dass sie einfach weibliche Rundungen hatte und damit total sexy aussah. Das sagte sie Kate allerdings nicht, weil sie es möglicherweise falsch verstehen würde.
»Ist heute eigentlich Buchklub-Abend?«, fragte Helen, nachdem sie sich eine Weile angeschwiegen hatten.
»Ja. Allerdings bezweifle ich, dass heute irgendjemand über Kundera reden will«, bemerkte Kate grinsend und schwenkte ihr Glas so heftig, dass die Eiswürfel klimperten.
»Wieso? Gibt’s neuen heißen Klatsch?«
»Brandheiß. Diese irrsinnig große Familie, die gerade auf die Insel gezogen ist.«
»In das Haus in ’Sconset?«, fragte Helen. Als Kate nickte, verdrehte sie die Augen.
»Oh, là, là! Du bist wohl zu vornehm, um mit uns zu lästern?«, neckte Kate sie und schnippte das Kondenswasser von der Außenseite ihres Glases auf Helen.
Helen tat so, als würde sie empört aufkreischen. Nachdem sie ein paar Kunden abkassiert hatte, kam sie zurück und nahm die Unterhaltung wieder auf.
»Das nicht. Ich finde nur nichts Besonderes daran, wenn eine große Familie ein großes Anwesen kauft. Vor allem, wenn sie das ganze Jahr über hier leben will. Das macht jedenfalls mehr Sinn, als wenn sich ein reiches altes Ehepaar ein Sommerhaus kauft, das so riesig ist, dass sie sich schon auf dem Weg zum Briefkasten verlaufen.«
»Das stimmt allerdings«, gab Kate zu. »Aber ich hätte wirklich gedacht, dass dich diese Familie Delos mehr interessiert. Immerhin wirst du mit einigen von ihnen deinen Schulabschluss machen«, fügte sie mit einem Schulterzucken hinzu.
Helen stand eine Sekunde lang da, während ihr der Name Delos im Kopf herumschwirrte. Der Name sagte ihr nichts. Wie sollte er auch? Und dennoch hallte in einem kleinen Teil ihres Kopfes der Name »Delos« wie ein Echo, immer wieder und wieder.
»Lennie? Woran denkst du?«, fragte Kate, wurde aber in dem Moment von den ersten Mitgliedern des Buchklubs unterbrochen, die ganz aufgeregt und bereits wild spekulierend in das Café stürmten.
Kate behielt recht. Die Unerträgliche Leichtigkeit des Seins hatte gegen die Neuigkeit von frisch zugezogenen Ganzjährigen keine Chance, zumal die Gerüchteküche zu wissen glaubte, dass die Leute vorher in Spanien gelebt hatten. Anscheinend stammten sie ursprünglich aus Boston und waren vor drei Jahren nach Europa gezogen, um näher bei ihrer weitverzweigten Familie zu leben, und jetzt hatten sie plötzlich beschlossen zurückzukommen. Dieses »plötzlich« fanden alle besonders spannend. Die Schulsekretärin hatte gegenüber einigen der Buchklub-Mitglieder geäußert, dass die Kinder erst so spät nach dem normalen Termin angemeldet worden waren, dass ihre Eltern schon beinahe zu Bestechung greifen mussten, um sie überhaupt noch einschulen lassen zu können, und dass alle möglichen Arrangements getroffen worden waren, damit die Möbel rechtzeitig zu ihrer Ankunft aus Spanien hertransportiert wurden. Offenbar hatte die Familie Spanien überstürzt verlassen, und der Buchklub war sich darüber einig, dass es Streit mit den Verwandten gegeben haben musste.
Die einzige Tatsache, die Helen aus den Gesprächen heraushören konnte, war, dass die Familie Delos ziemlich unkonventionell war. Sie bestand aus zwei Vätern, die Brüder waren, ihrer jüngeren Schwester und den insgesamt fünf Kindern, die alle zusammen auf dem Anwesen lebten. Nur einer der Männer war verheiratet, der andere war Witwer. Die ganze Familie sollte unglaublich klug und schön und reich sein. Helen verdrehte die Augen, als sie den Teil der Klatschgeschichten hörte, die diese Familie zu wahren Halbgöttern machte. Sie konnte diesen Unsinn kaum ertragen.
Helen blieb hinter dem Tresen und versuchte, das Getratsche zu ignorieren, aber das war unmöglich. Denn jedes Mal, wenn sie den Namen eines Angehörigen der Delos-Familie hörte, hatte sie das Gefühl, als hätte man ihn absichtlich laut in ihr Ohr gebrüllt, was sie ziemlich verrückt machte. Sie ging zum Ständer mit den Zeitschriften und ordnete sie, nur damit ihre Hände etwas zu tun hatten.
Als sie die Regale abwischte und die Gläser mit den Süßigkeiten zurechtrückte, ging sie die Delos-Kinder in Gedanken durch. Hector ist ein Jahr älter als Jason und Ariadne, die Zwillinge sind. Lucas und Cassandra sind Geschwister und Cousin und Cousine der drei anderen.
Sie gab den Blumen frisches Wasser und kassierte ein paar Kunden ab. Hector wird am ersten Schultag noch nicht da sein, weil er noch mit seiner Tante Pandora in Spanien ist, wenn auch niemand hier im Ort weiß, wieso.
Helen zog ein Paar schulterlange Gummihandschuhe und eine lange Schürze an und durchstöberte den Müll nach Dingen, die in die Recyclingtonne gehörten. Lucas, Jason und Ariadne kommen alle in meine Klassenstufe. Ich bin also umzingelt. Cassandra ist die Jüngste. Sie ist in ihrem ersten Highschool-Jahr, obwohl sie erst vierzehn ist.
Sie kehrte zurück in die Küche und belud die große Spülmaschine. Dann wischte sie die Böden und fing an, die Einnahmen zu zählen. Lucas ist ein total blöder Name. Der sticht heraus wie ein bandagierter Daumen.
»Lennie?«
»Was? Dad! Siehst du nicht, dass ich zähle?«, fauchte Helen ihren Vater an und schlug mit beiden Händen so heftig auf den Tresen, dass der Vierteldollar-Stapel hochhüpfte. Jerry hob beruhigend beide Hände.
»Morgen ist der erste Schultag«, erinnerte er sie mit seiner vernünftigsten Stimme, die er aufsetzen konnte.
»Ich weiß«, antwortete sie gelangweilt. Sie war immer noch unerklärlich gereizt, bemühte sich aber, es nicht an ihrem Vater auszulassen.
»Es ist fast elf, Liebes«, sagte er. Kate kam von hinten, um nachzusehen, was los war.
»Du bist noch da? Es tut mir leid, Jerry«, sagte sie verblüfft. »Helen, ich hatte dir um neun gesagt, dass du abschließen und nach Hause gehen sollst.«
Die beiden sahen Helen an, die alle Scheine und Münzen ordentlich aufgestapelt hatte.
»Ich bin abgelenkt worden«, murmelte sie verlegen.
Nachdem Kate und Jerry einen besorgten Blick getauscht hatten, übernahm Kate die Abrechnung und schickte die beiden nach Hause. Immer noch wie benebelt, gab Helen Kate einen Abschiedskuss und versuchte zu rekonstruieren, wo die letzten drei Stunden ihres Lebens geblieben waren.
Jerry verlud Helens Rad ins Auto und startete wortlos den Motor. Auf der Heimfahrt warf er ihr gelegentlich einen Blick zu, sagte aber erst wieder etwas, als sie in der Einfahrt hielten.
»Hast du gegessen?«, fragte er sanft und hob die Brauen.
»Ob ich … was?« Helen hatte keine Ahnung mehr, wann sie zuletzt etwas gegessen hatte. Sie erinnerte sich vage daran, dass Kate ihr einen Teller mit Kirschen hingestellt hatte.
»Bist du nervös, weil morgen die Schule wieder anfängt? Dieses Schuljahr ist ziemlich wichtig.«
»Ja, wahrscheinlich«, antwortete Helen geistesabwesend. Jerry warf ihr erneut einen Blick zu und biss sich auf die Unterlippe. Er atmete hörbar aus, bevor er weitersprach.
»Ich finde, du solltest mit Dr. Cunningham über diese Phobie-Pillen sprechen. Du weißt schon, diese Tabletten für Leute, die Menschenmengen nicht gut vertragen. Agoraphobie! Genau, so hieß das«, stieß er hervor, nachdem es ihm wieder eingefallen war. »Meinst du, dass die dir helfen würden?«
Helen lächelte und ließ ihren Anhänger an der Kette hin und her baumeln. »Ich glaube nicht, Dad. Ich habe keine Angst vor Leuten. Ich bin nur schüchtern.«
Sie wusste, dass das gelogen war. Sie war nicht nur schüchtern. Jedes Mal, wenn sie auch nur versehentlich die Aufmerksamkeit auf sich zog, bekam sie solche Bauchschmerzen, als hätte sie eine Darmgrippe oder Menstruationsbeschwerden – und zwar richtig schlimme –, aber sie würde sich eher die Zunge abbeißen, als es ihrem Vater zu sagen.
»Und du kommst damit zurecht? Ich weiß, dass du nie fragen würdest, aber brauchst du Hilfe? Ich glaube nämlich, dass es dich daran hindert, dein volles Potenzial …«, begann Jerry eines ihrer ältesten Streitgespräche.
Helen unterbrach ihn sofort. »Es geht mir gut! Ehrlich. Ich will nicht zu Dr. Cunningham und ich will keine Tabletten nehmen. Ich will nur reingehen und essen«, sagte sie hastig und stieg aus dem Wagen.
Ihr Vater sah mit dem Anflug eines Lächelns zu, wie Helen ihr schweres altmodisches Fahrrad von der Ladefläche des Jeeps hob und auf den Boden stellte. Sie ließ die Fahrradklingel ertönen und grinste ihren Vater an.
»Siehst du, mir geht’s gut«, sagte sie.
»Wenn du wüsstest, wie schwer das, was du gerade aus dem Auto gehoben hast, für durchschnittliche Mädchen in deinem Alter ist, wüsstest du, was ich sagen will. Du bist nicht durchschnittlich, Helen. Du versuchst zwar, so zu tun, aber du bist es nicht. Du bist wie sie«, sagte er und verstummte.
Zum tausendsten Mal verfluchte Helen die Mutter, die sie nicht kannte, dafür, dass sie ihrem Vater sein liebes Herz gebrochen hatte. Wie konnte jemand einen guten Menschen wie ihn einfach verlassen, ohne sich auch nur zu verabschieden? Ohne ein einziges Foto als Erinnerungsstück zu hinterlassen?
»Also gut, du hast gewonnen! Ich bin etwas Besonderes – genau wie jeder andere«, neckte ihn Helen in dem verzweifelten Bemühen, ihn aufzuheitern. Im Vorbeigehen knuffte sie ihn mit der Hüfte und schob dann ihr Rad in die Garage. »Und was gibt es zu essen? Ich verhungere und diese Woche bist du Küchensklave.«
2
Da Helen immer noch kein eigenes Auto hatte, musste sie am nächsten Morgen mit dem Rad zur Schule fahren. Normalerweise war es um Viertel vor acht noch kühl, und es wehte ein leichter Wind vom Meer, aber Helen spürte schon beim Aufwachen die feuchte, heiße Luft, die auf ihr lastete wie ein nasser schwerer Pelzmantel. Sie hatte nachts die dünne Bettdecke weggestrampelt, das T-Shirt ausgezogen und das ganze Wasserglas auf dem Nachttisch leer getrunken und war trotzdem von der Hitze total erschöpft aufgewacht. Dieses Wetter war absolut inseluntypisch, und Helen verspürte nicht die geringste Lust, aufzustehen und zur Schule zu gehen.
Sie radelte extra langsam, um nicht den Rest des Tages zu riechen, als käme sie gerade vom Sportunterricht. Sie schwitzte zwar nie viel, aber sie war am Morgen so durcheinander gewesen, dass sie sich nicht daran erinnern konnte, ob sie ihr Deo benutzt hatte oder nicht. Erleichtert nahm sie den Hauch eines fruchtigen Dufts wahr. Er war schwach, stammte also vermutlich vom Tag zuvor, aber er musste ohnehin nur bis zum Lauftraining nach der Schule halten. Was allerdings an ein Wunder grenzen würde.
Als sie die Surfside Road entlangradelte, spürte sie, wie ihr die Haare an Wangen und Stirn festklebten. Von ihrem Haus zur Schule war es zwar nicht weit, aber als sie ihr schäbiges altes Rad anschloss, war ihre kunstvolle Erster-Schultag-nach-den-Ferien-Frisur bereits eine einzige Katastrophe. Sie kettete ihr Fahrrad nur an, weil sie es wegen der Touristensaison so gewöhnt war, und nicht, weil es einer ihrer Mitschüler womöglich stehlen würde. Was ganz gut war, denn ihr Fahrradschloss war genauso schäbig wie das Rad.
Sie fuhr mit den Fingern durch ihre zerzausten Haare und band alles wieder zusammen, diesmal zu einem langweiligen Pferdeschwanz. Mit einem Seufzer schwang sie sich die Schultasche über eine Schulter und den Sportbeutel über die andere und schlurfte mit hängendem Kopf auf den Eingang zu.
Dort traf sie genau eine Sekunde vor Lindsey Clifford ein und war gezwungen, ihr die Tür aufzuhalten.
»Danke, Freak. Versuch, sie nicht aus den Angeln zu reißen, okay?«, sagte Lindsey hochnäsig und rauschte an Helen vorbei.
Helen stand wie angewurzelt am oberen Ende der Stufen und hielt die Tür für weitere Schüler auf, die an ihr vorbeigingen, als wäre sie eine Angestellte. Nantucket war eine kleine Insel, und jeder kannte jeden peinlich gut, aber manchmal wünschte Helen, dass Lindsey etwas weniger über sie wüsste. Sie waren bis zur fünften Klasse beste Freundinnen gewesen, und Helen, Lindsey und Claire hatten in Lindseys Haus Verstecken gespielt, bis Helen aus Versehen die Badezimmertür aus den Angeln gerissen hatte, als Lindsey gerade im Bad war. Helen hatte versucht, sich dafür zu entschuldigen, aber vom nächsten Tag an hatte Lindsey sie komisch angesehen und sie zum ersten Mal als Freak bezeichnet. Und seitdem schien sie es darauf anzulegen, Helen das Leben zur Hölle zu machen. Es half auch nicht, dass Lindsey zur Clique der Angesagten gehörte, während Helen sich bei den Strebern versteckte.
Sie hätte zu gern gekontert und Lindsey einen frechen Spruch hinterhergerufen, wie es Claire getan hätte, aber sie brachte kein Wort heraus. Stattdessen klappte sie nur mit dem Fuß den Türstopper herunter, damit die Tür für alle anderen offen blieb. Damit hatte ein weiteres Jahr des Unsichtbarseins offiziell begonnen.
Die Morgenversammlung leitete Mr Hergesheimer. Er unterrichtete Englisch und hatte für einen Typ um die fünfzig einen eigenwilligen Modegeschmack. Wenn es warm war, trug er Seidenkrawatten und bei Kälte knallbunte Kaschmirschals, und er fuhr ein uraltes Alfa Romeo Cabrio. Er hatte Geld wie Heu und hätte nicht arbeiten müssen, aber er unterrichtete trotzdem. Er sagte, dass er keine Lust hätte, auf Schritt und Tritt über ungebildete Trottel zu stolpern. Zumindest war das seine Version. Helen war überzeugt, dass er es tat, weil er seinen Job liebte. Ein paar Schüler konnten ihn nicht leiden und fanden, dass er ein eingebildeter Möchtegern-englischer-Snob war, aber Helen war überzeugt, dass er zu den besten Lehrern gehörte, die sie jemals hatte.
»Helen«, sagte er freudig, als sie genau zum ersten Läuten zur Tür hereinkam. »Pünktlich wie immer. Ich vermute, dass du neben deiner gewohnten Sitznachbarin Platz nehmen möchtest, aber vorab eine Warnung. Ein Hinweis darauf, warum eine von euch das Alias Giggles hat, und ich werde euch trennen.«
»Alles klar, Hergie«, rief Claire. Helen rutschte auf den Stuhl neben sie. Hergie verdrehte bei dieser kleinen Respektlosigkeit die Augen, war aber dennoch zufrieden.
»Wie schön, dass zumindest eine meiner Schülerinnen weiß, dass ein Alias in diesem Fall dasselbe ist wie ein Spitzname, auch wenn ihre Erwiderung ein wenig impertinent war. Nun, meine lieben Schüler, noch eine Warnung: Da ihr euch dieses Jahr auf eure Zwischenprüfung vorbereiten müsst, erwarte ich, dass ihr mir jeden Morgen die Bedeutung eines unbekannten Fremdwortes erklärt.«
Die Klasse stöhnte auf. Nur Mr Hergesheimer konnte so grausam sein, schon bei der morgendlichen Versammlung Hausaufgaben aufzugeben. So etwas gehörte sich einfach nicht.
»Kann ›impertinent‹ unser Wort für morgen sein?«, fragte Zach Brant eifrig.
Zach war schon immer eifrig gewesen, schon seit dem Kindergarten. Neben Zach saß Matt Millis, der ihn schräg ansah und den Kopf schüttelte, als wollte er sagen: »Das würde ich an deiner Stelle lieber lassen.«
Matt, Zach und Claire waren im LK. Sie waren Freunde, aber mit zunehmendem Alter wurde ihnen klar, dass nur einer von ihnen Jahrgangsbester sein und nach Harvard gehen konnte. Helen hielt sich aus diesem Wettbewerb heraus, vor allem, weil sie Zach in den letzten Jahren immer weniger mochte. Eigentlich, seit Zachs Vater der Footballtrainer war und seinen Sohn drängte, sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Schule die Nummer eins zu sein. Seitdem war Zach so ehrgeizig, dass Helen es kaum noch ertragen konnte, in seiner Nähe zu sein.
Ein Teil von ihr bedauerte ihn. Er hätte ihr sogar noch mehr leidgetan, wenn er nicht ständig versucht hätte, sie zu übertrumpfen. Zach musste immer alles sein – Präsident dieses Klubs, Kapitän jener Mannschaft, der Junge, der allen Klatsch kannte –, aber er machte nie den Eindruck, als hätte er Freude an irgendetwas davon. Claire behauptete, dass Zach heimlich in Helen verliebt war, aber Helen glaubte kein Wort davon. Manchmal hatte sie sogar das Gefühl, dass Zach sie hasste, und das bedrückte sie. In der ersten Klasse hatte er in den Pausen seine Cracker in Tierform mit ihr geteilt, und jetzt suchte er ständig nach Gelegenheiten, mit ihr zu streiten. Wann war das alles so kompliziert geworden, und wieso konnten sie nicht einfach alle Freunde sein, so wie in der Grundschule?
»Zach, du kannst ›impertinent‹ gern als dein Wort nehmen, wenn du willst«, sagte Mr Hergesheimer, »aber von jemandem mit deiner Auffassungsgabe erwarte ich etwas mehr. Vielleicht einen Aufsatz über Impertinenz in der Literatur?« Er nickte. »Ja, fünf Seiten über Salingers Verwendung von Impertinenz in seinem umstrittenen Fänger im Roggen. Bitte bis Montag.«
Helen konnte praktisch spüren, wie zwei Plätze weiter Zachs Handflächen zu schwitzen begannen. Hergies Angewohnheit, Schülern, die sich für oberschlau hielten, Extrahausaufgaben aufzubrummen, war legendär. Anscheinend hatte er gleich am ersten Tag an Zach ein Exempel statuieren wollen. Helen dankte ihren Glückssternen, dass Hergie sie verschont hatte.
Aber sie hatte sich zu früh gefreut. Nachdem Mr Hergesheimer ihnen den Stundenplan gegeben hatte, rief er Helen zu sich. Er erlaubte den anderen, sich zu unterhalten, und es brach sofort das für den ersten Schultag typische Geplauder aus. Hergie ließ Helen auf einem Stuhl neben sich Platz nehmen. Offenbar wollte er nicht, dass die anderen hörten, was er zu sagen hatte. Das beruhigte Helen ein wenig.
»Ich habe festgestellt, dass du dich dieses Jahr für keinen einzigen Leistungskurs eingetragen hast«, sagte er und musterte sie über den Rand seiner halbmondförmigen Lesebrille.
»Ich dachte, die zusätzliche Arbeit würde mir zu viel«, murmelte Helen. Sie schob die Hände unter ihre Oberschenkel, damit sie sich nicht bewegen konnten.
»Ich glaube, du kannst viel mehr, als du zugeben willst«, sagte Hergie mit einem Stirnrunzeln. »Ich weiß, dass du nicht faul bist, Helen. Ich weiß auch, dass du eine meiner klügsten Schülerinnen bist. Wieso nutzt du nicht aus, was unser Schulsystem dir zu bieten hat?«
»Ich muss arbeiten«, sagte sie mit einem hilflosen Schulterzucken. »Ich muss sparen, wenn ich aufs College will.«
»Wenn du in die Leistungskurse gehst und eine gute Zwischenprüfung hinlegst, sind deine Chancen auf genügend Geld fürs College größer, weil dir ein Stipendium mehr bringt als der Mindestlohn im Laden deines Vaters.«
»Mein Dad braucht mich. Wir sind nicht reich wie alle anderen auf der Insel, aber wir sind füreinander da«, verteidigte sich Helen.
»Das ist wirklich bewundernswert von euch beiden, Helen«, erwiderte Hergie ernst. »Aber du wirst nicht mehr lange auf die Highschool gehen, und es wird Zeit, dass du an deine eigene Zukunft denkst.«
»Ich weiß«, sagte Helen und nickte. An seinem sorgenvollen Gesicht konnte sie erkennen, dass er sich wirklich Gedanken um sie machte und ihr helfen wollte. »Ich denke, dass ich ein ganz gutes Sportstipendium fürs Laufen kriegen könnte. Ich bin in den Sommerferien viel schneller geworden. Ehrlich.«
Mr Hergesheimer sah ihr ins Gesicht und schließlich gab er nach. »Ist gut. Aber wenn du irgendwann das Gefühl hast, eine akademische Herausforderung zu brauchen, kannst du jederzeit in meinen Englischkurs einsteigen.«
»Danke, Mr Hergesheimer. Wenn ich denke, dass ich mit dem Leistungskurs zurechtkomme, melde ich mich bei Ihnen«, beteuerte Helen, die nur froh war, dass sie es überstanden hatte.
Auf dem Rückweg zu ihrem Platz wurde Helen klar, dass sie Hergie unter allen Umständen von ihrem Vater fernhalten musste. Die beiden durften auf keinen Fall darüber reden, dass sie besondere Kurse wählen sollte. Schon bei dem Gedanken daran bekam sie Bauchschmerzen. Warum konnten die anderen sie nicht einfach ignorieren? Insgeheim hatte Helen immer das Gefühl gehabt, anders zu sein, obwohl sie sich ihr ganzes Leben lang alle Mühe gegeben hatte, es zu verbergen. Aber offenbar hatte sie, ohne es zu merken, Hinweise auf den in ihr versteckten Freak gegeben. Sie musste versuchen, weiterhin den Kopf einzuziehen. Die Frage war nur, wie sie das anstellen sollte, wo sie doch jeden verdammten Tag ein Stückchen größer wurde.
»Was war denn?«, fragte Claire sofort, als Helen zurückkam.
»Ach, nur mal wieder eine von Hergies Motivationsansprachen. Er ist der Meinung, ich tue nicht genug«, sagte Helen so gleichgültig, wie sie nur konnte.
»Du tust ja auch nicht genug. Du machst nie mehr als unbedingt nötig«, mischte sich Zach ein. Er klang empörter, als es ihm zustand.
»Halt den Mund, Zach«, fuhr Claire ihn an und verschränkte herausfordernd die Arme vor der Brust. Dann drehte sie sich wieder zu Helen um. »Es stimmt aber, Lennie«, sagte sie entschuldigend. »Du machst wirklich nie mehr als nötig.«
»Ja, ja. Ihr könnt beide den Mund halten«, konterte Helen und kicherte. Dann läutete die Pausenglocke und Helen sammelte ihre Sachen zusammen. Matt Millis lächelte ihr zu, eilte aber sofort davon, als sie alle den Raum verließen. Schuldbewusst erkannte Helen, dass sie noch kein Wort mit ihm gewechselt hatte. Dabei hatte sie ihn gar nicht ignorieren wollen, jedenfalls nicht am ersten Schultag.
Claire zufolge wussten »alle«, dass Helen und Matt »angeblich« ein Paar waren. Matt war intelligent, sah gut aus und war Kapitän des Golfteams. Er wurde zwar als Streber angesehen, aber da Helen praktisch eine Außenseiterin war, seit Lindsey angefangen hatte, Gemeinheiten über sie zu verbreiten, war es geradezu ein Kompliment, dass die anderen sie für gut genug hielten, um mit jemandem wie Matt auszugehen.
Leider empfand Helen nicht das Geringste für ihn. Null Kribbeln. Das eine Mal, als man sie auf einer Party zusammen in einen Schrank gesperrt hatte, wo sie herumknutschen sollten, war schrecklich gewesen. Helen hatte das Gefühl, ihren Bruder zu küssen, und Matt hatte sich zurückgestoßen gefühlt. Danach war er zwar immer noch sehr nett zu ihr gewesen, aber seitdem herrschte zwischen ihnen doch eine gewisse Spannung. Er fehlte ihr wirklich, aber sie fürchtete, dass er es falsch verstehen könnte, wenn sie ihm das sagte. Es kam Helen so vor, als würden die Leute in letzter Zeit alles, was sie sagte, in den falschen Hals kriegen.
Den Rest des Vormittags wandelte Helen wie ferngesteuert von einem Kurs zum nächsten. Sie konnte sich nicht konzentrieren, und jedes Mal, wenn sie es versuchte, überkam sie eine unerklärliche Gereiztheit.
Irgendetwas stimmte nicht. Ihr ging jeder – von ihren Lieblingslehrern bis zu den paar Bekannten, über deren Wiedersehen sie sich eigentlich freuen sollte – auf die Nerven, und auf dem Weg durch die Flure hatte sie plötzlich immer wieder das Gefühl, in einem Flugzeug in 3000 Metern Höhe zu sitzen. Ihre Ohren fühlten sich an wie verstopft, alle Geräusche kamen nur noch gedämpft an, und ihr Kopf wurde ganz heiß. So plötzlich, wie es gekommen war, verschwand es dann auch wieder. Aber trotzdem spürte sie überall um sich herum einen gewissen Druck, wie die Energie vor einem Gewitter, obwohl der Himmel klar und blau war.
Beim Mittagessen wurde es noch schlimmer. Gierig biss sie in ihr Sandwich, weil sie dachte, dass ihre Kopfschmerzen vielleicht mit einem zu niedrigen Blutzuckerspiegel zusammenhingen, aber das war nicht der Fall. Jerry hatte extra ihr Lieblingssandwich eingepackt – geräucherten Putenaufschnitt mit Apfelscheiben und Brie auf Baguette –, aber sie bekam noch nicht mal einen Bissen runter.
»Hat dein Dad eine neue Katastrophe gebastelt?«, fragte Claire. Als Jerry die Partnerschaft mit Kate eingegangen war, hatte er angefangen, kreative Lunchpakete für Helen zu packen. Das Schmelzkäse-und-Gurke-Desaster ihres ersten Highschool-Jahres war an ihrem Tisch schon legendär.
»Nein, es ist die gute alte Nummer drei. Ich habe nur keinen Appetit«, sagte Helen und schob ihr Essen weg. Claire schnappte sich gierig das Sandwich und fing an zu kauen.
»Mmmh, ’ichtig ’ut«, murmelte sie mit vollem Mund. »’ist ’n los mit dir?«
»Ich fühl mich einfach komisch«, sagte Helen.
Claire hörte auf zu kauen und warf ihr einen besorgten Blick zu.
»Ich bin nicht krank. Du kannst ruhig weiterkauen«, versicherte ihr Helen hastig. Sie sah Matt näher kommen und rief »Hey!«, um wiedergutzumachen, was sie am Morgen versäumt hatte.
Er war so ins Gespräch mit Lindsey und Zach vertieft, dass er nicht reagierte, aber zumindest steuerte er seinen gewohnten Platz am Strebertisch an. Und Lindsey und Zach waren durch ihre Unterhaltung so abgelenkt, dass sie ihren Abstecher ins Streberland nicht einmal bemerkten.
»Ich habe gehört, dass sie in Europa Filmstars waren«, sagte Zach.
»Wo hast du das denn gehört?«, fragte Matt ungläubig. »Das ist doch lächerlich.«
»Ich habe von mindestens zwei Leuten gehört, dass Ariadne Model war. Hübsch genug ist sie dafür jedenfalls«, beteuerte Zach hitzig. Er hasste es, den Kürzeren zu ziehen, auch wenn es nur um Klatsch und Tratsch ging.
»Also bitte. Sie ist doch längst nicht dünn genug, um Model zu sein«, zischte Lindsey boshaft. Dann riss sie sich zusammen und fügte hinzu: »Natürlich finde ich sie sehr hübsch, wenn man auf diesen exotisch-sinnlichen Look steht. Aber sie ist nichts, verglichen mit ihrem Zwillingsbruder Jason – oder ihrem Cousin. Lucas ist geradezu überirdisch«, schwärmte sie.
Die Jungen tauschten einen bedeutungsvollen Blick, aber da die Mädchen in der Überzahl waren, einigten sie sich wortlos darauf, lieber den Mund zu halten.
»Jason ist schon fast zu hübsch«, verkündete Claire ernsthaft, nachdem sie einen Moment darüber nachgedacht hatte. »Und Lucas ist der Hammer. Ich glaube, ich habe noch nie einen Jungen gesehen, der so gut aussieht. Und Ariadne ist eine echte Schönheit, Lindsey. Du bist ja nur neidisch auf sie.«
Lindsey schnaufte empört und stemmte eine Faust in die Hüfte. »Als wärst du das nicht«, war alles, was ihr dazu einfiel.
»Klar bin ich das. Ich bin fast so neidisch auf sie wie auf Lennie. Aber nur fast.« Helen spürte, wie sich Claire zu ihr umdrehte, um ihre Reaktion zu sehen, aber sie hatte die Ellbogen auf den Tisch gelegt, die Hände am Kopf und massierte ihre Schläfen.
»Lennie?«, sagte Matt und setzte sich neben sie. »Hast du Kopfweh?« Er streckte die Hand aus, um ihre Schulter zu berühren, doch sie sprang auf, murmelte eine Entschuldigung und eilte davon.
Als sie die Mädchentoilette erreicht hatte, ging es ihr schon besser, aber sie spritzte sich trotzdem noch kaltes Wasser ins Gesicht. Dann fiel ihr wieder ein, dass sie am Morgen Mascara aufgetragen hatte, um sich wenigstens am ersten Schultag etwas Mühe zu geben. Sie betrachtete ihre Waschbärenaugen im Spiegel und prustete los. Das war der schlimmste erste Schultag aller Zeiten.
Irgendwie überstand sie auch die letzten drei Schulstunden, und als die Glocke endlich läutete, ging sie erleichtert in den Umkleideraum der Mädchen, um sich für den Geländelauf umzuziehen.
Coach Tar war in Bestform. Sie hielt eine unangenehm optimistische Ansprache über ihre Chancen, in diesem Jahr viele Rennen zu gewinnen, und versicherte ihnen, wie sehr sie an sie glaubte. Dann sah sie Helen an.
»Hamilton. Du läufst dieses Jahr gegen die Jungen«, sagte der Coach ohne Umschweife. Dann befahl sie allen, an den Start zu gehen.
Helen saß noch einen Moment lang auf der Bank und überlegte, was sie tun konnte, während die anderen schon zur Tür hinausströmten. Sie wollte keinen Aufstand machen, aber der Gedanke, die Grenze zwischen den Geschlechtern überschreiten zu müssen, ließ sie vor Angst erstarren. Die Muskeln in ihrem Unterbauch begannen sich zu verkrampfen.
»Los, rede mit ihr! Lass dich nicht von ihr rumschubsen«, sagte Claire empört, bevor auch sie hinausging. Verwirrt und voller Angst vor den Bauchschmerzen, die sie gleich bekommen würde, nickte Helen und stand auf.
»Coach Tar? Können wir es nicht so machen wie immer?«, rief sie. Coach Tar blieb stehen und drehte sich zu ihr um, aber besonders glücklich sah sie nicht aus. »Ich meine, warum kann ich nicht mit den Mädchen trainieren? Immerhin bin ich ein Mädchen«, beendete Helen ihren Appell lahm.
»Wir haben entschieden, dass du dich mehr anstrengen musst«, erwiderte Coach Tar mit eisiger Stimme. Helen hatte schon immer das Gefühl gehabt, dass die Trainerin sie nicht besonders mochte, aber jetzt war sie sich dessen sicher.
»Aber ich bin kein Junge. Es ist nicht fair, dass ich mit ihnen im Gelände laufen soll«, versuchte Helen zu argumentieren und bohrte währenddessen unterhalb des Nabels zwei Finger in ihren Bauch.
»Krämpfe?«, fragte Coach Tar, und plötzlich war in ihrer Stimme ein Hauch von Mitgefühl zu hören. Helen nickte und die Trainerin sprach weiter. »Coach Brant und ich haben etwas Interessantes bezüglich deiner Zeiten festgestellt, Helen. Gegen wen du auch läufst, egal, ob es schnelle oder langsame Läufer sind, du kommst immer als Zweite oder Dritte ins Ziel. Wie kann das sein? Hast du eine Erklärung dafür?«
»Nein. Ich weiß es nicht. Ich laufe einfach, okay? Ich tue mein Bestes.«
»Nein, das tust du nicht«, widersprach Coach Tar entschieden. »Und wenn du ein Stipendium haben willst, musst du anfangen, die Läufe zu gewinnen. Ich habe mit Mr Hergesheimer gesprochen …« Helen stöhnte auf, aber der Coach ließ sich nicht davon beeindrucken. »Das hier ist eine kleine Schule, Hamilton, gewöhn dich dran. Mr Hergesheimer hat mir erzählt, dass du auf ein Sportstipendium hoffst, aber wenn du das willst, musst du es dir verdienen. Vielleicht nimmst du dein Talent ernst, wenn du gegen die Jungen antreten musst.«
Helen hatte solche Angst davor, richtige Krämpfe oder Bauchschmerzen zu bekommen, dass sie eine Mini-Panikattacke bekam. Sie begann, hektisch draufloszureden. »Ich tue es ja, ich gewinne die Läufe, aber bitte zwingen Sie mich nicht, die Einzige zu sein, die mit den Jungs läuft«, flehte sie, und die Worte sprudelten nur so aus ihr heraus, weil sie den Atem anhielt, um die Schmerzen unter Kontrolle zu halten.
Coach Tar war zwar hart wie Stahl, aber sie war nicht grausam. »Alles in Ordnung?«, fragte sie besorgt und rieb Helens Rücken zwischen den Schulterblättern. »Halt den Kopf zwischen die Knie.«
»Mir geht’s gut. Es sind nur die Nerven«, erklärte Helen mit zusammengebissenen Zähnen. Nachdem sie Luft geholt hatte, fuhr sie fort. »Wenn ich schwöre, mehr Läufe zu gewinnen, lassen Sie mich dann weiter mit den Mädchen laufen?«
Coach Tar sah in Helens verzweifeltes Gesicht und nickte, ein wenig geschockt von der Panikattacke, die sie gerade miterlebt hatte. Sie ließ Helen zum Start der Mädchenstrecke laufen, ermahnte sie aber, dass sie trotzdem Siege erwartete. Und zwar mehr als nur ein paar.
Beim Geländelauf sah Helen auf den Boden. Ein Sportstipendium wäre toll, aber das würde bedeuten, dass sie mit Claire um die Zensuren konkurrieren musste, und das kam nicht infrage.
»Hey, Giggles«, sagte Helen, die ihre Freundin mühelos eingeholt hatte. Claire schwitzte und schnaufte schon jetzt.
»Was war denn? Gott, ist das heiß!«, beschwerte sie sich keuchend.
»Ich glaube, die gesamte Schule probiert gerade, ob alle gleichzeitig auf meinen Rücken steigen können.«
»Willkommen in meiner Welt«, schnaufte Claire. »Japanische Kinder wachsen … mit mindestens zwei … Leuten auf dem Buckel auf … Man gewöhnt sich daran.« Nach ein paar weiteren qualvollen Momenten, in denen sie versuchte, mit Helen mitzuhalten, fügte Claire japsend hinzu: »Können wir … langsamer laufen? Nicht jeder ist … vom Planeten Krypton.«
Helen passte ihr Tempo der Freundin an, obwohl sie wusste, dass sie auf den letzten paar Hundert Metern Gas geben musste. Das Training strengte sie nie besonders an, und ihr war klar, dass sie siegen konnte, ohne sich zu verausgaben. Diese Tatsache machte ihr Angst, aber wie immer, wenn Gedanken an ihre unnatürliche Schnelligkeit in ihrem Kopf auftauchten, verdrängte sie sie schnell wieder und plauderte mit Claire.
Während die Mädchen die Surfside Road hinunter und quer durch die feuchte Landschaft zum Miacomet Pond liefen, konnte Claire nicht aufhören, von den Delos-Jungen zu erzählen. Sie berichtete Helen mindestens drei Mal, wie Lucas ihr nach dem Ende der Stunde die Tür aufgehalten hatte. Das bewies nicht nur, dass er Manieren hatte, sondern auch, dass er bereits in sie verknallt war. Jason dagegen, verkündete Claire, war entweder schwul oder ein eingebildeter Schnösel, denn er hatte sie nur mit einem kurzen Blick bedacht und dann sofort wieder weggesehen. Außerdem passte es ihr nicht, dass er sich wie ein Europäer kleidete.
»Er hat doch die letzten drei Jahre in Spanien gelebt, Gig. Damit ist er so etwas wie ein Europäer. Können wir jetzt bitte aufhören, über sie zu reden? Ich kriege Kopfweh davon.«
»Wieso bist du die einzige Person der ganzen Schule, die sich nicht für die Delos-Familie interessiert? Bist du denn gar nicht neugierig, sie mal zu sehen?«
»Nein! Und ich finde es total peinlich, dass der ganze Ort sie anstarrt, als wären wir eine Horde Hinterwäldler!«, brüllte Helen.
Claire blieb abrupt stehen und starrte sie an. Es passte nicht zu Helen, dass sie diskutierte, geschweige denn brüllte, aber irgendwie schien sie nicht damit aufhören zu können.
»Diese Delos-Familie langweilt mich zu Tode!«, fauchte Helen weiter. »Es macht mich krank, wie besessen alle von diesen Leuten sind, und ich hoffe, dass ich nie einen von ihnen treffe, sehe oder meine Atemluft mit ihm teilen muss.«
Helen sprintete los und ließ Claire allein auf dem Weg stehen. Sie kam als Erste ins Ziel, wie sie es versprochen hatte, aber sie war ein wenig zu schnell gewesen: Coach Tar sah sie geschockt an, als sie ihre Zeit stoppte. Helen rannte an ihr vorbei und stürmte in den Umkleideraum. Dort schnappte sie sich ihre Sachen und verließ fluchtartig die Schule, ohne sich vorher umzuziehen oder sich von irgendwem zu verabschieden.
Auf dem Heimweg fing sie an zu weinen. Sie radelte an den Häuschen mit den schwarz-weiß gestrichenen Fensterläden vorbei und versuchte, sich wieder zu beruhigen. Es sah aus, als würde die Sonne tiefer über dem trockenen Land stehen als sonst. Fast schien es, als drückte sie mit Macht auf die Giebel der alten Walfängerhäuser, um sie nach Jahrhunderten des störrischen Widerstands jetzt endlich in die Knie zu zwingen. Helen hatte keine Ahnung, wieso sie so wütend geworden war oder wieso sie ihre beste Freundin einfach allein stehen gelassen hatte. Sie brauchte einfach etwas Ruhe.
Auf der Surfside Road war ein Unfall passiert. Ein riesiger Geländewagen hatte versucht, in eine schmale, von Sandwällen gesäumte Seitenstraße einzubiegen, und war umgekippt. Den Insassen war nichts passiert, aber ihr Auto blockierte die gesamte Straße wie ein gestrandeter Wal. In ihrer derzeitigen gereizten Stimmung wusste Helen genau, dass sie ausrasten würde, wenn sie versuchte, sich an diesen dämlichen Touristen vorbeizudrängen. Also beschloss sie, den langen Weg nach Hause zu nehmen. Sie drehte um und fuhr zurück Richtung Ortsmitte, vorbei am Kino, dem Fähranleger und der Bücherei, die im Stil eines griechischen Tempels gebaut worden war und überhaupt nicht zu den übrigen Gebäuden der Insel passte, die vier Jahrhunderte puritanischer Bauweise repräsentierten. Genau das war der Grund, wieso Helen die Bücherei so liebte. Das Athenäum war eine Art fremdartiger weißer Lichtstrahl mitten im öden Grau und irgendwie identifizierte sich Helen mit beidem. Eine Hälfte von ihr war typisch Nantucket – ernsthaft und vernünftig –, aber die andere Hälfte waren Marmorsäulen und imposante Treppen, die dort nicht hingehörten, wo man sie gebaut hatte. Im Vorbeiradeln schaute Helen zum Athenäum auf und lächelte. Sie empfand den Gedanken als tröstlich, dass es etwas gab, das noch mehr aus der Masse herausstach als sie.
Zu Hause angekommen, versuchte sie, sich zusammenzureißen, und duschte eiskalt, bevor sie Claire anrief, um sich bei ihr zu entschuldigen. Claire nahm nicht ab. Helen hinterließ ihr eine lange Nachricht, in der sie die Schuld auf Hormone, die Hitze, Stress und alles andere schob, was ihr gerade einfiel, obwohl sie tief in ihrem Innern wusste, dass nichts davon für ihren Ausbruch verantwortlich gewesen war. Sie war schon den ganzen Tag so gereizt.
Die Luft draußen war immer noch drückend. Helen machte alle Fenster des zweistöckigen Hauses auf, aber es wehte kein Lüftchen hindurch. Was war das für ein verrücktes Wetter? Windstille gab es auf Nantucket praktisch nie – wenn man so dicht am Meer lebte, wehte immer eine leichte Brise. Helen zog ein dünnes Top und ihre kürzesten Shorts an. Da es ihr peinlich war, so knapp bekleidet hinauszugehen, beschloss sie, das Abendessenkochen zu übernehmen. Eigentlich war diese Woche ihr Vater der Küchensklave und damit noch ein paar Tage lang fürs Einkaufen, Kochen und Abwaschen zuständig, aber um nicht die Wände hochzugehen, musste sie sich unbedingt mit etwas beschäftigen.
Pasta verbesserte Helens Laune fast immer und Lasagne war die Königin unter den Pastagerichten. Und wenn sie die Pasta selbst herstellte, würde sie stundenlang damit zu tun haben, was genau das war, was sie wollte. Also holte sie Mehl und Eier und machte sich an die Arbeit.
Als Jerry nach Hause kam, war der leckere Duft das Erste, was er zur Kenntnis nahm. Helen saß am Küchentisch, Mehl klebte in ihrem verschwitzten Gesicht und an ihren Armen, und sie spielte an dem Herzanhänger an der Kette herum, die ihre Mutter ihr gegeben hatte, als sie noch ein Baby war. Jerry sah sich mit großen Augen und angespannten Schultern um.
»Hab Essen gemacht«, sagte Helen ausdruckslos.
»Habe ich etwas falsch gemacht?«, fragte er zögernd.
»Natürlich nicht. Wieso fragst du, ich hab doch nur Essen für dich gekocht.«
»Wenn eine Frau Stunden damit verbringt, ein aufwendiges Essen zuzubereiten und dann mit mürrischem Gesicht dasitzt, bedeutet das unweigerlich, dass irgendein Kerl etwas total Blödes gemacht hat«, erklärte er immer noch verunsichert. »In meinem Leben gab es nämlich außer dir noch andere Frauen, weißt du?«
»Hast du Hunger oder nicht?«, fragte Helen mit einem Lächeln und versuchte, ihre miese Laune loszuwerden.
Der Hunger siegte. Jerry machte den Mund zu und ging sich die Hände waschen. Helen hatte seit dem Frühstück nichts mehr gegessen und hätte eigentlich halb verhungert sein müssen. Aber als sie die erste Gabel voll probiert hatte, merkte sie, dass sie nichts runterbekam. Sie hörte ihrem Vater zu, so gut sie konnte, und schob ihr Lieblingsessen auf dem Teller herum, während Jerry bereits die zweite Portion vertilgte. Als er sie fragte, wie ihr Tag gewesen war, versuchte er unauffällig, sein Essen nachzusalzen. Helen hinderte ihn wie gewöhnlich daran, aber sie hatte nicht genug Energie, um ihm mehr als einsilbige Antworten zu geben.
Sie ging um neun ins Bett, obwohl ihr Vater noch ein Spiel der Red Sox im Fernsehen sah. Doch als das Spiel um Mitternacht endete und ihr Vater nach oben kam, lag sie immer noch wach. Sie war zwar müde genug zum Schlafen, aber jedes Mal, wenn sie einnickte, hörte sie dieses merkwürdige Geflüster.
Anfangs hatte sie gedacht, dass es echt war und draußen jemand stand, der ihr einen Streich spielte. Sie ging hinaus auf den Witwensteg auf dem Dach über ihrem Zimmer und versuchte, in der Dunkelheit etwas zu erkennen. Es war alles still. Nicht einmal ein Windstoß, der die Rosenbüsche rund ums Haus bewegt hätte. Sie setzte sich hin und starrte hinaus auf den ruhigen schwarzen Ozean, der sich jenseits der Lichter der Nachbarn erstreckte.
Sie war eine ganze Weile nicht mehr hier oben gewesen, aber sie fand den Gedanken an die Frauen, die früher hier gestanden und Ausschau nach den Masten der Schiffe ihrer Ehemänner gehalten hatten, total romantisch. Als Helen klein gewesen war, hatte sie immer so getan, als wäre ihre Mutter auf einem dieser Schiffe und dass sie zurückkommen würde, nachdem sie von Piraten oder Kapitän Ahab oder sonst jemandem mit unendlicher Macht entführt worden war. Helen hatte Stunden auf dem Witwensteg zugebracht und den Horizont nach einem Schiff abgesucht. Erst viel später war ihr klar geworden, dass das Schiff nie kommen würde.
Helen rutschte unbehaglich auf dem harten Boden herum, bis ihr einfiel, dass ihre Schatzkiste noch hier oben stand. Jahrelang hatte ihr Vater ihr verboten, allein auf den Witwensteg zu gehen, weil er Angst hatte, sie könnte abstürzen. Aber es spielte keine Rolle, wie oft er sie dafür bestrafte, sie schlich immer wieder hinauf, knabberte Kekse und träumte vor sich hin. Nach ein paar Monaten hatte Jerry schließlich nachgegeben und es ihr unter der Bedingung erlaubt, dass sie sich nie über das Geländer beugte. Er hatte ihr sogar eine wasserdichte Kiste gezimmert, in der sie ihre Sachen verstauen konnte.
Sie klappte die Kiste auf, holte den Schlafsack heraus, den sie darin aufbewahrte, und breitete ihn auf dem Holzboden aus. Weit draußen auf dem Ozean waren Boote unterwegs, die Helen aus dieser weiten Entfernung eigentlich gar nicht hätte hören oder sehen dürfen. Sie schloss die Augen und gönnte sich das Vergnügen, einem kleinen Segelboot zuzuhören, dessen Segel im Wind flappte, dessen Teakholzplanken knarrten und das weit draußen in den sanften Wellen schaukelte. Als sie dann irgendwann einnickte, ging sie nach unten ins Bett, um es noch einmal mit Schlafen zu versuchen.
Sie stand in einer hügeligen, felsigen Gegend, in der die Sonne so heiß brannte, dass die knochentrockene Luft bebte und in zitternde Streifen zerteilt wurde, als würden Teile des Himmels schmelzen. Die Felsen waren blassgelb und scharfkantig und hier und dort wuchsen dicht am Boden garstige kleine Büsche mit fiesen Dornen. Auf der nächsten Anhöhe stand ein einzelner knorriger Baum.
Helen war allein. Und doch nicht allein.
Unter den verkrüppelten Ästen des Baums tauchten drei Gestalten auf. Sie waren so schmal und klein, dass Helen sie im ersten Moment für kleine Mädchen hielt, aber etwas an der Art, wie sich die Muskeln um ihre knochigen Unterarme wanden wie Stricke, ließ Helen erkennen, dass sie sehr alt waren. Alle drei ließen den Kopf hängen und ihre Gesichter waren komplett unter verfilzten schwarzen Haaren verborgen. Sie trugen zerlumpte weiße Kleider und ihre Beine waren mit grauweißem Staub bedeckt. Von den Knien abwärts hatten sie dunkle Schmutzstreifen auf der Haut und schwarz getrocknetes Blut an den zerschundenen Füßen, die sie sich auf der Wanderung durch die öde Wildnis verletzt hatten.
Helen hatte Angst. Sie wich zurück. Die Felsen zerschnitten ihr die Fußsohlen und die Dornen zerkratzten ihre Beine. Die drei widerlichen Wesen machten einen Schritt auf sie zu, und ihre Schultern bebten, weil sie lautlos schluchzten. Blut tropfte aus ihren verfilzten Haaren und lief an den Vorderseiten ihrer Kleider herunter. Sie flüsterten Namen, während sie ihre ekligen Tränen vergossen.
Eine Ohrfeige weckte Helen. Ihre Wange brannte und fühlte sich zugleich taub an und in ihrem Ohr tönte ein schriller Ton. Jerry war außer sich vor Sorge. Er hatte sie noch nie geschlagen. Bevor er etwas sagen konnte, musste er erst ein paarmal zittrig Atem holen. Der Wecker auf dem Nachttisch stand auf 3.16 Uhr.
»Du hast geschrien. Ich musste dich wecken«, stammelte er.
Helen schluckte schwer und versuchte, ihre geschwollene Zunge und die zugeschnürte Kehle wieder funktionsfähig zu bekommen. »Schon gut. Nur ein Albtraum«, flüsterte sie und setzte sich auf.
Ihre Wangen waren feucht, vom Schweiß oder von Tränen, sie wusste es nicht. Helen fuhr sich übers Gesicht und lächelte ihren Dad an, um ihn zu beruhigen, womit sie allerdings keinen Erfolg hatte.
»Was war das, Lennie? Das war nicht normal«, sagte er mit beunruhigter Stimme. »Du hast Dinge gesagt. Wirklich schlimme Dinge.«
»Zum Beispiel?«, krächzte Helen. Sie hatte schrecklichen Durst.
»Überwiegend Namen, Unmengen von Namen. Und dann hast du immer wieder ›Blut für Blut‹ gesagt und ›Mörder‹. Was hast du bloß geträumt?«
Helen dachte an die drei Frauen, drei Schwestern, und wusste, dass sie ihrem Vater nicht von ihnen erzählen konnte. Also zuckte sie nur mit den Schultern und tischte eine Lügengeschichte auf. Es gelang ihr, Jerry davon zu überzeugen, dass ein Mord etwas ziemlich Typisches war, um Albträume auszulösen, und schwor, dass sie nie wieder Gruselfilme sehen würde, wenn sie allein war. Endlich brachte sie ihn dazu, wieder ins Bett zu gehen.
Das Glas auf ihrem Nachttisch war leer und ihr Mund so trocken, dass es wehtat. Sie schwang die Beine aus dem Bett, um sich im Badezimmer noch ein Glas Wasser zu holen, doch als ihre Füße den Dielenboden berührten, schaute sie entsetzt nach unten. Sie schaltete das Licht an, um besser nachsehen zu können, doch sie wusste schon jetzt, was sie erwarten würde.
Ihre verdreckten Fußsohlen hatten tiefe Schnittwunden und ihre Schienbeine waren von spitzen Dornen ganz zerkratzt.
3
Als Helen am Morgen aufwachte und nach ihren Füßen sah, waren die Schnitte verschwunden. Sie glaubte schon, sich alles nur eingebildet zu haben – bis sie sah, dass ihr Bettzeug ganz schmutzig und mit dunkel getrocknetem Blut verschmiert war.
Um festzustellen, ob sie vielleicht verrückt geworden war, beschloss Helen, das Laken nicht abzuziehen, zur Schule zu gehen und nachzusehen, ob es immer noch schmutzig war, wenn sie nach Hause kam. Wenn es dann sauber war, war das Ganze nur Einbildung gewesen, und sie war tatsächlich ein bisschen verrückt geworden. Wenn der Dreck aber noch da war, wenn sie nach Hause kam, war sie offensichtlich so verrückt, dass sie nachts herumwanderte und sich Schmutz und Blut ins Bett schmierte, ohne sich hinterher daran zu erinnern.
Helen versuchte, zum Frühstück einen Fruchtjoghurt zu essen, aber da sie null Appetit hatte, packte sie ihre Lunchbox erst gar nicht ein. Falls sie wirklich Hunger bekam, konnte sie sich in der Cafeteria immer noch etwas Magenfreundliches kaufen.
Als sie zur Schule radelte, musste sie feststellen, dass es nun schon den zweiten Tag unerträglich heiß und schwül war. Als sie ihr Fahrrad anschloss, fiel ihr auf, dass sich kein Lüftchen regte und auch keine Vögel zu sehen oder zu hören waren. Alles war unnatürlich still – als wäre die ganze Insel ein riesiges Schiff, das bei Flaute irgendwo in den Weiten des Ozeans herumdümpelte.