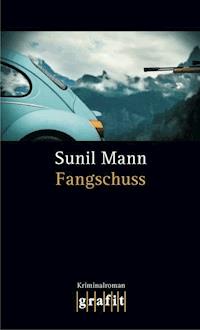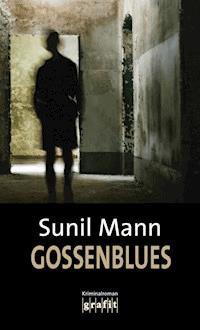Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GRAFIT
- Kategorie: Krimi
- Serie: Vijay Kumar
- Sprache: Deutsch
»Du bist zwar auch nicht gerade ein Eingeborener, aber ein Inder ist immer noch besser als ein Deutscher!« Dass sich ein ausländerfeindlicher Klient ausgerechnet an Vijay Kumar wendet, hätte sich der Privatdetektiv nicht träumen lassen. Mit seiner vereinnahmenden indischen Mutter und seit Neuestem auch noch seiner Schwiegermutter in spe, die ihn permanent auf das Thema Hochzeit ansprechen, fühlt sich Vijay nicht gerade als Vorzeigeschweizer. Doch für Adrian Bühler ist ein Inder noch das kleinere Übel im Vergleich zu einem Deutschen. Ihn quält die Frage, ob seine Frau ihn mit einem Deutschen betrügt. Bei seiner Observation knipst Vijay ein paar Fotos von Bühlers Ehefrau Jasmin in eindeutiger Situation mit einem orientalisch aussehenden Mann. Seinem Auftraggeber gegenüber verschweigt er diese Entdeckung, um seine Wut nicht weiter zu schüren. Als Jasmins syrischer Liebhaber erschossen aufgefunden wird, verschwindet Adrian Bühler. Vijay fühlt sich verantwortlich und macht die Suche nach Bühler zu seiner persönlichen Angelegenheit. Er bekommt es mit rechtspopulistischen Politikern, für die der Tod des Syrers ein gefundenes Fressen ist, und einer wiedererweckten Geheimorganisation zu tun …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sunil Mann
Faustrecht
Kriminalroman
© 2014 by GRAFIT Verlag GmbH
Chemnitzer Str.31, 44139 Dortmund
Internet: http://www.grafit.de
E-Mail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagfoto: © kallejipp / photocase.de
Der Autor
Sunil Mann verbindet mit seinem Detektiv Vijay Kumar nicht nur die indische Herkunft und der damit einhergehende Seiltanz zwischen den Kulturen, sondern auch eine weit mehr als nur beruflich bedingte Neugier. Beide haben sich in diversen Tätigkeiten versucht, bevor sie ihre wahre Bestimmung gefunden haben, kennen Zürichs Rotlichtviertel besser als ihre Hosentaschen und werden geradezu magisch von Bars jeglicher Art angezogen. Gemeinsam ist ihnen auch die Vorliebe für indische Küche und das Leiden unter der daraus resultierenden Notwendigkeit zur körperlichen Ertüchtigung. Im Übrigen sind sie aber zwei grundverschiedene Charaktere, die sich außerhalb der Kriminalromane tunlichst aus dem Weg gehen.
Prolog
»Schon wieder Deutsche!«
Schwer atmend stützte sich der Mann auf den Tresen und wischte mit dem Handrücken den Regen aus seinem Gesicht. Nachdem er einige Sekunden vergeblich auf eine Reaktion meinerseits gewartet hatte, neigte er den Kopf und guckte mich Zustimmung heischend an. Sein Blick war glasig, das Haar klebte ihm nass an der Stirn und von der rot-schwarzen Filzjacke tropfte es unablässig auf den Boden. Ich starrte so konzentriert in meinen Drink, als wäre mir eine Kontaktlinse hineingefallen. Der Typ war gerade erst hereingetorkelt, und während hinter ihm die Tür krachend ins Schloss gefallen war, war er schwankend im Eingangsbereich der Bar stehen geblieben und hatte sich einen Überblick verschafft. Um dann ausgerechnet den Hocker direkt neben mir anzupeilen – obschon es im spärlich besuchten Lokal gefühlte dreiundzwanzig freie Sitzgelegenheiten gegeben hätte. Mein Karma war definitiv reif für einen Weiterbildungskurs.
Trotz meines demonstrativen Desinteresses laberte der Kerl unbekümmert weiter: »Wohin man in dieser Stadt auch geht: Sie sind einfach überall!«
Mit einer vorwurfsvollen Kinnbewegung deutete er zu dem halben Dutzend Frauen und Männer hinüber, das vor einiger Zeit eingetrudelt war – nach einem Besuch im nahe gelegenen Kino Metropol vielleicht – und sich lachend und schwatzend um einen der Stehtische in der Nähe der Theke geschart hatte. Allesamt sprachen sie hochdeutsch und waren ungefähr im selben Alter, um die dreißig, schätzte ich. Ihre regenfeuchten Mäntel, unter denen sie Anzüge oder Kostüme im Businesslook trugen, hatten sie abgelegt, und aufgrund der mitgebrachten Laptoptaschen vermutete ich, dass sie direkt nach der Arbeit losgezogen waren. Fast meinte ich, im schummrigen Kneipenlicht die an die Wand gelehnten Karriereleitern ausmachen zu können.
Der Mann ruckelte mit seinem Hocker näher heran, sodass mir seine Schnapsfahne in die Nase stach. Zu meiner grenzenlosen Begeisterung war sie versetzt mit dem fettigen Nachgeschmack einer erst kürzlich verzehrten Bratwurst und einer unpassend süßlichen Tabaknote. Der Typ rauchte aller Wahrscheinlichkeit nach Zigarillos mit Vanillearoma.
»Wie eine Alieninvasion«, flüsterte er in verschwörerischem Ton und nickte nachdrücklich dazu.
Ich bemühte mich, durch den Mund zu atmen.
»Hollywood und so, weißt du? Äußerlich unterscheidet sie nichts von dir und mir. Aber auf dem Weg zur Macht unterwandern sie das System von innen und übernehmen nach und nach die Kontrolle. Erst reißen sie unsere Jobs an sich, dann die Wohnungen und am Ende die Frauen!«
Wie zähflüssige Melasse troff das Selbstmitleid aus seinen Worten und ich musste mich beherrschen, ihn nicht mit der Realität zu konfrontieren. Denn Schweizer Frauen waren in der Regel keine willensschwachen Wesen, die man nach Gutdünken ›an sich riss‹, und bezüglich Arbeitsmarkt stand nicht zuletzt der Staat in der Verantwortung, der der Nachfrage nach qualifiziertem Personal in etlichen Bereichen ausbildungstechnisch hinterherhinkte.
Erfahrungsgemäß wusste ich aber, dass solche Diskussionen nie ein gutes Ende nahmen. Deshalb schwieg ich weiterhin eisern.
Der Gesichtsausdruck des Mannes wurde leer, wie wenn er nicht mehr weiterwüsste, bis sein Blick erneut auf das Grüppchen am Stehtisch fiel.
»So ist es doch, oder?«, schnauzte er in diese Richtung. »Man wird doch im eigenen Land noch seine Meinung sagen dürfen!«
Die Deutschen verstummten schlagartig, vielsagende Blicke wurden ausgetauscht.
»Ist doch wahr!«, wetterte er halblaut und in trotzigem Tonfall weiter. »Zürich ist von Deutschen völlig vereinnahmt!«
Nach einer Weile setzte drüben das Gespräch wieder ein, allerdings nur zögerlich und leiser als zuvor, zu lachen getraute sich keiner mehr. Ein hochgeschossener Typ mit Seitenscheitel und schwarzer Hornbrille reckte herausfordernd das Kinn, trat an den Tresen und bestellte halblaut sechs Bier bei der Bedienung, worauf mein Nachbar verächtlich schnaubend die Mundwinkel verzog.
»Nach Berlin müssen wir nicht mehr, denn den Prenzlauer Berg finden wir direkt vor der Haustür, hab ich nicht recht?«
Ich ersparte mir und ihm eine Antwort. Das ewig gleiche Gelaber langweilte mich unsäglich. Auf Deutsche zu schimpfen, war in den letzten Jahren zu einer Art Volkssport geworden. Aus keinem anderen Land wanderten zurzeit mehr Menschen in die Schweiz ein und obschon die meisten von ihnen für etliche Wirtschaftszweige unentbehrlich waren, haperte es teilweise an der Akzeptanz seitens der Einheimischen. Doch das war nichts Neues: Vor den Deutschen hatte man über die Einwanderer aus dem Balkan gemeckert, davor waren die Tamilen dran gewesen, noch früher die Italiener. Man pflegte die Traditionen in diesem Land.
»Du bist zwar auch nicht gerade ein Eingeborener«, brummte der Mann jetzt, als wäre ihm mein eindeutig nicht kaukasisches Äußeres bis anhin gar nicht aufgefallen.
»Aber …«, er legte mir vertraulich den Arm um die Schulter und rief viel zu laut, »… aber du bist schon in Ordnung. Im Gegensatz zu denen!« Er deutete mit der freien Hand zu den Deutschen hinüber und schnitt eine abfällige Grimasse. Ich fühlte mich nicht im Geringsten geschmeichelt und befreite mich resolut aus seiner Umklammerung.
»In Polen lohnt es sich ja nicht mehr, drum marschieren die heutzutage hier ein …«
»Kannst du nicht einfach ein paar Sekunden lang die Klappe halten?« Grimmig erhob ich mich und zog mit meinem Glas ans andere Thekenende um.
»Was ist denn jetzt los?« Verdutzt blickte mir der Typ hinterher. »Hey, komm zurück! Ich will mit dir reden!« Er winkte mich zu sich, doch ich rührte mich nicht. Worauf er kopfschüttelnd von seinem Hocker rutschte und mir hinterherstolperte.
Ich seufzte gereizt. Ein Dienstagabend, geradezu perfekt, um mir in meiner Lieblingsbar Daniel H. an der Müllerstrasse in aller Ruhe einen Drink oder zwei zu genehmigen und vor mich hin zu sinnieren – hatte ich zumindest gedacht, als ich mich auf den Weg gemacht hatte. Nicht einmal das miserable Wetter hatte mich abhalten können, denn der seit Tagen anhaltende Regen schreckte mich weit weniger als der indische Taifun, der momentan bei uns zu Hause alles durcheinanderwirbelte. Doch offensichtlich fand mein entspannter Abend genau in diesem Moment sein jähes Ende.
Der Mann blieb dicht vor mir stehen und glubschte mich aus wässrigen Augen an. Einen Moment lang dachte ich, er wolle mir eine reinhauen, doch dann entspannte sich seine Miene. Er war eine stattliche Erscheinung, noch keine vierzig, kräftig und groß gewachsen. Erst jetzt erkannte ich, wie aufgedunsen er war und wie fertig er aussah. Er war unrasiert, seine Haut gräulich und kraftlos, das blonde Haar strähnig. Unter den Augen hatten sich dunkle Ringe eingraviert. Er war wohl einmal gut aussehend und sportlich gewesen, doch jetzt wirkte er nur noch ausgebrannt und irgendwie verzweifelt, was selbst sein schiefes Grinsen nicht übertünchen konnte.
»Hey, Kumpel! Wir haben uns noch gar nicht bekannt gemacht!« Er packte meine Hand und schüttelte sie begeistert. »Ich bin der Adrian und du, du bist der …?«
»Vijay«, gab ich mich abweisend, doch das schien meiner neuen Barbekanntschaft nicht das Geringste auszumachen.
»Vijay?«, wiederholte er und runzelte dazu die Augenbrauen. »Aha. Was ist das für ein Name?«
»Ein kurzer.«
Irritiert blinzelte er, bis er endlich begriff. Dann lachte er dröhnend und patschte mir die Hand auf die Schulter. »Nicht auf den Kopf gefallen, was? Der war gut, wirklich gut! Aber echt jetzt: Woher stammt dein Name?«
»Ist indisch.«
»Großartig! Ich hab meiner Frau schon oft gesagt: Jetzt müssen wir endlich nach Indien …«
Ich verdrehte die Augen. Weshalb bloß hatten wildfremde Menschen stets das Gefühl, sie müssten mich unbedingt in ihre Reisepläne einweihen, sobald ich die Herkunft meines Namens erwähnte?
»Muss ein wunderbares Land sein.« Adrian, der sich etwas beruhigt zu haben schien, schlüpfte aus seiner klitschnassen Baseballjacke mit dem Namenszug der Boston Red Sox und setzte sich unverdrossen neben mich.
»Ich hätte gern meine Ruhe«, versuchte ich endlich, seinem impertinenten Befreundungsbestreben Einhalt zu gebieten.
»Alles klar.« Er winkte den Barkeeper heran.
»Für den Vijay noch mal dasselbe«, orderte er, ehe ich ihn davon abhalten konnte. »Ich hätte gern einen Scotch auf Eis.«
Stöhnend nahm ich Blickkontakt mit dem Kellner auf, einem hageren Bürschchen mit rötlichem Schopf, doch der ignorierte meine Notsignale, während gleichzeitig ein feines und ziemlich hinterhältiges Lächeln seine Lippen umspielte. Missmutig leerte ich meinen Drink. Von mir konnte er heute Abend kein Trinkgeld erwarten.
»Vijay!« Nachdem Adrian einen Moment lang trübsinnig die deutschen Gäste fixiert hatte, erinnerte er sich plötzlich wieder meiner.
»Erzähl mir von dir«, lallte er mit schwerer Zunge. »Was tust du so im Leben?«
»Ich bin Privatdetektiv«, gab ich resigniert Auskunft.
»Echt jetzt?« Adrian riss die Augen auf.
»Ja.«
»Ist nicht wahr!«
»Doch.«
»Wahnsinn!«
»Du sagst es.«
Da hatte der Homo sapiens über Jahrtausende hinweg die ausgefeilteste Sprachkultur aller Lebewesen entwickelt, dennoch traf man immer wieder auf Individuen, mit denen man keinen einzigen vernünftigen Satz wechseln konnte.
Mein Gegenüber krempelte die Ärmel seines schwarz-weiß karierten Flanellhemdes hoch und begann, in seinem Portemonnaie rumzuwühlen. Schließlich förderte er eine zerknitterte Visitenkarte zutage, die er feierlich vor mich hinlegte. »Hier.«
Ohne einen Blick darauf zu verschwenden, widmete ich mich meinem Drink, bis ich Adrians fragende Miene nicht mehr aushielt. Wortlos schob ich ihm eine meiner eigenen Geschäftskarten hin. Grundsätzlich war mir das willkürliche Herumreichen von Kontaktinformationen auf diese Art zuwider, ich fand es anbiedernd und wichtigtuerisch und hatte mich lange dagegen gesträubt, überhaupt welche drucken zu lassen.
Doch meine Freundin Manju war der Meinung gewesen, dass ich angesichts des mittelmäßigen Erfolgs meiner Detektei auf jedes Werbemittel angewiesen war, und hatte mir am Computer selbst ein – ihrer Meinung nach passendes – Design entworfen. Ein kleiner Albtraum, farblich auf der weniger dezenten Seite und mit vedischen Symbolen geschmückt, die eher zu einem Yogastudio oder einem Teppichhändler gepasst hätten als zu einem knallharten Ermittler. Seither achtete Manju streng darauf, dass ich stets einen kleinen Stapel der Kärtchen bei mir trug. Zu meiner Verblüffung löste ihr Anblick überall Begeisterung aus, nur der sprunghafte Anstieg an Aufträgen ließ weiterhin auf sich warten.
Adrian griff nach dem Kärtchen, fokussierte mit Mühe seinen Blick auf die Buchstaben und studierte sie dann eingehend.
»Vijay Kumar. Privatdetektiv, tatsächlich!« Anerkennend schob er die Unterlippe vor und ich konnte ihm förmlich ansehen, wie angestrengt er nachdachte. Höchstwahrscheinlich suchte er gerade krampfhaft nach einem Verwendungszweck für meine Fähigkeiten, einem Vorteil zu seinen Gunsten, den er aus unserem Zusammentreffen schlagen konnte. Das erging nicht nur mir als Privatermittler so. Auf einer Geburtstagsparty hatte ich erst kürzlich eine Dame beobachtet, die sich nur mit Mühe hatte davon abhalten lassen, einem zufällig anwesenden Dermatologen ihr schwärendes Ekzem am rechten inneren Oberschenkel zu zeigen. Einem befreundeten Zahnarzt näherten sich in allen möglichen Lebenslagen Menschen mit aufgeklapptem Kiefer: »Nur ganz kurz, wenn wir uns schon sehen.« Augen auf bei der Berufswahl!, konnte ich da nur sagen.
Plötzlich kam Bewegung in das Grüppchen am Stehtisch, Mäntel wurden zugeknöpft, jemand bückte sich nach einem Schirm. Als hätte man ihm einen Stromstoß versetzt, wirbelte Adrian herum. Eine der jungen Frauen drückte gerade die Ausgangstür auf, als er aufsprang und grölte: »Uuuuuund Abmarsch! Jawoll! Zurück ins Reich! Links, rechts, links, rechts!«
Wie ein Derwisch kam der Barmann angewetzt und wies ihn zurecht, doch Adrian war nicht zu bremsen.
»Grüßt mir den Adolf!« Mit einem Ruck riss er den Arm zum Hitlergruß hoch – laut kürzlich gefälltem Bundesgerichtsurteil war diese Geste in der Schweiz durchaus legitim. »Heil!«
»Arschloch!«, zischte der Bursche mit der Hornbrille, daraufhin überstürzten sich die Ereignisse: Adrian schoss auf ihn zu, im nächsten Moment hatte er den jungen Mann am Kragen gepackt und gegen die Wand gerammt. Ein Stuhl kippte krachend um und jemand stieß einen spitzen Schrei aus. Adrians linker Unterarm lag quer über der Kehle des Mannes, sodass der arme Kerl kaum mehr Luft bekam, die Augäpfel quollen hervor, während sein Widersacher mit der Rechten ausholte.
»Schluss jetzt!« Gerade noch rechtzeitig bekam ich Adrians drohend erhobene Faust zu fassen. Mit einer geschmeidigen Bewegung bog ich den Arm auf seinen Rücken. Dann drehte ich ihn so weit nach oben, bis Adrian vor Schmerzen winselte und von seinem Opfer abließ. Als Privatdetektiv sah ich mich leider hin und wieder gezwungen, meine zartfühlende Seite zu unterdrücken.
Einen Moment lang standen alle wie versteinert. Keuchend blickte der Brillenträger von einem zum anderen und schien erst jetzt zu begreifen, was ihm eben widerfahren war. Nach einer Weile strich er sich mit einer mechanisch anmutenden Geste über den Seitenscheitel und rückte seinen Hemdkragen zurecht.
Ich lockerte meinen Griff erst, als die Gesellschaft die Bar verlassen hatte. Adrian wehrte sich nicht einmal. Nachdem ich ihn freigegeben hatte, richtete er sich mit puterrotem Kopf auf und rieb sich schnaufend den rechten Arm. Tunlichst vermied er es, mich anzusehen, doch als der Barmann die rot-schwarze Baseballjacke brachte und ihm stumm die Tür aufhielt, drehte er sich mit einer rudernden Bewegung um und schaute mich Hilfe suchend an.
»Zeit, nach Hause zu gehen«, brummte ich ungerührt und er taumelte die wenigen Stufen hinunter auf den Gehsteig.
Mit einlullender Monotonie trommelte der Regen auf das Dach meines hellblauen Käfers und ergoss sich in endlosen Sturzbächen über die Windschutzscheibe. Obwohl erst früher Abend war, versank die Welt um mich herum in Düsternis, erhellt einzig durch den orangefarbenen Schein der Straßenlampen. Ich hatte in einer Seitengasse geparkt und wartete. Passend zum Hundewetter lief im Radio ein Programm mit Songs, die irgendwie mit Regen zu tun hatten: It’s raining again von Supertramp, Tina Turners I can’t stand the rain, Prince und sein Klassiker Purple rain. Der letzte Riff von Naked in the rain der Red Hot Chili Peppers war gerade verklungen, sodass es nun an Elvis Presley lag, das Offensichtliche festzustellen. When it rains, it really pours, sang er zu einem schleppenden Blues und mich fröstelte ob der feuchten Kälte, die durch alle Ritzen in den Wagen drang und sich in meinen Kleidern festsetzte. Um die Zeit rumzubringen, spielte ich eine Runde Angry Birds auf meinem iPhone, allerdings behielt ich dabei den Eingang des Industriegebäudes an der Badenerstrasse stets im Auge. Bis auf ein einziges Stockwerk lag die mit Spiegelglas versetzte Fassade im Dunkeln. Dieses war jedoch neonhell erleuchtet und ermöglichte so den Blick auf eine Reihe Crosstrainer, auf denen sich Menschen mit verbissenen Mienen abstrampelten. Weshalb sie dabei zwingend hautenge Synthetikteile in schreiend bunten Farben tragen mussten, erschloss sich mir nicht auf Anhieb. Dafür hatte ich in Erfahrung gebracht, dass der Kurs Bodypump bis um acht dauerte, entsprechend bald würde die Warterei ein Ende haben.
Natürlich hätte ich den Auftrag ablehnen sollen, der Klient war mir zutiefst unsympathisch und sein Anliegen langweilte mich. Andererseits hätte er dann einfach jemand anderen damit beauftragt, seine Frau zu beschatten. Zudem befand ich mich immer noch nicht in der finanziellen Lage, Aufträge einfach aus einer Laune heraus zurückzuweisen. Als Adrian Bühler, der mich gleich am Tag nach dem Zwischenfall in der Bar aufgesucht hatte, dann auch noch eine Anzahlung von dreihundert Schweizer Franken auf meinen Schreibtisch geknallt hatte, war mir nichts anderes übrig geblieben, als mich unverzüglich an die Fersen seiner Frau zu heften. Betrügen würde sie ihn, vermutete er, mit einem Deutschen, den sie drei Mal die Woche im Fitnessklub träfe.
Klar, hatte ich bei mir gedacht, so klingt Paranoia. Erstaunlicherweise hatte ich es aber geschafft, den Mund zu halten. Was nicht zuletzt an Bühlers Erscheinung lag: Er wirkte topseriös, war frisch rasiert und trug einen maßgeschneiderten Anzug mit Krawatte. Einzig die Ausgebranntheit in seinem Blick erinnerte an das Wrack vom Vorabend. Als er mir erneut seine Visitenkarte hinstreckte – und diesmal in einer knackig frischen Variante –, fiel mir die willkürlich erscheinende Abfolge englischer Wörter unter seinem Namen auf, von denen mir auf den ersten Blick Business und Executive und Manager ins Auge stachen. Als ich ihn etwas zweifelnd musterte, bemerkte Bühler ungefragt, dass GoforIT-Solutions ein Global Player und er übrigens als Leiter der hiesigen Niederlassung vorgesehen sei. Selbstverständlich hatte ich beeindruckt genickt.
Seit drei Tagen war ich nun der unsichtbare Schatten von Jasmin Bühler, doch bislang wies keine meiner Beobachtungen auf Ehebruch hin. Glücklicherweise, fand ich, denn ich hatte ja hautnah miterlebt, zu welchen Gewaltausbrüchen ihr Ehemann fähig war, und wollte mir lieber nicht ausmalen, was er ihr antun könnte, falls sich sein Verdacht bewahrheiten sollte.
Jasmin Bühler war achtunddreißig Jahre alt. Dunkel gelocktes Haar, das ihr in den Nacken fiel, und ein etwas zu spitzes Gesicht, um als wirklich hübsch durchzugehen, die Augen kieselgrau und fordernd. Eine spröde Eleganz ging von ihr aus, in Kleiderfragen war sie stilsicher mit einem Hang zum Exklusiven. Sie gehörte zu jenen Frauen, die man nie aus vollem Herzen lachen sah, selbst wenn sie lächelte, blieb ihre Miene reserviert.
Eine vielversprechende Karriere in einer renommierten Bank hatte die Bühler vor ein paar Jahren abrupt aufgegeben, seither beriet sie halbtags Privatkunden in finanziellen Belangen. Daneben engagierte sie sich sozial, arbeitete beim Fundraising der Krebsliga mit, half in einer Kinderkrippe aus und unterstützte Asylanten bei der Jobsuche und im alltäglichen Papierkrieg mit den Ämtern. Die Frau schien dauernd auf Achse zu sein, ihre Tage waren mit Terminen vollgepackt, Zeitfenster gab es nur für Sport. Soweit ich beobachtet hatte, gingen die Bühlers abends nie aus. Das Paar war kinderlos und wohnte in einem schicken Neubau am Rand von Altstetten, einem gutbürgerlichen Quartier in Zürichs Westen.
A hard rain’s a-gonna fall. Joan Baez und ihr berüchtigtes Vibrato, das sich stellenweise anhörte, als hätte der Produzent die Gute an der Gurgel gepackt und ein bisschen geschüttelt, ließen die Fensterscheiben erzittern, während gegenüber zwei Gestalten aus dem Gebäude traten und unter dem Vordach stehen blieben. Ich betätigte die Scheibenwischer, um etwas erkennen zu können. Es handelte sich dabei tatsächlich um meine Zielperson. Rasch versetzte ich das Handy in den Ruhemodus und legte es auf den Beifahrersitz. Mit meinem Fotoapparat zoomte ich das Paar näher heran und schoss ein paar Bilder. Jasmin Bühler und ihr angeblicher Liebhaber unterhielten sich. Sie berührte ihn am Arm und sprach auf ihn ein, während er einen Schluck aus einer bunten Plastikflasche trank. Alles ganz harmlos. Ich fragte mich ohnehin, wie ihr Ehemann auf die Idee kam, sie könnte ihn betrügen. Die Frau hatte dazu gar keine Zeit, bei all ihren Terminen. Die Bühler schickte sich an, sich von ihrem Begleiter zu verabschieden, der meinen Nachforschungen zufolge Holger Schulze hieß, aus Dortmund stammte und Assistenzarzt auf der onkologischen Abteilung des Triemlispitals war. Doch der Mann hielt sie zurück, er sprach beschwörend und zunehmend erregt auf sie ein, in einer plötzlichen Aufwallung seiner Gefühle griff er nach ihrer Hand. Ich schoss ein Bild nach dem anderen. In Jasmin Bühlers Gesicht spiegelten sich erst Erstaunen und ein Anflug von Amüsement, doch ihre Züge nahmen bald einen bedauernden Ausdruck an, sie schüttelte immer wieder den Kopf und wich zurück, worauf er sie gegen ihren Willen an sich zog. Sie wehrte halbherzig ab, als er sie aber zu küssen versuchte, stieß sie ihn grob von sich und funkelte ihn wütend an. Ich hatte mittlerweile auf Serienaufnahme umgeschaltet. Jetzt presste sie die Lippen zusammen, öffnete die Handtasche und entnahm ihr den Autoschlüssel. Schulze folgte Jasmin Bühler ein paar Schritte und flehte sie gestenreich an, doch sie ignorierte seine Bettelei und eilte zu ihrem roten Renault Clio, der direkt vor dem Fitnessstudio geparkt war. Ohne einen weiteren Blick an Schulze zu verschwenden, stieg sie ein, schoss aus der Parklücke und machte eine gewagte Kehrtwende auf der Fahrbahn, bevor sie stadtauswärts davonbrauste.
Ich startete meinen Motor und als ich aus dem Seitensträßchen bog, stand Holger Schulze immer noch wie ein begossener Pudel vor dem Gebäude und starrte konsterniert Jasmin Bühlers Wagen hinterher.
Buckets of rain, nölte Bob Dylan, während ich alles aus meinem Käfer rausholte, um den roten Clio nicht aus dem Blickfeld zu verlieren. Jasmin Bühler raste in einem Höllentempo die Badenerstrasse entlang und jedes Mal, wenn die Reifen durch abgesunkene Stellen im Belag pflügten, spritzten seitlich mannshohe Fontänen auf. Am Straßenrand sprudelten schmutzig braune Bäche, kein Gully, der nicht überlief.
Erst als der Renault am Farbhof in die Hohlstrasse einschwenkte, wurde mir klar, dass die Bühler nicht auf direktem Weg nach Hause fuhr. Die Straße führte in einem weiten Bogen zum Bahnhof. Während sich links zu den Gleisen hin klotzartige, in ihrer Hässlichkeit kaum zu übertreffende Bürogebäude aneinanderreihten, wechselten sich rechts heruntergekommene Mehrfamilienhäuschen mit lachsfarbenen Wohnblocks aus den Siebzigern ab, dazwischen sorgte eine verkehrsberuhigte Gasse mit gepflegten Gärtchen und einer Scheune aus längst vergangener Zeit unerwartet für idyllische Dorfatmosphäre. Das war das Charakteristische an diesem Stadtkreis und gleichzeitig sein Dilemma: der Spagat zwischen Industrie und ländlichem Charme. Dominiert wurde der Stadtteil vom Stadion Letzigrund mit seinen dreißigtausend Plätzen und einem Shoppingcenter, das es schaffte, noch einen Tick desolater auszusehen als andere sogenannte ›Einkaufsparadiese‹. Mit dem Resultat, dass Altstetten zumindest auf mich einen etwas verzettelten Eindruck machte.
Erschrocken trat ich auf die Bremse. Beinahe hätte ich das Lichtsignal übersehen, das soeben auf Rot gesprungen war. Jasmin Bühler war im letzten Moment über die Kreuzung geprescht und hatte gegenüber dem Bahnhof angehalten. Zeitgleich bemerkte ich eine dunkle Gestalt, die sich dem Wagen näherte. Der Mann hatte wohl an der dortigen Bushaltestelle gewartet und stieg nun, ohne zu zögern, ein, worauf die Bühler sofort Gas gab.
Bei den herrschenden Lichtverhältnissen war es schwierig gewesen, etwas zu erkennen. Ich wusste nur, dass der Kerl vermutlich Südländer war, ein schwarzes Hemd trug sowie eine weite, dunkelgraue Cargohose, sein Haar war dunkel und kraus gewesen.
Die Ampel schaltete auf Grün und ich nahm die Verfolgung wieder auf. Die Fahrt war nur von kurzer Dauer. Vor der Europabrücke setzte Jasmin Bühler den Blinker und bog hinter dem ersten Pfeiler in den dunklen und schwer einsehbaren Parkplatz unter der Brückenauffahrt ein. Ich rollte langsam unter der Brücke hindurch. Ehe hinter mir ein Hupkonzert ausbrach, wendete ich den Wagen und lenkte ihn auf das Trottoir der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Clio war nirgendwo zu sehen. Der Brückenpfeiler verdeckte mir von dieser Position aus die Sicht auf den Parkplatz, doch ich vermutete, dass die beiden noch immer im Wagen saßen. Ich stieg aus, schlüpfte in meine Regenjacke und schlug zur Tarnung die Kapuze hoch, den Fotoapparat nahm ich mit. Glücklicherweise war ich unter der Brücke vor dem Regen geschützt. Ich überquerte die Straße und tat so, als beabsichtigte ich, das stümperhafte Graffito auf der Außenseite des Pfeilers zu fotografieren. Unauffällig lehnte ich mich etwas vor und entdeckte Jasmin Bühlers Auto neben einem silbernen BMW. Ich zoomte ihren Wagen heran und drückte ein paar Mal auf den Auslöser.
Was ich auf dem Display zu sehen bekam, verschlug mir die Sprache. Jasmin Bühler und ihr Begleiter hatten die Rückenlehnen des Clios hinuntergeklappt. Er lag halb auf ihr und während seine Hand in ihrer aufgeknöpften Bluse verschwand, erwiderte sie leidenschaftlich seine Küsse.
»Und du bist dir absolut sicher, dass da nichts läuft?« Adrian Bühler, der unruhig in meinem Büro umhergetigert war, stützte sich auf dem Schreibtisch ab und studierte zum wiederholten Mal die ausgebreiteten Fotoausdrucke. Als befürchtete er, ihm wäre ein entscheidendes Detail entgangen.
»Sie war eindeutig nicht interessiert und hat ihn ziemlich harsch abgewiesen.«
»Und danach? Was hat sie danach gemacht?«
»Sie blieb erst eine ganze Weile in ihrem Auto sitzen, wahrscheinlich, um sich zu beruhigen. Anschließend hat sie sich einen Drink genehmigt.«
»Wo?«
»Im Red Floor«, log ich weiter.
Bühler verzog das Gesicht. »Sie mag diese Art von Lokal, in der die Leute so tun, als wäre die Zürcher Agglo ein ausgelagerter Distrikt von New York. War sie allein?«
»Ja.«
Nachdenklich musterte er die Aufnahmen, die seine Frau mit Holger Schulze vor dem Fitnesscenter zeigten. »Weißt du, wir waren mal gut befreundet, der Holger und ich.«
Leises Bedauern in seiner Stimme. Abwartend lehnte ich mich in meinem Bürosessel zurück, doch Bühler schob bloß geistesabwesend die Fotos zusammen.
»Sie war an dem Tag gegen halb elf zu Hause«, sagte er in abschließendem Ton. »Da hab ich mich bezüglich der Affäre wohl geirrt.«
Er rieb sich das Kinn und wirkte beinahe enttäuscht. Dann bedankte er sich mit einem Händedruck und ich hoffte insgeheim, dass dies ein Abschied für immer war. Zu dem Zeitpunkt konnte ich unmöglich vorausahnen, dass ich mich schon bald wieder intensiv mit ihm beschäftigen würde.
Nachdem er mein Büro verlassen hatte, stellte ich mich ans Fenster und sah ihm zu, wie er über die Straße rannte, seine Anzugjacke als Schutz vor dem Regen über den Kopf gezogen. Er stieg in einen schwarzen Range Rover, eine dieser Protzkarren, deren hochgelegte und gepanzert wirkende Karosserie eindeutig dafür konstruiert war, Feindesland zu durchqueren. Ein solcher Wagen roch förmlich nach Gefahr und Testosteron und machte selbst aus dem fadesten Bürohengst einen waghalsigen Abenteurer, der auf dem Weg zur Kinderkrippe oder beim morgendlichen Brötchenholen permanent sein Leben für die Familie aufs Spiel setzte. Vielleicht stieß mir aber auch nur sauer auf, dass nicht einmal mein doppeltes Jahresgehalt für den Kauf eines solchen Vehikels gereicht hätte.
Nachdem Bühler Richtung Langstrasse davongebraust war, setzte ich mich an den Schreibtisch, schenkte zwei Fingerbreit Amrut in ein Whiskyglas und schaltete meine Kamera ein. Der Mann, der sich mit Jasmin Bühler in ihrem roten Renault vergnügt hatte, war schlank und groß gewachsen, seine Haut hatte die Farbe von Milchkaffee, die Augenbrauen waren ungewöhnlich dicht. Er hatte eine hohe Stirn und die geschwungene Nase verlieh ihm etwas Edles. Im Nachhinein hielt ich es für möglich, dass er aus dem Nahen Osten stammte, ganz sicher war ich mir aber nicht. Es spielte auch keine Rolle. Ich nahm einen Schluck vom indischen Whisky. Dann drückte ich wiederholt das Papierkorbsymbol und sah zu, wie ein Foto nach dem anderen von meiner Speicherkarte verschwand.
Montag
Regen klatschte unablässig gegen die Jalousien und im Fernsehen sagten sie, dass für die nächsten Tage keine Wetterverbesserung in Sicht sei. Zu meinem Leidwesen hatte es sich Manju angewöhnt, morgens die Glotze einzuschalten.
»So kann ich mich nebenbei darüber informieren, was in der Welt geschieht«, hatte sie auf meine genervte Frage erwidert. »Um die Zeitung zu lesen, fehlt mir schlicht die Zeit.« Dass sie duschte oder in der Küche herumhantierte, während der Apparat vor sich hin lief, stellte für sie keinen Widerspruch dar.
»Ich höre den Ton ja in der ganzen Wohnung«, hatte sie erklärt, worauf ich schlaftrunken geknurrt hatte: »Ich auch.«
Wie immer hatte sie vergessen, das im Schlafzimmer stehende Gerät auszuschalten, bevor sie zur Arbeit gegangen war. Ich zog mir die Decke über den Kopf und versuchte, das aufgekratzte Gequatsche der Moderatorin auszublenden, die in der morgendlichen Wettersendung gerade Statistiken präsentierte.
Außergewöhnlich regenreich sei der April bislang gewesen, stellte sie beängstigend gut gelaunt fest, als hätten das die Zuschauer nicht selber bemerkt. Auch für heute würden auf der Alpennordseite überdurchschnittliche Niederschlagsmengen von bis zu hundertfünfzig Millimeter erwartet. In der Ostschweiz sei es in der vergangenen Nacht zu Erdrutschen gekommen, der Lago Maggiore hätte den höchsten Wasserstand seit Jahren erreicht und wenn es so weiterregne, wie die Meteorologen voraussagten – an dieser Stelle gluckste die Wetterfee unpassenderweise –, dann könne es gut sein, dass der See in den nächsten Tagen über die Ufer trete. Vermutlich schlug sie vor Begeisterung gleich einen Purzelbaum.
Grimmig schob ich die Decke zur Seite und machte mich ans Aufstöbern der Fernbedienung, die Manju normalerweise irgendwo deponierte, nur nicht neben dem Bett. In indischen Haushalten war es gang und gäbe, dass der Fernseher den ganzen Tag im Hintergrund lief und wie ein weiteres Familienglied zum konstanten Geschnatter der vielköpfigen Sippe inklusive Großeltern, Tanten und Cousins beitrug. Doch so sehr ich die orientalischen Einflüsse schätzte, die Manju in mein Leben und meine Wohnung brachte, manchmal sehnte ich mich einfach nach ein wenig guter, alter, mitteleuropäischer Stille.
Trotz verzweifelter Suche blieb die Bedienung unauffindbar, aber da ich schon mal auf war, konnte ich mir auch gleich einen Kaffee aus der Maschine lassen. Während ich verpennt der dunkelbraunen Flüssigkeit zusah, wie sie in die Tasse plätscherte, hörte ich, wie im Schlafzimmer nebenan die quietschfidele Ansagerin abrupt unterbrochen wurde. Eine seriös klingende Stimme vermeldete eine Schießerei vor dem Asylzentrum Altstetten, die genauen Umstände seien noch nicht geklärt. Ein Mann sei dabei so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort verstorben sei.
Mit der Tasse in der Hand schlurfte ich hinüber. Auf dem Bildschirm waren Polizeiautos und Ambulanzen zu sehen und in einer mit rot-weißem Band abgesperrten Zone stand ein weißes Zelt. Beamte hielten Wache und medizinisches Personal rannte durch den strömenden Regen, Blaulicht flackerte, eine chaotische Szene. Die rote Anzeige am oberen Bildrand gleich neben dem Signet des Schweizer Fernsehens wies darauf hin, dass live berichtet wurde.
Endlich entdeckte ich die Fernbedienung auf dem Bücherregal und stellte den Ton lauter. Eben wurde ins Studio zurückgeschaltet. Der Moderator sah erschüttert aus, er kündigte eine Berichterstattung direkt vom Ort des Geschehens an, der Kollege sei gerade in Altstetten eingetroffen.
Die Kamera schwenkte über das Areal des Asylzentrums. Unter den Vordächern und auf den Treppen der lang gezogenen Baracken waren verängstigt wirkende Menschen versammelt. Männer mit ernsten Mienen hatten sich etwas vorgewagt, die Arme in die Hüften gestützt oder vor der Brust verschränkt, Kleider und Haare klatschnass. Aus den Fenstern lehnten sich Kinder, eine Mutter drückte schützend ihren Säugling an sich. Entlang der Absperrung waren blasse Gesichter unter aufgespannten Regenschirmen zu erkennen, Handys wurden hochgehalten: Die ersten Gaffer waren eingetroffen.
Ein junger Reporter, den ich noch nie zuvor gesehen hatte, trat jetzt mit einem selbstgefälligen Lächeln vor die Kamera. Er trug einen durchsichtigen Plastikregenschutz über dem Anzug und schien Probleme mit dem Ton zu haben, immer wieder nestelte er am Kopfhörer in seinem Ohr herum. Endlich hielt er den Daumen hoch und setzte eine betroffene Miene auf. Mit viel zu pathetischer Stimme wiederholte er die bisherigen Erkenntnisse zur Schießerei. Noch war nicht viel bekannt. Heute Morgen um kurz vor acht sei auf einen Mann geschossen worden, der im Begriff gewesen sei, das Asylzentrum zu verlassen.
»Der Mann war zu einem Termin im Verfahrenszentrum des Bundesamtes für Migration vorgeladen und befand sich auf dem Weg in den zweieinhalb Kilometer entfernten Kreis 5«, berichtete der Moderator, dessen Name jetzt im unteren Bereich des Bildschirms eingeblendet wurde. Matthias Glättli fuhr sich durch seine blonde Igelfrisur, bevor er weitersprach: »Laut Logendienst hat er das Areal um 07:53Uhr verlassen, gleich darauf wurde auf ihn geschossen, so viel ist durchgesickert. Ob es sich dabei um einen politisch motivierten Mord handelt, ist noch ungewiss. Auch zum Schützen gibt es bislang keine weiteren Informationen. Wie es scheint, konnte er ungesehen entkommen.«
Es folgten ein paar Informationen zur Barackensiedlung auf dem Juch-Areal in Altstetten, wo seit dem Frühjahr eine Testphase für beschleunigte Asylverfahren stattfand. Was bei der lokalen Bevölkerung auf Besorgnis und zum Teil heftigen Widerstand gestoßen war.
Glättli fingerte schon wieder am Knopf in seinem Ohr herum. »Wie ich gerade erfahre, wurde das Opfer identifiziert. Es handelt sich um einen sechsunddreißigjährigen Syrer, der erst vor wenigen Wochen in der Schweiz einen Asylantrag gestellt hat.« Er machte eine Pause und lauschte auf die Anweisungen der Regie. »Soeben wurde auch ein Foto des Ermordeten freigegeben und sollte gleich eingeblendet werden.«
Im nächsten Moment füllte das Gesicht des Mannes den Bildschirm. Die Tasse rutschte mir aus der Hand und zerschellte klirrend auf dem Fußboden, heißer Kaffee netzte meine Zehen, doch ich nahm es kaum wahr. Wie gebannt starrte ich auf den Fernseher. Es bestand kein Zweifel. Faruq al-Naser. So also hieß der Mann, den ich erst vor wenigen Tagen dabei fotografiert hatte, wie er sich mit Jasmin Bühler im Auto vergnügte.
Beim Einbiegen in die Quartierstraße geriet mein Käfer bedenklich ins Schlingern und beinahe hätte ich auf der glitschigen Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen verloren. Mit einer unsanften Bremsung brachte ich ihn schließlich vor dem Domizil der Bühlers zum Stehen. Sofort stürzte ich aus dem Auto, stieß das Gartentor auf und drückte sekundenlang auf die Klingel. Nichts rührte sich. Die Rollläden des Einfamilienhauses waren heruntergelassen, wodurch es trotz des mediterran inspirierten Baustils einen abweisenden Eindruck machte. Ich umrundete das Gebäude und fuhr erschrocken zusammen, als grelle Scheinwerfer aufflammten. Vor den großen Fensterfronten auf der Rückseite waren die Storen ebenfalls heruntergekurbelt. Ums Haus herum herrschte eine geradezu pingelige Ordnung, einzig der gepflegte Rasen versank im Schlamm. Es sah aus, als sei das Ehepaar in den Urlaub gefahren. Dafür sprach auch, dass Bühler nicht erreichbar war, weder auf dem Handy noch an seinem Arbeitsplatz, obschon ich ihn auf der Fahrt hierher sicher ein Dutzend Mal angerufen hatte. Doch instinktiv wusste ich, dass das nicht zutraf. Vielmehr bestätigte seine Abwesenheit meinen ungeheuerlichen Verdacht.
Ich rannte zurück zum Wagen und fuhr auf schnellstem Weg zum Schweizer Firmenhauptsitz von GoforIT-Solutions, der ganz in der Nähe in einem modernen Gebäudekomplex untergebracht war.
»Ist Adrian Bühler im Haus?«, erkundigte ich mich atemlos am Welcome Desk.
»Sie machen hier alles schmutzig!« Naserümpfend taxierte die Empfangsdame meine nassen Schuhabdrücke auf dem spiegelglatten Kachelboden und bedachte mich mit einem Blick, der das Welcome-Schild über ihrem Arbeitsplatz Lügen strafte.
»Ist er da?«
»Wen, sagten Sie, suchen Sie?«
»Adrian Bühler«, wiederholte ich ungeduldig. »Sehen Sie bitte nach, es ist dringend!«
Pikiert kräuselte sie die Lippen und tippte auf ihrer Tastatur herum.
»Und? Was ist?«
Sie zog eine Augenbraue hoch. »Leider nein, aber vielleicht sollten Sie …«
»Verdammter Mist, wo kann er nur stecken?« Gehetzt sah ich mich im klinisch wirkenden Eingangsbereich des Gebäudes um, als fände sich dort nebst dem unvermeidlichen Hydrokulturficus und den ebenso unvermeidlichen Corbusiersesseln der entscheidende Hinweis auf Bühlers Aufenthaltsort.
»Warten Sie …!«, rief mir die Frau hinterher, doch ich war bereits auf die Ausgangstür zugerannt und bedankte mich per Handzeichen. Ich durfte keine Zeit verlieren.
Die heftigen Regenschauer waren kurzfristig abgeflaut, es nieselte nur noch und einen Moment lang sah es sogar danach aus, als würde die Hochnebeldecke aufreißen. Doch von Westen her näherte sich bereits eine weitere Unwetterfront, düster aufgetürmte Wolkenberge, in deren Inneren es unheilvoll brodelte.
Am Tatort herrschte eine äußerst angespannte Atmosphäre. Hier und da konnte ich Mitleid oder Besorgnis in den Gesichtern der Zaungäste erkennen, während ich mich eilig durch die Menge drängelte, doch die meisten warteten mit unergründlichen Mienen auf neue Erkenntnisse.
»Einfach abgeschoben haben die das Problem und jetzt: Mord und Totschlag direkt vor unserer Haustür!«, machte eine ältere Frau ihrem Unmut halblaut Luft. »Und wir müssen nun schauen, wie wir damit zurechtkommen!«
Ringsum wurde ihr murmelnd beigepflichtet.
»Und wo bleibt die rot-grüne Regierung, wenn man sie braucht? Denen haben wir das doch zu verdanken!«, meckerte ein jüngerer Mann, der sich an sein Fahrrad lehnte. Ein paar der Umstehenden klatschten Beifall.
Entlang der Absperrung patrouillierten Polizisten und beobachteten wachsam die Menge, um sofort reagieren zu können, falls die Stimmung kippte. Gleißende Blitzlichter zuckten über die Szene, es fanden sich immer mehr Presseleute ein. Kameras wurden ausgepackt, Objektive montiert, Stative aufgestellt. Moderatorinnen suchten Schutz unter aufgespannten Schirmen und legten Lippenstift oder Puder nach. Der Zufahrtsweg war längst von Übertragungswagen blockiert. Im Scheinwerferlicht einer Fernsehkamera entdeckte ich Matthias Glättli, der die spärlichen Erkenntnisse für die Zuschauer wiederkäute.
»Fiona!« Wie alle anderen Polizisten trug sie eine unförmige Pelerine, sodass ich sie einzig am umgehängten und mit einer Schutzhülle gegen den Regen verpackten Fotoapparat erkannte. Sie wandte sich mit suchendem Blick um. Erst als ich die Hand hob, entdeckte sie mich und kam ans Absperrband gelaufen. Seit sie Mutter war, arbeitete sie nur noch Teilzeit als Polizeifotografin und war in der Regel zusammen mit Vertretern der Medienstelle als eine der Ersten am Tatort – gerade in Fällen von großem öffentlichen Interesse, wenn mit dem Auftauchen von Journalisten zu rechnen war.
Fiona sah angespannt aus, ein paar blonde Strähnen hingen ihr nass in die Stirn. Ich erklärte ihr hastig, was ich wusste und was ich befürchtete.
»Hast du das der Zentrale gemeldet?«, wollte sie sofort wissen.
»Ja, klar. Aber …«
»In dem Fall wird man der Sache nachgehen.«
»Ich hatte nicht das Gefühl, ernst genommen zu werden.«
Fionas Blick schweifte weiterhin wachsam über das Areal, während sie mir erklärte: »Bei jeder Ermittlung melden sich unzählige Leute mit vermeintlich wichtigen Hinweisen, da kann es schon mal vorkommen, dass man am Telefon einsilbig abgekanzelt wird. Gerade, wenn der Fall noch ganz neu ist. Wir nehmen jedoch jeden einzelnen Anruf ernst und gehen den Meldungen nach, das versichere ich dir. Nur dauert das manchmal etwas.«
»Aber Bühler ist verschwunden! Ich war bei ihm zu Hause und an seinem Arbeitsplatz … Der ist krankhaft eifersüchtig. Ich sage dir, er hat diesen Syrer abgeknallt und ist dann untergetaucht! Und seine Frau war auch nicht da, wer weiß, was er ihr angetan …«
»Vijay, beruhige dich! Wir werden uns darum kümmern und dann wird sich schnell herausstellen, ob was an der Sache dran ist.«
»Der Mann ist gefährlich!«, stieß ich hervor.
»Überlass das uns. Wir werden ihn finden.«
»Okay, okay.« Ich holte tief Luft. »Verdammte Scheiße.«
»Kann man so sagen.«
»Halt mich auf dem Laufenden, ja?«
»Sicher.«
»Wo ist José?«
Ihr Blick wurde verschlossen und sie deutete mit einer knappen Kinnbewegung die Richtung. Das Verhältnis zwischen meinem besten Freund und Fiona, der Mutter seines kleinen Sohnes, war seit einem Seitensprung Josés angespannt. Obschon sie ihrem Kind zuliebe immer noch zusammenwohnten, herrschte Eiszeit zwischen den beiden.
Das Asylzentrum lag malerisch eingebettet zwischen Autobahn und Eisenbahnlinie, das Areal grenzte an eine unwirtliche Industriezone mit Lagerhäusern und Gewerbegebäuden, dahinter erstreckte sich ein Schrebergartengelände. José lehnte etwas vom Volksauflauf entfernt an der Wand einer Fabrikruine mit zerbrochenen Fensterscheiben und rauchte.
»Was tust denn du hier?«, erkundigte er sich erstaunt und hielt mir unaufgefordert die Zigarettenschachtel hin. Ich winkte ab. Obschon ich das Rauchen theoretisch aufgegeben hatte, paffte ich gern hin und wieder eine. Doch jetzt war es definitiv noch zu früh dazu.
»Ich muss mit dir reden.« Ich lieferte meinem Schulfreund, der mittlerweile stellvertretender Chefredakteur einer Gratiszeitung war und bei einer größeren Sache wie dieser selbstredend persönlich vor Ort sein wollte, eine Zusammenfassung der bisherigen Geschehnisse.
»Hast du die Polizei benachrichtigt?«
»Ja, natürlich. Ich hab eben mit Fiona geredet. Ihre Kollegen sind momentan etwas überfordert, befürchte ich. Da gehen angeblich gerade Hunderte von Hinweisen ein …«
»Die meisten leider von Leuten, die sich nur wichtigmachen wollen. Aber nach dem, was du erzählt hast, wäre der Ehemann eindeutig der Hauptverdächtige.«
»Und der Typ ist verschwunden.«
»Das entlastet ihn nicht gerade.«
»Ich mach mir Sorgen, José.«
»Und seine Frau hatte eine Affäre mit dem erschossenen Asylanten?«
»Ja, da bin ich mir absolut sicher. Die beiden machten einen so vertrauten Eindruck und kamen so schnell zur Sache – das war keine einmalige Angelegenheit.«
»Hast du Beweise?«
»Nicht mehr«, gab ich kleinlaut zu. »Ich hab die Fotos gelöscht.«
Stoisch zog José an seiner Zigarette.
»Ich weiß, das war rückblickend dumm. Aber ich dachte, ich brauch die eh nicht mehr …« Mit einer Handbewegung forderte ich José auf, mir das Zigarettenpäckchen jetzt doch auszuhändigen, und zündete mir einen Glimmstängel an.
»Aber die Geschichte hat einen Haken.« Ich blies den Rauch gegen den sich verdunkelnden Himmel. »Bühler wusste gar nichts von der Affäre. Ich habe sie ihm verschwiegen, um seine Frau vor ihm zu schützen. Er ist sehr aufbrausend und wird schnell handgreiflich, das hab ich selbst erlebt, ich wollte verhindern, dass er ihr was antut. Als ich vorhin von dem Mord erfuhr, war mir sofort klar, dass er dahintersteckt. Deshalb bin ich zu ihm gefahren. Dass er dann weder zu Hause noch an seinem Arbeitsplatz war, hat meinen Verdacht noch verstärkt. Nur – auf welchem Weg hat er vom Verhältnis seiner Frau erfahren?«
»Du weißt ja nicht, was seit letzter Woche passiert ist. Vielleicht hat sie ihm inzwischen alles gebeichtet?«
Bestürzt sah ich José an. Dieser Gedanken war mir noch gar nicht gekommen.
»Möglicherweise ist er ihr auch selbst gefolgt«, fuhr er fort. »Eifersüchtige Ehepartner sind zuweilen ziemlich findig.«
»Auf jeden Fall schwebt Jasmin Bühler in großer Gefahr!«
»Die Polizei wird sich um sie kümmern.«
»Wann denn? Vielleicht ist es bis dahin zu spät. Ich kann doch nicht einfach untätig rumstehen und warten!«
»Hombre, es ist nicht deine Aufgabe, die Frau zu beschützen!«
»Das weiß ich doch. Aber ich fühle mich trotzdem irgendwie verantwortlich …«
»Was ist denn da los? Joder!« Aufmerksam reckte José den Kopf und trat seine Kippe aus.
Vor der Absperrung war ein Tumult ausgebrochen, laute Rufe waren vernehmbar. Ein eilig fabriziertes Transparent wurde hochgehalten: Für ein Altstetten ohne Asylzentrum war in krakeligen Buchstaben daraufgesprayt. Weiter hinten wurden Pappschilder mit ähnlichen Aufschriften hochgereckt. Mörderasylanten raus! forderte jemand unter fataler Verdrehung der Tatsachen, die Kameras fingen die zunehmend aufgeheizte Stimmung dankbar ein. Erste Parolen wurden skandiert und die Polizisten sprachen alarmiert in ihre Walkie-Talkies, ohne dabei die unruhig wogende Menschenmenge aus den Augen zu lassen.
Mit mir im Schlepptau stürzte sich José in das Gewühl und hielt Ausschau nach seinen Mitarbeitern, die er ganz vorne, im Zentrum des Geschehens, vermutete. Auf dem Weg dorthin wurden wir immer wieder grob angerempelt und mehr als einmal abgedrängt. Hier, mitten im Mob, herrschte eine fiebrige, aggressive Atmosphäre. Wenn nicht bald jemand die Leute beruhigte, würde die Situation in Kürze außer Kontrolle geraten. Wir hatten endlich die beiden jungen Journalisten gefunden, als direkt vor dem weißen Zelt, in dem vermutlich noch immer der Tote lag, ein greller Scheinwerfer aufflammte. Die Rufe verstummten nach und nach, um einer erwartungsvollen Stille Platz zu machen. Unter einem hochgehaltenen Schirm entdeckte ich einen jungen Mann in ausgebeultem Jackett und Jeans, der hektisch einige Notizen durchging, während er gleichzeitig in ein Mobiltelefon sprach, eine Assistentin fuchtelte mit einem Puderpinsel in seinem Gesicht herum.
»Wer ist das denn?«, fragte ich José und deutete in Richtung des Schirms.
»Sebastian Studer«, antwortete er mir, nachdem er einen prüfenden Blick auf den mit seiner Nickelbrille und der wuscheligen Frisur irgendwie knuffig wirkenden Burschen geworfen hatte. »Ein Grüner. Möchte unbedingt in den Stadtrat, hat aber bei den letzten Wahlen den Einzug knapp verpasst.«
»Erklärt einiges.«
»Und das ist erst der Anfang, du wirst sehen.«
Studer hatte sich ein Megafon geschnappt und brachte sich jetzt direkt vor dem Absperrband in Position.
»Liebe Altstetter, liebe Zürcher, liebe Schweizer!«
José und ich sahen uns an und verdrehten die Augen. Das Blitzlichtgewitter warf gespenstische Effekte auf Studers blasses Gesicht.
»Ein schwarzer Tag! Für Altstetten, für die Schweiz, für uns alle. Eine Tragödie hat sich hier abgespielt, über die wir noch nichts Genaues wissen. Ein Menschenleben, das einem sinnlosen … äh … Gewaltakt zum Opfer fiel …« Studers Stimme hallte über die Menschenmenge und Unruhe erfasste mich. Ich sollte nicht hier sein, sondern nach Jasmin Bühler suchen, selbst wenn mich keine Schuld an der mutmaßlichen Tat ihres Mannes traf. Vielleicht waren sie ja tatsächlich im Urlaub und ich machte mir umsonst Sorgen. Doch irgendwie fand ich diesen Gedanken wenig überzeugend. Vielmehr konnte ich mir vorstellen, dass Adrian Bühler – auf welchem Weg auch immer – von der Affäre seiner Frau erfahren hatte und ausgetickt war. Er hatte erst den Liebhaber hingerichtet und dann seine Frau … verschleppt, umgebracht? Und ich stand hier und ließ mich von einem Politiker volllabern.
»… und deshalb … äh … ist es wichtig, dass wir den Asylanten auf Augenhöhe begegnen. Sie sind Menschen … äh … wie wir, Menschen, die Schreckliches erlitten haben …«
»Das behaupten sie zumindest!«, brüllte jemand hinter mir und nicht wenige Zuschauer applaudierten.
»Um genau darüber schnellstmöglich Klarheit zu erhalten, wird hier das verkürzte Asylverfahren getestet! Altstetten spielt dabei … äh … eine Pionierrolle …«
Pfiffe erklangen, ein Teil der Menge buhte. Für Sebastian Studer wurde es langsam unbehaglich, er lockerte seinen Hemdkragen, fuhr aber unbeirrt fort: »Wichtig ist jetzt, Ruhe zu bewahren! Die Ermittlungen sind … äh … in vollem Gange und noch kann niemand sagen, was es mit dieser … äh … Schießerei auf sich hatte. Man sollte sich hüten, vorschnell Schuldige zu benennen …« Er blickte zu dem Schild mit der Falschaussage hinüber, das daraufhin kleinlaut in der Menschenmasse versank, »… oder seinen Emotionen freien Lauf zu lassen. Dies ist eine sehr emotionale Angelegenheit, das ist mir bewusst, dennoch appelliere ich hiermit an Ihren gesunden Menschenverstand und … äh … die Vernunft. Ich nehme Ihre Besorgnis sehr ernst, das versichere ich Ihnen! In dieser heiklen Situation setze ich mein … äh … ganzes Vertrauen in die Fähigkeiten unserer Polizei und bin mir sicher, dass sie den oder die Schuldigen schon bald überführen wird. Nur so kann … äh … in Altstetten wieder Frieden einkehren. Ich danke Ihnen!« Studer nickte der Menge zu und erstaunlich viele Zuhörer klatschten Beifall, manche sogar ziemlich begeistert. Die Buhrufe im Hintergrund waren dennoch nicht zu überhören.
»Ich muss los, diese Sache mit Bühler lässt mir keine Ruhe«, verabschiedete ich mich von José.
»Coño!«, flüsterte er und blickte gebannt auf eine robuste Dame im taubengrauen Kostüm, die an der Spitze einer Ansammlung Anzugträger zielstrebig vor die abgesperrte Zone trat.
»Die Widmer! Ausgerechnet!« Nationalrätin Annegret Widmer stammte selbst aus Altstetten und war das Aushängeschild der VPRS, der Volkspartei zur Rettung der Schweiz, die für ihre Ausländerhetze weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt war. Selbstverständlich wohnte die Widmer längst nicht mehr hier, sondern residierte standesgemäß in einem noblen Anwesen an der Goldküste.
»Die versuchen, sich auf Kosten eines toten Asylanten zu profilieren«, konstatierte José fassungslos. »Für Politiker ist wohl immer Wahlkampf.«
»Taktgefühl ist eh überschätzt. Aber auf die Widmer kann ich gut verzichten.«
José hielt meinen Arm fest. »Ich denke, das solltest du dir anhören.«
Annegret Widmer war stehen geblieben und verlangte mit einer herrischen Geste nach dem Megafon. Jetzt erst fiel mir ihre neue Frisur auf. Anstelle des bisherigen Helmschnitts trug sie das blonde Haar nun halblang und mit luftigen Wellen versetzt. Damit beabsichtigte sie wohl, ihrer notorisch strengen Erscheinung – die häufig an einen Kriegsgeneral erinnerte – ein paar feminine Akzente zu verleihen. Die weibliche Wählerschaft ansprechen. Unverändert allerdings, trotz des dezenten Make-ups, ihr feistes Schweinchengesicht, dem sie – wie böse Zungen behaupteten – zu einem guten Teil ihre Beliebtheit bei der Landbevölkerung verdankte.
»Peng!« Annegret Widmer peitschte das Wort durch den Verstärker und wartete ab, bis absolute Stille herrschte. »Peng! Peng! Jetzt ist es geschehen! Es wird wieder geschossen in unserem friedlichen Land! Man weiß nicht wer, aber man weiß wegen wem: einem Asylanten! Wir von der Volkspartei haben immer davor gewarnt! Ein Asylzentrum mitten im bewohnten Gebiet, das kann ja nicht gut gehen!«
Jeder Satz ein Ausruf, eine Anklage. Für diese Rhetorik war Widmer bekannt und sie funktionierte. Beim einfachen Volk sowieso, doch auch gebildetere Schichten waren je länger, je mehr von der Frau angetan. Eine, die so redete, dass jeder sie verstand, die sich nicht scheute, denen da unten in Bern und jenen da oben in Brüssel die Stirn zu bieten. Die sich bei sämtlichen sich bietenden Gelegenheiten über die brave Konsenspolitik des Bundesrates mokierte und die Ideen anderer Parteien mit Genuss zerpflückte. Bei dem ganzen Getöse, das sie veranstaltete, übersah man gern, dass die selbst ernannte Landesmutter so ziemlich gegen alles war, was die Schweiz vorwärtsgebracht oder offener gemacht hätte. Ohne jemals eine originellere Alternative anzubieten, als die Schotten dicht zu machen und alles so zu belassen, wie es immer gewesen war. Bloß keine Veränderung, die Schweiz den Schweizern und an der Grenze gerade so viele Ausländer durchwinken, damit die Drecksarbeiten erledigt werden können – ausgenommen natürlich die Reichen, die köderte man gern auch mal mit großzügigen Steuergeschenken.
»Ich halte das nicht aus!«, zischte ich José zu.
»Aber guck doch mal genau hin! Wie genial die das anstellt! Das muss ihr erst einer nachmachen.«
Widmer hatte die Faust erhoben und schüttelte sie gegen die schwarzen Wolken über Altstetten, sie kam mir dabei vor wie ein kleiner machtbesessener Gnom. Fehlten nur noch Blitz und Donner.
»… das haben wir jetzt vom Kuschelkurs der rot-grünen Stadtregierung! Meine Damen und Herren, wir sind im eigenen Land nicht mehr sicher! Mord und Totschlag mitten unter uns!« Sie legte eine dramatische Pause ein. »Natürlich sagen die Linken, dass ein paar mehr keine Rolle spielen. Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Afrika – egal, lasst sie rein. Kommt her, hier wird für euch gesorgt, hier wird’s euch gut gehen! Natürlich sind wir ein Land mit humanitärer Tradition. Nur: Da kommt zuerst einer, doch schon bald folgen ihm Frau und Kinder und am Ende haben wir die ganze Sippe hier! Jawoll, meine Damen und Herren! So ein Syrer hat im Durchschnitt zwölf Familienmitglieder! Rechnen Sie selbst nach, wie viele Flüchtlinge das ausmacht, wenn wir auch nur fünfhundert von denen reinlassen! Wenn das so weitergeht, sind wir bald eine Minderheit im eigenen Land! Und wer bezahlt das alles? Der Steuerzahler natürlich! Da fragt sich der Schweizer zu Recht, wo er bleibt. Dabei ist das Boot längst voll! Wir von der Volkspartei zur Rettung der Schweiz …«
Wie immer hielt sich Annegret Widmer nicht mit Fakten auf, sondern opferte diese gern für volksnahe Polemik.
»Diese Frau kennt die Befürchtungen der Bevölkerung haargenau und sie sagt exakt das, was die Leute hören wollen. Dabei lässt sie es so aussehen, als sei das alles auf ihrem eigenen Mist gewachsen. Anprangern ohne Ende und dabei möglicherweise unangenehme Lösungsvorschläge unterschlagen. So macht man erfolgreiche Politik!«
José hatte recht: Die Menge tobte und jubelte der rechtskonservativen Politikerin im wieder stärker werdenden Regen frenetisch zu.
Ich war in trockene Sachen geschlüpft und hatte es mir mit einer Tasse dampfendem Chai und meinem Laptop auf dem Bett bequem gemacht. Im Fernseher lief immer noch die Liveschaltung nach Altstetten, Matthias Glättli hatte soeben ein längeres Gespräch mit Annegret Widmer geführt und machte nun auf die schwierige Situation in Altstetten aufmerksam.
»Erst waren es die Schrebergärten, die dem geplanten Eishockeystadion hätten weichen müssen. Zum Glück für die Gartenliebhaber hat der ZSC die Planung gestoppt, zumindest vorübergehend. Dann sind da nebst dem Asylzentrum auch noch die Sexboxen. Wie es scheint, lagert die Stadt Zürich zurzeit alles, was ihr nicht genehm ist, nach Altstetten aus.«
Die Sexboxen waren seit rund einem Jahr in Betrieb. Eine Art städtisch organisierter Fickparcours im Außenbezirk, als Ersatz für den von Straßenprostitution überlasteten Sihlquai in der Innenstadt. Verhaltenstafeln mit einer Unzahl an Piktogrammen, die zu entziffern wohl länger dauerte als der Akt selbst, leiteten den Freier in seinem Auto durch eine lauschige Anlage mit Büschen und authentischer Ghetto-Graffitiwand, wo er erst einmal das Tagesangebot in freier Wildbahn begutachten konnte. Dann führte die Straßenschlaufe zu einem an einen Pferdestall erinnernden Unterstand, dem irgendeine Amtsstelle die unsägliche Bezeichnung ›Verrichtungsbox‹ verliehen hatte. Darin war es dann dem Freier erlaubt, mit der Dame seiner Wahl zu kopulieren. In der Schweiz wurde selbst Sex zur Paragrafenreiterei.
Ich drehte die Lautstärke des Fernsehers herunter, klappte das Laptop auf und widmete mich Adrian Bühler. Auf der Heimfahrt war ich nochmals bei ihm zu Hause gewesen, doch weder er noch seine Frau waren in der Zwischenzeit zurückgekehrt. Ich sah ein, dass es wenig Sinn ergab, auf gut Glück nach Bühler zu suchen, bevor ich nicht wusste, mit wem ich es eigentlich zu tun hatte.
Schon bald hatte ich einiges über ihn herausgefunden: Er stammte aus Lenzburg im Kanton Aargau und war seit sechs Jahren mit Jasmin verheiratet. Er hatte 1997 das Informatikstudium an der ETH Zürich mit glänzendem Resultat abgeschlossen, zwei Semester davon war er in Cambridge am Massachusetts Institute of Technology eingeschrieben gewesen. Gleich nach Studienende wurde er bei Hewlett-Packard in Dübendorf mit einem verantwortungsvollen Posten betraut, zwei Jahre später wechselte er zur Privatbank Julius Bär. Beide Jobs waren ebenfalls mit einer unübersichtlichen Reihe englischer Wörter bezeichnet, die ein Zufallsgenerator bestimmt haben mochte und mir entsprechend wenig sagten. Bühler hatte sich konstant weitergebildet, wie ich seinem Curriculum auf der Homepage von GoforIT-Solutions entnehmen konnte, vor drei Jahren hatte er in Altstetten bei seinem jetzigen Arbeitgeber angefangen, nach einer mehr als einjährigen Auszeit.