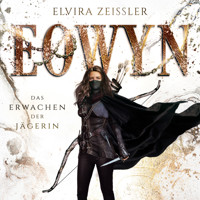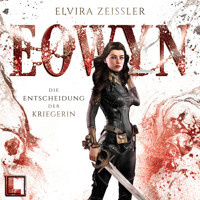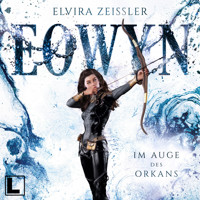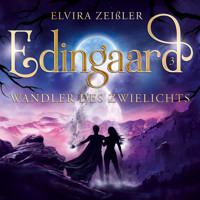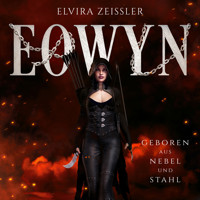0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dhalia, eine junge Fürstentochter, wächst in dem Glauben an eine alte Prophezeiung auf – ihr scheint es bestimmt zu sein, eines Tages ihr Land von der Unterdrückung durch den Herrscher zu befreien. Doch an ihrem 18. Geburtstag erkennt sie ihren Irrtum. Auf der Suche nach Antworten macht sie sich auf, das sagenumwobene Volk der Alten Feen zu finden. Auf diesem Weg, der nicht für sie bestimmt war, lauern viele Gefahren, denn schon bald wird sie von den gefürchteten Dunkelfeen des Herrschers gejagt… Abenteuer, Romantik und Magie mit einer faszinierenden jungen Heldin!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Feenkind - Der See des Abschieds
XXL-Leseprobe
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenProlog
Zärtlich strich Elinor über das mit weicher Spitze versetzte Deckchen, das ihre schlafende Tochter bedeckte. Obwohl die Geburt schon beinahe einen Mond zurücklag, konnte sie dieses Wunder noch immer nicht fassen. Neben ihr lächelte ihr Gatte, Fürst Th’emidor, und zog ihre Hand sanft fort.
Das Baby gähnte und schmatzte schläfrig mit den Lippen.
„Komm schon, Elinor, lass unsere Kleine jetzt schlafen.“
Als sie sich abwandte, streifte ihre Hand ein filigranes, handflächengroßes silbernes Blatt, das wie ein Talisman über dem Kopf des Babys hing. Ein verirrter Sonnenstrahl verfing sich in der spiegelnden Oberfläche und schickte blendend helle Lichtreflexe quer durch den gesamten Raum. Die Mutter streckte die Hand aus, um den kleinen Spiegel ruhig zu stellen, damit sein Glanz das eben eingeschlafene Baby nicht störte.
Noch während sie das Blatt festhielt, verdunkelte sich plötzlich seine Oberfläche und der silbrige Glanz wurde von einer rauchigen Tiefe abgelöst. Die Oberfläche des Spiegels schien einen Augenblick lang zu wabern. Dann, ganz langsam, formten sich Buchstaben, erst kaum erkennbar, dann immer klarer, bis ein Text in glühenden Lettern sich deutlich von den Nebelschwaden des Hintergrunds abhob.
Die Tochter des Hauses Th’emidor wird einst am Scheideweg der Weltordnung stehen. Heil denen, die sie auf ihrer Seite wissen. Und wehe denen, die sich ihr in den Weg stellen – sie werden untergehen.
Erschrocken ließ Elinor den Spiegel los und griff nach ihrer Tochter, als könnte sie dadurch das Kind vor jeglicher Gefahr beschützen.
In seinem Schlaf gestört, fing das Baby an, protestierend zu weinen.
„Ist ja gut, mein Liebling, Mama ist da. Dhalia, mein Schatz, schhht, schlaf weiter, Kleines. Mama ist ja da“, versuchte sie das Kind zu beruhigen, während ihr eigenes Herz wie wild pochte. Gebannt starrten Th’emidor und sie weiter auf das kleine Blatt, denn die Schriftzüge veränderten sich und ein weiterer Satz erschien.
In achtzehn Jahren wird sich der Auserwählten ihr Schicksal offenbaren.
So plötzlich, wie sie gekommen waren, verschwanden die Buchstaben auch schon wieder, und nichts deutete darauf hin, dass das kleine Blatt etwas anderes war als ein meisterhaft gearbeiteter Spiegel. Vergeblich warteten die Eltern darauf, dass noch irgendetwas sonst geschah.
„Was war das?“ Elinor blickte ihren Mann in der Hoffnung an, dass er nichts gesehen hatte, dass es nur eine Sinnestäuschung oder ihre Einbildung gewesen war.
Doch sein Blick bestätigte ihr, dass er es auch gesehen hatte. Er wirkte sehr ernst. „Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich hatte keine Ahnung, dass so etwas möglich ist. Aber du weißt ja, was das hier ist.“ Er deutete vorsichtig auf den kleinen Spiegel.
„Ja, ich weiß es, und ich wollte nicht, dass es über Dhalias Kopf hängt. Es scheint, ich hatte Recht damit“, antwortete sie besorgt.
Verwundert blickte Th’emidor seine Frau an. „Aber, meine Liebe, das ist doch nichts Böses. Was auch immer unsere Tochter erwartet, es ist besser, wenn wir vorgewarnt sind.“
„Glaubst du? Und was geschieht wohl, wenn der Herrscher davon erfährt? Wirst du immer noch sagen, dass dieses Ding es gut mit uns gemeint hatte, wenn sie uns unsere Tochter wegnehmen?“ Ihre Stimme hatte einen panischen Unterton. Beschützend drückte sie das hilflose kleine Wesen in ihren Armen an ihre Brust.
Fürst Th’emidor sah seiner Frau fest ins Gesicht. Sein ganzer Körper und noch mehr seine Stimme strahlten eine ruhige Entschlossenheit aus, als er sagte: „Das wird er nicht. Niemand außer uns Dreien wird jemals etwas davon erfahren. Doch was auch immer Dhalias Schicksal eines Tages sein wird, wir werden sie auf ihre Aufgabe vorbereiten und ihr beistehen, wenn es soweit ist.“
Kapitel 1
Dhalia machte einen gewagten Schritt vorwärts und ließ ihr Schwert mit aller Macht niedersausen. Doch der Mann vor ihr wich ihrem Hieb geschickt aus und parierte ihn mit seiner eigenen Klinge. Die Wucht des Aufpralls jagte einen brennenden Schmerz durch Dhalias Arme bis in ihre Schultern hinauf. Doch sie verzog keine Miene.
Herausfordernd umkreiste ihr Gegner sie. „Was ist los, Schätzchen, ist das alles, was du kannst?“ Er versuchte, sie in Rage zu bringen.
Doch sie blieb ruhig und beobachtete sorgfältig jede seiner Bewegungen. Seine Stimme hatte sie völlig ausgeblendet und konzentrierte sich darauf, seine Schwachstelle zu finden. Das war gar nicht so leicht. Sie täuschte einen Ausfall vor, doch er fiel nicht darauf rein und startete stattdessen einen Gegenangriff. Wieder prallten die zwei Klingen aufeinander, so fest, dass Funken sprühten. Dhalias Arme schmerzten. Lange würde sie diesen Kampf nicht mehr aushalten. Sie war zwar geschickter und schneller als die meisten Männer, an purer Kraft war sie ihnen jedoch einfach unterlegen. Aber sie hatte mittlerweile gelernt, diesen Mangel zu kompensieren.
„Mehr hast du nicht drauf, Mädchen?“ spottete er weiter. „Kannst du nicht einmal einen alten Mann besiegen?“
Ohne auf die Bemerkungen einzugehen, umfasste sie den Griff ihres Schwertes ganz fest mit beiden Händen und führte eine schnelle Folge von kurzen Schlägen aus, so dass es aussah, als wäre ihr Schwert lebendig und würde sich geradezu um das Schwert ihres Gegners winden. Ehe er sich versah, hatte sie es ihm schon aus der Hand geschlagen. Schwer atmend und stolz hielt sie ihm ihre eigene Schwertspitze vors Gesicht.
„Für einen alten Mann reicht es noch allemal, Vater.“
Er lachte herzlich. „Wo du Recht hast, hast du Recht, Kleine. Wann hast du denn diese Finte wieder gelernt? Ich habe sie dir bestimmt nicht beigebracht.“
Sie zuckte mit den Achseln. „Ich weiß nicht, ist mir eben so eingefallen.“
„Das war verdammt gut. Ich habe gar nicht gemerkt, was du vorhattest, bis ich deine Schwertspitze an meinem Hals spürte.“ Voller Stolz betrachtete ihr Vater ihre aufrechte, schlanke Gestalt, die langen blonden Haare, die sie zu einem schlichten Zopf geflochten hatte, damit sie sie beim Kampf nicht störten, und ihre vor Anstrengung rosigen Wangen. Wenn man sie betrachtete, wäre man nie auf den Gedanken gekommen, dass sie ein Schwert mit tödlicher Präzision zu führen vermochte oder dass sie reiten konnte wie der Wind oder dass sie mit ihrem Bogen auch auf hundert Schritte Entfernung immer ins Schwarze traf. Es war erstaunlich, was dieses Kind, denn das war sie trotz allem noch immer für ihn und würde es auch immer bleiben, in den letzten fast achtzehn Jahren gelernt hatte. Er hoffte, es würde genug sein. Nein, er wusste es ganz sicher. Jedes Mal, wenn er sie ansah – die anmutige und stolze Haltung des Kopfes, die verborgene Kraft der geschmeidigen Glieder, den funkelnden Glanz ihrer so ungewöhnlich grünen Augen – spürte er, dass ihr ein außergewöhnliches Schicksal bevorstand. Er brauchte keine Prophezeiung, um daran glauben zu können.
Dhalia spürte, wie sie unter dem wohlwollenden Blick ihres Vaters errötete. Doch sie war stolz auf sein Lob zu ihrem Kampf. Es machte ihr Spaß, neue Figuren auszuprobieren, und es freute sie, wenn sie erfolgreich waren. Der Schwertkampf war für sie einem Spiel oder einem Tanz vergleichbar, es ging um Geschicklichkeit, Strategie und Ausdauer. Sie konnte sich nicht vorstellen, damit einem lebendigen Wesen etwas anzutun. Sie bezweifelte, dass sie jemals die Kraft haben würde, durch lebendes Fleisch zu schneiden, oder dass sie ihr Schwert nach so einer Tat jemals wieder würde in die Hand nehmen können.
Gedankenverloren spielten ihre Finger mit dem silbernen Blatt, das an einem Lederband um ihren Hals hing. Seit sie sich erinnern konnte, hatte sie es immer bei sich gehabt. Und immer noch schaute sie mehrmals am Tag hinein. Doch außer ihrem eigenen Spiegelbild konnte sie darin rein gar nichts erkennen. Seit dem denkwürdigen Tag, von dem ihr ihre Eltern so oft erzählt hatten, hatte der Spiegel nie wieder etwas gezeigt.
Sie fragte sich oft, ob ihre Eltern die Geschichte nicht bloß erfunden hatten, denn sie fühlte sich so überhaupt nicht zu Höherem berufen.
Ihr Vater, der ihr Mienenspiel verfolgt hatte, legte einen Arm um sie, während sie zum Essen in die Burg zurückkehrten. „Du wirst es schon schaffen, das weiß ich.“
Sie blieb stehen und sah ihn scharf an. „Was? Was soll ich schaffen? Wie soll ich etwas tun, wenn ich noch nicht einmal weiß, was dieses etwas ist und warum ich es tun sollte? Du erwartest doch nicht ernsthaft von mir, dass ich losziehe, um die Welt zu verändern, ohne zu wissen, wie und wieso, bloß weil ihr vor achtzehn Jahren etwas in diesem Dingsda gesehen habt!“ Frustriert ließ sie das Blatt gegen ihre Brust fallen.
Ihr Vater blieb ruhig, doch sie spürte, dass sie ihn verärgert hatte. Er sah sie lange und ernst an, während sie sich immer kleiner vorkam und sich wünschte, im Erdboden zu verschwinden. „Es ist gut, dass du nachdenkst, Dhalia. Und es ist gut, dass du skeptisch bist. Wie du richtig erkannt hast, würden wir niemals von dir erwarten, dass du etwas tust, nur weil andere es so gesagt haben, wenn du davon nicht überzeugt bist.“
„Ich weiß einfach nicht, wie ich das tun soll, was ihr von mir erwartet.“
„Wenn die Zeit reif ist, wirst du schon erkennen, wie du ihn besiegen kannst.“
Zweifelnd blickte sie hoch. „Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das bewerkstelligen sollte. Ich meine, er hat Armeen und er beherrscht große Magie. Während in unserem Reich Magie sogar völlig verboten ist. Niemand, den ich kenne, hat je etwas Magisches auch nur gesehen.“
Lächelnd sah ihr Vater sie an. „Und was glaubst du dann, was du um den Hals trägst?“ fragte er ruhig.
Sie nahm ihr Amulett ab und betrachtete genauer die silbrige Oberfläche, die trotz der Zeit nichts von ihrem Glanz eingebüßt hatte. „Einen Glücksbringer? Einen Talisman, der ab und zu verrücktes Zeug redet?“ Sie versuchte, der Unterhaltung wieder einen scherzhaften Ton zu geben.
Doch ihr Vater ging nicht darauf ein. „Das ist ein Unterpfand der Freundschaft.“
„Zwischen wem?“
„Zwischen unserer Familie und dem Volk der Feen.“
„Den Feen?“ Ihr erster Impuls war, den Anhänger fallen zu lassen, als könnte er sie verbrennen. Doch sie beherrschte sich, denn sie gab ihren Ängsten nicht gerne nach. Außerdem war sie neugierig. „Warum sollte unsere Familie mit den Feen befreundet sein? Sie stehen doch alle auf der Seite des Herrschers.“
„Das war nicht immer so.“
Sie hatten die Eingangspforte erreicht. Dhalia wollte hineingehen, doch ihr Vater hielt sie zurück. „Warte, ich möchte lieber noch ein wenig hier draußen bleiben.“
Dhalia nickte, sie wusste, warum. Drinnen war man nie vor den neugierigen Ohren der Dienerschaft sicher. Bei diesem Thema konnten sie nicht vorsichtig genug sein. Rasch blickte sie sich um. Außer einem Milchmädchen, das in einer Ecke des Hofes die Butter schlug, war niemand zu sehen. Sie winkte mit ihrem Kopf in Richtung der Pferdekoppel, auf der ihr Hengst Bruno ruhig graste. Als sie sich der Umzäunung näherten, stieß er ein freudiges Wiehern aus und trabte heran. Während Dhalia für Bruno einen Apfel aus ihrer Rocktasche hervorzauberte, nahm ihr Vater seinen Erzählfaden wieder auf.
„Du kennst doch die Geschichten über die Dunkelfeen?“
„Du meinst die Gruselgeschichten, die man den Kindern erzählt, um sie zum Gehorsam zu zwingen? ‚Iss deinen Brei auf, sonst holen dich die Dunkelfeen, die bringen dich dann zu ihrem Herren und dann wärst du sehr froh, etwas von diesem leckeren Brei zu haben’.“
Tadelnd sah Th’emidor seine Tochter an. Heute wollte sie einfach nicht ernst bleiben. „Jedes Ammenmärchen hat einen Funken Wahrheit.“
„Ja, ich weiß.“ Sie streichelte den Kopf des Pferdes und lachte auf, als er durch Anstupsen mit seiner Schnauze nach weiteren Leckereien verlangte. „Ich habe leider nichts mehr für dich“, erklärte sie. Der Hengst tat seinem Unmut durch lautes Schnauben kund, ließ sich jedoch weiter von ihr streicheln. Dhalia wandte sich wieder zu ihrem Vater, der geduldig neben ihr gewartet hatte. „Also gut, ich weiß, dass die Dunkelfeen wirklich existieren und dass sie dem Herrscher dienen. Es heißt, sie hätten große Macht und führten geheime Aufträge für ihn aus. Ich habe aber noch nie eine gesehen“, schloss sie beinahe bedauernd.
„Das ist auch gut so“, erwiderte ihr Vater nachdrücklich. „Eine Begegnung mit ihnen bedeutet nur Ärger.“
„Hast du schon einmal eine gesehen, Vater?“ Sie sah ihn eifrig an.
„Nein. Wir haben es immer geschafft, derart großen Ärger zu vermeiden, der die Anwesenheit eines Einsatztrupps erfordert hätte.“
„Was ist ein Einsatztrupp?“
„Das ist eine Dunkelfee, die zwei Menschen unter ihrem Kommando hat. In der Regel reichen die drei aus, denn die Angst vor den Feen ist groß. Vielleicht größer als ihre tatsächliche Macht, doch ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Den Krieg hatten sie damals jedenfalls gewonnen.“
„Du meinst den Krieg, der uns zum Teil des Großen Reiches machte?“
„Genau den, der unserem Land jede Freiheit nahm und es zu einer Provinz des Großen Reiches machte. Einer Provinz neben vielen anderen.“
Ich weiß, dachte Dhalia bei sich. Und ich allein soll das alles ändern, das ist doch Wahnsinn. Das Mädchen, das auszog, die Welt vom Bösen zu befreien. Sie war zwar jung, doch so naiv war sie schon lange nicht mehr. Aber sie wusste, dass es keinen Sinn hatte, mit ihrem Vater darüber zu streiten. Für ihn gab es nichts, was sie nicht schaffen konnte. Die Gewissheit, dass sie ihn eines Tages zwangsläufig enttäuschen musste, schmerzte sie tief. Kein Mensch könnte jemals die großen Erwartungen erfüllen, die er in sie setzte. Doch sie verdrängte diese Gedanken, vielleicht würde es ja gar nicht dazu kommen. Vielleicht war die Prophezeiung nichts weiter als ein Lichtreflex in einem kleinen Spiegel gewesen. Es war müßig, jetzt darüber nachzudenken.
„Du hast mir immer noch nicht gesagt, was wir mit den Dunkelfeen zu tun haben“, wandte sie sich wieder an ihren Vater.
„Nicht die Dunkelfeen, Dhalia, andere.“
„Es gibt noch andere Feen? Ich habe nie von ihnen gehört.“
„Vor langer Zeit gab es welche, die den Menschen wohl gesinnt waren. Sie schenkten unseren Vorfahren dieses besondere Pfand der Freundschaft.“
„Und wo sind sie jetzt?“
Ihr Vater zuckte mit den Achseln. „Ich weiß es nicht. Sie scheinen sich aus unserer Welt zurückgezogen zu haben. Doch dies“, er deutete auf das Blatt, das sie noch immer in ihren Händen hielt, „ist ein Beweis dafür, dass es sie gibt.“
„Und wie soll mir das jetzt weiterhelfen?“
„Ich weiß es nicht. Doch du wirst wissen, was zu tun ist, wenn es soweit ist. Denn du bist die Auserwählte, und das ist alles, was zählt. In einer Woche wirst du achtzehn und dann werden wir weitersehen.“