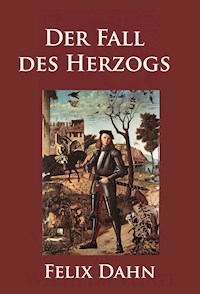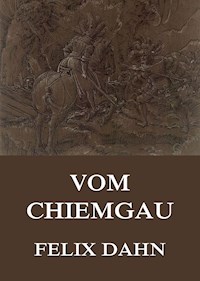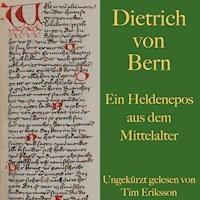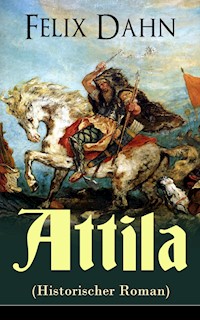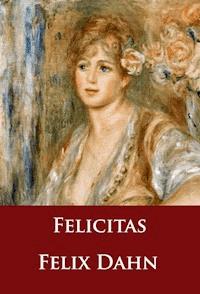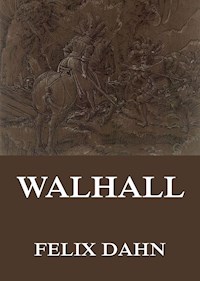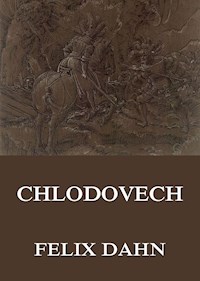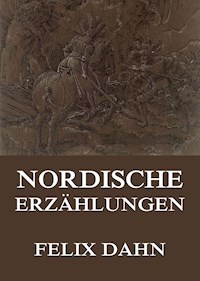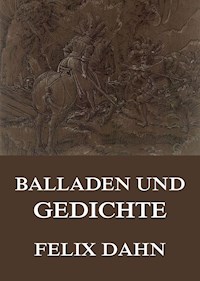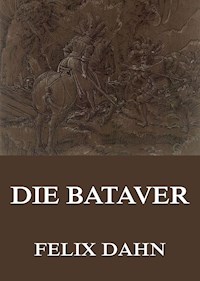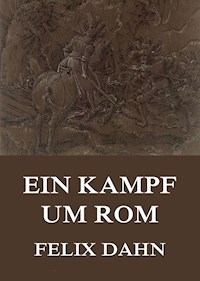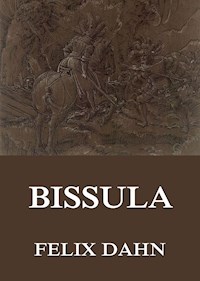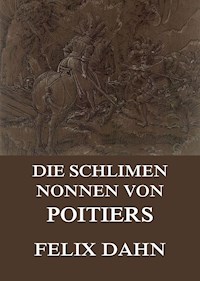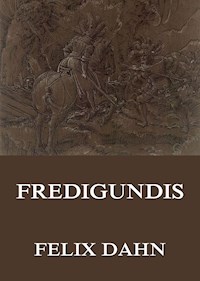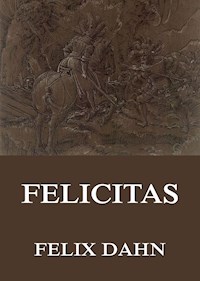Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Felix Dahns Buch 'Historische Romane, Erzählungen & Gedichte' taucht der Leser in eine Welt vergangener Epochen ein. Dahn präsentiert eine Vielzahl von Geschichten, die von historischen Ereignissen und Persönlichkeiten inspiriert sind. Sein literarischer Stil ist geprägt von detailreichen Beschreibungen und einer präzisen Darstellung historischer Fakten. Als Germanist und Rechtshistoriker konnte Dahn sein tiefgreifendes Wissen in die Gestaltung seiner Erzählungen einfließen lassen, was dem Leser ein authentisches Leseerlebnis bietet. Diese Sammlung von historischen Romanen, Erzählungen und Gedichten zeigt Dahns Fähigkeit, historische Ereignisse mit literarischem Geschick zu verweben. Felix Dahn, ein prominenter deutscher Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, war bekannt für seine historischen Werke. Als Rechtshistoriker und Germanist konnte Dahn historische Fakten mit literarischer Fiktion meisterhaft vermischen. Sein tiefes Verständnis für Kultur und Geschichte spiegelt sich in seinen Werken wider, die einen bedeutenden Beitrag zur deutschen Literaturgeschichte leisten. Durch seine vielfältigen Interessen und sein profundes Wissen konnte Dahn ein breites Spektrum von Lesern ansprechen. 'Historische Romane, Erzählungen & Gedichte' von Felix Dahn ist ein Muss für alle Liebhaber historischer Literatur. Mit einer meisterhaften Mischung aus Fakten und Fiktion entführt Dahn die Leser in vergangene Epochen und lässt sie Geschichte auf lebendige Weise erleben. Durch Dahns präzise Sprache und sein tiefgründiges Verständnis für die menschliche Natur wird dieses Buch sowohl Kenner als auch Neulinge im Bereich historischer Romane gleichermaßen faszinieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 9578
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Felix Dahn: Historische Romane, Erzählungen & Gedichte
Books
Inhaltsverzeichnis
Romane
Weltuntergang
»Dem Stift Wirzburg viel Gutes hat gethan Bischof Heinrich, der herrliche Man, Das muß man von ihm sagen! Zwei Grafschaften bracht’ er daran, Drei neue Kloster fing er an Zu bauen bei seinen Tagen: Neumünster, Haug und Sankt Stephan, Darin des Gottesdienstes pflagen Viel fromme Chorherrn sonder Wahn: Sankt Benediktus Ordensban Thäten’s alle jagen.«
Inhaltsverzeichnis
Erstes Buch
I.
Gar wunderhold, wie sonst kaum irgendwo auf deutscher Erde, zieht der Frühling ein zu Würzburg an dem Main.
Frühzeitiger als anderwärts kehrt er zu: im Hornung schon flötet die Amsel ihr melodisch Lied hoch vom Ulmenwipfel, wann die Sonne zu Rüste geht über dem Guttenberger Wald, Thal und Rebgelände tauchend in eitel Gold und Segen. Frühe sprießen an sonniger Halde die Veilchen hervor und wie leuchten, wie duften sie in den Weingärten der sanften Hügel, die wilden, gelben Tulpen! Dankbar gedenkt, wer je sein genoß, des Würzburger Lenzes. –
Und ganz besonders schön, herrlicher denn je zuvor, meinten die frohen Menschen, war der liebe Lenz in das Mainthal eingefahren im Jahre des Herrn Eintausend.
Das Land weithin stand in eitel Maienblust.
Das Wildgedörn, das die Rebgärten rings an den sanft aufsteigenden Hängen umhegte – Weißdorn und Rotdorn und zahllose Hagerosen – blühte so reich, daß der süße Duft, vom Südwind getragen, berauschend flußabwärts zog. In den dichten Hecken vor der Stadtmauer, aber auch in den häufigen Gärten innerhalb der Umwallung sang die Mönchsgrasmücke, sang die Nachtigall ihr feurig Lied. –
Am Abend eines wunderschönen Maientages leuchteten vom linken Flußufer her über den Wall am rechten Ufer, zumal über die Mainbrücke hin, die Strahlen der versinkenden Sonne: sie trafen voll auf den ragenden Dom und das unmittelbar im Süden daranstoßende »Bischofshaus«: das heißt das gemeinsame Wohnhaus der Kanoniker. Brücke und Dom standen damals bereits genau an derselben Stelle wie heute: aber beide waren von Holz gebaut und erheblich schmäler als dermalen.
In dem Hauptsaale – der Bücherei – des Bischofshauses, in dem einzigen Stockwerk oberhalb des Erdgeschosses, stand an dem hochgewölbten romanischen Rundbogenfenster ein ernster Mann in mittleren Jahren. Er hatte soeben den von zierlichen Querlatten gebildeten Fensterladen, der den heißen Tag über verschlossen gehalten worden, nach außen aufgestoßen und blickte nun hinaus. –
Wo sich heute bergab, gegen den Fluß zu, die »Domstraße« senkt, lag damals ein offener Platz, nur in weitem Abstand vom Dom und dessen Anbauten durch ein paar unverbundene »Höfe« begrenzt.
Der einsame Mann neigte das braunhaarige, aber stark ergrauende Haupt leicht hinaus; er strich langsam mit der Linken über den breiten, fast völlig weißen Bart; er schloß die grauen, schwermütigen Augen; seltsame Augen waren es: nicht schön von Form oder Farbe: müde von vielem Lesen: – vielleicht auch von anderem: – aber doch war ihr Blick scharf, – wie der des Falken – und unvergeßbar für jeden, der ihn aus der verhaltenen, ja trüben Ruhe hatte plötzlich aufleuchten sehen in flammendem Blitz. –
Aber jetzt, als er sie wieder aufschlug, war der Ausdruck dieser sinnigen Augen tief verträumt. Lange blickte er schweigend hinaus. »Wie schön,« sprach er endlich leise vor sich hin, »wie friedevoll! Des Herrgotts reichster Segen ruht auf Gau und Stadt. Soll ich – darf ich – diesen Frieden stören? – Aber muß ich nicht? – Und wird nicht – wie sie sagen – vielleicht der Herrgott diesen Frieden in wenigen Wochen wandeln in flammende Zerstörung, in Verderben? – Er nach einem unerforschlichen Ratschluß im großen – ich im kleinen, nach Pflicht meines von ihm mir verliehenen Amtes, also doch auch nach seinem Ratschluß.«
Er richtete sich hoch auf, trat von dem Fenster zurück und machte einen Gang durch den geräumigen, durch zwei Reihen von Holzpfeilern mit Rundbogen gegliederten Saal.
Die Einrichtung war einfach, ohne Prunk, aber würdevoll; das ansehnlichste Gerät bildete eine Art Baldachin, der an der Ostwand gegenüber den nach Westen blickenden Fenstern, von zierlich geschnitzten Rundpfeilern getragen, eine lange Truhe überhöhte, deren Deckel, mit weichen Decken belegt, als Rücksitz diente; in der Mitte der Bücherei stand ein mächtiger runder Tisch, dessen weiße Ahornplatte mit Schreibgerät und mit vielen Pergamenten bedeckt war, an welchen an Lederriemen und bunten Schnüren große Siegel in hölzernen, bleiernen und silbernen Kapseln herabhingen.
»Mein Amt?« raunte er nun leise. »Ist es nur des Amtes Pflicht, was dich treibt, Heinrich von Rothenburg! Oder ist es die alte Lust am Kampf?« – Er ballte die Rechte wie um Schwertesknauf und spannte die Muskeln des eingebogenen Armes. – »Am Kampfe, – zumal gegen diesen Feind? – – Also Sünde? – Sünde also plante ich, während der Rächer aller Sünde vielleicht schon die Wolken zusammenballt, auf denen er niederfahren wird, zu richten die Lebendigen und die Toten!« –
Er hielt erschauernd inne in seinem hastigen Gang und schlug andächtig ein Kreuz über Stirn und Brust. –
»Sünde?« – begann er aufs neue, wieder ausschreitend. »Jawohl! – Hätte ich nicht dringendere Pflichten, – vielleicht! – aber die meinen immer noch weltlichen Sinn weniger befriedigen, meine Kampfesfreude schwächer – locken? Denn diese Pflicht des Amtes lockt dich, Heinrich! Ist das nicht ein Zeichen, daß sie weniger Pflicht als – – Leidenschaft?«
Er stieß bei einer raschen Wendung an den Rundtisch: eine der Urkunden glitt herab und rollte vor seine Füße. Er hob sie auf und warf einen Blick auf das daranhängende Siegel. »Kaiser Karls Verleihung! Sie selbst! – War das ein Wink, eine Mahnung des Herrn? Wüßt’ ich es nur, – zweifelfrei: – ich nähme sie ja so gern auf mich, die Pflicht und den Kampf.« – Er drückte das Pergament heftig an die Brustfalten seines langwallenden dunkel-porphyrfarbigen geistlichen Gewandes.
II.
Da ward die in das Vorgemach – nach Süden – führende Thüre des Saales geräuschlos geöffnet und ebenfalls in geistlichem, aber ganz schwarzem Gewande trat ein wenige Jahre älterer Mann ein. Dicht an der Schwelle, zwischen den dunkelgelben Thürvorhängen, blieb er stehen; demütig neigte er tief das ganz glattgeschorene Haupt und mit leiser Stimme hob er ehrerbietig an: »Hochehrwürdiger Herr Bischof, Ihr habt befohlen.«
Der Angeredete trachtete, seine lebhafte Erregung zu bändigen, zu verbergen; er legte die aufgeraffte Urkunde ganz sacht auf den Tisch: – er suchte, vor denselben tretend, sie dem Blicke des Besuchers zu entziehen. »Laß diese unterthänige Weise, Bruder Berengar«, sprach er gütevoll. »Sind wir doch Kampfgesellen: du bist mein eifrigster Mitstreiter.«
Der andere trat näher, langsamen Schrittes. Die starren Züge des langen, hageren, gelbfahlen Gesichtes blieben unbeweglich, die schmalen Lippen öffneten sich kaum, die tiefschwarzen Augen hielt er streng zu Boden gerichtet, als er sanft erwiderte: »ich darf nicht anders. – Euer Vorgänger, der hochselige Herr Bischof Bernwart, hat mir solches Gebahren besonders auferlegt zur Buße für meine hochfärtige Überhebung.«
»Ja, ja,« lächelte Herr Heinrich – und die freundliche Heitre stand dem wohlgebildeten Antlitz, den feinen Zügen herzgewinnend gut, »Mein gestrenger Oheim war ein stolzgemuter Herr« – »Er durfte es sein. – War er doch ein Graf von Rothenburg, – wie Ihr.« Der Bischof zuckte die Achseln: »Edle Geburt ist wertvoll.« »Ha, wirklich?« flüsterte der Priester, aber ganz unhörbar. –
»Doch ist sie kein Verdienst. – Aber er hatte dich im Verdacht, Archidiakon«, – und er hob mit lächelnder Drohung den Finger – »erstens schon bei seinen Lebzeiten Bistum und Bischof beherrschen und zweitens um jeden Preis sein Nachfolger werden zu wollen.« – »Was doch nur abermals ein Rothenburger werden sollte.« Ganz tonlos und unterwürfig kam das aus den kaum geöffneten Lippen. Aber der Bischof schüttelte lebhaft das Haupt und hob, schmerzlich berührt, in Abwehr die Hand: »Da irrst du, Freund. – Mein Oheim konnte nicht ahnen … War ich doch ein Kriegsmann! Ein Mann der Staatskunst …« – »Und was für einer! In keiner Heerfahrt des Kaisers Otto des Roten und des jungen Otto fehltet Ihr auf deutscher, wendischer und zumal auch meiner italischen Heimaterde. Wie oft ginget Ihr als der Frau Kaiserin Theophano Vertrauter in Gesandtschaft nach Rom, ja selbst nach Byzanz!«
»Also!« unterbrach Herr Heinrich, kopfschüttelnd. »Mein Ohm und ich – wir dachten wahrlich nicht daran, daß ich weltlicher, mit viel Schlachtenblut befleckter Mann jemals geistlich, vollends Nachfolger des heiligen Burchhard werden würde. Du – Archidiakon, es ist wahr – hattest das nächste Anrecht auf diesen Stuhl.« – »Kaiser Otto der Junge dachte anders, weiser – als er Euch – noch nicht sehr lange trugt Ihr geistlich Gewand – das Bistum gab.« Der Rothenburger seufzte: »Ja: Er gab es mir.« Beschwichtigend fiel der Archidiakonus ein: »Ihr seid vom Kapitel gewählt.« – »Ja, ja, aber warum? Weil der Kaiser es wünschte.« – »Nachdem er und die Regentin so sehr überrascht waren durch Euern Rücktritt aus der Welt.« »Sieh, Berengar,« fuhr der Bischof fort, »das ist es ja, was mir den Entschluß so schwer macht. Er – der König – setzt mich in dies Würzburg, vertrauend, daß ich sein Recht und seinen Vorteil hier nach Kräften wahre. Und nun soll ich Stadt und Grafschaft ihm entreißen!« Der Archidiakon glitt geräuschlos näher; scharf richtete er auf den Ringenden die dunkeln Augen, die unter kohlschwarzen, streng regelmäßig geschwungenen Brauen hervorblitzten. »Verzeiht,« sprach er ruhig, »Herr Bischof: das ist nicht bischöflich geredet.« – »Mag sein! Aber es ist ehrlich gedacht: – mit Gedanken treuer Lehenschaft.« – »Ihr aber seid vor allem Sankt Peters Vasall! Von ihm, nicht vom deutschen König oder römischen Kaiser, tragt Ihr den Bischofstab zu Lehen. Sankt Peters und Eures großen Vorgängers, Sankt Burchhards, Recht habt Ihr zu wahren, auch gegen des Königs Vorteil. Und nicht im Recht, im Unrecht ist der König! Gedenkt des Briefes Kaiser Karls! – Scharf sah ich es, wie ich eintrat: – er hatte Euch gerade wieder beschäftigt! Diese ehrwürdige Urkunde giebt Euch nicht nur das Recht, – hört es, Herr Bischof! – sie legt Euch die Pflicht auf, in jenen Kampf einzutreten und nicht zu rasten noch zu wanken, bis Ihr Gott erstritten habt, was Gottes ist. Dem Kaiser bleibe, was des Kaisers ist.« – »Dann bleibt ihm wenig genug in Stadt und Gau!« – »Gleichviel! Habt Ihr des Kaisers Sache zu führen oder die der heiligen Kirche? Wollt Ihr, nachdem Ihr das gute, klare Recht des Bistums entdeckt habt, es diesem Bistum vorenthalten – aus Schwäche, aus Menschenfurcht?«
Unwillig fuhr der Bischof auf und griff an die Stelle, wo er einst im Wehrgehäng das Schwert getragen hatte.
»Verzeiht: aus Liebe zu diesem Kaiserjüngling vorenthalten, was der große Karl aus Ehrfurcht vor Sankt Kilian und Sankt Burchhard dem Stuhle zugewandt? Erkennt Ihr nicht den Finger Gottes darin, daß er Euch – gerade Euch! – durch Zufall, – sagen die Weltleute – durch ein Wunder der Heiligen, ziemt uns Geistlichen zu sagen – in der Kämmerei, unter altem wertlosem Gerät und Gerümpel dieses kostbare Pergament auffinden ließ?«
»Ja, es ist erstaunlich,« sprach Herr Heinrich nachdenksam, das Kinn in die linke Hand schmiegend. »Ist wirklich wundersam! Unter Bischof Dietho – vor achtzig Jahren – verbrennen mit dem damals erst seit siebenundzwanzig Jahren vollendeten Dom – hier, an der Stelle des jetzigen, stand auch er – in der Sakristei alle Urkunden des Bistums, aber auch alle! So daß, als Bischof Burchhard der Jüngere, der wackere Henneberger, vor etwa zwei Menschenaltern dies Gotteshaus hier neu erbaute, auch nicht Eine Urkunde, nicht Ein Beweismittel für all unsere Rechte vorhanden war: mußten alle vom König, von den Erben der anderen Schenker und Verleiher neu ausgestellt werden – auf vieles Bitten meiner Vorgänger. Und nun muß ich vor wenigen Monaten in einer alten Truhe der Kämmerei unter abgetragenen, zerschlissenen Meßgewändern und angebrannten Altardecken dieses unschätzbare Kleinod auffinden! Wie kann das aus der Bücherei oder aus dem Archiv dahin geraten sein?«
Berengar zuckte die Achseln: »Wer soll das wissen? Vielleicht gelang einem der Brüder die Rettung dieses wertvollsten Stückes aus dem brennenden Archiv: – er selbst mag darüber umgekommen sein.« »Ja, ja,« bestätigte der Bischof, »es sind mehrere bei dem Brand erstickt, und zwar gerade auch – in der Kanzlei – der Protonotar, der dem ganzen Urkundenwesen vorstand, der pflichtgetreue Bruder Skapelarius.« – »Die Kämmerei lag auch damals im Erdgeschoß – die Urkunde, in die Altardecke gewickelt, kann von dem Kanzleifenster – hier, im ersten Stock – in das offene Fenster der Kämmerei geworfen worden sein, als der Protonotar, der sie retten wollte, erkannte, daß er selbst nicht mehr zu entkommen vermöge.«
»Klingt ganz glaublich! – Aber weshalb lassen die Heiligen die wichtige Urkunde sechzig Jahre verborgen bleiben und sie auffinden gerade durch meine weltliche, schwertgewohnte, vom Schlachtenblut befleckte Hand?« – »Gerade darin erblickt und verehrt die weise Fügung der Vorsehung.« – »Wie meinst du das, Archidiakon?« »Heinrich von Rothenburg,« erwiderte dieser feierlich, wieder leis einen Schritt näher gleitend, »gebt der Wahrheit die Ehre, hier im Kämmerlein vertrauter Zwiesprache: mehr vom Kriegsmann, als vom Geistlichen, mehr vom Staatsmann, denn vom Priester, mehr vom rechts- und waffenkundigen Grafen, als vom Bischof habt Ihr an Euch – immer noch!« »Ja, leider,« seufzte Herr Heinrich demütig, »immer noch!« »Weshalb – vor fünfzehn Jahren etwa – der tapferste Graf über alles deutsche Land, die rechte Hand der schönen Kaiserwitwe und Reichsregentin, Frau Theophano, plötzlich das Schwert ablegte und Priester ward – – kein Mensch weiß es …« Er zögerte: er schien gespannt auf Auskunft zu warten. Allein Herr Heinrich sprach nur leise zu sich selbst: »Aber Gott weiß es« und drückte die schwermütigen Augen zu.
Der Welsche wartete noch eine Weile: da aber der andere beharrlich schwieg, fuhr er fort: »Aus der Haut konntet Ihr eben nicht fahren, wie aus der Brünne, auch nicht, als Ihr, nach kurzer Priesterzeit, hier Bischof wurdet. Nach wie vor weilen Eure Gedanken noch häufiger bei Recht und Gericht und weltlicher Wohlfahrt und weltlicher Gewalt, denn bei Beten und Büßen und bei dem Jenseits.« »Leider!« wiederholte Herr Heinrich betrübt. »Nein, nicht leider: zum Heile dieses Bistums! Seht Ihr denn nicht? Deshalb eben führten die Heiligen Kaiser Karls Verleihungsbrief gerade in Eure starke Hand! Euch, Eurem weltkundigen Sinn vertraute Sankt Burchhard, Eurer weltlichen Klugheit, Eurer frischen Manneskraft seine Rechte an, nicht Euren Vorgängern, meist mönchischen weltflüchtigen Psallierern. Der Bischof, nicht der Graf, muß herrschen über diese Mainstadt und den Waldsassengau, darin sie liegt. Vor allem über die Stadt! So wollte Kaiser Karl! So will es Gott! Seht hier auf diesen Plan der Stadt« – er wies auf eines der Pergamente, die auf dem Tische ausgebreitet lagen – ein langes Jagdmesser war darüber gelegt, es auseinandergespreitet zu halten – »Ihr selbst habt ihn – mit der Hand des kundigen Feldherrn – entworfen: glaubt Ihr, es ist ohne Bedeutung, daß die Stadt ein Fünfeck bildet, genau wie Eure Bischofsmütze, die dort liegt, Herr Heinrich?« »Spiel des Zufalls!« erwiderte dieser. Aber der Einfall behagte ihm. – »Ihr seid der Mann, des Bistums Recht zu wahren, mit scharfem Wort und – muß es sein – mit scharfem Schwert. Sankt Burchhard, Sankt Kilian, Sankt Petrus, ja Gott selber rufen Euch in diesen heiligen Kampf. Heinrich von Rothenburg, der Mann ist ein Felon, der irdischem Lehnsherrn die geschuldete Heerpflicht weigert: Heinrich von Rothenburg, willst du sie dem himmlischen Lehnsherrn weigern?«
»Nein! Bei meinem Schwerte!« rief der Starke und seine grauen Augen blitzten auf. »In solchem Lichte sah ich’s noch nie. Gott ruft zum Streit. So will ich denn streiten bis zum Sieg oder – Untergang! Ich fürcht’ ihn nicht, den Grafen Gerwalt!« »Gewiß nicht! Und« – der Welsche trat näher und flüsterte – »jene Weissagung des arabischen Magiers in Kalabrien, die Ihr mir vertraut – wie war es doch?« »Ich werde nicht sterben – so las er in meiner rechten Hand – bis ich mit dieser Hand meinen schlimmsten Feind auf Erden erschlagen,« sprach Herr Heinrich mit grimmiger Freude. »Nun also! Und das ist doch ohne Zweifel –« »Graf Gerwalt!« nickte der Bischof.
»Aber,« fuhr Berengar fort, »es wird zum Waffenkampfe gar nicht kommen müssen. Ihr werdet schon auf dem Wege Rechtens – vor dem Reichstag gewinnen. Sicher! Das Gericht möchte ich sehen –« und hier flog ein stolzes Lächeln um die schmalen, allzu schmalen Lippen des Lombarden und seine schwarzen Augen funkelten – »das Gericht möchte ich sehen, welches gegen jene Urkunde Kaiser Karls irgend eine Einwendung gelten lassen könnte.« »Allein,« warf der Bischof ein – »warum haben alle meine Vorgänger seit bald zwei Jahrhunderten das Recht aus der Verleihung nicht geltend gemacht?«
Berengar zuckte die Achseln: »Wer kann solche Fragen beantworten? Soviel steht fest: Graf Gerwalt, Euer schlimmster Feind … –« »Der Welsche weiß nicht,« flüsterte Herr Heinrich zu sich selbst, »wie sehr sein Wort die Wahrheit trifft!« – »Kannte die Urkunde nicht. Und groß war sein Erstaunen, ja sein Zorn, als ich sie ihm – wohlweislich nur in Abschrift – übersandte. Diese Urkunde ist unanfechtbar. Nicht umsonst hab’ ich Jahre um Jahre in der Rechtsschule zu Pavia geistlich Recht, Lehenrecht, Landrecht gelernt bei den ersten Lehrern. Viele, viele hundert Urkunden von Königen und Kaisern hab’ ich eingesehen, viele Dutzend hab’ ich abgeschrieben, hab’ ich selbst verfaßt im Auftrag des Pfalzrichters daselbst. Erkennt Kaiser Otto unser Recht nicht an, so rufen wir das Urteil des Reichsgerichts am Reichstage an. Nach dem Rechte muß es für uns ausfallen! Siegt aber in dem barbarischen Reichstag dieser plumpen Deutschen – verzeiht, aber manchmal bricht das Blut Italiens in mir durch! – die Scheu vor dem Herrn König, so lebt noch ein anderer Richter, der uns – das heißt Sankt Kilian und Sankt Petrus! – unzweifelhaft zu unserem Recht verhelfen wird.« »Gott der Herr!« sprach der Bischof fromm. »Der ist gar fern und unberechenbar! – Nein, der Herr Papst zu Rom. Nicht rasten will ich und nicht ruhen, bis wir gesiegt – für Sankt Burchhard. Und müßt’ ich auf meinen Knieen im Sankt Peter dem heiligen Vater Bann und Interdikt über König und Reich der Deutschen entwinden!« »Nein! Nimmermehr!« rief der Rothenburger erschrocken. »Ich sollte den Bann herabbeschwören auf des großen Otto Enkel, meines teuren Feldherrn in so vielen Schlachten? Das Interdikt auf diese geliebte deutsche Erde, auf dieses blühende Mainthal? Es ist nicht deine Heimat, Lombarde!«
»In die Hölle stoß’ ich ganz Lombardenland, das abgefallene, um diesen Sieg!« schrie der Welsche, fortgerissen von wilder Leidenschaft.
Betroffen sah Herr Heinrich auf ihn herab: »Abgefallen? Von wem?«
»Von … sich selbst!« rief Berengar noch heiß erregt, dann fuhr er zusammen und erläuterte: »Von seinem wahren Heil – das heißt: von der Herrschaft der deutschen Könige.«
»Aber wie,« fiel Herr Heinrich, plötzlich stehenbleibend, ein, »wenn all unser Planen und Trachten gar nicht mehr Zeit fände, sich zu vollenden? Wenn es sündhaft, frevelhaft wäre, solch’ irdischer Sorgen zu pflegen, an Herrschaft über Stadt und Gau und an weltliche Macht zu denken, während Stadt und Gau und Welt in wenigen Wochen …?« Er brach ab. Der Welsche lächelte; es zuckte wie Hohn über seine sonst so starren Züge hin. »Ihr meint? Auch Ihr? Jene Weissagung – aus meiner Heimat kam sie über die Berge – unheimlich – wie der schwüle Südwind … –« »Es ist der Glaube ja weit verbreitet,« sprach der Bischof ernst. »Viel gelehrtere und viel frommere Männer als ich hegen keinen Zweifel. Ich – ich kann’s noch nicht recht glauben. Entscheidend ist mir der Ausspruch des Herrn Papstes. Und der, so schreibt man mir aus Rom, schwankt hin und her.«
»Wie? Papst Sylvester? Er? Der große Gerbert von Reims, der Schüler der Araber in Spanien, der Lehrer des Erdkreises, von fast übermenschlicher Weisheit! Wenn der nicht daran glaubt, dann …« – »Ich sage Euch ja, er soll zweifeln. Seine Auslegung der Schrift und der Väter führte ihn nicht zur Bejahung.« – »Nun also.« – »Aber ein heiliger Einsiedler – den Namen erfuhr ich nicht – soll stets wachsenden Glauben nicht nur bei dem ganzen Volke in Welschland, auch bei dem tief gelehrten Papste finden. Doch, wie dem sei! Ich muß der Kirche, des Oberhauptes der Kirche Weisung einholen, nicht nur für meine Belehrung, sondern darüber, wie ich mich als Bischof gegenüber meiner Gemeinde zu verhalten habe.« »Mich würde der nahe Untergang herzlich wenig freuen,« meinte Berengar spöttisch. »Noch gar viel hab’ ich vor in der Welt.«
»Ist das ein Grund für den Himmelsherrn, sie noch zu erhalten, wenn das Maß der Sünden voll? Ich fürchte sehr, solcher Wunsch, solch weltlich Begehren ist auch für mich der letzte Grund, der, unbewußt in der Tiefe der Seele wirkend und wühlend, mich abhält, daran zu glauben. Und so hab’ ich denn über die Alpen, nach Rom, an den Herrn Papst einen ganz eigen gearteten Boten gesandt.« »Wen?« forschte Berengar eifrig. »Es fehlt keiner aus unserem – wollte sagen: Eurem Klerus.« Der Bischof schwieg; ein heiteres Lächeln schwebte um seinen feinen Mund. »Denn,« fuhr der Archidiakon eifrig fort, »es kommt oft sehr auf den Boten an, welche Botschaft er heimbringt. Wenn einer von den Schwarmgeistern, den Träumern, den geheimnisbrünstigen Priestern, wie sie Kloster Cluny züchtet –« Herr Heinrich lachte. »Nun, hat keine Gefahr! Ungefähr das Gegenteil von solcher Art hab’ ich zur Kundschaft ausgeschickt. Wenn dieser Bote, der welt- und lebensfreudigste Mann –« – »Dann meint Ihr Arn aus Bayerland, Euren Jägermeister! Richtig! Er fehlt seit Wochen!« – »Wenn der in Welschland dazu bekehrt wird, an den Untergang der Welt zu glauben –« »Arn? Ja dann,« lächelte der Lombarde, »dann muß sie vorher schon halb untergegangen sein. Einstweilen aber: – ruhet nicht, handelt, Herr Bischof. Die Zeit ist günstig; der Mann, der von Amts wegen ebenso berufen ist für den Kaiser, wie Ihr für Sankt Burchhard zu handeln – der Graf des Gaues, ist fern – man sagt, in Italien. Wenigstens seine Reisigen und Vasallen alle hat der König nach Rom entboten: der Marienberg da drüben ist fast unbesetzt: ein rascher Handstreich und – aber –« er stockte und sprach leiser zu sich selbst – »es scheint beinah, Er – der andere – hat recht.« Herr Heinrich stutzte. »Wer? – Was zischelt Ihr da?« – »Ich? – Oh nichts!«
»Doch! Ich hörte genug, um mehr hören zu müssen! Wer hat recht?« Drohend, ahnungsvoll trat er näher. – »Nicht doch,« wich der Welsche aus. »Lasset ab, Herr! Nicht gerne nenn’ ich Euch diesen Namen. Er pflegt Euch zu ergrimmen!« »Graf Gerwalt!« rief Herr Heinrich und seine Augen blitzten. »Dacht’ ich’s doch! Was – was hat er gewagt, von mir zu sagen?« »Es wird Euch erbittern!« warnte Berengar. »Oh nein,« knirschte der Bischof und zerbrach mit der starken Rechten die Armlehne von Eichenholz des hohen Stuhles, den er ergriffen, »ich bin ja ganz ruhig! – – Was hat er …?« – »Nun – vor seiner Abreise – er war ja nur ein paar Tage auf der Burg – an der Brücke war’s – der Zollwart erhob den Zoll von den Mainschelchen, welche den Fluß zu Berg getreidelt wurden und meinte –: ›Nun wird der Zoll, wie jedes Gefäll in der Stadt, bald nicht mehr in des Herrn Grafen Jagdranzen, in des Herrn Bischofs Kirchenbüchse wird er wandern.‹ Da lachte der Graf, wie er zu Pferde stieg, – er und sein Jagdtroß sperrten mir den Weg über die Brücke – und meinte: ›Bah, es wird gehen wie immer zwischen uns. Wo ich gegen ihn vortrete–‹« – »Nun? Was …?« – »›Tritt der Rothenburger zurück‹« »Ah, ah, ah!« schrie der Gepeinigte auf, wie von einer Natter gebissen. »Das hat er gesagt? Er soll sich irren! Graf Gerwalt liebt es zwar, an sich zu reißen, was nicht ihm, – was mir gehört: aber doch nur, wenn ich fern, wenn ich wehrlos bin gegen ihn. Doch Sankt Burchhards Recht soll er mir nicht entreißen. Und wehrlos? Noch bin ich’s zwar – nicht lange mehr will ich’s sein! – Wo …?« Er schritt, hastig, heiß erregt, durch den Saal. »Wo stehen die Wenden? Du weißt: die Söldner, von denen wir sprachen?«
Der Archidiakon war nun dicht an den Tisch getreten: er legte beide Hände auf die hohe Lehne des Eichenstuhles und hielt sich fest daran: er drückte darauf, während seine Augen wachsam jedem Schritte, jeder Miene des Erbitterten folgten. »Mainaufwärts, wenige Tagemärsche. Noch auf deutscher Erde, aber nahe der böhmischen Mark. Sie sind von Markgraf Eckhard von Meißen – nach tapferen Diensten – entlassen. Ihr Führer, Zwentibold, verhandelt um neuen Dienst mit Herzog Boleslav von Polen. Kommt der zum Abschluß, dann ziehen sie nach dem fernen Osten … –« – »Nichts da! Wir müssen sie an der Hand, zur Verfügung bereit haben. – Noch diese Nacht muß an sie ein geheimer Bote – ein verlässiger Mann … wen schicken wir?« Berengar folgte dem Gange des Bischofs durch die Halle: »Ich will gehen: ich selbst,« sagte er mit leiser, aber fester Stimme. – »Du wolltest? Es ist halsgefährlich!«
Berengar zuckte die Achseln: »Ich trage dieses Haupt nur für Sankt Burchhard und für Euch.« – »Gut! Dank! … Aber höre! – Noch nicht fest abschließen! – Ich bin jetzt – ein wenig – erregt! In der Hitze soll man nichts beschließen. – Nichts übereilen« – »Aber auch nichts versäumen soll man! Die Söldner sind viel umworben. Auch der Magdeburger Erzbischof, Herr Gisiler, will sie dingen …« – »Die Wenden sollen warten! … Nur noch kurze Zeit!« – »Das thun sie nicht – ohne Wartegeld.« – »Freilich! Freilich! und die Kammer ist …?« – »Leer. Nur der fällige Betrag für die Armen – das Drittel der Einkünfte …« – »Nein! Nichts da! Kein Schilling davon! Aber – wie steht es denn mit dem Gelde für meine Bauten in der neuen Vorstadt?« – »Euerer Vorstadt: auf dem Sande?« – »Jawohl! Das Waisenhaus und die Klosterschule … freilich: der Verschlag, in dem jetzt beide untergebracht sind – recht elend ist er. Aber bah! – Menschenalter hindurch hat es genügen müssen: – bessere ich es, ist’s mein eigenstes Werk. Drängt sich mir nun Notwendigeres vor, so …! Die Waisen, die Schüler können warten: die Wenden, – du hast recht – die warten nicht. Nimm das Geld für meine Bauten in der Sandvorstadt. Bezahle Zwentibold die Wartezeit.« – »Es wird nicht reichen.« – »So nimm die Summe für das geplante Siechenhaus bei Sankt Andreas überm Main dazu. Aber eile.« – »Ihr sollt mit meinem Eifer zufrieden sein.« Er stand schon in den Vorhängen der Thüre. – »Aber noch nicht abschließen: nur Wartegeld! hörst du?« Die Vorhänge rauschten. – Ohne Erwiderung war Berengar verschwunden.
III.
Gar früh am Tage – wie heute noch bei unseren Bauern auf dem Lande – begann dazumal auch in den Städten das Leben.
Mit Sonnenaufgang und den Vögelein erhob man sich vom Lager: um elf Uhr pflegte das Mittagmahl gehalten zu werden: bald nach Einbruch der Dunkelheit suchte man den Schlaf: die recht spärliche Beleuchtung der Zimmer lud nicht dazu ein, Arbeit oder geselligen Verkehr im Hause in die Dunkelheit zu verlängern.
So war denn auch an dem schönen Maientage, der auf Berengars rasche Abreise folgte, das Leben in dem Städtlein früh erwacht. Bei der ersten Hahnenkraht war diejenige Rotte der speertragenden Bürger, die für diese Nacht die Reihepflicht der Wache an den Thoren, in den Türmen und auf den bezinnten Mauern getroffen hatte, abgelöst worden von der »Tagwacht«.
Und der »Morgengruß«, den, sobald die Sonne über die Höhen emporgestiegen war, die Türmer weithin über die Holzdächer der kleinen Siedelung aus ihren langen, gewundenen »Tuthörnern« schmettern ließen, weckte überall in den wenigen schmalen Gassen, in den zahlreichen »Höfen« der freien Plätze sofort rühriges Regen.
Die Runde der neu aufziehenden Wache bedurfte nicht langer Zeit, den ganzen Umfang der Umwallung abzuschreiten Denn das liebe, liebliche Würzburg war dazumal noch gar enge beschlossen: zählte doch die Umwallung, eingerechnet die Geistlichen, die Mönche, die bischöflichen Dienstmannen und die Reisigen des Grafen auf dem Marienberge, nicht mehr als etwa viertausend Bewohner.
Der Archidiakon hatte recht, als er die Gestalt der Stadt einer Bischofsmütze verglich. Denn sie bildete damals ein Fünfeck und dessen Grundlage der von Süd nach Nord, dann nach Nordwest gerichtete Lauf des Mains.
Eine Holzbrücke, wie bemerkt, gerade an der Stelle der heutigen schönen und breiten Steinbrücke, bezeichnete ungefähr die Mitte der ganzen, damals noch auf das rechte Ufer beschränkten Stadt: auf dem linken Ufer lagerten sich an den Fuß der alten Feste, um ein paar Kapellen und ein Kloster nur wenige Hütten armer Fischer. Die Siedelung auf dem rechten Ufer hatte erst vor etwa achtzig Jahren Erdwälle, hier und da durch steinerne Mauern verstärkt, und davor einen schützenden Graben erhalten zur Abwehr der ungarischen Raubreiter, die wiederholt so weit westlich gestreift und alles nicht ummauerte Land verbrannt und verheert hatten.
Damals hatte der bisher offene Flecken zugleich Stadtrecht empfangen; aber auch die neue »Stadt« war unter der Amtsgewalt des Grafen des Gaues, – Waldsassen hieß er – zu welchem sie gehörte, geblieben.
Die Brücke oder – in ihrer Verlängerung – der ihr im Osten gerade gegenüberstehende Dom schied die Stadt in zwei ungefähr gleich große Teile. Denn von der Brücke lief die Ringmauer mainaufwärts gen Süden, wandte sich dann in scharfer Biegung nach Osten bis an den Zwinger, das heißt den Zwingergraben, vor dem Wall, und bog von da nach Nordosten, die Wiesen östlich außerhalb des Grabens belassend. Von dort zog sich die Umwallung weiter gen Nordwesten, dann von Ost nach West, wandte sich dem dermalen noch sogenannten »inneren« Graben entlang dem Flusse zu und erreichte stromaufwärts von Nord nach Süd den Ort, von dem wir ausgegangen: die Mainbrücke.
So war also die ganze damalige Stadt eingeschlossen durch die Grenzen, die heute der Fluß im Westen, die Neubaugasse im Süden, die Kettengasse und die Theaterstraße im Osten, der innere Graben im Norden bilden. Auf dem linken, dem westlichen Ufer schaute von dem Marienberg die Burg des Grafen, das »Castellum Virteburch«, weithin über Stadt und Gau.
Die von dem Fünfeck der Umwallung umhegten Häuser bildeten nun aber sehr selten Straßen oder Gassen: waren es doch »Höfe«, ganz wie die Siedelungen der Landsassen draußen vor den Thoren im Gau, fast ausschließlich aus Holz aufgezimmert, nur etwa der Unterbau aus Stein: die vornehmeren »Höfer« liebten es wohl hier, ein paar Platten des wunderschönen fränkischen roten Sandsteins als Treppenstufen vor die alsdann etwas erhöhte Thüre des Wohnhauses zu legen. Dies war aber – ganz wie auf dem Lande draußen – stets umfriedet von einem manneshohen Hofzaun aus Pfahlwerk: der »Hofwehre«; das Hofthor mußte so weit sein, daß die zweispännigen breiten Wirtschaftswagen bequem ein- und ausfahren konnten. Denn Ackerbürger waren sie, diese burgenses, und die Anfänge von Handel und Gewerk noch sehr bescheiden. So lagen auch innerhalb der Mauern weite Strecken von Wiesen, lagen Äcker, besonders aber Gärten, in welchen Wein, Obst, Gemüse gepflegt wurden.
Alsbald nachdem bei Sonnenaufgang von der Zinne des Brückenturmes der Thorwart seinen Morgengruß geschmettert, antwortete ein höchst friedlicher Schall: auf dem Widderhorn blies der Gemeindehirte seine Herde von blökenden Schafen und meckernden Ziegen zusammen. Er fing damit an im Nordwesten der Stadt, hielt vor jedem Hof und wartete, bis der Viehschalk die bereits aus der Stallthüre entlassenen und an dem verschlossenen Hofthore sich drängenden Tiere aus diesem zu dem Hirten hinausließ.
So zog er die Kreuz und die Quer an allen Höfen vorbei, bis er an das »Südthor« gelangt war. Wie im Norden und im Osten zog sich auch im Süden um die Stadt, hart vor Graben und Wall beginnend, ein breiter Gürtel von Wiesen und Gärten innerhalb des »Pfahlhags«, den an geeigneten Stellen ein paar Blockhäuser, aus festen Balken gefügt, verstärkten; hier wohnten kleine Leute, die als Taglöhner, Gärtner, Zeidler, Winzer, Fischer ihr Leben fristeten.
Gleich hinter den wenigen ärmlichen Lehmhütten und Holzhäuslein dieser werdenden »Vorstadt« begann die weitgestreckte, bis zu dem »Acker des Randahar« sich hinziehende »Allmännde«, das Gemeindegut der Stadt, bestehend aus Weide, Wiese und buschigem Wald, von den »Burgensen« besonders zur Weide für Rinder und Schafe verwendet; während manches Borstentier mit grunzendem Wohlbehagen in den häufigen Pfützen sich sielte, die, an Stelle von gepflasterten Straßen, Hof von Hof zu trennen pflegten.
IV.
Rado, der graubärtige, hünenhaft lange und starkknochige Gemeindehirte, kam nicht so rasch hinweg von den meisten Höfen als er wünschte: – denn ihm war nur wohl draußen in Wald und Heide: in der Stadt, diesem ummauerten Grabe, müsse er ersticken, schalt er.
Und er war ein Liebling der Leute, der Alte: Hausherr und Hausfrau, Knecht und Magd, zumal aber die Kinder ließen ihn nicht leicht los ohne ein paar Fragen. Er wußte gar so viel, so vielerlei, was sonst kein Mensch mehr wußte: von Jagd und Fischfang und Viehzucht, von gesunden und kranken Tieren. Das Wetter verstand er ganz genau vorher zu sagen, manche meinten, geheimnisvoll nickend, weil er es selbst – ein wenig – mache.
Und alte Geschichten vollends wußte er zu erzählen – von seiner verstorbenen Mutter her – und Mären und Sagen, daß Kinder und Große offenen Mundes lauschten; und Segen: Wundsegen, Jagdsegen, Kampfsegen, Reisesegen, Biersegen, Viehsegen, Fischsegen – in mannigfaltigster Auswahl: seltsam nur, daß er sie alle plötzlich vergaß, trat in den Kreis seiner Hörer ein »Geschorener«, wie er unwillig sagte. Herr Heinrich schalt wohl oft darüber, aber er lächelte dazu und ließ ihn gewähren: denn der Hüne war in jungen Jahren ein gar treuer und trefflicher Waffenknecht der Rothenburger Grafen gewesen und hatte – so sagte man – dem Vater Herrn Heinrichs das Leben gerettet in Welschland.
Während nun der Hirt von Knecht und Magd und Kind an dem Hofthor aufgehalten ward mit Frag’ und Antwort, wartete der vorwärtsdrängenden Herde gar oft – und auch heut’ – ein anmutvolles Kind mit dicken, langen, dunkelblonden Zöpfen, die durch die lebhafte Kleine stets in Bewegung gehalten wurden, daß die hellblauen Bändlein an deren Enden hin- und herflatterten. Sie zeigte weit über ihre vierzehn Jahre hinaus voll und üppig entwickelte Formen, aber sie war so mutwillig und so kindlich wie die springenden, bockenden Zicklein ihrer Herde.
Als der Alte aus dem letzten Hofe vor dem Thor der Sandvorstadt zurückkam, fand er die Kleine aus vollem Halse lachend: lachend, daß ihr aus den hellgrauen Augen die Thränen über die dicken, runden Kinderbacken liefen. Sie hielt sich vor Lachen kaum aufrecht an dem langen, gebogenen Schäferstab, den sie einstweilen dem Alten abgenommen hatte.
»Was hast du, Fullrun?« fragte der. »Dich reiten wohl wieder die Elben!« »Es ist zum Zerspringen!« keuchte sie, sich mit der umgewandten Linken über die Augen fahrend. – »Was?« – »Schau ihm nur nach, Ohm! Da – links hin! – humpelt er davon. Sieh nur, wie er ausschaut! Ganz weiß vom trockenen Straßenstaub. Wie der Müller aus der Au! Nur nicht so sauber!«
Der Alte reckte die hohe Gestalt und hielt die Hand vor die buschigen Augenbrauen: denn die Morgensonne blendete von dort her: »Ei, das ist ja Junker Blandinus, der Sohn des Dogen aus Venetia, der jüngst erst ankam, Korn zu kaufen von dem Juden Renatus. Was hat der hier – in deiner Nähe wieder! – gesucht?« Und er nahm ihr den Stab aus der Hand und hob ihn drohend, daß sein langer Mantel, aus drei Wolfsfellen zusammengenäht, von seinen Schultern zurückwallte. »Weiß nicht, Ohm. Aber was er auch suchte: – gefunden hat er was anderes. Er ist immer um die Wege, mit seinem seidenen Mäntelein und dem bunten gezipfelten Wams. Wäre gar nicht so übel im Gesicht, putzte er sich nicht so weibisch heraus. Kaum warst du im Hammerhof verschwunden, da bog er flugs um die Ecke der Wirsinge und stand vor mir. ›Jungfrau Fullrun!‹ flüsterte er in seinem welschen weichen Ton, ›segne Euch Sankt Amor!‹ ›Ich heiße die runde Runel und mein Schutzheiliger heißt Sankt Kilian!‹ rief ich. ›Wer ist Euch wohl der Liebste auf der Welt nach Euren Gesippen?‹ fragte er und machte ganz verschwommene Augen. ›Schnufilo!‹ erwiderte ich rasch ohne Besinnen. Denn es ist ja auch wahr. ›S–Se–ch? – Schn–ufilo?‹ wiederholte er lispelnd. ›Wo ist er? Ist er ein Ritter, daß ich ihn bestehen mag? Ich durchspeere ihn!‹ ›Durchspeeren? – Meinen Herzens-Schnufilo? Nun wartet! Komm!‹ schrie ich ›faß, Schnuf, faß!‹ Und grimmig bellend sprang der herzige Schnuf herzu und fuhr ihm an die Waden.
›Oh – ohimè – Eine bestia? Ein monstro!‹ Nun trat der Schwarzkopf wieder näher: die dunkeln Locken – ’s ist wahr – lassen ihm nicht übel! Aber sein Haar stank süß von Salben! Ich hielt mir die Nase zu! – So!« Und sie machte es dem Alten vor: – so drollig, daß er lachen mußte. »Und wisperte: ›Wißt Ihr auch, schöne Runa, wie man in Venetia küßt?‹ ›Nein,‹ sagte ich. ›Ich küsse überhaupt nur Schnuf und Schnee.‹ ›S–ch–nee? Ist das auch so eine Beißbestia?‹ forschte er, besorgt um sich blickend. ›Nein, hier mein Mailämmlein.‹ ›So will ich Euch küssen lehren!‹ lächelte er und machte einen Schritt. Aber – o Sankt Kilian sei gepriesen! – er trat, nur auf mich guckend – auf das Ferkelein, das da – nun wieder! – in der Pfütze liegt. Laut aufquiekend fuhr ihm das zwischen die langen Beine – er stolperte und fiel bäuchlings in den weißen Staub daneben. Nun fuhr auch Schnuf ganz erbost wieder gegen ihn und zerriß ihm den langen erdbeerroten Flattermantel. Fluchend sprang er auf und entwich eilfertig.«
»Kommt er wieder,« drohte Rado, »lehr’ ich ihn, wie man im Waldsassengau – haut! – Auf, Thorwart, auf mit dem Gitter!« – Und nun flüsterte er ganz andächtig, gen Himmel blickend:
»Unsern Ausgang Geleite der graue Wandrer, weise der Wege. Die Wölfe wehr’ er Von Herde wie Hirt.«
»Hier, Giero, hier!« Er pfiff dem mächtigen grauen Hund: der trieb in unablässigem Umkreisen die zerstreuten Schafe und Ziegen auf dem weiten Platze rasch zusammen, so daß sie nun in guter Ordnung durch das geöffnete Thor und dann über den an eisernen Ketten herabgelassenen schmalen Steg über den Graben trippelten. Draußen begrüßte das kluge Tier freudig in lustigen Sätzen und laut bellend die Freiheit. Einverstanden klopfte ihm der Alte den Kopf. Fullrun folgte zuletzt; sie trug über den geländerlosen Steg gar sorgsam auf ihrem vollen linken Arm ein schneeweißes Lämmchen, das sie aus der blökenden Menge gegriffen hatte: mit der Rechten hob sie den Saum ihres rotbraunen Röckleins bis über den Knöchel des unbeschuhten Fußes: im Morgenwind flog das krause kurze Haar an ihren Schläfen: mit vollen Zügen sog sie den frischen Hauch des Morgens in die junge Brust.
V.
An demselben Morgen trabte, nachdem die Frühmesse in dem Dom zu Ende, ein bunter Reiterzug den freien Platz hinab auf die Mainbrücke zu.
Die Hengste der Männer und auch zwei zeltende Paßgänger für Frauen – mit zierlich gegitterten hohen Seitenwänden an den weichen Sätteln aus spanischem Leder – waren neben der Kirche von mehreren Knappen in Bereitschaft gehalten worden. Als das gemeine Volk aus den weitgeöffneten schön geschmiedeten Doppelthüren und über die vier roten Sandsteinstufen des Eingangs hinab sich verstreut hatte, wurden die Pferde dicht an die kniehohen »Roßsteine« geführt, die, an dem Dom, wie an gar manchem Eckgebäude angebracht, das Aufsteigen und Absteigen reitender Damen erleichterten.
Ein schlanker Jüngling von nicht allzuhohem, aber zierlichem Wuchs und von auffallend anmutvoller Haltung geleitete gar höfisch, nur an den Fingerspitzen ihren hellgelben Reithandschuh berührend, ein schönes junges Mädchen die Stufen des Domes hinab. Das veilchenfarbene Barett, geschmückt mit dem weißen Gefieder der Silbermöwe, stand gut zu dem dunkelbraunen dichten Gelock des jungen Ritters mit dem etwas helleren Bart, der überall das feine Gesicht umrahmte. Das enganliegende Wams, von gleicher Farbe wie das Barett, zeigte vorteilhaft die geschmeidigen, wohlgestalteten Glieder: die zarten Gelenke der Hände und der Knöchel schienen nicht deutsche oder doch nicht ungemischt deutsche Abkunft zu bekunden.
Lebhaft sprach er zu der jungen Dame, feurig blickte er ihr – und recht nah! – in die großen Augen von hellstem sonnig goldenem Braun, welche unter blonden, nicht allzustarken Brauen hervor freundlich und freudig in die schöne Welt hineinleuchteten. Ihre Wangen waren hold wie vom Flaum des Pfirsichs überzogen: die frischen, ein wenig aufgeworfenen Lippen lächelten gar gern und zeigten dann zierlich gereiht die weißesten Zähnlein. Ein Reiterhut von weißem weichstem Filz mit sehr breitem Rand und schwarzer Feder wiegte sich keck auf dem ganz hellbraunen, aber leicht von einem roten Schimmer durchleuchteten Haar. Gar anmutvoll war die Bewegung ihrer schmalen langen Hand, mit der sie das weitflutende weiße Wollkleid aufhob, wie die feinknöcheligen Füßlein über die Steinstufen vorsichtig hinabglitten. Herzhaft lehnte sie dabei den vollen warmen Arm auf den des Ritters; der führte sie an den weißen iberischen Zelter mit hellrotem Sattel- und Zaumzeug, der, ungeduldig harrend, mit dem rechten Vorderhuf gescharrt hatte und nun, die schöne Herrin erkennend, sie freudig begrüßend laut wieherte.
Der Junker hielt ihr beim Aufsteigen die Hand unter den Schuh und umspannte dabei den feinen Knöchel erheblich fester, als die Sicherheit der Reiterin gerade würde erheischt haben. Diese zürnte aber nicht, sondern sowie sie sich sicher im Sattelsitz fühlte, neigte sie ihm das wunderschöne Antlitz zu in gar holdseligem Lächeln: er erglühte vor Glück über soviel Huld, seine dunkelgrauen Augen blitzten und freudig schwang er sich auf seinen feurigen friesischen Rapphengst.
Hinter diesem Paar schritt langsam ein zweites die Domstufen hinab: gleich jung, gleich schön, aber in ganz anderer Haltung und Stimmung, so schien es. –
Zwar der Ritter, dessen blondes Haar dicht aus der ehernen Sturmhaube quoll, ließ die blauen Augen gar sehnend ruhen auf dem schmalen, blassen, nur ganz zart rosig überhauchten Antlitz der Dame; aber diese preßte den kleinen, stolzen Mund fest zusammen, schlug die Augen unerbittlich nieder und furchte streng die Brauen, deren tief dunkelbraune Farbe scharf abstach von dem fast weißgelben Geriesel ihres gewellten Haares, das unter der himmelblauen runden Seidenkappe hervor auf den gleichfarbigen langen Mantel frei, gelöst, flutete; dieser Gegensatz der fast schwarzen Brauen zu dem weißblonden Haar verlieh dem höchst vornehmen, edeln, aber marmorkalten Antlitz eigenartig fesselnden Reiz: wer diese stolzen, feinen Züge einmal geschaut, – er mußte ihrer gedenken für und für. Die ganze schlanke hohe Schilfgestalt schien ein schönes, aber herbes Rätsel; man mußte nachgrübelnd fragen, welch Geheimnis das junge Herz so streng verschlossen hüte? Denn die hellgrauen Augen, die sie selten aufschlug, schienen auch dann nicht in die Welt, schienen nach innen zu schauen, fest entschlossen, um keinen Preis zu verraten, was sie in diesen Tiefen erblickten.
Schweigend, sinnend, zögernd, wie widerstrebend, schritt sie nun die Stufen hinab: sie waren noch feucht vom Morgentau: – sie glitt ein wenig aus: – der Jüngling hielt ihr rasch den rechten Arm hin: aber sie achtete dessen nicht: noch schärfer die langgestreckten Brauen furchend richtete sie sich – allein – rasch auf zu ihrer vollen Höhe, schritt sicheren Fußes fürbaß und winkte, auf der letzten Stufe angelangt, einen grauhaarigen Knappen herbei: der mußte ihr auf den Rücken ihres Falben helfen. Dem Jüngling klirrte laut Schuppenbrünne, Wehrgut und Schwertknauf aneinander, wie er sich nun hastig auf das starke Streitroß schwang, einen braunen Flanderer schwersten Schlages.
Die beiden Junker ritten jetzt an die Seite der beiden Edelfräulein und nun ging’s in raschem Trab hinab an die Brücke: – deren Thor ward von den Wächtern ehrerbietig aufgethan: – nun über die dröhnenden Balken und drüben aufwärts auf dem linken Ufer, wo sich der Leinpfad zum Schleppen für die Mainschelche hinzog.
Ein Holzverhack sperrte den schmalen Weg zwischen dem Fluß zur Linken und dem steil abfallenden Felsen des Marienbergs zur Rechten: jenseit eines engen Durchlasses in dem Verhack wartete der beiden Paare ein Häuflein von Jägern mit Pferden, Hunden und Falken: denn der Falkenjagd, der Reiherbeize galt dieser Morgenritt.
VI.
Das Jagdgeleit bestand aus nur Einer »Rotte«: das heißt dem Falkenmeister und drei Falkenieren; alle vier waren beritten; die letzteren hielten abwechselnd den Falkenrahmen, eine leichte viereckige Trage, aus weißem Holze zierlich geschnitzt, auf welcher zwei Beizvögel, mit einer langen Kette unter dem Flügelbug und einer kurzen um den rechten Lauf und Fang angefesselt, saßen: zierlich stand den schlanken Vögeln die Falkenhaube, ein Käppchen von rotem Leder aus Cordoba, oben mit weißen Federn, unten mit kleinen silbernen Schellenkügelein geschmückt: ein schmales Lederriemchen hielt die Haube, über Kopf und Augen gezogen, unter der Kehle festgeschnallt. Den Berittenen folgten zu Fuß drei Hundekoppeler, von denen jeder zwei Stöberhunde an der Koppelleine führte: mächtig zerrten sie vorwärts, die starken, grauhaarigen, hochbeinigen Rüden aus Ungarland: aber scharf erzogen, gaben sie bei aller Jagdgier nicht Laut.
»Was habt Ihr heute für Vögel auf den Rahmen gesetzt, Herr Fulko?« fragte die Braunlockige, anmutvoll den Kopf und den breitrandigen Hut nach ihrem Begleiter zurückwendend. »Geht es auf hohen oder auf niederen Flug?« »Wer mit schön Minnegardis jagt – und für sie, – denkt nur an hohen Flug,« erwiderte der Junker mit weicher, wohllautender Stimme. »Die Falkeniere haben Reiher angesagt in den Altwassern des Mains, nahe der Fähre bei den Höfen der Heitinge: sogar einen –, nun, nicht vor der Jagd von der Strecke plaudern, sonst verfällt sie dem wilden Jäger! Heute wollen wir erproben, Freund Hellmuth, ob des Herrn Bischofs isländischer Girofalk besser arbeitet oder mein Wanderfalk: ich holte ihn, gerade flügge geworden, selbst aus dem Horst auf dem Geiersberg im Spechteshart.«
»Deiner steigt besser und streicht gehorsamer zurück auf die Faust zur Atzung,« antwortete der Blonde; trüb war, gedämpft der Ton seiner Rede. »Ei ja,« rief Fulko, »er hat mir auch manch Federspiel zerzaust, bis er’s gehörig lernte. Der Isländer ist nicht gut abgetragen: denn Freund Arn, der Jägermeister, der’s besser als wir alle kann, ward vom Herrn plötzlich verschickt, bevor der teure Vogel stoßreif war. Aber nun, habt acht, Jungfrau Minnegardis! Die Stöberer springen ein.« »Da platschen sie ins Röhricht,« rief das Mädchen, und setzte in hellem Jagdeifer ihren Zelter in lustigen Trab. »Seht, schon müssen die vordersten schwimmen: da ist’s schon tief.« – »Ja, ein altes Weidmannswort scherzt: ›Reiher ist von höherem Stand denn Rüde‹. Aber jetzt – den Rahmen herbei!« Die Ritter lösten den Vögeln beide Fesseln, nahmen sie von der Trage und setzten einen derselben je einem der Fräulein, – Minnegard den Wanderfalk, Edel den Isländer – auf den seidengestickten Handschuh der rechten Hand, so daß die scharfrandigen Krallen den Zeigefinger fest umschlossen; die Kappen blieben noch unbehoben.
Es war nun gar schön zu schauen, wie die beiden holden Reiterinnen in raschem Trabe den Fluß entlang dahinflogen, mit wehenden Federn, Locken und Mänteln, die stolzen Vögel auf dem anmutig gebogenen Handgelenk.
»Hört ihr?« rief Fulko. »Da schlagen die Stöberhunde den Reihergruß. Lüpft die Kappen! Werft eure Vögel, edle Jägerinnen!« Die Mädchen schnallten den Vögeln rasch die Kappenriemen ab, ließen die von dem plötzlichen Lichteinfall Geblendeten noch einen Augenblick in den Himmel schauen, wiesen ihnen dann Beute und Flug, sie in der Richtung der rasch enteilenden Reiher in die Höhe hebend, und schnellten sie mit kräftigem Schwunge des Gelenks in die Luft mit dem lauten Rufe: »Holî! Holî!«
Sofort hatten die Falken das steigende Wild eräugt und stiegen nach, pfeilschnell, mit gellendem Schrei, dem der kreischende Angstruf der Reiher »krätsch! kraitsch!« antwortete. Beide Flüchtlinge blieben auf dem linken Ufer und eilten flußaufwärts: die Berittenen hatten also nur die nebenherziehende breite Heerstraße einzuhalten, so konnten sie leicht folgen.
Herrlich war der Anblick der Flucht und der Verfolgung durch die Lüfte. Zuerst entleerten die beiden Sumpfvögel die Kröpfe des Fraßes, ihren Flug zu erleichtern: denn sie hatten mit Erfolg in dem Schilfwasser gefischt, stets gegen die Sonne stehend und watend, damit der hinter sie fallende Schatten die Fische nach vorn ihrem Schnabel zutreibe. Dann legte jeder den langen kegelförmig zugespitzten Schnabel mit den messerscharfen Schneiden auf den Kropf, streckte die langen Ständer gerade hinter sich und sausend ging es nun in die Höhe, immer höher, immer höher, dem Verfolger das Überfliegen unmöglich zu machen.
Denn der Falke konnte den viel größeren Feind nur zwingen, wenn er ihn überstieg und dann von oben her schlug, ihm zwischen den Flügelschultern und dem Ansatz des Halses den Haken des Schnabels mit dem scharf ausgeschnittenen dreieckigen Zahn des Oberkiefers einhieb, die beiden Fänge aber mit den kräftigen spitzen Krallen unter den ausgespannten Flügeln – vor deren Bug – in den Rumpf schlug und so schon durch den Druck von oben den keineswegs immer tödlich getroffenen Reiher zum sausenden Sturz brachte; der Falkenier eilte dann herzu und tötete oder fing den Verwundeten, während der Falke, wenn gut abgetragen, auf die Hand der Herrin zurückstrich.
Aber nicht gerade aufwärts stiegen die Reiher, sondern schraubenförmig, ähnlich den Lerchen, in immer höher und höher gezogenen Ringen: der schwere Vogel konnte nicht senkrecht oder sehr steil schräg fliegen, während der Falke schnurgerade, nur stets etwas höher zielend als sein Gegner flog, auf diesen losstürmte.
Übrigens kamen diesmal die beiden Paare in den Lüften und demgemäß die beiden Jägerpaare auf der Erde bald ziemlich weit auseinander. Edel hatte ihren Vogel früher geworfen als Minnegard: derselbe ersah daher den zuerst aufgestandenen grauen Reiher: dieser und sein Verfolger, der Isländer, gewann rasch starken Vorsprung in die Höhe und in die Weite vor dem Wanderfalk, der den zweiten etwas größeren Reiher – weiß wie Schnee leuchtete im Sonnenglast dessen Gefieder – stets vom Wasser ab nach dem Walde hin zu treiben suchte.
VII.
Edel und Hellmuth sprengten an dem anderen Paare vorbei und hatten bald Mühe, zu Pferd den raschen Fliegern zu folgen.
Lange vermochte der Isländer nicht, dem Feinde nachzukommen: endlich, endlich aber hatte er ihn überstiegen – etwa um sechs Fuß – und sofort stürzte er sich nun aus dieser Höhe auf seine Beute. Allein blitzschnell hatte der Reiher den bisher abwärts auf dem Kropfe getragenen starken, spitzen und langen Schnabel – eine fürchterliche, oft den Augen des Jägers sogar, der den wunden Vogel greifen will, gefährliche Waffe – senkrecht nach oben gekehrt: der Falke, der mit voller Wucht herabstieß, spießte sich dabei die Brust auf wie auf einem Speer, so daß die Spitze des Reiherschnabels ihm im Rücken zwischen den Flügeln hervordrang. Der Sieger aber konnte sich nicht von dem verendenden Feinde losmachen, nicht unter dem Drucke dieser Last den Schnabel aus der Wunde reißen und so taumelte er denn, den Rücken nach unten, sausend zur Erde. Kaum war er aufgefallen, – zwischen der Straße und dem Fluß – war Hellmuth schon zur Stelle, Edel folgte. Der Junker sprang ab, riß den toten Falken von dem Reiher los, faßte diesen mit der Rechten im Genick an beiden Fittigen und warf ihn hoch in die Luft: »Geh!« rief er dem hastig Enteilenden nach. »Du hast dich ritterlich gewehrt – hast gesiegt: ich mag dich nicht unritterlich erwürgen. – Ich habe doch recht gethan?« fragte er zu Edel hinaufblickend, die nun dicht hinter ihm auf dem schnaubenden Falben hielt. »Gegen Reiher seid Ihr ritterlich,« erwiderte sie herb, ohne eine Miene zu verziehen, wandte das Roß und ritt langsam zu dem anderen Paare zurück.
Auch dessen Beize war ausgebeizt. Gar bald hatte der Wanderfalk den großen, glänzendweißen Vogel überhöht, und ihn von dem Flusse, den er nun überschreiten wollte, ab- und auf das linke Ufer zurückgedrängt: auf den ersten Stoß gelang ihm das Schlagen: Reiher und Falk taumelten, aber der Falke rittlings auf seiner Beute sitzend, auf die blumige Wiese zur Rechten der Heerstraße. »Ruft ihn, ruft ihn rasch,« drängte Fulko die Jägerin, während beide heransprengten. »Er verliert sonst die Zucht und den Heimstrich.« »Hilô! Hilô!« rief Minnegardis freudig und setzte in vollem Jagen über den breiten Graben auf die Wiese: ihre schwarze Feder flog, ihre Locken flatterten. Entzückt folgte Fulko der zierlichen Gestalt der mutigen Reiterin.
Gehorsam kam der kluge Vogel zurückgestrichen und ließ sich auf dem Handgelenk der Herrin nieder: vergnügt die beiden Schwingen leicht schlagend rief er ganz leise, – nicht den gellenden Kampfschrei – und sah mit seinen nußbraunen Augen in Minnegardens Antlitz: ein Falkenier brachte ihr eilig auf goldenem Stäblein ein Stück Rinderherz und hielt ihr den Zügel, während der Vogel aus ihrer Linken behaglich und mit leisem Dankrufe gierig kröpfte: dann ward er wieder gehaubt und auf die Trage zurückgebracht.
Nicht eher doch hatte der Falke seinen Gefangenen freigegeben, bis Fulko, vom Rosse gesprungen, denselben an beiden Schwingenknochen gefaßt hatte; er hielt ihn nun der Jägerin hin, die sich anmutvoll aus dem Sattel herabbeugte. »Welch herrlich Tier!« rief sie erfreut. »Welch leuchtend Weiß! Nie sah ich seinesgleichen!« – »Es ist ein Silberreiher. Ich wollt’ es nicht – vor der Zeit! – verkünden. Aber ich hatte ihn gestern abend angeschlichen.« – »Er ist – wie es scheint – ganz unverletzt?« – »Fast ganz. Nur wenig blutet hier der Hals. Das hab’ ich ihn gelehrt, den klugen Greif, am Federspiel: – für den Silbervogel! – nur fangen, nicht morden!« – »Oh! dann wollen wir das edle Tier freilassen! Nicht?« – »Gewiß: Ihr seid ja seine Fängerin, nicht ich! Und ich: – im voraus erriet ich Euer gütig Herz.« Er griff in die kleine von Stricken geflochtene Jagdtasche, die er am Wehrgurt trug. »Das mögt Ihr jetzt leicht sagen,« lächelte sie. »Ich beweis es, Herrin!« gab er zur Antwort. – »Wie? Was wollt Ihr thun?« – »Wie immer: Euren Willen – Nur ein Andenken an diesen frohen Morgen soll Euch Euer schöner Gefangener lassen. Seht Ihr die beiden silberweißen Federn hier auf seinem Haupt?« – »Wie stolz sie wallen! Schaut, sie reichen noch weit über seinen Rücken.« – »Wie prächtig werden sie sich abheben von Eurem Jagdhut und von Eurem Haar.« Er zog nun mit sanfter Gewalt dem Vogel die beiden Kopffedern aus und überreichte sie der Jägerin, die sie freudig dankend nahm und sofort in dem Goldring ihres Hutes befestigte. Sie schmückte sich so gern! Für sich und für andere. Und jeder einfachste Schmuck ließ ihr so gut. Aber nun vollends diese stolze fürstliche Zier!
»Ihr seht aus wie die Königin von Avalon, dem Feenland!« – »Wenigstens trägt keine Königin schöneren Schmuck.« – »Und keine Kaiserin würdiger denn Ihr.« – »Dank! Recht von Herzen Dank!« – »Aber nun wollen wir ihm die Freiheit geben, dem Glücklichen, der Euch erfreuen und Euch zieren durfte. – Seht, lange hab’ ich vorgedacht für diese Jagd.« Und er zeigte ihr, was er aus der Netztasche hervorgeholt: es war eine kleine, runde Goldplatte an einer länglichen, rohrartigen, innen hohlen Schließe aus Silber: »Was hab’ ich darauf ritzen lassen von Meister Aaron, dem kundigen Goldschmied zu Frankfurt? Schon vor Wochen ritt ich deshalb hinüber.«
Und das Mädchen las mit holdem Erröten:
»Mich fing die wunderschöne Minnegard Und gab mich wieder frei: Der Freiheit wenig Dank ihr ward: Denn wen sie fing, die holde Fei, Will, daß er ewig ihr Gefangner sei.«
»Ihr seid ein Schalk,« lächelte sie, »wie alle Sänger, aber ein feiner.« – »Und was Ihr seid, – das singen und sagen alle Sänger der Erde nicht aus! – Nun fliege, Reiher, und verkünde in allen Landen vom Maine bis zum Jordan Minnegardens Schönheit!« Er hatte nun das Silberröhrlein um den linken Ständer des Gefangenen zusammengedrückt, die Schnalle geschlossen und gab ihn jetzt frei: der Reiher reckte sich in die Höhe, hob den langen Hals, breitete dann die mächtigen Schwingen aus, stieß vom Boden ab, hob sich und flog, mit lautem frohem Ruf der Erlösung, schwirrend in die Höhe: bald war er im fernen Blau wie ein schimmernd weiß Gewölk verschwunden.
VIII.
Das Jagdgeleit ward nun entlassen, es kehrte in die Stadt zurück; die beiden Paare jedoch, gefolgt von einigen Dienern zu Pferd, wandten sich von der Heerstraße und dem Flußufer ab nach Westen die Hügel hinan dem schönen Walde zu, der jetzt der Guttenberger heißt, damals der Königswald genannt wurde.
Sobald der kleine Zug wieder beisammen war, gab Minnegard ihrem Zelter, aber auch dem Falben ihrer Genossin einen leichten Schlag mit der Gerte, die ihr Fulko von einer Weide gebrochen: »Ei,« rief sie, »gestrenge Edel, nun wollen wir sehen, welcher Reiterin Rößlein rascher läuft: deren Herz schlägt auch wohl mutiger.« »Rascher das deine, aber mutiger nicht!« erwiderte die Blonde ernst und schoß weit an ihr vorüber. Sie wollte sichtlich allein sein; Hellmuth folgte ihr nicht; er hielt den Hengst an und blieb so auch hinter dem anderen Paare zurück.
Der steil ansteigende Weg ward bald so schmal, daß zwei Pferde nur gerade zur Not nebeneinander Raum fanden. Dies machte sich Junker Fulko zu nutze. Gar bald hatte er seinen Rappen dicht neben Minnegards Weißrößlein gelenkt und nun wich er nicht mehr von ihrer Seite. Geraume Zeit ritten sie, nur stumme Blicke tauschend, nebeneinander hin, damit begnügt, Aug’ in Auge zu senken. – Da strauchelte das Tier der Reiterin – allzuwenig achtete sie des Weges! – über eine knorrige Wurzel, die den Pfad kreuzte: es drohte, auf die Vorderfüße zu fallen und seine leichte Last vornüber zu schleudern. Mit raschem Griff riß der Junker das Pferd empor und schob die Errötende in dem Sattel zurecht. Sie war wohl ein wenig erschrocken: aber sie lächelte schon wieder mit schalkhafter Fröhlichkeit: »Dank!« rief sie. »Waret Ihr nicht an meiner Seite … –« – »O dürft’ ich’s immer sein!« »Ausreden lassen!« schalt sie. »Waret Ihr nicht an meiner Seite, hätte mich dies Unheil nicht bedroht.« – »Wieso?« – »Ei, dann hätte ich wohl besser, zwischen den Ohren meines Rößleins durch, gerade vor mich auf den Weg geschaut, wie mich Herr Bischof Heinrich, mein geistlicher Reitlehrer und reisiger Beichtiger, gelehrt hat. Da Ihr mich in Gefahr gebracht, mußtet Ihr mich freilich auch beschützen.« – »O könnt’ ich Euch auf meinen Armen über alle Gefahren hinweg – durch’s Leben – tragen.« – »Gemach, Herr Ritter von Yvonne! Zunächst müßtet Ihr mich dann tragen – in das Kloster, das zu schmücken ich bestimmt bin.« – »Ihr seid noch nicht darin!« – »Aber bald werd’ ich’s sein.« – »Arme Minnegard!« – »Und armes Kloster!« – »Man kann Euch nicht zwingen.« »Ich zwinge mich selbst. War es doch der letzte Wunsch meiner sterbenden Mutter. Meine Oheime, die Bischöfe von Köln und von Würzburg, kennen diesen Wunsch und …! Oder vielmehr,« lächelte sie, – »weshalb wähnt Ihr, daß es des Zwangs bedürfe? Warum soll ich nicht gern eine Heilige werden?« »Weil’s ein Frevel ist!« brach der Junker los, »eine Sünde wider die Natur, die Euch holdes Wunder, so wunder-anmutvoll geschaffen hat! O Minnegard, Ihr gleicht an holdem Reiz, an blühender Schöne der Alpenrose, die Euerer wie meiner grünen Heimat Berge schmückt. Ihr seid geboren, zu beglücken und beglückt zu sein! Schon Euch anschauen ist wie heiße Qual, so heiße Wonne, heiße Seligkeit! Und all dieser Reiz – er soll verblühen? O viel edle Dame! Ich sah einmal – zu Paris war’s – in der Basilika der heiligen Genoveva – hinter einem Gegitter von Golddraht auf dem Seitenaltar schöne, wirklich wunderschöne vollblühende Blumen: Lilien, Rosen, Krokus, – auch eine Alpenrose war darunter! – Staunend trat ich näher: denn draußen lagen fußhoch Eis und Schnee: allein ach! meine Freude schwand! Gemacht waren sie, diese armen Blumen, aus Flitter, aus Lappen, auf Draht gezogen, seelenlos, duftlos: – vielmehr ging ein Geruch von Staub, von dumpfem Moder von ihnen aus! – Das, o holde Alpenrose, ist die Nonne! Und Ihr solltet also vertrocknen? Diese leuchtenden Augen sollten nicht Liebe strahlen? Diese roten, weißen, weichen Lippen …« – »Hört auf, Herr Fulko von Yvonne! Vernähmen es die Leute, sie dächten, Ihr wüßtet drum, ob meine Lippen weich oder hart. Und davon wißt Ihr doch so wenig wie …« – »Ach ja! wie Ihr von meiner heißen Liebe!« – »Ei, meint Ihr? Ich glaube, davon weiß ich doch ein wenig mehr!«
Und sie schaute ihn dabei so freundlich an und sie lächelte dabei so hold, daß er, kühn gemacht durch soviel Huld, fortgerissen von soviel Liebreiz seine verlangenden Lippen sehr nah unter ihren breitrandigen Jagdhut wagte. »Oho, Reitersmann!« rief sie, sich weit von ihm abbeugend. »Jetzt, – so scheint’s – seid Ihr