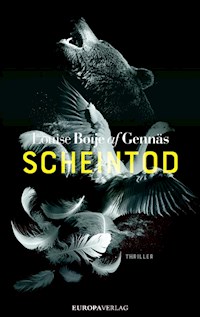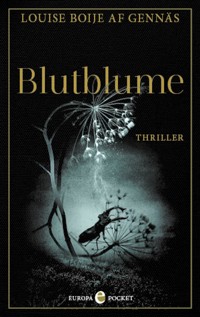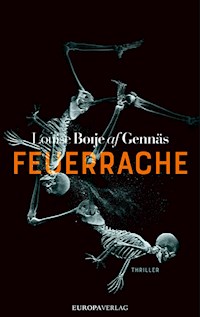
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Widerstandstrilogie
- Sprache: Deutsch
Monatelang wurde die 25-jährige Sara von einer unbekannten Schattenorganisation an den Rand des Wahnsinns getrieben. Mehrere ihr nahestehende Personen sind unter mysteriösen Umständen zu Tode kommen und auch Sara schwebt in höchster Lebensgefahr. Doch ihre Widersacher lassen nicht von ihr ab – zu groß ist die Gefahr, dass die junge Frau ihre dunklen Machenschaften enthüllt, denen bereits Saras Vater gefährlich nahe gekommen ist. Als ihre geheimnisvollen Verfolger ausgerechnet Saras jüngere Schwester Lina auf ihre Seite ziehen, versucht Sara alles, um ihre Widersacher ausfindig zu machen und endlich Erklärungen zu finden ... Im dritten Band ihrer fesselnden Widerstandstrilogie jagt Louise Boije af Gennäs ihre Protagonistin Sara in einem nervenaufreibendem Showdown durch ein Gewirr an Intrigen, Korruption und politischer Einflussnahme auf höchster Ebene, das auch dem Leser den Atem stocken lässt. Das fulminante Finale einer außergewöhnlichen Suspense-Reihe, die man erst aus der Hand legen kann, wenn man die ganze Wahrheit kennt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 762
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Louise Boije af Gennäs
FEUERRACHE
Thriller
WiderstandstrilogieBand 3
Aus dem Schwedischenvon Ricarda Essrich
Die schwedische Originalausgabe ist 2019 unter dem Titel Verkanseld bei Bookmark förlag, Schweden, erschienen.
Dieses Werk ist fiktiv und der Fantasie der Autorin entsprungen.
Die wiedergegebenen Artikel sind jedoch echt, genau wie die bislang unaufgeklärten »Affären«, die sie zum Thema haben. Bitte beachten Sie, dass Realität und Fiktion in diesem Buch parallel existieren.
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
1. eBook-Ausgabe 2020
© 2019 by Louise Boije af Gennäs
Published by agreement with Nordin Agency AB, Sweden
© 2020 der deutschsprachigen Ausgabe
Europa Verlag in Europa Verlage GmbH, München
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,
unter Verwendung eines Designs von Elina Grandin
Lektorat: Antje Steinhäuser
Layout & Satz: Robert Gigler & Danai Afrati
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-293-0
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
In Erinnerung an meinen Vater,Hans Boije af Gennäs (1922–2007)
»Nur die Verteidigung ist gut, sicherund dauerhaft, welche von dir selbstund von deiner eigenen Tapferkeit abhängt.«
Aus Der Fürst (1532)von Niccolò Machiavelli (1469–1527)
Inhalt
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
EPILOG
DANK
1. KAPITEL
Mama stand in ihrem hellblauen Morgenmantel in der Küche und brühte duftenden Kaffee auf. Papa war gerade von einer Langlaufrunde heimgekehrt und zog, wo immer er mit geröteten Wangen und geschmolzenem Schnee auf der Mütze entlangging, eine kleine Dampfwolke hinter sich her. Vor dem Fenster schien die Sonne auf das schneebedeckte Örebro, das Thermometer zeigte minus fünf Grad. Die Szene erinnerte an ein Bild aus einem Buch von Elsa Beskow. Ich selbst saß am Küchentisch und aß meinen Brei, und auf dem Boden spielte Lina mit Esmeralda, unserem Kätzchen.
»Sara«, sagte Papa, »hast du nicht Lust, mit mir eine Runde in der Vena-Loipe zu drehen? Es ist eine Wohltat ‒ für Körper und Seele!«
Ich sah meinen Vater vor mir, wie er da stand, mit seinem breiten, freundlichen Lächeln, und ich wusste, nichts hätte ihn mehr gefreut, als wenn ich ihn begleitet hätte, nach Norden über den Kasernvägen und dann auf der Vena-Loipe in den Wald hinein. Wir hätten die Sonne im Rücken, die Luft wäre frisch, und wir würden ein Tempo halten, bei dem wir uns beide ordentlich anstrengen müssten, dabei aber trotzdem die fantastische Winterlandschaft mit blauen Schatten über dem leuchtend weißen, harschen Schnee genießen könnten.
»Ja«, sagte ich. »Ich komme mit, Papa.«
Ich erhob mich vom Küchentisch, nahm meine Jacke und zog die roten Fäustlinge mit dem traditionellen Lovvika-Muster an, die Torstens Frau Kerstin mir gestrickt hatte. Doch plötzlich veränderte sich das Bild. Der Himmel vor dem Fenster verdunkelte sich und füllte sich mit dicken lila Gewitterwolken. Der Schnee war fort, stattdessen peitschte Regen gegen die Fenster. Lina und das Kätzchen waren verschwunden, und als Mama sich vom Spülbecken zu mir umdrehte, war keine Spur mehr von ihrem sonst so klaren Blick unter dem lockigen braunen Haar zu sehen. Wo vorher ihre Augen gewesen waren, wies ihr Schädel nicht mehr als ein Paar leere Augenhöhlen auf.
Voller Panik drehte ich mich zu Papa um. Seine Augen sahen aus wie immer, und er öffnete den Mund, um etwas zu sagen. Doch anstatt der Wörter quoll eine hellgraue Aschewolke aus seinem Mund und wirbelte durch den Raum. Und ich sah, dass Papa keine Zähne mehr hatte.
Dann warf sich Micke auf mich, und ich schrie.
Ich stand am Fenster und sah in die Nacht hinaus, trank ein Glas Wasser und versuchte, meinen Puls wieder unter Kontrolle zu bringen. Aus Linas Zimmer drang kein Laut; dieses Mal schien ich sie nicht geweckt zu haben. Unsere kleine Küche ging direkt zum Nytorget hinaus, der ruhig und friedlich dalag. Der Herbst war schon zu spüren, auch wenn die Bäume noch keine Blätter verloren hatten. Eine einsame Frau mit einem Bullterrier bewegte sich unter den Laternen von einem Lichtkegel zum nächsten.
Den ganzen Sommer über hatte ich nichts von BSV gehört.
Nach Johans und Mamas plötzlichem Tod Ende des Frühjahrs war ich mehrere Wochen kaum ansprechbar gewesen. Erst lag ich beinahe eine Woche im Krankenhaus, dann war Sally mit mir nach Örebro gefahren und hatte mich bei Ann-Britt und ihrer Familie untergebracht. Ich war so weit wiederhergestellt, dass ich an Mamas Beerdigung auf dem Nordfriedhof teilnehmen konnte, doch ich erinnere mich an kaum etwas. Ann-Britt kümmerte sich ganz rührend um mich, brachte mich ins Bett, versorgte mich mit Essen und ließ mich ansonsten wie ein Gespenst in ihrem Haus und Garten umherschleichen, während ich wieder und wieder durchging, was passiert war. Zunächst konnte ich nicht weinen, doch mit der Zeit – je mehr ich darüber redete – kamen die Tränen. Ann-Britt wurde nicht müde, mir zuzuhören, genauso wie Sally und Andreas, wenn sie mich besuchten.
Ab Anfang Juli kam ich langsam wieder auf die Beine. Beschämt musste ich mir eingestehen, dass ich meine kleine Schwester, der es auch schlecht ging, völlig vernachlässigt hatte. Es war, als tauchte ich aus einer ganz anderen Welt auf – erst jetzt erkannte ich, wie schwer das alles für Lina sein musste, die erst ihr geliebtes Pferd und danach ohne Vorwarnung unsere Mutter verloren hatte, nur knapp ein Jahr nach dem Tod unseres Vaters. Auch Lina hatte bei Ann-Britt gewohnt, doch ich hatte ihre Existenz kaum wahrgenommen. Die Ereignisse des letzten Jahres hatten mich sehr mitgenommen, und nun forderte der Stress seinen Tribut.
Im Juli funktionierte ich beinahe wieder normal und konnte langsam auch für Lina da sein. Doch zu meiner Verwunderung musste ich feststellen, dass Lina ganz anders auf all das Schreckliche reagiert hatte, das uns widerfahren war. Sie war nicht zusammengebrochen, obwohl sie allen Grund dafür gehabt hätte. Stattdessen hatte sie regelrecht eine Schutzmauer um sich herum aufgebaut, und keiner von uns verstand so richtig, was innerhalb dieser Mauer vor sich ging. Ann-Britt sah mich hilflos an.
»Sie weint nicht«, sagte sie leise. »Ich weiß nicht, was ich machen soll.«
Ich versuchte, mit Lina zu sprechen, jedoch ohne Erfolg. Sie sah mich mit Härte im Blick an und weigerte sich, über ihre Gefühle zu sprechen.
»Ruh dich lieber aus«, sagte sie stattdessen. »Du brauchst das.«
Also ruhte ich mich aus. Meine Kräfte kehrten langsam zurück, physisch und mental, doch gefühlsmäßig war ich immer noch ganz unten. Mamas Tod war mir unbegreiflich. Nicht, dass es passiert war. Das verstand ich, und ich ahnte auch, wie sie gestorben war, auch wenn ich noch nicht dazu in der Lage gewesen war, mich damit auseinanderzusetzen. Aber dass Mama tatsächlich fort war, dass sie nicht mehr da sein und ich nie wieder mit ihr sprechen würde?
Das war unfassbar.
Bei meinen langen Spaziergängen durch die Stadt – während alle anderen am See im Alnängsbadet in der Sonne brieten und die extreme Sommerhitze Örebro so stark im Griff hatte, dass das Universitätskrankenhaus alle Operationen bis auf Weiteres einstellen musste – wälzte ich all die unbeantworteten Fragen. In dem gut einen Jahr, das seit Papas Tod vergangen war, war so viel passiert, aber ich wusste immer noch nicht, wer hinter mir her war und warum.
Gedanklich ging ich alles, was ich erlebt hatte, wieder und wieder durch, und je mehr ich grübelte, desto surrealer schien das Ganze. Nachts lag ich wach und wälzte mich im Bett herum oder suchte im Garten Abkühlung. Die Waldbrände in der Gegend wirkten wie ein Abbild meines Innersten: eine verwüstete Landschaft, zu nichts mehr zu gebrauchen. Was passiert war, ergab schlicht keinen Sinn.
Falls die menschliche Seele wirklich in der Lage sein sollte, Unangenehmes von sich fernzuhalten, um heilen zu können, dann war es genau das, was meine Seele gerade tat: Sie deckte einen Mantel über alles Schreckliche und suchte nach alternativen Erklärungen für das, was passiert war. Ich fing an zu verstehen, dass wir Krieg, Folter und unmenschlichen Verlusten ausgesetzt sein und trotzdem weiterleben können – unser Überlebensinstinkt ist so stark, dass wir sogar unsere eigenen Erinnerungen manipulieren, um zu überleben.
Bis Ende Juli war ich die Ereignisse so oft durchgegangen, dass ich es beinahe leid war, und ich hatte entschieden:
BSV gab es nicht wirklich.
Das Ganze war womöglich eine Reaktion auf Papas Tod: Die Trauer war übermächtig geworden und hatte dazu geführt, dass ich mir einige Dinge einbildete und andere größer machte, als sie eigentlich waren. Ich hatte psychologische Fachartikel gelesen, in denen die Rede von Screen Memories war: fiktiven Erinnerungen, die die tatsächlichen Ereignisse überdeckten, weil diese nicht auszuhalten waren. Mein Gehirn hatte viele Situationen und Ereignisse erfunden, um das Unbegreifliche begreifbar zu machen: dass mein geliebter Papa bei einem Unfall in unserem Sommerhaus umgekommen war.
Wahrscheinlich war ich psychisch aus dem Gleichgewicht geraten – vielleicht befand ich mich schon an der Grenze zu einer Psychose – und bildete mir daher Dinge ein, die nie passiert waren.
Hatte es Bella überhaupt gegeben, oder war sie nur ein Produkt meiner Fantasie?
All diese unerklärlichen Ereignisse, hatten sie wirklich stattgefunden oder hatte mein Gehirn sie konstruiert?
Forschungen zufolge gab es im Leben jedes Menschen ein Zeitfenster, in dem Schizophrenie ausbrechen kann, irgendwann im Alter zwischen zwanzig und fünfundzwanzig Jahren. Ich war fünfundzwanzig, und das Muster schien zu stimmen. Die Frage war, ob ich Hilfe brauchte oder ob schon die Erkenntnis über mein mögliches Krankheitsbild ein Zeichen dafür war, dass ich gesund wurde?
Wenn es BSV tatsächlich gegeben hätte, hätten sie sich dann im Sommer nicht zu erkennen geben müssen?
Egal, wie oft ich meine Sachen durchsuchte, ich konnte kein einziges der »Siegel« mit den Buchstaben BSV, dem Schild und drei kleinen Kronen finden, die ich doch angeblich so oft gesehen haben wollte.
Wo waren die Zettel hingekommen?
Hatten sie vielleicht nie existiert?
Eine leise Stimme in mir protestierte und sagte, dass ich natürlich all das erlebt hatte. Aber ich tat mein Bestes, um sie zum Schweigen zu bringen.
Im August kümmerte ich mich um einige praktische Dinge. Sally und Andreas halfen mir dabei, die Wohnung auf Kungsholmen zu verkaufen, und taten eine Dreizimmerwohnung in der Skånegatan am Nytorget auf. Sie war sehr teuer, doch mit dem Verkauf der Wohnung und meinem Anteil an Mamas Erbe konnte ich sie mir nicht nur leisten, es blieb auch noch eine Menge Geld übrig. Die Wohnung wurde versteigert, Sally gab für mich ein Angebot ab und gewann. Das Wichtigste war jetzt, für Lina und mich so schnell wie möglich ein neues Zuhause zu schaffen, damit sie ihr Leben weiterleben konnte und sich nicht in der Trauer vergrub. Und ich wollte weder nach Östermalm noch nach Kungsholmen zurück. Der Nytorget auf Södermalm war perfekt. Außerdem behielten wir Mamas Auto, damit wir schnell und unkompliziert nach Örebro fahren konnten, wenn wir wollten.
Ann-Britt half uns den Sommer über, unser Elternhaus auszuräumen und alles einzulagern. Weder Lina noch ich waren derzeit in der Lage, etwas auszusortieren, doch wir wollten das Haus auch nicht leer stehen lassen. Wir waren uns einig, dass wir unsere Kindheit hier hinter uns lassen und zusammen in Stockholm neu anfangen mussten, auch wenn es ein furchtbares Gefühl war, das Haus, in dem wir aufgewachsenen waren, zu verkaufen. Aber Lina wies zu Recht darauf hin, dass wir immer wieder nach Örebro fahren und nach dem Haus sehen müssten, wenn wir es behielten. Und schon der Gedanke daran, das leere Haus zu betreten, fühlte sich an, als würde ich Schorf von einer Wunde kratzen.
Über Ann-Britts Kontakte fanden sich schon nach wenigen Wochen zwei Familien, die sich für das Haus interessierten und gegeneinander boten. Die nettere Familie gewann, und mit einer Mischung aus Erleichterung und Trauer unterschrieben Lina und ich den Kaufvertrag. Als wir zum letzten Mal die Tür hinter uns zuzogen und abschlossen, weinten wir beide, doch dann überwog die Erleichterung, dass wir hier zukünftig nicht mehr von unseren Erinnerungen überwältigt werden würden.
Noch nie war ein Geldsegen so wenig reizvoll gewesen wie jetzt. Doch Sally half mir, ihn in Aktien und Fonds anzulegen.
»Du bist jetzt eine ziemlich vermögende Person«, sagte sie erfreut. »Immerhin etwas, oder?«
Mein Major beim Militär hatte – obwohl er den Ruf hatte, selbst »nie ausruhen zu müssen und nie krank zu sein« – sehr verständnisvoll auf meine Situation reagiert und meinen Arbeitsbeginn auf den ersten September verschoben. Er hätte mir auch noch mehr Zeit gegeben, aber das wollte ich nicht. Es war Zeit, auch arbeitsmäßig neu anzufangen.
Lina hatte sich auf einige Kurse an der Uni Stockholm beworben und die Zulassung für einen Kurs in Ideengeschichte und einen in Literaturwissenschaft bekommen. Wie es ihr damit ging, so schnell mit dem Studium anfangen zu müssen, wusste ich nicht, doch sie hatte auch keinen Job, und nur rumhängen konnte sie ja schließlich nicht. An der Uni würde sie neue Freunde treffen und vielleicht nach und nach über all die schrecklichen Ereignisse hinwegkommen.
Ich hatte versucht, sie wieder zum Reiten zu motivieren, doch Lina hatte mich nur mit diesem durchdringenden Blick angesehen, der neuerdings zu ihrem Markenzeichen geworden war.
»Ich setze mich auf keinen Fall noch mal auf ein Pferd«, sagte sie. »Es wird nie wieder ein Pferd wie Salome geben.«
Inzwischen ging der Wahlkampf in die heiße Phase, ständig sah man Wahlbarometer, Politikerbefragungen und Debatten der Parteivorsitzenden im Fernsehen. Doch nie hatte mich Politik so wenig interessiert wie jetzt. Bis zu den Wahlen nächste Woche musste ich mich entscheiden, welche Partei ich wählen wollte.
Im schlimmsten Fall würde ich losen müssen.
Immer noch sah ich auf den Nytorget hinaus. Die Frau mit dem Bullterrier war verschwunden, kein Mensch war zu sehen. Beim Straßencafé auf der gegenüberliegenden Seite bewegte sich etwas, und ich schaute genau hin: Ratten. Zwei große Ratten rannten schnuppernd unter Tischen und Stühlen herum. Gut, dass Sally nicht hier war.
Die Uhr am Herd zeigte 3:45 Uhr. Die Albträume hörten einfach nicht auf, egal, ob BSV nun existierte oder nur ein Produkt meiner Fantasie war. Um halb sieben würde mein Wecker klingeln.
Ich seufzte, stellte das Glas in die Spüle und ging wieder schlafen.
»Willkommen im ›Humor-Kubus‹«, begrüßte mich Therese mit ausdrucksloser Miene, und ich schüttelte ihre schlaffe Hand.
Es war mein erster Arbeitstag in der Poststelle des Hauptquartiers des Schwedischen Militärs. Therese, ein hübsches Mädchen mit dunklem Haar und hellblauen Augen, führte mich im Erdgeschoss herum und stellte mich den Mitarbeitern vor, zeigte mir die Kantine und die Toiletten. Dann wurde ich an meinen Schreibtisch in der Poststelle gesetzt. Ich teilte das Büro mit Therese und zwei Kollegen und sollte dort den Postein- und -ausgang bearbeiten.
Nach den beiden sehr anspruchsvollen Jobs im PR-Büro Perfect Match und bei McKinsey fühlte es sich wie ein ziemlicher Abstieg an, mich nur mit dem Sortieren von Post zu befassen, Der Major hatte mich ja gewarnt, dass das passieren könnte. Ich selbst hatte ihn darum gebeten, eine Stelle beim Militär für mich zu finden, egal, auf welcher Ebene. Ich selbst hatte eine erheblich glamourösere und besser bezahlte Probezeit von sechs Monaten bei McKinsey abgelehnt.
Meine Erinnerungen an die Zeit dort im letzten Frühjahr schienen in eine Art Nebel eingehüllt zu sein.
War Johan wirklich ermordet worden?
In meiner Erinnerung war er der absolute Traummann. Wahrscheinlich würde ich nie mehr einen so anständigen, intelligenten, lieben und humorvollen Mann treffen.
Hatte ich mir die Details rund um seinen Tod ausgedacht, um die Trauer bewältigen zu können?
War er vielleicht eines natürlichen Todes gestorben, und ich weigerte mich nur, das zu akzeptieren?
Wurde ich allmählich verrückt?
Diese und andere Fragen gingen mir in meiner ersten Arbeitswoche ständig durch den Kopf, während ich Briefe öffnete, las, in grüne Mappen legte und dafür sorgte, dass sie in die richtige Abteilung im Haus gelangten. Abends beeilte ich mich, nach Hause zu kommen, aß etwas, wusch ab und ging schlafen. Und am nächsten Tag ging das Ganze von vorne los.
Gegen Ende der Woche blickte ich auf meine ersten Arbeitstage zurück. Die Arbeit war furchtbar langweilig. Und meine Kollegen rissen es nicht gerade mit ihrer lustigen Art raus. Alle drei waren irgendwie seltsam: Therese und zwei Männer. Alle in den Dreißigern und keiner schien den Kontakt zu mir oder zu den anderen zu suchen. In den ersten Tagen hatte ich nacheinander mit allen zu Mittag gegessen und versucht, ins Gespräch zu kommen. Doch das war gar nicht so einfach.
Therese hatte wie ich auch Wehrdienst geleistet, doch sie »mochte das Militärische nicht« und »war im Grunde eher Pazifistin«. Klas, ein großer, hagerer Typ im Anzug, war Betriebswirtschaftler, hatte jedoch »Schwierigkeiten gehabt, einen Job zu finden« und »solange den hier genommen«. Wir stellten fest, dass Klas wie ich eine Katze besaß, aber das war auch schon das einzig Positive, was es über ihn zu sagen gab. Sture, ein recht ansehnlicher Typ mit einem breiten Lächeln, das ich zunächst für freundlich hielt, fasste meinen Vorschlag, gemeinsam zu essen, als Einladung auf und machte mir ziemlich unanständige Angebote. Nach ein paar Tagen musste ich ihm über den Kopierer hinweg mit ein paar deutlichen Worten klarmachen, dass ich kein Interesse hatte und er es aufgeben konnte. Danach würdigte er mich keines Blickes mehr.
Wenn dies ein Anzeichen für den Zustand des schwedischen Militärs war, war die Lage ziemlich finster. Als ich am Donnerstagabend nach Hause kam, sah ich Papas Hefter nach Texten über das Militär durch. Seit dem Frühjahr war es das erste Mal, dass ich mich wieder dazu aufraffen konnte, in den Heftern zu lesen. Und was ich las, hob meine Stimmung nicht gerade.
Was ist bloß aus unserem Militär geworden?
Unsere Parteien im Reichstag werfen sich gegenseitig »Versäumnisse bei Investitionen für unsere Streitkräfte« vor. Ein wenig unbeholfen führen wir die »Wehrpflicht« ein und ziehen eine Handvoll Jugendliche zur Ausbildung ein.
Über die Ursachen dafür, dass wir uns in einer unter Sicherheitsaspekten prekären Lage in einer unruhigen Welt befinden, erfährt man nichts. […]
Im Jahr 2006 war die Operation ›Schweden abrüsten‹ abgeschlossen. Und zwar offenbar mit parteiübergreifendem Konsens. Was war passiert? Unser Militär bestand aus zwei voneinander unabhängigen Teilen. Anlagen und Material auf der einen Seite, eine allgemeine Wehrpflicht für die Personalversorgung auf der anderen.
In der Nachkriegszeit verfügte das Militär über genügend Ressourcen, um nach und nach rund 800 000 Mann zu bewaffnen. In nur einer einzigen Maßnahme wurden sowohl die Wehrpflicht als auch Hunderte feste Anlagen und Waffensysteme abgeschafft, mit einem Anschaffungswert von Hunderten Milliarden (!) Kronen.
Was blieb, war eine verkrüppelte Luftwaffe ohne einen Großteil ihrer Flottillen und Stützpunkte. […]
Es dauerte nicht lang, bis das militärische Hauptquartier alarmiert feststellte, dass Gotland, einst gut befestigt, ohne Verteidigung dastand.
Sämtliche Anlagen waren verschrottet oder verschleudert worden, genau wie im restlichen Land.
Allmählich begann eine Kehrtwende mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht. Das Problem ist nur, dass Anlagen, Material und Kompetenzen verschrottet, verschenkt und zu Spottpreisen verkauft worden waren.
Und das ohne eine nennenswerte politische Diskussion.
Da fragt man sich doch: Kann das noch einmal passieren? Welches Regelwerk legitimiert eine solch beispiellose Kapitalvernichtung und einen Doktrinwechsel, ohne das Oberhaupt, nämlich das schwedische Volk, zu fragen?
Wer seitens der Verantwortlichen hat genug Rückgrat, um seinen Anteil an diesem Übergriff zuzugeben:
»Ich war dabei, ich lag falsch«. Das ist keine Frage, es ist eine Aufforderung.
Arvid Eklund, Leserbrief in der Borås Tidning, 25.10.2017
Heute zeigt sich der damalige Oberbefehlshaber Owe Wiktorin kritisch: »Man hat die wichtigste Aufgabe des Militärs vergessen, nämlich die Verteidigung Schwedens.«
SVT, Reihe: Interne Dokumente, dokumentiert von Pär Fjällström, 08.04.2015.
So wurde aus den Schweden ein Volk ohne Verteidigung
Die Kriegstaktik der verbrannten Erde sieht vor, bei einem Rückzug ein vollkommen zerstörtes Land zu hinterlassen. Dem Feind soll so wenig bleiben wie möglich. In den Verteidigungsbeschlüssen von 2000 und insbesondere von 2004 wurde diese Taktik auf dem eigenen Territorium angewendet, und nach dem Rückzug ist fast nicht geblieben. Es war, als hätte man mit einem Mähdrescher gearbeitet: Ein Kommando nach dem anderen verschwand. […]
Trotz der Streitigkeiten im Reichstag waren sich die Regierung unter Göran Persson und die bürgerliche Opposition über die Fahrtrichtung einig. Auch das Hauptquartier hatte kein Interesse daran, dieses Fass aufzumachen. Warum das so ist, zeigt sich in »Die Illusionen des Friedens: Der Untergang und Fall des schwedischen Militärs 1988—2009« von Wilhelm Agrell (Atlantis Verlag).
Agrell ist als sachlicher Analytiker bekannt, dennoch fiel das Ergebnis seiner Untersuchung sehr kritisch aus ‒ wie hätte es auch anders sein können. Wenn Verteidigungsminister Sten Tolgfors davon spricht, dass ganz Schweden verteidigt werden muss, ist es, als würde er in Zungen reden. Hier und jetzt, zu Hause und in der Ferne.
In den Neunzigerjahren stand fest, dass die Tage der Angriffsarmee gezählt waren. Man benötigte eine neue Armee. Reformen wurden beschlossen, und eines Tages war die Verteidigung des Territoriums Geschichte, ohne dass ‒ wie Agrell betonte ‒ dies beabsichtigt gewesen wäre.
Da waren Pläne, die nicht aufgingen, es bestanden Verpflichtungen aus Bestellungen für Material, das nicht länger benötigt wurde, der Sparzwang der Politiker – all das führte zu einer regelrechten Militärfarce. Agrell beleuchtet auch die Triebkräfte hinter dem Prozess: die Priorisierung internationaler Einsätze und die Investition in eine netzwerkzentrierte Kriegsführung. […]
Der entscheidende Fehler, der zum Untergang des Militärs geführt hat, ist nach Agrell jedoch die Tatsache, dass ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat, dem die Vorstellung einer neuen, gesamteuropäischen Sicherheitsordnung zugrunde lag. Ein Time-out wurde zu einem Black-out. Wenn Schweden nicht bedroht wird, ist auch keine Verteidigung nötig – außer in Weitfortistan.
Nach dem russischen Georgienkrieg zerbrach die Idee des ewigen Friedens in tausend Scherben.
Claes Arvidsson, Leitartikel Svenska Dagbladet, 26.09.2010
Als sich 2011 russische Kampfjets in der Nähe des schwedischen Luftraums aufhielten (was zu Zeiten des Kalten Krieges ganz normal war, aber in den Neunzigerjahren aufgehört hatte) und immer neue Berichte über Sichtungen von fremden U-Booten an den Küsten aufkamen, ging der Oberbefehlshaber Sverker Göranson 2013 mit einer Aussage an die Öffentlichkeit, die das schwedische Volk zu Tode erschreckte – und die Politiker sehr wütend machte. Der Oberbefehlshaber antwortete auf die Frage, wie gut das schwedische Militär derzeit sei: »Wir können uns bei einem Angriff auf eine begrenzte Anzahl von Zielen verteidigen. Wir sprechen hier von einer Woche, die wir allein schaffen.«
Durfte er das sagen, oder war das eine geheime Information? Trotz einer Anklage hielt der Oberbefehlshaber an seiner Aussage fest.
Alyson J.K. Bailes, eine britische Diplomatin in mehreren skandinavischen Ländern, die auch Leiterin des Friedensforschungsinstituts Sipri in Stockholm gewesen war, sagte im Dokumentarfilm »Was ist mit den Streitkräften passiert?«:
»Schweden hat seine Streitkräfte in den letzten Jahren reduziert und besitzt jetzt fast die kleinste Armee in Skandinavien – obwohl das Land doppelt so groß ist wie die anderen. Ich glaube, das Volk wird sich sehr wundern, wenn es davon erfährt. Und ich denke, wenn externe Verteidigungsexperten näher hinsehen, könnten sie zu der Schlussfolgerung gelangen, dass Schweden über nicht genug Ressourcen verfügt, um sich zu verteidigen.« […]
Karlis Neretnieks, ehemaliger Rektor der Militärhochschule:
»Es gäbe einen Wettlauf um schwedisches Territorium, wenn sich in unserer Nähe eine Krise abspielen würde. Die Russen würden enorm profitieren, wenn sie Gotland ›leihen‹ dürften. Das kostet nichts, es geht schnell, und sie könnten sagen: ›Wir tun Euch nichts, Ihr bekommt Gotland in 2-3 Monaten zurück, wenn wir die baltischen Staaten dazu gebracht haben zu tun, was wir wollen.‹ Warum sollten die Russen dem widerstehen?«
Das verschwundene Militär, Ingrid Carlqvist, Gatestone Institute, 07.08.2015
Am Freitag machten wir schon um halb fünf Feierabend, und ich entschied spontan, in der Stadt ein wenig bummeln zu gehen. Dann würde ich mir zu Hause die Schlussdebatte der Parteivorsitzenden im Fernsehen ansehen – es war wohl meine letzte Chance, mir vor der Wahl am Sonntag eine Meinung zu bilden.
Irgendwie fühlte es sich merkwürdig an, in die Stadt zu gehen; seit Mamas Tod hatte ich außer zum Lebensmitteleinkauf keinen Fuß mehr in ein Geschäft gesetzt. Doch es war an der Zeit, für etwas mehr Normalität in meinem Leben zu sorgen, auch wenn ich mich dabei eigenartig und einsam fühlte.
Ich schrieb Lina eine SMS und fragte sie, ob wir uns treffen wollten. Keine Antwort.
Was machte man nach der Arbeit, wenn man in meinem Alter war und in Stockholm wohnte?
Während meiner Zeit bei McKinsey hatten wir so lang gearbeitet, dass ich danach kaum mehr als mein Fitnessprogramm – oft zusammen mit Johan – schaffte. Davor, in der Zeit mit Bella, waren die Wochenenden von Anfang an voll verplant – Pläne, die Bella oder Micke gemacht hatten und an die ich mich einfach dranhängte.
Aber was sollte ich jetzt tun, mit normalen Arbeitszeiten und ohne eine beste Freundin oder einen Freund, die das Planen für mich übernahmen?
Ins Nordiska Kompaniet zu gehen war immer eine Möglichkeit. Das Kaufhaus hatte bis 20 Uhr geöffnet, und viele Frauen schlenderten gerne durch die verschiedenen Etagen, auch wenn sie sich dort nicht viel leisten konnten.
Mit der Tasche über der Schulter ging ich den Lidingövägen entlang Richtung Stadtmitte und dann die Sturegatan hinunter zum Stureplan. Es war Anfang September, und im Humlegården-Park spielten Kinder im goldenen Licht der Nachmittagssonne. Einige Bäume färbten sich bereits rot oder gelb, andere waren immer noch grün und kräftig. Doch ich verband so viele Erinnerungen mit diesem Platz, dass ich mir nicht gestattete, stehen zu bleiben und den Anblick zu genießen. Stattdessen ging ich schneller in Richtung Stureplan und folgte dann der Birger Jarlsgatan bis zur Hamngatan.
Auch die Bäume im Berzelii-Park waren noch weitestgehend grün. Mit diesem Ort verband ich nicht so viele Erinnerungen, daher konnte ich wieder langsamer gehen. Ich ging die Hamngatan hinauf am Norrmalmstorg und Kungsträdgården vorbei zum Haupteingang des Kaufhauses NK.
Vor dem Eingang in das prachtvolle Gebäude blickte ich geradewegs in ein Gesicht aus der Vergangenheit: Nicolina, die Stylistin, die mich für meine Arbeit bei Perfect Match eingekleidet hatte und mit der ich im Frühjahr einen Kaffee auf dem Stureplan getrunken hatte. Damals war sie in ein Auto gesprungen, in dem der Mann mit dem silbernen Stock saß. Jedenfalls meinte ich ihn gesehen zu haben.
Unsere Blicke trafen sich.
»Hallo!«, sagte Nicolina freundlich und winkte, ohne jedoch langsamer zu werden.
Sie ging vorbei, und ich sah ihr nach. Modisch gekleidet wie immer, mit der gleichen großen Tasche über der Schulter, die ich noch von unserer ersten Begegnung im Sturehof kannte.
Eine zufällige Begegnung?
Warum nicht? An einem Freitagnachmittag waren doch alle in der Stadt.
Nicolina verschwand im Gewimmel, und ich setzte meinen Weg durch den Haupteingang des Kaufhauses fort.
Im NK war es sehr voll. Im Lichthof fand eine Modenschau statt, und an einem Stand in der Schmuckabteilung wurden »Herbstaccessoires« verkauft – was auch immer das bedeuten sollte. Ein Haufen aus rotem Laub als Hut? Goldgelbe Pfifferlinge um den Hals? Drei Fliegenpilze als Bikini, für den Herbsturlaub auf Mauritius? Ich lächelte und dachte daran, dass Sally diesen Begriff gemocht und meinen Scherz ausgiebig ausgeschlachtet hätte.
Sie fehlte mir, wir hatten uns lange nicht gesehen.
Die Modenschau war zu Ende, und die jungen, düster dreinblickenden Models verschwanden in Richtung Kosmetikabteilung. Ich ging ein paar Stufen die Treppe zum Café Entré hinauf, doch dann blieb ich plötzlich stehen.
Wohin sollte ich gehen?
Gab es etwas, das ich mir ansehen wollte?
In diesem Moment stand er plötzlich vor mir, ganz nah, und sah mir direkt in die Augen.
Tobias.
Der Mann, der sich als Therapeut ausgegeben und behauptet hatte, mich hypnotisieren zu können. Als ich ihn später bei einer Begegnung in der U-Bahn damit konfrontiert hatte, hatte er so getan, als hätte er mich noch nie gesehen.
Jetzt hatte er anscheinend die Strategie gewechselt.
»Sara«, raunte er mir zu. »Hör mir zu.«
Er stand so nah vor mir, dass ich seinen Atem spüren konnte. Ich wich zurück. Da packte er mich mit beiden Händen.
»Du musst mir zuhören«, sagte er und starrte mich mit seinen intensiven blauen Augen an. »Ich weiß, dass du sauer bist, aber vergiss das jetzt. Komm mit: Wir müssen uns unterhalten.«
Ich war derart überrumpelt, dass ich nicht widersprach. Tobias führte mich an den Taschenabteilungen und dem Bereich, der gerade umgebaut wurde, vorbei bis vor die Aufzüge. Hier war es nicht ganz so voll.
»Hör mir zu«, sagte er ganz nah an meinem Ohr. »Du schwebst in Lebensgefahr, und deine Schwester auch. Kannst du ihnen nicht einfach geben, was sie haben wollen?«
Ich wich zurück.
»Aber wer sind sie? Was wollen sie von mir? Ich verstehe das einfach nicht!«
Tobias sah mich ernst an.
»Ich habe dich immer gemocht. Denk doch mal nach! Sie wollen dich!«
Plötzlich umarmte er mich heftig und drückte mir dabei fast die Luft ab.
»Viel Glück, Sara«, sagte Tobias ganz nah an meinem Ohr und ging dann schnell davon.
Ich stand immer noch da und blickte ihm nach. Etwas an seinem Verhalten passte nicht ins Bild. War er high gewesen? Verrückt geworden? Der Unterschied zwischen unserer Begegnung in der U-Bahn, wo er eiskalt behauptete, mich nicht zu kennen, und diesem überspannten Geflüster und der Umarmung konnte nicht größer sein.
Oder war ich vielleicht diejenige, deren Kopf nicht richtig funktionierte?
Verrückt, verrückt, verrückt.
Die kleine protestierende Stimme in meinem Kopf widersprach vehement. »Du bist nicht verrückt«, sagte sie. »Was will Tobias? Versuche zu verstehen, was er sagt und was er meint!«
Es gelang mir nicht, meine Gedanken zu ordnen, nicht hier und nicht jetzt. Also atmete ich tief durch, schob den Henkel meiner Tasche auf der Schulter zurecht und ging zurück zum Lichthof.
Ein neuer Nagellack. Das wäre doch eine gute Idee, jetzt zum Herbstanfang, oder?
Fünf Minuten später stand ich an der Chanel-Theke und sah mir die Nagellacke an, als mir jemand auf die Schulter tippte. Nicht schon wieder, dachte ich und drehte mich um. Ich rechnete damit, Tobias zu sehen, doch ich irrte mich. Hinter mir standen zwei Wachleute des Kaufhauses, ein Mann und eine Frau.
»Ich muss Sie bitten, in Ihre Tasche sehen zu dürfen«, sagte die Frau.
»Warum?« Ich zog die Augenbrauen hoch. »Ich habe nichts gestohlen!«
»Das werden wir sehen.«
Ich gab ihr meine Tasche, und sie öffnete sie. Dann zog sie, zu meiner Verwunderung, eine kleine rosa Abendtasche mit einem Schnappverschluss in Form eines Totenkopfes daraus hervor.
»Die habe ich nicht eingesteckt!«, rief ich. »Ich habe diese Tasche noch nie gesehen!«
Die Wachleute sahen sich an.
»Wir bringen Sie in den Sicherheitsraum«, sagte der Fachmann.
Seine Kollegin nickte.
»Was soll das heißen?«, sagte ich. »Sie müssen mir glauben: Ich habe diese Tasche nicht gestohlen!«
»Sicherheitsraum«, sagte die Frau. »Oder der Festnahmenraum, wenn Ihnen das lieber ist.«
Festnahmenraum?
»Kommen Sie freiwillig mit? Dann können wir Sie nämlich loslassen«, sagte der Wachmann freundlich.
Ich gab nach. »Natürlich.«
Wir nahmen die Rolltreppe ins Untergeschoss, und ich ging von den Wachleuten flankiert durch den neuen Tunnel bis zu einer abgelegenen Tür, wo sie einen Zahlencode eintippten. Dahinter befanden sich mehrere Büroräume und ein Verhörraum mit einer Glaswand, auf deren beiden Seiten je ein Stuhl stand.
»Soll das ein Scherz sein?«, fragte ich.
»Setzen Sie sich«, sagte die Frau und deutete auf den einen Stuhl. »Wir werden sehen, ob Sie noch zu Scherzen aufgelegt sind, wenn wir die Aufnahmen der Überwachungskameras angesehen haben.«
Der Wachmann betrat einen kleinen Raum, in dem ein Mann vor einer ganzen Reihe Bildschirme saß. Sie sprachen leise miteinander, vermutlich darüber, welche Filme und Zeiten sie kontrollieren wollten. Währenddessen setzte sich seine Kollegin auf die andere Seite der Glaswand, ausgestattet mit einem Notizblock und einem Stift. Sie nahm meinen Namen und meine Daten auf und begann dann, mich zu verhören.
Warum war ich im Kaufhaus? Wollte ich etwas kaufen? Wie lange hatte ich mich dort aufgehalten?
»Hören Sie«, sagte ich. »Ich habe das Geschäft, in dem sie diese Taschen verkaufen, nicht einmal betreten, bin nur daran vorbeigegangen.«
Da ging mir plötzlich auf, was passiert war. Warum hatte ich das nicht sofort verstanden?
»Wie sind Sie eigentlich auf mich gekommen? Ich war ja in der Kosmetikabteilung, als Sie mich angesprochen haben.«
»Jemand hat uns einen Tipp gegeben«, sagte die Fachfrau. »Er meinte, er hätte gesehen, wie Sie etwas aus dem Taschenladen in Ihre Tasche gesteckt hätten. Doch er hatte es sehr eilig, deswegen konnten wir seinen Namen nicht aufnehmen.«
Tobias.
Das war natürlich nicht sein richtiger Name.
»Ein Mann kam zu mir und wollte mit mir reden. Das muss er gewesen sein. Wir gingen zu den Aufzügen hinüber. Er verhielt sich merkwürdig und umarmte mich. Dabei muss er mir die kleine Abendtasche untergeschoben haben, ohne dass ich es gemerkt habe.«
»Warum hätte er das tun sollen?«, fragte sie ruhig.
Das war natürlich eine gute Frage. Jedenfalls hier draußen, in der Wirklichkeit.
Ihr Kollege stand in der Tür.
»Auf den Überwachungsfilmen ist nichts«, sagte er. »Sie haben mit dem Mann gesprochen, der uns den Tipp gegeben hat, aber dann zog er Sie um die Ecke, wo wir keine Kameras haben.«
»Dann soll sich die Polizei darum kümmern«, sagte die Fachfrau in bestimmtem Ton. »So verfahren wir immer, wenn wir nichts auf den Aufnahmen haben, aber die aufgegriffene Person trotzdem Diebesgut in der Tasche hat.«
»Sie sind schon auf dem Weg«, sagte der Wachmann.
»Ich habe nichts gestohlen«, sagte ich müde.
Die Frau sah auf das Preisschild auf der kleinen rosa Tasche mit dem Totenkopf.
»Nicht schlecht«, sagte sie. »Dieses kleine süße Spielzeug kostet fast 20 000. Alles ab 1000 Kronen gilt als schwerer Diebstahl.«
Die Polizisten hatten mich aus dem Sicherheitsraum geholt und aus dem Kaufhaus geführt.
Hoffentlich treffen wir niemanden, den ich kenne, dachte ich.
Ob ich wohl einen guten Anwalt brauchte?
Ich erkannte, dass ich keine Ahnung hatte, welche Folgen das Ganze für mich haben könnte.
Jetzt saßen wir vor dem Kaufhaus in einem Polizeiwagen, einer der Polizisten hatte gerade einen Bericht geschrieben. Er riss einen Durchschlag ab und gab ihn mir.
»Das ist für Sie«, sagte er.
»Was passiert jetzt? Ich schwöre: Ich habe diese Tasche nicht gestohlen! Da war ein Mann, der sie mir in die Tasche gesteckt haben muss!«
»Das sagten Sie schon«, sagte der Polizist.
»Ich arbeite bei den Streitkräften«, sagte ich. »So etwas passt nicht zu mir.«
Der andere Polizist lachte – es war ein kurzes, glucksendes Lachen ‒, ohne etwas zu sagen.
»Werde ich meinen Job verlieren?« Ich spürte einen Kloß im Hals.
»Das glaube ich nicht«, sagte der erste Polizist.
Dann sah er mich an.
»Nur damit wir uns richtig verstehen: Normalerweise hätten wir Sie mit aufs Revier genommen und Sie wegen Diebstahls belangt. Beim ersten Mal gibt es dafür in der Regel eine Geldstrafe. Wie das Militär als Ihr Arbeitgeber sich verhalten wird, weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum, aber dieses Mal werden Sie nicht angezeigt. Eine klare Ansage, anscheinend von höchster Stelle. Es liegt jetzt eine ruhende Strafanzeige gegen Sie vor …«
Er klopfte auf sein Exemplar des Berichts.
»… und die steht fünf Jahre lang in Ihrer Akte. Ansonsten sind keine weiteren Folgen zu erwarten.«
Jetzt verstand ich gar nichts mehr. Doch seine Worte hallten in meinem Kopf nach: von höchster Stelle. Plötzlich sah ich wieder Katarina vor mir, die Oberärztin in der Pathologie in Örebro, als sie mir erklärte, warum ich Papas Obduktionsbericht nicht sehen durfte: »Auf Weisung von höchster Stelle.«
»Aber warum? Ich verstehe das nicht! Können Sie mir das erklären?«
Jetzt drehte sich der andere Polizist um und sah mich an.
»Was verstehen Sie nicht?«, sagte er irritiert. »Dass Sie ein unglaubliches, völlig sinnloses Scheißglück hatten? Ich weiß nicht, was für Kontakte Sie haben, aber wenn Sie ein Kanake aus Akalla wären, wäre es nicht so glimpflich abgelaufen. So viel kann ich Ihnen sagen.«
Er starrte mich wütend an und nickte in Richtung Straße.
»Und jetzt verschwinden Sie, bevor wir es uns anders überlegen.«
Ich öffnete die Autotür und tat, was er sagte.
Der Polizeiwagen fuhr mit quietschenden Reifen davon.
Da Lina nicht zu Hause war, verbrachte ich den Abend allein und versuchte, der Schlussdebatte der Parteiführer im Fernsehen zu folgen.
Ich verstand nicht ein Wort von dem, was sie sagten.
Nach dem Schrecken im Kaufhaus blieb ich das Wochenende über zu Hause und ließ es ruhig angehen. Am Sonntag verließ ich kurz das Haus, um wählen zu gehen, und nachdem ich eine Weile auf die verschiedenen Wahlzettel gestarrt hatte, ohne sie wirklich zu sehen, nahm ich aufs Geratewohl drei Zettel und steckte sie in den Wahlumschlag. Nicht besonders zufriedenstellend, aber wenigstens hatte ich meine bürgerliche Pflicht erfüllt. Lina weigerte sich, auch nur zum Wahllokal zu gehen; sie behauptete, ihre Stimme würde nichts ändern. Als ich anfing, die Wahlberichterstattung im Fernsehen zu verfolgen, ging sie demonstrativ in ihr Zimmer und schloss die Tür.
Auch ich hielt es nicht besonders lange vor dem Fernseher aus, aber als ich am nächsten Morgen aufstand und auf meinem Telefon Nachrichten las, sah ich, dass keiner der Blöcke eine Mehrheit erzielt hatte. Rot-Grün hatte 144 Mandate bekommen, die Allianz 143 und die Schwedendemokraten 62.
Auf dem Weg zur U-Bahn versuchte ich zu verstehen, was das bedeutete, doch das Ganze war schwer zu durchschauen.
An der Ecke Nytorgsgatan und Bondegatan saß eine Obdachlose, vor der ein Pappbecher stand. Ich hatte sie bereits ein paar Mal gesehen; dies schien ihr fester Platz zu sein. Sie war recht kräftig, und einmal, als sie auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig ging, sah ich, dass sie humpelte. Jetzt hielt ich vor ihr an, nahm einen Hunderter und ließ ihn in ihren Becher fallen. Sie sah nicht einmal auf, sondern murmelte nur ein paar unverständliche Worte. Doch ich konnte sehen, dass sie heftige Narben im Gesicht hatte, eine sah nach einer schweren Hasenscharten-OP aus. Ihre Oberlippe war immer noch ein wenig gespalten.
Obwohl meine Aufgaben nicht besonders herausfordernd waren, arbeitete ich in der kommenden Woche so hart, wie ich nur konnte.
Abends war ich so müde, dass ich auf direktem Weg nach Hause ginge, Essen in der Mikrowelle aufwärmte und mich mit einem klassischen Roman auf der Couch niederließ. Ich arbeitete mich durch Jane Austens beste Werke, die mich meiner Mutter näherbrachten – Austen war eine ihrer Lieblingsschriftstellerinnen gewesen. Danach ging ich auf die Geschwister Brontë und Charles Dickens los. Lina saß meist in ihrem Zimmer und sah fern, aber ich schaffte es nicht einmal, mit ihr zu reden. Mein Impuls, Sally anzurufen, hatte sich gelegt: Darum würde ich mich ein anderes Mal kümmern.
Das Wochenende verging in einem gleichmäßig ruhigen Tempo, aber am Montag – als ich den Job beinahe automatisch machte und tatsächlich mehrmals wegen der Kombination aus Langeweile, nächtlichen Albträumen und den Romanen, die ich verschlang, über dem Computer eingenickt war, nur um unter Thereses prüfendem Blick hochzuschrecken ‒ wurde ich zum Major gerufen.
»Setzen Sie sich«, sagte er.
Ich nahm ihm gegenüber am Schreibtisch Platz. Mein Herz pochte, ich hatte einen trockenen Mund; ich wollte diesen Job einfach nicht verlieren.
»Wenn es um die Sache bei NK letztes Wochenende geht, das kann ich erklären«, sagte ich.
Der Major sah mich freundlich an.
»NK?«, fragte er verwirrt, ohne mit dem Lächeln aufzuhören. »Davon weiß ich nichts. Was Sie in Ihrer Freizeit tun, geht mich nichts an, solange Sie Ihre Arbeit gut machen!«
Das galt aber vielleicht nicht für Diebstahl.
Offenbar hatte der Major noch keine Informationen über die Ereignisse in dem Kaufhaus erhalten.
»Ich habe gute Neuigkeiten«, sagte er. »Ich muss zugeben, ich bin etwas erstaunt, weil Sie von allen in Ihrer Abteilung als Letzte dazukamen. Auf der anderen Seite haben Sie konsequent gute Ergebnisse abgeliefert.«
Konsequent gute Ergebnisse? Alles, was ich getan hatte, war, die Post in grüne Umschläge zu stecken. Eine Achtjährige hätte meinen Job übernehmen können. Aber strategisch wäre es wahrscheinlich unklug gewesen, ihn in diesem Moment darauf hinzuweisen.
»Befehl von oben«, sagte der Major erfreut, »Sie werden versetzt. Und das nicht etwa auf der gleichen Ebene. Es geht für Sie in der Hierarchie ein ganzes Stück nach oben. Glückwunsch!«
Irgendwas ist faul, irgendwas ist faul, irgendwas ist faul.
»Aha«, sagte ich vorsichtig. »Was bedeutet das?«
»Das bedeutet«, der Major sah auf seine Notizen, »dass der Stabschef Sie oben in der achten Etage haben will, als seine Assistentin. Dort sitzen der Oberbefehlshaber und die anderen hohen Tiere. Sie werden dort ganz gut zu tun haben, denn Sie sollen zum einen als Sekretärin arbeiten, zum anderen an Strategiegesprächen teilnehmen. Man will ganz einfach Ihre Meinung hören, ohne dass Sie dabei zu viel Raum einnehmen. Außerdem sollen Sie sich die ganze Zeit bereithalten, auch administrativ zu arbeiten.«
Warum ich – why me?
»Als Assistentin des Stabschefs verwalten Sie seinen Terminkalender und dienen als Pförtner«, erklärte der Major weiter. »Ohne Sie bekommt man keinen Termin bei ihm. Sie koordinieren seine Besuche und treiben Unterlagen ein. Und ganz unter uns: Solange der Stabschef Sie mag, haben Sie Macht. Mag er Sie nicht, werden die Messer gewetzt. Keine Ahnung, wo Sie dann landen.«
Ich sollte die Motive hinter der Entscheidung des Stabschefs hinterfragen.
Ich sollte eine vollständige Erklärung vom Major verlangen.
Auf der anderen Seite wusste ich ja, wie das Militär funktionierte – nicht alle Entscheidungen waren rational, und es gab kein richtiges »Wer-zuletzt-kommt-geht-zuerst«-System, egal, was der Major versuchte anzudeuten.
Ich würde nicht mehr mit grünen Umschlägen arbeiten müssen.
»Das klingt ganz hervorragend«, sagte ich und lächelte zuckersüß. »Wie schön!«
In dieser Sekunde spürte ich zum ersten Mal seit Mamas Tod einen Funken echter Freude. Es war, als würde die Sonne am schwedischen Winterhimmel endlich – wenn auch nur für eine Sekunde – zwischen den Wolken hervorkommen, nach einer schier unendlichen Reihe trostloser, grauer, bleischwerer Tage.
Daher hielt ich mich mit meinen Fragen zurück, jedenfalls bis auf Weiteres.
Dann schloss sich die Lücke in den Wolken wieder, und alles wurde wieder grau.
Am Freitag der gleichen Woche, ein paar Stunden vor Feierabend, erhielt ich eine E-Mail vom Major.
»Der Stabschef hätte gerne, dass Sie heute Nachmittag mit zur After-Work-Party des Hauptquartiers im Tre Vapen gehen, damit er Sie den Leuten in seiner Abteilung vorstellen kann. Sind Sie bereit?«
Es war einer dieser Tage, an denen ich ungeschminkt zur Arbeit gegangen war, in verschlissener Jeans und einem ausgeleierten, fleckigen Pulli, mit ungewaschenem Haar. Während meiner Zeit bei Perfect Match war so etwas nie vorgekommen und auch nicht bei McKinsey. Doch nach dem Tief, durch das ich diesen Sommer gegangen war, gab es immer noch Momente, in denen ich noch nicht vollständig funktionieren wollte oder konnte und mir meine Umgebung daher völlig egal war. In meinem Verschlag in der Poststelle konnte ich vielleicht so aussehen. Aber in diesem Aufzug mit meinem zukünftigen Chef zum After Work im Verwaltungsgebäude zu gehen und der ganzen Abteilung vorgestellt zu werden, vielleicht den Oberbefehlshaber zu treffen, war undenkbar.
Ich betrat den großen Waschraum in der Nähe der Kantine und betrachtete mich im Spiegel. Ein kräftiges »Fuck you!« ging von meiner gesamten Erscheinung aus; ich sah mit anderen Worten genauso aus, wie ich mich fühlte.
Doch so konnte ich nicht zur After-Work-Party gehen. Wir hatten noch keinen Vertrag unterschrieben, meine Anstellung war noch nicht geklärt. Und ich wollte doch so gerne weg aus der Poststelle.
Was sollte ich tun?
»Ich hole Sie in einer halben Stunde ab«, hatte in der E-Mail des Majors gestanden.
Mit anderen Worten: keine Zeit, nach Hause zu rasen und sich umzuziehen.
Plötzlich kam jemand aus einer der Kabinen. Es war Therese.
Ich setzte alles auf eine Karte.
»Red alert, red alert.« Ich verwendete einen Code aus meinem Wehrdienst.
Sie sah mich ausdruckslos im Spiegel an.
»Was ist los, brauchst du einen Tampon?«, fragte sie, während sie sich die Hände wusch.
Ich atmete tief durch.
»Therese, ich könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen.«
Ich erklärte die Situation. Die ganze Zeit ruhte Thereses ausdrucksloser Blick auf mir, und beinahe hätte ich meine Erläuterungen unterbrochen, um zu prüfen, ob sie wirklich einen Puls hatte.
»Daher habe ich mich gefragt«, sagte ich vorsichtig, »ob du vielleicht Make-up dabeihast?«
Therese begutachtete mich von oben bis unten, ohne die Frage zu beantworten.
»Kleidergröße 38?«
Ich nickte.
»Ich auch«, sagte Therese.
Ohne weitere Worte zog sie ihren Blazer aus. Erst jetzt bemerkte ich, was sie trug: einen klassischen Blazer, wahrscheinlich von Ralph Lauren oder so, eine frische hellblaue Bluse darunter sowie einen braunen Bleistiftrock. Dazu ein Paar dunkelbraune Lederstiefel.
Ein dezentes Outfit, in dem sie sehr hübsch aussah.
»Los jetzt«, sagte sie tonlos. »Du hast wahrscheinlich nicht viel Zeit, oder?«
»Was, wir sollen die Kleider tauschen?«
Wieder dieser ausdruckslose Blick.
»Tut mir leid, aber ich denke, andernfalls solltest du lieber gar nicht zum After Work gehen. Du siehst in dem, was du da anhast, total schäbig aus.«
Ich zögerte nicht länger, sondern schälte mich stattdessen aus meinen Sachen, bis ich in BH und Slip dastand. Therese tat es mir nach, und wir tauschten unsere Kleider. Meine Gedanken schweiften zum Waschraum in unserem Quartier ab, in dem zwanzig Personen – fünf Frauen und fünfzehn Männer – innerhalb von acht Minuten duschen, die volle Montur anziehen und sich zum Appell im Hof aufstellen mussten. In so einer Situation war kein Platz für Schüchternheit: Manchmal musste man sich vor den Augen der Männer ausziehen und duschen.
Das härtete ab.
Offenbar hatte Therese in etwa die gleichen Erfahrungen gemacht. Jetzt schlüpfte sie in meine Jeans und den ausgeleierten Pulli und kramte dann in ihrer Handtasche.
»Kajal, Mascara und Lidschatten«, zählte sie auf und legte die Schminkutensilien in einer Reihe auf den Rand des Waschbeckens. »Und einen rosa Labello. Bitte schön, bedien dich!«
»Therese, du bist unglaublich!«
»Du kannst ja mal an mich denken, wenn du in die höheren Sphären aufgestiegen bist«, antwortete sie trocken. »Wenn ich mich bis dahin noch nicht davongemacht habe.«
»Worauf du dich verlassen kannst. Das vergesse ich dir nie!«
Ich schminkte mich schnell, und das Ergebnis war ganz okay: In Thereses klassischen Klamotten konnte ich mich sehen lassen. Therese dagegen sah in meinen Sachen noch ungepflegter aus, als ich sie je gesehen hatte.
Plötzlich war Klas’ eindringliche Stimme vor der Tür zu vernehmen.
»Sara, bist du da drin? Du hast Besuch!«
Therese und ich nahmen unsere Sachen und gingen hinaus. Klas, der mir den ganzen Tag gegenübergesessen hatte und genau wusste, wie ich gekleidet gewesen war, brachte kein Wort hervor. Er starrte uns beide wortlos von oben bis unten an.
»Bitte frag nicht«, bat ich ihn.
Klas hob die Augenbrauen.
»Dann versuche ich mich zu beherrschen.«
Am Empfang stand der Major und wartete.
»Sie sehen gut aus«, begrüßte er mich und lächelte. »Perfekt!«
Ich antwortete nicht, erwiderte aber sein Lächeln und folgte ihm aus dem Gebäude.
Therese, meine neue Heldin, hatte die Situation gerettet.
Die After-Work-Veranstaltung fand im Restaurant Tre Vapen statt, in den Räumen des Hauptquartiers auf der Banérgatan, wo die gesamte militärische Verwaltung untergebracht war. Als der Major und ich dort ankamen, waren schon etwa fünfzig Personen versammelt. Ich erkannte einige von ihnen, auch wenn ich mir ihre Titel noch nicht hatte einprägen können: einige ältere Herren aus der Verwaltung, einige Kolleginnen und Kollegen aus dem Joint Operations Center und ein paar, die oben beim Oberbefehlshaber in der achten Etage saßen. Die Decke war hier im Restaurant so niedrig, dass die Leute sich beinahe zu ducken schienen. Auf einem Tisch standen Wein, Bier und irgendeine Bowle, dazu gab es Snacks wie Chips und Salzstangen. Der Stabschef – in Uniform – sah aus, als habe er blendende Laune, während er sich mit einem blonden, stark sonnengebräunten Mann unterhielt. Neben ihnen stand eine gut aussehende dunkelhaarige, etwa sechzigjährige Frau.
Den Stabschef erkannte ich sofort als »Christer« wieder, den ich sowohl bei der Party mit Bella als auch von der Feier bei McKinsey getroffen hatte. Aber ich tat, als sei nichts gewesen. Es konnte Zufall sein, dass wir uns in den gleichen Kreisen bewegt hatten. Es war an ihm, sich zu erkennen zu geben, wenn er das wollte.
Der Major dirigierte mich direkt zu ihm.
»Christer, das ist Sara«, sagte er.
Wir schüttelten einander die Hände, und der Sonnengebräunte wandte sich ab in Richtung Getränketisch.
»Freut mich!«, sagte der Stabschef mit einem herzlichen Lächeln. »Willkommen, Sara! Wir freuen uns sehr, Sie bald bei uns auf der achten Etage begrüßen zu dürfen.«
»Danke«, sagte ich. »Es wird sicher sehr spannend.«
Irrte ich mich, oder sah ich in seinen Augen ein ganz kurzes Funkeln, das da nicht sein sollte? Ein winziges Aufblitzen anderer Absichten als der, die er schon offenbart hatte?
Du bist paranoid, schalt ich mich selbst. Hör auf.
Gleichzeitig wusste ich, dass ich alle etwaigen Warnzeichen in den Wind schlug, weil ich diesen Job so verzweifelt haben wollte. Die Alarmglocken läuteten Sturm, doch ich brachte sie mit Watte zum Schweigen.
»Das ist meine Frau Anna«, sagte der Stabschef und wandte sich der Dunkelhaarigen zu. »Anna, das ist Sara. Sie ist die Tochter von Lennart. Erinnerst du dich? Wir haben ihn vor ein paar Jahren in Paris getroffen.«
Paris?
Anna sah leicht überheblich auf mich herab und lächelte.
»Natürlich, ich erinnere mich.«
»Ich habe Ihren Vater über die Jahre mehrmals getroffen«, sagte der Stabschef, nun wieder an mich gerichtet. »Ein sehr begabter Mann. Er spricht immer so herzlich von Ihnen und ist vollkommen überzeugt, dass Sie eine Zukunft beim Militär haben werden.«
Warum sprach er in der Gegenwartsform?
»Ich weiß«, sagte ich, »davon hat er immer geträumt.«
»Und jetzt kann er wahr werden. Dafür werden wir sorgen, nicht wahr?«
»Auf jeden Fall«, sagte ich.
»Könnten wir hier noch etwas Wein bekommen?«, fragte Anna und schwenkte ihr leeres Weinglas in der Luft. »Oder fehlt es euch etwa auch an diesen Ressourcen?«
Ein paar Sekunden lang war es ganz still, dann reagierte der Major.
»Ich kümmere mich darum«, sagte er, nahm ihr Glas und eilte zum Getränketisch.
»Wie geht es Lennart?«, fragte der Stabschef mich ungerührt. »Immer noch so neugierig und eigensinnig?«
Er wandte sich an seine Frau, immer noch mit einem breiten Lächeln.
»Dieser Mann versteht wirklich, was das Wort ›Feuerrache‹ bedeutet«, sagte er. »Ich habe selten jemanden getroffen, der so sehr bereit war, für seine Überzeugungen einzustehen, und sich gleichzeitig so unerschrocken gezeigt hat.«
Wieder wurde es still. Anna sagte nichts, sondern lächelte nur und starrte vor sich hin.
»Mein Vater ist tot«, sagte ich. »Er starb vor gut einem Jahr bei einem Unglück in unserem Sommerhaus.«
Der Stabschef sah mich an.
»Das tut mir wirklich leid zu hören. Mein Beileid.«
In diesem Moment sah ich wieder das Funkeln in seinen Augen, und die Gewissheit raubte mir fast den Atem.
Du wusstest es, dachte ich. Du hast es die ganze Zeit gewusst.
Der Major kehrte mit einem gefüllten Weinglas zurück, das er Anna reichte.
»Sie sind ein Engel«, sagte sie und nahm einen tiefen Schluck. »Da könnte man fast den Glauben an das Militär zurückgewinnen.«
»Kommen Sie«, sagte der Stabschef und ergriff meinen Arm. »Ich stelle Ihnen ein paar Ihrer zukünftigen Kollegen vor. Dort drüben steht der Oberbefehlshaber. Möchten Sie ihn kennenlernen?«
»Ja, gern«, sagte ich.
»Entschuldigt ihr uns?«, wandte er sich an seine Frau und den Major.
Sie sah ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an.
»Was würdest du tun, wenn ich Nein sagen würde?«, fragte sie.
Der Stabschef antwortete nicht und führte mich zu einer Gruppe Menschen, in der ich wieder ein paar erkannte, aber nicht einordnen konnte. Ich dachte, ich hätte den Mann auf einem von Andreas’ Bildern im Frühjahr gesehen, doch ich war mir nicht sicher. Ihm gegenüber, ein wenig abseits, stand Georg, der dunkelhaarige Anwalt, und unterhielt sich mit einem Mann in Uniform. Er nickte mir zu und lächelte. Neben ihm stand Olov, einer der Männer bei McKinsey, die an den Ereignissen um Ola beteiligt gewesen und mich für meine Zivilcourage gelobt hatten.
Ein Stück weiter weg entdeckte ich den Stock mit dem silbernen Griff, der an die Wand gelehnt war.
Ich sah mich um. War der Weißhaarige hier? Jetzt würde ich erfahren, wer er war.
Ich konnte nirgends einen älteren Herrn mit weißem Haar entdecken.
Plötzlich stand Georg neben mir.
»Ich soll dich von Berit grüßen«, sagte er leise. »Sie ist zurück.«
Berit? Ich bekam kein Wort heraus.
»Warum hast du dich nicht gemeldet?«, fragte er weiter. »Hast du den Film bekommen?«
»Welchen Film?«
»Ach, egal«, sagte er. »Hauptsache, du bist jetzt hier. Wir haben viel Arbeit vor uns.«
Ich starrte ihn an.
»Was meinst du mit ›wir‹? Ich glaube, du verstehst nicht ganz, wie wenig ich weiß!«
Georg sah sich um.
»Da du im Hauptquartier sitzt, bist du dem inneren Kreis ganz nah«, sagte er. »Da läuft etwas, und zwar weit mehr als das, was wir schon wissen. Und du wirst an ganz zentraler Stelle agieren.«
Er sah mir in die Augen.
»Der Widerstand braucht dich, Sara!«
»Sara«, sprach mich der Stabschef plötzlich an, »kommen Sie und lernen Sie den militärischen Assistenten und die politischen Berater des Oberbefehlshabers aus dem Außenministerium kennen. Sie sitzen wie wir im achten Stock.«
Ich riss mich zusammen und lächelte Georg freundlich an.
»Natürlich«, sagte ich zu ihm, »du meldest dich also? Lass es dieses Mal nicht so lange dauern!«
Er nickte kurz und machte auf dem Absatz kehrt. Ich folgte dem Stabschef in die andere Richtung.
Papiere, Papiere und noch mehr Papiere.
Dokumente über Dokumente.
Ich muss die ganze Zeit an die kleinen Wichtel in der Weihnachtsausgabe von Donald Duck denken, diese Myriaden von Wichteln, die ganz umtriebig arbeiten, um alle Spielsachen für die Kinder zusammenzubauen und sie dann in den Sack des Weihnachtsmanns zu befördern. Lässt man diesen Film rückwärtslaufen, bekommt man schnell einen Überblick darüber, wie die Demontage des schwedischen Militärs vonstattengegangen ist. Stück für Stück. Stein für Stein. Baustein für Baustein, in etwa so, als würde man abends die Lego-Kreationen der Kinder wieder auseinandernehmen und in die Schublade legen.
Systematisch, um eine fast schon manische Ordnung zu schaffen.
Besser gesagt Unordnung.
Wer sagt, dass wir eine starke Armee brauchen?
Ich sage das, obwohl ich im Grund meines Herzens Pazifist bin.
Aber ich habe den russischen Bären und den amerikanischen Adler von Nahem gesehen, und ich weiß, dass keiner von beiden zum Spielen aufgelegt ist.
Besiegen werden wir sie nie. Aber vielleicht können wir es so teuer wie möglich machen, wenn sie uns angreifen, statt uns in Ruhe zu lassen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in anderer Hinsicht.
Wie also konnte es zu dieser Demontage kommen?
Man hatte sie von langer Hand geplant.
Ich habe so viele Papiere und Dokumente und so viel geheimes Material, dass ich das ganze Haus damit tapezieren könnte. Trotzdem lässt sich das Ganze auf eine einzige Sache reduzieren.
Einer oder einige haben unser Militär freiwillig auseinandergenommen, während das schwedische Volk vor dem Fernseher gesessen und geschlafen hat.
Diese Personen haben nicht auf eigene Initiative gehandelt.
Sie hatten starke, sorgfältige Auftraggeber.
Der Auftrag, unser Land zu verkaufen, war schwer durchzuführen, doch gleichzeitig so viel einfacher, als man sich hätte vorstellen können.
Ich besitze alle Unterlagen, die es braucht, um exakt nachzuweisen, wie und auf wessen Veranlassung es passiert ist.
Doch das letzte Puzzleteil, der letzte Baustein, fehlt mir noch. Wohin soll all das führen, und wie hängen die Teile zusammen? Ich weiß, dass es um sehr viel Geld geht. Um enormes menschliches Leid und zunehmende Instabilität in der Region. Und keiner weiß, wie man es aufhalten kann.
Kann mir jemand helfen, jemand, der klarer sieht und das versteht? Jemand, der vielleicht sogar versuchen könnte, all das Entsetzliche aufzuhalten?
Wach auf, schwedisches Volk!
Der Adler und der Bär sind da.
Habt ihr Lust, mit ihnen spielen?
Das ganze Wochenende dachte ich über das nach, was passiert war, während ich die hellblaue Bluse von Hand wusch, trocknete und bügelte und Blazer und Rock ausbürstete und zum Lüften auf den Balkon hängte. Der Major und ich hatten die After-Work-Party gemeinsam verlassen und uns auf der Straße voneinander verabschiedet. Er hatte mich leicht verlegen angesehen.
»Ich muss mich für Christers Frau Anna entschuldigen«, sagte er. »Sie wird leicht reizbar, wenn sie trinkt.«
»Sie hat wenigstens den Alkohol als Ausrede«, erwiderte ich. »Das kann man leider nicht von allen behaupten.«
Der Major lachte.
»Berufskrankheit«, sagte er. »Die Leute können sich nur schwer entspannen, wenn Außenstehende wie die vom Außenministerium dabei sind. Man ist ständig auf der Hut. Bei den Dinnerpartys für die Offiziere ist das anders.«
»Ich verstehe.«
Jetzt stand ich auf dem Balkon und grübelte, während ich Thereses Klamotten aufhängte. Ihre Großzügigkeit im Waschraum hatte ich immer noch nicht ganz verdaut. Es wäre viel einfacher für sie gewesen zu sagen: »Tut mir leid, ich habe kein Make-up dabei«, und die ganze Sache zu vergessen. Dass sie bereit war, ihre Klamotten mit mir zu tauschen – ein ziemlich intimer Moment, den sich viele Frauen kaum mit ihrer besten Freundin vorstellen können, geschweige denn mit einer Fremden –, und mir ihre Schminksachen geliehen hatte, zeugte von echten Freundinnenqualitäten. Wenn es etwas gab, was ich für Therese tun könnte, würde ich keine Sekunde zögern.
Natürlich konnte es auch bedeuten, dass Therese mit dem Widerstand in Verbindung stand. Was hatte Georg mit seinem kryptischen Kommentar zu einem Film, Berits Rückkehr und an ganz zentraler Stelle agieren gemeint? Er schien mich für erheblich besser informiert zu halten, als ich tatsächlich war.
Während ich darüber nachdachte, raschelte es auf dem Balkon nebenan, und eine unserer Nachbarinnen machte sich mit einer Packung Zigaretten und einem Aschenbecher bemerkbar. Ich wusste, dass in der Nachbarwohnung ein lesbisches Paar wohnte, wir waren einander bereits mehrmals im Treppenhaus begegnet, hatten uns aber noch nie vorgestellt. Jetzt trafen sich unsere Blicke, und sie trat ans Balkongeländer und streckte die Hand aus.
»Hallo, Nachbarin«, sagte sie. »Ich heiße Aysha, und die Frau da drinnen, das ist meine Freundin Jossan.«
»Sara«, stellte ich mich vor und schüttelte ihre Hand. »Ich wohne hier mit meiner kleinen Schwester Lina.«
»Willkommen im Haus«, sagte die dunkel gelockte Frau mit den hellgrünen Augen.
Die Balkone lagen so nah beieinander, dass wir hätten hinüberklettern können. Stattdessen zündete sich Aysha eine Zigarette an und reichte mir die Packung.
»Magst du eine?«, fragte sie.
»Nein danke, ich rauche nicht.«
»Gut für dich. Schlechte Angewohnheit.«
Ich lachte.
»Ich war bei der Armee. Da brauchte man eine gute Kondition.«
»Oje«, sagte Aysha, »ich bin Pazifistin.«
Sie sah mich an.
»Du siehst gar nicht so militärisch aus. Ich kenne da ein paar Lesben vom Nytorget, die viel gewalttätiger aussehen als du.«
Ich lächelte ein bisschen. Mir gefiel ihre Art, geradeheraus, ohne dabei aggressiv zu sein.
»Ich bin an der Oberfläche nett und freundlich, darunter verstecke ich meine brutale Seite«, sagte ich.
Aysha nickte nachdenklich.
»Genau wie meine Freundin«, sagte sie. »Das sind die Schlimmsten. Das fühlt sich jedes Mal an, als würde man gegen eine Wand laufen.«
Eine Weile standen wir nur da und sahen in den Innenhof des Hauses hinunter.
»Seit wann wohnt ihr hier?« wollte ich wissen.
»Seit zwei Jahren. Die Eigentümergemeinschaft ist ganz okay, nicht annähernd so schlimm wie in anderen Stadtteilen. Ein paar Freunde aus Gärdet haben mir Schauergeschichten erzählt, bei denen an den Müllschluckern Schilder hingen: Es ist nicht gestattet, Tretroller oder Bügeleisen in den Müllschlucker zu werfen! Das gilt auch für Tretautos, Bootsmotoren oder ausgediente Haushaltsgeräte! Zuwiderhandlungen werden geahndet!!!«
Ich lachte.
»Es gibt genug verrückte Menschen, die Hauspolizei spielen, nicht nur in Eigentümergemeinschaften.«
Aysha runzelte wieder die Stirn.
»Was bedeutet ›geahndet‹? Das habe ich mich immer schon gefragt.«
Ich zog mein Telefon hervor.
»Wir googeln«, schlug ich vor. »Ich glaube, es heißt so etwas wie ›bestrafen‹.«
»Ich kenne nur ›ahnen‹«, Aysha blies eine Rauchwolke aus, »aber das hat damit wohl nichts zu tun.«
»Hier. Ahnden: strafen, gegen jemanden vorgehen.«
»Alles klar«, sagte Aysha. »Ich gelobe, gegen jedes Bügeleisen und jeden Bootsmotor vorzugehen, der durch unseren Müllschlucker poltert. Vielleicht nehme ich die Sachen sogar mit nach Hause und schaue, ob ich sie reparieren kann, und dann kommen sie an unsere kleine Nussschale draußen beim Sommerhäuschen. Ich bastle gerne.«
»Das mit dem Bootsmotor verstehe ich ja, an der Nussschale«, sagte ich. »Aber das Bügeleisen?«
»Als Anker«, klärte Aysha mich auf.
Ich nickte bedächtig. Wir sahen einander an.
»Komm doch bei Gelegenheit mal auf ein Bier rüber«, lud Aysha mich ein. »Mit deiner Schwester zusammen.«
»Sehr gern.«
Als ich hineinging, fühlte ich mich wieder etwas besser, ungefähr so hatte ich mich auch gefühlt, als der Major mir von meinem neuen Job erzählt hatte. Ein Sonnenstrahl zwischen ansonsten bleischweren Wolken.