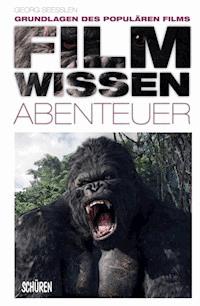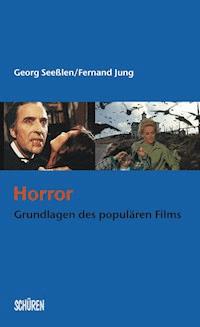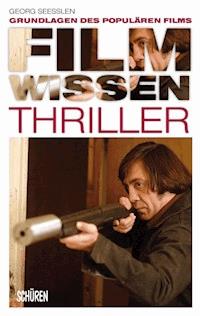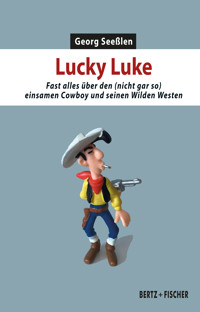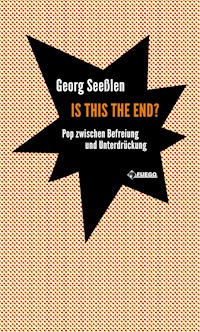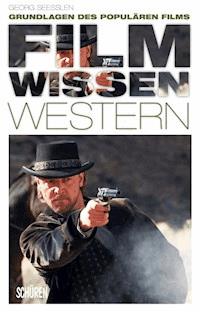
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schüren Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Filmwissen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
In den Grundlagen des populären Films analysiert der Kulturkritiker Georg Seeßlen detailreich und hintergründig die stilbildenden Elemente unterschiedlicher Filmgenres und verfolgt ihren Weg durch die Filmgeschichte. Ein enzyklopädisches Werk von hohem Rang, das präzise und informativ Filmwissen vermittelt ohne je oberflächlich zu sein. In Western verfolgen wir den Weg des einsamen Helden, der sich Feinden in mancherlei Gestalt gegenüber sieht, der Natur, den Fremden, den Frauen, den eigenen Träumen. Die Darstellung führt vom Helden der Stummfilmzeit Broncho Billy über die Klassiker von Howard Hawks und John Ford zu Clint Eastwood und lässt auch die Spaghetti-Western nicht aus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 604
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg Seeßlen
Filmwissen: Western
Grundlagen des populären Films
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Schüren Verlag GmbH Universitätsstr. 55 · D-35037 Marburg www.schueren-verlag.de © Schüren 2011 Umschlaggestaltung: Wolfgang Diemer, Köln unter Verwendung eines Fotos aus dem Film Todeszug nach Yuma (USA 2007, Regie: James Mangold; Sony Pictures) Druck: Druck: Bercker Graphischer Betrieb Kevelaer
Stichworte zum historischen Mythos des Westens
Die Kolonisation
Die Indianer
Das Land
Furcht und Träume
Der ewige Cowboy
Geschichte des Westernfilms
Der Western der Stummfilmzeit
Anfänge
David Wark Griffith und der Western
Der erste Cowboystar: Broncho Billy
Erinnerungen an den wirklichen Westen: William S. Hart
Der Glamour-Cowboy: Tom Mix
1915 bis 1925: Western in Serie
The Covered Wagon und die frühen Western-Epen
Neue Helden: Buck Jones, Tim McCoy, Hoot Gibson, Ken Maynard
Die dreißiger Jahre
Neue Anfänge: Filme von Victor Fleming, Raoul Walsh und anderen
Romantische und pessimistische Gemälde: Tonfilm-epics
1939: Das große Jahr des Western
Die vierziger Jahre
Historische und epische Western
Western zwischen Psychologie und Politik
Hawks und Ford
Die Rückkehr der Cowboys: Serien-Western 1930 bis 1955
Neue Western-Stars
Hopalong Cassidy
Die singenden Cowboys
Western-Serials
Die fünfziger Jahre
Adult Western: Neue Themen
Indianer-Western
Anthony Mann und Budd Boetticher
John Ford
1960 bis 1980: Tode und Wiedergeburten des Genres
Die Professionals
Rassenprobleme im Western
Der Italo-Western
1980 bis 1995: Western und Post-Western
Das Heaven’s-Gate-Fiasko
Der Western verschwindet
Rauchende Colts im Bildschirm-Format: Western im Fernsehen
Parodies & Oddities: Westernkomödien und Horrorwestern
Die Rückkehr des verschwundenen Amerikaners: Neue Indianerfilme
Black Western
Die weniger glückliche Rückkehr der Spaghetti-Westerner
Clint Eastwoods Gespenster-Western
Western und Post-Western
Tombstone Revisited
Go west, young woman
2001 – 2011: Open Ranges
John Ford Point
The New World
Remakes & Revisionen
Some Good, Some Bad, Some Old Some Young
Western Neo Noir
Neo-Western: Western nach dem Westen, Western der Gegenwart
Trauma und Triumph: Der Bürgerkrieg
Heftige Fortsetzungen in drei Kontinenten
TV-Western: Neo-Epen und tote Wälder
Mystery Western und Horrortrips
Bibliografie
Stichworte zum historischen Mythos des Westens
Die Kolonisation
Amerika – das ist auch die lange Geschichte vom Exodus vieler Menschen aus ihren eng und feindlich gewordenen Heimatländern. Die gemeinsamen Erfahrungen der Kolonisatoren waren die wirtschaftlichen Veränderungen, die in Europa neue Zwänge für den Einzelnen hervorbrachten und eine radikale Veränderung von Lebensrhythmus und Alltagsleben bewirkten: die Umwandlung der Gesellschaften von agrarischen und feudalherrschaftlichen Strukturen zu immer mehr merkantilen, später frühkapitalistischen Herrschaftsformen. War dieser Prozess im Ganzen gesehen langwierig und vollzogen sich die großen Übergänge fast unmerklich, so gestaltete sich die Entwicklung für den Einzelnen in nichts anderem als in Schicksalsschlägen. So ist verständlich, dass höchstens im Fall religiös verfolgter Gruppen der Auswanderung so etwas wie eine politische Bewegung vorausging, ansonsten aber, wer sich in Amerika eine neue Heimat suchte, dies als ganz persönliches Schicksal erfuhr. Von daher wird ein wenig deutlich, warum der Individualismus in der Idee von Amerika eine so zentrale Bedeutung hat. An seinem Anfang stand ein Verlust, sowohl der materiellen Existenzmöglichkeiten als auch der kulturellen Identität.
Dieser gesamte, lange und zähe historische Vorgang begann schon drei Jahrhunderte vor der Fahrt des Kolumbus, als die Handelsstädte entstanden und deren Machtzuwachs zu politischen Konflikten führte, und fand sein Ende eigentlich erst im Ersten Weltkrieg. Dieser Prozess schuf notwendig den Aussiedler und Pionier, der seine Heimat verloren und nichts mehr zu gewinnen hatte. Er wurde dabei, je nach Intention und Herkunft, entweder zum legalisierten Eroberer, der im Dienste seiner Heimatnation handelte, zum Kolonisator oder zum rebellischen Pionier, wie der «verlorene Sohn» Johann August Sutter, der für sich und die Seinen das grundsätzlich Neue verlangte.
Parallel zu dieser Fluchtstimmung gab die wirtschaftliche Entwicklung durch den Konflikt zwischen bürgerlicher Geld-Macht und feudaler Grundbesitz-Macht eine Motivation insbesondere für den Adel, in den Kolonien neuen Grund zu erwerben und dadurch seine Position zu stärken. Diese Motive bewogen unter anderem auch solch legendäre Personen wie Walter Raleigh, der Neufundland und zunächst auch Virginia besaß, Sir Ferdinando Gorges (Maine), Lord Baltimore (Maryland) oder den Herzog von York (New York).
Grundbesitz war für die bäuerlichen Auswanderer eine Hoffnung auf Freiheit und für den alten Adel eine Hoffnung darauf, im Kampf gegen das Bürgertum und seine Zins- und Buchhaltungskultur zu bestehen. «Landhunger» ist ein Wort aus den Geschichtsbüchern, dahinter verbirgt sich der Kampf ums Überleben, um eine Identität. Dieselbe Idee, nämlich neues Land zu nehmen, war zugleich Ausdruck einer konservativen und einer progressiven Strömung, diente gleichzeitig der Erhaltung alter Machtzusammenhänge und neuer individueller Möglichkeiten. Auf diesen Widerspruch hin lassen sich zahlreiche Mythen der amerikanischen Geschichte und eine Reihe der Herrschaftsformen zurückverfolgen, die sich in den 200 Jahren der Unabhängigkeit herausgebildet haben. Und viele Elemente des amerikanischen Denkens entstanden aus diesem unerschütterlichen Glauben an den Grundbesitz, der reiche und arme, alte und junge, fortschrittliche und reaktionäre Menschen gleichermaßen beherrschte. Der epische Western mit seinen Siedlerzügen und Stadtgründungen hat diesen konstanten Drang in verklärende Bilder übersetzt; zum Image eines jeden Cowboystars gehörte es, sich große Ranchgebiete von seinen Tantiemen erworben zu haben, als Erfüllung seines Auftrags sozusagen, für den ihn sein Publikum ausgewählt hatte. Schließlich lässt sich in der von uns Europäern stets diagnostizierten amerikanischen «Fetischisierung» von Geld und Erfolg eine Art der Verschiebung von «Triebzielen» sehen.
Was auf dem alten Kontinent noch als Widerspruch nebeneinander existierte, der Grundbesitz und die Handels- und Bankwirtschaft, das verband sich in den Kolonien und besonders in Amerika zu einer neuen politischen Kraft. Der Viehbaron des Westerns und seine Stadt sind ein Ausdruck hiervon. Auf der Grundlage von Grundbesitz wurde das neue Land durch Handelsgesellschaften beherrscht. «Zu dem von den ersten englischen Kolonisten nach Amerika verpflanzten Erbgut der wirtschaftlichen Ideen gehörten: der Hang zum Grundbesitz als Grundlage für Reichtum und Wohlergehen, das Prinzip des wirtschaftlichen Individualismus und die Praxis der kooperativen wirtschaftlichen Unternehmung. Diese Ideen sollten von Anbeginn an die Basis für die neu entstehende Kultur Amerikas bilden» (Max Savelle).
Im Verlaufe der wirtschaftlichen Umwandlungen kristallisierte sich in Europa der moderne Staat heraus, der gegründet wurde durch das Bündnis der Monarchen mit der neuen bürgerlichen Klasse. Dieses Bündnis bestimmte zunächst auch die Politik in den Kolonien; die Interessen des Kolonialstaates waren nahezu identisch mit den Interessen der Handelsgesellschaften. Andererseits hatten sich im Verlauf der politischen Geschichte Englands und insbesondere durch die «Glorreiche Revolution» von 1688/89 die Machtbefugnisse des Parlaments erweitert, und es war daher die Idee, dass auch die Vertretung des Volkes an der Regierung zu beteiligen sei, ein Teil des politischen Erbgutes der Pioniere.
Auch die religiöse Haltung der Menschen machte eine starke, anhaltende Wandlung durch; eine notwendige Befreiung aus Lethargie stand am Beginn der Landnahme. Im katholischen Weltbild gab es zu Gott keinen anderen Weg als über den Priester und die Kirche. Eine eigene, persönliche Beziehung zu seinem Gott zu haben, war der Ausgangspunkt der neuen christlichen Lehren, insbesondere von Martin Luther und Johann Calvin, die mit der wirtschaftlichen Entwicklung und der durch sie begründeten individualistischen Haltung an Einfluss gewannen. Der Protestantismus motivierte zur eigenständigen Leistung und zur persönlichen Erfahrung; vor allem der calvinistische Glaube, der Englands anglikanische Staatskirche in großem Maße beeinflusste, verwob wirtschaftliche und politische Macht mit Gottgefälligkeit. Die anglikanische Kirche selbst war in ihrem Wesen allzu eklektizistisch, als dass sie eine religiöse Einheit hätte bilden können. Sie beinhaltete ebenso katholische wie lutherische und calvinistische Formen und Vorstellungen. Hiergegen bildete sich schon bald nach der Loslösung der anglikanischen Kirche eine Opposition, die zum Teil außerhalb (Separatisten, Kongregationalisten), zum Teil innerhalb der Kirche (Puritaner) für einen «reinen Glauben» und die daraus abgeleitete Moral eintraten.
Neben den Indianern waren für die Engländer die hauptsächlichen Rivalen um das Land die Franzosen und die Holländer, die die Kolonisation etwa zur gleichen Zeit begannen, während Spanier und Portugiesen im Süden des Kontinents bereits seit einem Jahrhundert Kolonien besaßen. Warum es gerade die angelsächsischen Puritaner waren, die sich durchsetzten und zur führenden Kraft wurden, geht zum Teil sicher auch auf die religiöse Motivation der Aussiedler englischer Herkunft zurück, die weder am Erfolg noch am Recht der Landnahme den geringsten Zweifel aufkommen ließ.
So sehr die englischen Siedler, die sich schwarze Sklaven auf ihre Plantagen (etwa in Virginia) holten, den englischen Lebensstil und, soweit dies möglich war, den Stil der englischen Aristokratie nachahmten, so sehr mischten sich doch auch mehr und mehr eigenständig amerikanische Elemente in das Denken der Kolonialisten, und diese Elemente basierten zu einem nicht geringen Teil auf der Pionier-Mythologie, auf heroischen und legendären Vorstellungen, die sich durch die Indianerkämpfe und den Befreiungskrieg gebildet hatten. Auf dieser Grundlage entstand eine neue Aristokratie mit vorwiegend dynastischen Herrschaftsprinzipien.
Im Gegensatz zu den Landaristokraten von Virginia waren die Puritaner New Englands Vertreter des Mittelstandes, einer, wenn man so will, kleinbürgerlichen Bewegung, die ihre Unduldsamkeit und die Identität religiöser und politischer Verfassungen nur zögernd unter dem Druck neuer Einwanderergruppen aufgab. Diese bürgerliche Kultur brauchte den Fortschritt, technisch, moralisch, politisch. Der Nord-Süd-Konflikt, der sich Jahrzehnte später in einem blutigen Bürgerkrieg, dem ersten «modernen» Krieg der Weltgeschichte, entlud, war in diesem Spannungsfeld bereits vorgezeichnet. Der integrative Mythos der Landnahme, der selbst heterogene politische Ideen vereint hatte, musste seine verbindende Wirkung verlieren, nachdem die ihm zugrunde liegenden Systeme sich in «reiner» Form wieder voneinander geschieden hatten. Umgekehrt ergab sich aus dem realpolitischen Konflikt zwischen Nord und Süd, der mit einem seltsam ambivalenten Sieg des Nordens geendet hatte, die Notwendigkeit des neuen Mythos vom Westen, in dem zum zweiten Mal die Einigung der Nation in der Bewegung der Landnahme unternommen wurde. Das historische Erbe der Pioniere, der Grundwiderspruch, den sie aus ihrer Heimat nach Amerika brachten und der dort durch Revolutionen und Kriege gelöst wurde (oder auch nicht), hatte im Bürgerkrieg keine Auflösung, sondern nur den erschreckendsten Ausdruck gefunden. Erst im Westen konnte die Nation zu sich selbst finden. Darum ist auch nicht der Prä-Western oder Bürgerkriegsfilm, sondern der Western «der amerikanische Film par excellence».
Die Indianer
Die Indianer, wie sie waren oder sind, haben sicher nicht sehr viel damit zu tun, wie der Western sie zeigt. Sie haben vielleicht aber auch nicht viel mit dem Bild gemeinsam gehabt, das in den Köpfen der weißen Christen von ihnen entstand. Es standen sich zunächst nicht die «Existenz» der Indianer und die «Existenz» der Weißen gegenüber – hier hätte man sich (und hat man, wie das Leben der ersten Pioniere zeigt) durchaus arrangieren können. Vielmehr hat die «Existenz» der Indianer die «Mythologie» der Weißen gefährdet. Nicht ihre Vorstellungswelt, ihr materieller Anspruch oder gar eine (zunächst gar nicht vorhandene) Aggressionsbereitschaft flößten dem Siedler Furcht ein, sondern die bloße Existenz der Ureinwohner. Anders ausgedrückt: Weil und solange es den Indianer gab, war dem weißen Christen die Welt aus den Fugen geraten, hatte sein ganz auf die wörtliche Auslegung der Bibel ausgerichteter Glaube einen gefährlichen Riss, und es war durchaus nicht die Sophisterei einiger Spinner, die heftig darüber debattieren ließ, ob Indianer eine Seele haben oder nicht, sondern es handelte sich um einen Ausdruck allgemeiner Verunsicherung, die zunächst in vielfältigen traumatischen oder verklärenden Versuchen zur Sinnerstellung, später in manifester Brutalität mündete.
Weil die Indianer das Weltbild der Europäer verwirrten, mussten sie sterben, es fand sich in der Bibel keine Erklärung für ihr Vorhandensein. Sie waren nicht die Nachkommen Noahs, stammten nicht von den Stämmen Sem oder Japhet ab, nicht einmal von Ham, wie die Schwarzafrikaner; die Indianer traten gleichsam von außen an die überlieferte Schöpfungsgeschichte heran und stellten sie in Frage.
Immer wieder versuchte die «weiße Mythologie» den Indianer zu integrieren, mit wechselndem Erfolg. Die rationale Wissenschaft erklärte die Herkunft des Indianers aus Asien, auf dem Weg über eine nun zerstörte Landbrücke. Im Laufe ihrer Wanderungen nach Süden haben sie, den jeweiligen Naturbedingungen angepasst, die verschiedenartigen Kultur- und Gesellschaftsformen entwickelt, denen man nun gegenüberstand. Einige sahen die Indianer als Nachfahren eines pazifischen Volkes, als Erben von Atlantis. Und in manchen religiösen Mythologien – insbesondere die Mormonen dachten und denken noch heute so – wurden die Indianer zum auserwählten Volk des Alten Testaments, das seiner Mission untreu geworden ist. Leslie A. Fiedler erinnert in diesem Zusammenhang an den Rancher in (Cat Ballou (1965, Regie: Elliot Silverstein), der zutiefst erstaunt darüber ist, dass ein Indianer nicht auf seinen hebräischen Gruß «Shalom» reagiert.
Es gibt aber für diese Vorstellung ein viel früheres Beispiel noch aus der Zeit der Stummfilm-Western. In dem Ken Maynard-Film The Red Raiders aus dem Jahr 1926 regt sich ein Kavallerie-Sergeant furchtbar über einen jüdischen Rekruten auf, der beständig «mit den Händen» redet. Als dieser Indianer gewahr wird, die das Fort besuchen, in dem die Soldaten stationiert sind, und sich mittels Zeichensprache verständigen, stutzt er, betrachtet die Nasen der Indianer, fasst sich an seine eigene, hat dann die Erleuchtung und ruft: «Brudders!» Er nimmt zwei der Indianer beiseite und redet mit ihnen in Zeichensprache, wie er meint. Nach einiger Zeit hat er den ganzen Schmuck und die Kleider der Indianer für eine Handvoll Plunder eingetauscht. Enttäuscht wendet er sich an seinen Sergeanten und meint, dass es sich bei den Indianern doch nicht, wie er angenommen hatte, um die «verlorenen Stämme Israels» handelt, denn ein Jude hätte sich niemals so leicht übers Ohr hauen lassen.
Die Begegnung mit dem Indianer ist für den WASP (White Anglo-Saxon Protestant) die eigentliche mythologische Grundsituation, durch die er entweder zu einem neuen Menschen wird, der den Europäer in sich überwindet, oder an der er scheitern muss. «Der Western ist demnach in seiner archetypischen Form ein Werk der Literatur, in dem ein verpflanzter WASP in der Wildnis auf ein radikal fremdes Wesen, den Indianer, trifft. Das Ergebnis dieser Begegnung ist entweder die Verwandlung des WASP in einen Menschen, der weder Weißer noch Indianer ist (das geschieht manchmal durch Adoption, manchmal durch reine Nachahmung, niemals jedoch durch Rassenmischung) oder die Vernichtung des Indianers (er wird entweder bekehrt, in ein Ghetto geschickt oder bisweilen einfach ermordet). In beiden Fällen wird die Spannung dadurch gelöst, dass der eine der beiden mythologischen Partner ausgeschaltet wird, im ersten Beispiel auf eine rituelle oder symbolische Weise, im zweiten durch physische Gewalt. Die erstgenannte Methode lässt einen radikal anderen Western entstehen, einen Sekundärwestern, der die Abenteuer des Neuen Menschen, des amerikanischen tertium quid beschreibt. Die andere Methode – unsere eigene ‹Endlösung› – führt zur Auslöschung des Western» (Leslie A. Fiedler).
Viele Helden von Westernfilmen kämpfen im Grunde in diesem Konflikt, entweder eine neue, allerdings durch das Tabu der Rassenmischung zukunftslose Identität zu finden, oder durch vehemente Entscheidung für die eigene Seite den Indianer zum Feind zu erklären, im gleichen Moment aber auch die eigene Integrität zu verlieren. Dieser Konflikt taucht auch in zahlreichen Verkleidungen auf, und sogar in solchen Filmen des Genres, in denen gar keine Indianer vorkommen, ist die Struktur dieses Konflikts sichtbar und haben sich die Indianer in Assoziationsbezügen (Frau, Natur, Banditen etc.) «aufgehoben».
Der Hass auf den Indianer, zu dem der weiße Siedler letztlich in einem Verhältnis stand wie Kain zu Abel, kam zu einem guten Teil daher, dass der Weiße in Amerika den Garten Eden, das Paradies und somit seine eigene «Wiege», seine vormalige Heimat, wiedergefunden zu haben glaubte. Kolumbus selbst hielt den Orinoko für den Fluss Gihon, einen der vier in der Bibel beschriebenen Flüsse des Paradieses. Nun musste der Weiße zu seinem Schrecken feststellen, dass das Paradies keineswegs unbewohnt und leer war, sondern dass nackte Menschendort lebten, die offenbar im Gegensatz zu den Weißen nicht aus dem Paradies vertrieben worden waren. Von daher ist erklärlich, wie nahe Hass und Verklärung, Identifikation und Auslöschung beieinander lagen und wie nahe sie auch in den Mythen der Unterhaltung beieinander sind.
Da in Europa alles auf eine «verbietende» Gesellschaftsform hinauslief, der Geist sich verdunkelte zur Zeit der ersten Kontakte mit den Uramerikanern, wurde auf den Wilden alles projiziert, was man selber an Leidenschaft und Trieb verbieten musste. Tatsächlich aber musste dieser Wilde von den Weißen erst erfunden werden, denn der Indianer, den man vorfand, musste erst vom Weißen so deformiert werden, dass er in das Schema passte und damit die Legitimation zur Ausrottung gab. Dabei wurde gewaltsam ein historischer Entwicklungsprozess in die eine Richtung gelenkt, die der Vorstellung der Kolonisatoren entsprach. Aus der Vielfalt indianischer Kulturen und Nationen, die in einem steten Austauschprozess begriffen waren, im Mittelpunkt einer «eigenen» Geschichte, wurde das statische Wesen «Indianer», seiner Geschichte und Identität beraubt und zu einer Randerscheinung in der Geschichte der Weißen. (Selbst dort, wo er indianerfreundlich ist, hat der Western diese Haltung nie überwinden können.)
Der Mythos vom Indianer im Western hat nicht nur eine historische und eine religiöse, sondern auch eine erotische Komponente. Da ist zunächst der Mythos von der «guten Indianerin», die ihr Vorbild in der Geschichte von Pocahontas, der Tochter des Häuptlings, und dem Kapitän John Smith fand, mit dem sie zusammenlebt. Diese gute Indianerin erscheint dem weißen Westerner als Möglichkeit, seine Flucht vor der Zivilisation, und damit vor der weißen Frau, zu beenden. Die gute Indianerin will den Frieden zwischen den Weißen und den Indianern, und sie ist sogar bereit, ihr Volk an die Weißen zu verraten. Ihr Wert für den weißen Mann liegt in ihrer Sinnlichkeit und Unterwürfigkeit zugleich, zwei Wesensmerkmale, die in der Frau des puritanischen Kulturkreises nicht mehr zur Deckung gebracht werden konnten.
Im Mythos von der Indianerprinzessin Pocahontas, den die amerikanische Literatur immer wieder aufgegriffen hat, und die nun ihre letzte Verklärung als Zeichentrick-Schönheit im Disney-Film gefunden hat, liegt auch ein Teil der neuen «Schöpfungsgeschichte» Amerikas verborgen. Pocahontas ist die Mutter Amerikas, eine Erlöserin, wie sie von den Pionieren gesehen wurde: Hier hat eine Frau die Rolle Christi als Erlöserin eingenommen. So hat das Leben in der Wildnis für den Westerner immer zugleich einen heiligen und einen sündigen erotischen Aspekt. Im jedem Westerner, der in die Stadt kommt, aus den Bergen, aus den Wäldern, aus der Prärie, steckt ein Teil von dem weißen Mann, der mit einer Indianerin geschlafen hat und ganz heimisch bei den Seinen nicht mehr werden kann, und in jedem Jungen, der das puritanische Farmhaus verlässt, steckt die Sehnsucht nach der schönen Indianerprinzessesin.
Während der Mythos dem weißen Pionier die indianische Frau als Mutter und Erlöserin zur Seite stellt, auch als Verlockung zum anderen Leben, ist die weiße Frau, die unter die Indianer gerät, immer eine Märtyrerin. Das Urbild all dieser Erzählungen ist die Geschichte von Hannah Duston, die von Indianern als Kind entführt wurde und sich die Freiheit mit dem Tomahawk erkämpfte, ein Sinnbild für die Antisinnlichkeit und den Stolz der Siedlerfrau, vor deren fesselnder Kraft sich der Mann fürchten muss. Um ihre Abscheu vor den Indianern erklärlich zu machen, werden diese mit einigen mythologischen Attributen behaftet, die nun gerade ihnen die lebensfeindlichen Züge unterstellen und sie als grausame Bestien zeichnen: Sie töten Kinder, indem sie sie an den Füßen packen und an Bäumen oder Steinen zerschmettern, Frauen nehmen sie sich grundsätzlich mit Gewalt. Jeder Neuankömmling im Indianerland wurde zunächst einmal mit solchen Legenden geimpft und verhielt sich entsprechend. In vielen Westernfilmen findet sich dieser Mythos gleichsam auf den Kopf gestellt, wenn nämlich die Frauen getötet und die Kinder entführt werden. Bei einem Indianerangriff hebt der Westerner die letzte Kugel für die Frau neben sich auf: So wird er selber zum Vollstrecker eines möglicherweise nur in seinem Kopf existenten Traumas.
Die weiße amerikanische Mutter tut, im Gegensatz zu Pocahontas, nichts, um die Rassen einander näher zu bringen oder den Frieden zu sichern – im Gegenteil: Sie hetzt Weiße und Indianer in den Krieg miteinander, bewusst und unbewusst. Für die puritanische Frau gibt es zwei Arten von Männern: den Aggressor von außen und den Mann in der Familie. Der eine versetzt sie in ständige Panik, der andere kann kaum der Aufgabe gerecht werden, sie zu schützen, ohne sie gleich über die Maßen zu versklaven. Für die weiße, das heißt die gute Frau im Western ist das erotische Ideal ein Mann im Übergang, zum Beispiel ein umherziehender Abenteurer, der sesshaft wird, jedenfalls ein Mann, der vom gefürchteten, erotischen Bild, das seinen traumatischen Ausdruck im Indianer findet, einen Teil seines Wesens entlehnt hat.
Die erotische Grundkonstellation des Western besteht also in einer Gegenüberstellung von je zwei männlichen und zwei weiblichen Idealbildern. Die weiße Frau, die nicht selten blond ist, immer in heller Kleidung auftritt und eine hohe Stimme hat, hat zur Konkurrentin die dunkle Frau, die Indianerin, die Mexikanerin, die schwarzhaarige, dunkel gekleidete, sinnliche Frau. Und der Westerner hat zwei Seelen: die eine des Abenteurers, Wanderers, des Mannes, der mit den Indianern gelebt hat, und die andere des Gründers, des Gesetzestreuen, des Familienvaters, des Mannes, der Wälle gegen die «rote Flut» errichtet. Die inneren Konflikte im Genre lassen sich als Entscheidungs- und Zuordnungsprozesse in dieser Konstellation deuten. Der Western ist alles andere als ein anti-erotisches Genre; seine Heldinnen und Helden haben schwer an ihren Versuchungen zu tragen.
Das Land
«Einen gar nicht geringen Anteil an der Bildung des ‹amerikanischen Typus› hatte die natürliche Umwelt, die Landschaft des Kontinents. Verglichen mit der alten Heimat der Siedler bot das neue Land unerschöpfliche natürliche Reichtümer, die umso unerschöpflicher schienen, als die Bevölkerungsdichte zunächst nur sehr gering war. Feudalwirtschaft im europäischen Sinne konnte sich nicht entwickeln, da Pächter niemals lange in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Herrn gehalten werden konnten, bevor es ihnen die Fülle des frei zur Verfügung stehenden Landes ermöglichte, selbst Landbesitzer zu werden. Die Plantagenwirtschaft in den Südstaaten war auf ganz anderer Grundlage, nämlich auf dem Vorhandensein käuflicher Negersklaven aufgebaut. Aber auch der Begriff des Erbhofes oder das in Europa vielfach vorherrschende Prinzip der Erbfolge des ältesten Sohnes ließ sich in den Siedlungen in den Weiten des nordamerikanischen Kontinents einfach nicht durchsetzen» (Niels C. Nielsen). Das eroberte Land war es, was zählte, weit vor dem erworbenen oder ererbten; das Land war Freiheit, sofern und solange es im Überfluss vorhanden war.
Heroische Legenden in Bezug auf das Land steuert nicht nur das harte Siedlerleben an der Grenze bei, die im Verlauf des 18. und 19. Jahrhunderts immer weiter nach Westen wanderte, sondern auch die Erforschung des Landes, die in einigen Prä-Western (darunter auch Howard Hawks’ The Big Sky aus dem Jahr 1952) thematisiert ist. Eine der bekanntesten Forschungsreisen ist diejenige von Meriwether Lewis und William Clark, die den Missouri erforschten und die Rocky Mountains überquerten und dadurch nicht nur die geografischen Kenntnisse, sondern auch den Besitzanspruch der Vereinigten Staaten erweiterten. Ihre Reise unternahmen sie und ihr Gefolge auf Geheiß des dritten amerikanischen Präsidenten, Thomas Jefferson. Eine große Rolle spielten auf ihrer Expedition Clarks schwarzer Diener York und eine Indianerin, Frau eines kanadischen Halbblut-Trappers und Tochter eines Häuptlings, und auch diese beiden trugen durch ihre heldenhaften Taten zur Schaffung einer rassischen Typologie bei, die späterhin auch die Unterhaltungsindustrie übernahm.
Im Westerner steckt also nicht nur ein idealisierter Pionier oder Siedler, sondern auch ein Forscher, der das Land nach neuen Wegen durchquert. Er will das Land kennen lernen, nicht besitzen. Wenn er den nachdrängenden Siedlern die Wege zu ihrer neuen Heimat weist, muss ihm deutlich werden, dass durch seine Hilfe die Freiheit, die er gefunden hat, zerstört werden wird. Die Tragik des Westerners liegt unter anderem darin, dass er im Kern kein kolonialistisches Verhältnis zum Land hat, aber im System der Landnahme kolonialistische Aufgaben lösen muss.
Der amerikanische Dichter Theodore Dreiser meinte: «Es war wunderbar, Amerika zu entdecken, aber es wäre noch wunderbarer gewesen, es wieder zu verlieren.» Diese Wahrheit schleppt fast jeder Westerner des Films mit sich herum. Das Land, das man den Indianern genommen hat, eine rätselvolle Geliebte, wird zum schuldbeladenen Problem. Die Puritaner, asketisch hinsichtlich des Lebensgenusses, hatten als Legitimation den Auftrag, die Welt nach ihren Vorstellungen zu gestalten und auf ihr ein bible commonwealth zu errichten. Die Erben des Puritanismus hatten mit dem Geschehen fertig zu werden. Im Westen wird das Denken romantisch, chaotisch, sentimental.
Die Geschichte Amerikas ist auch die Geschichte der Überwindung des calvinistisch-puritanischen Nützlichkeitsdenkens, in dem kein Platz für die Schönheit bleibt. Ein Blick auf die frühe amerikanische Literatur zeigt, dass sie überreich an theologischen und politischen Streitschriften, aber arm an Lyrik und Erzählendem ist, und dass die wenigen poetischen Schriften und Bücher in starkem Maße angefeindet wurden. Die eigene, innere wie äußere, Kargheit war dem Puritaner Kampfmittel und Legitimation gegenüber der Natur, die er als Material ansah, als von Gott gespendetes Werkzeug für die Tatkraft des Menschen. Der Westerner später, der auf seinen langen Reisen manch anderer Kultur begegnete, nicht nur der indianischen, behielt etwas von dieser Kargheit bei, versuchte sie aber auch zu überwinden. Der Westerner ist auch ein Held auf der Suche nach der verlorenen Freude und der Schönheit. Er sieht sich um und entdeckt plötzlich, dass dieses Land schön ist, und gleichzeitig entdeckt er, dass es zu spät ist, es zu retten.
Wirklich fröhlich im Westernfilm ist eigentlich nur der Mexikaner, der das Land als Geschenk sieht, während auch den Festen der Siedler immer etwas Zeremonielles anhaftet. Meistens erfüllen Feste in Western einen Zweck: Jemand wird geehrt, jemand soll verheiratet werden etc., um des Vergnügens allein wird kaum etwas getan. In Vergnügungsstätten der religiös freieren Cowboys schließlich, den Saloons, geht es zugleich öde und hysterisch zu; erst in der Besinnungslosigkeit kommt er zur Ruhe – der Cowboy ersäuft den Puritaner in sich.
Furcht und Träume
Der Puritanismus, dieser düstere Geburtshelfer Amerikas, bietet uns kein einheitliches Bild, auch er ist von Widersprüchen gekennzeichnet. Verbunden mit Strenge, Willenskraft und pedantischer Hingabe an die religiöse Mythologie war sein Unternehmungsgeist eine durch kein Hindernis zu bremsende Aktivität und der Wunsch zu gestalten, im Dienste nicht des Glücks, sondern des Erfolgs. Die Triebkraft des Puritanismus war die Furcht, eine Furcht, die den «tief eingewurzelten mittelalterlichen Angst- und Verfolgungsvorstellungen» (Heinrich Stammler) entstammte, und es ist daher nicht verwunderlich, dass die amerikanische Geschichte zugleich die einer Eroberung und einer Flucht ist. Die Furcht und die Unterdrückung der Gefühle, die dem Mitglied der puritanischen Gemeinde auferlegt waren, führten immer wieder zu hysterischen Ausbrüchen. Sie waren der Grund ebenso für die Salemer Hexenprozesse wie für die religiöse Erneuerungsbewegung der «Großen Erweckung», die in den Jahren zwischen 1730 und 1750 zu einer fanatischen Massenbewegung wurde.
Dieser puritanischen Mystik folgte der Einfluss der Aufklärung auch auf das amerikanische Denken, der insbesondere durch die technischen und naturwissenschaftlichen Erkenntnisse im 18. Jahrhundert ausgelöst worden war. Erster Repräsentant dieser anderen amerikanischen Weltsicht, die auf Toleranz und Vernunftreligion gegründet war, ist Benjamin Franklin. Durch den Einfluss dieser Gedanken bedingt trat neben die Vorstellung von der Besiedlung des Westens als einer religiösen Sendung auch die eines technischen und sozialen Experiments, das dem Menschen ermöglichen sollte, sich selbst zu entfalten. Demokratische Tendenzen, die im Puritanismus noch in heftigem Widerstreit mit aristokratischen und theokratischen Tendenzen standen, erhielten so Stärkung. Schließlich ging mit der amerikanischen Aufklärung auch der Umschlag vom Merkantilismus zum Frühkapitalismus vonstatten, der sich, wie es Max Weber ausdrückt, auf die ethisch eingefärbte Verpflichtung zum Gelderwerb gründete. So gibt es im Westen nicht nur den Kampf ums Land, sondern auch die rauschhafte Suche nach dem Gold, die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen wirtschaftlichen Interessengruppen, die sich die Ausgangsposition für eine möglichst umfassende Ausbeutung der natürlichen Ressourcen teils auch mit durchaus mafiosen Mitteln sicherten.
Die Zeit, in der der Western seine Erzählungen ansiedelt, zwischen 1850 und 1910, war nicht nur die Zeit der Goldsuche, des Bürgerkriegs und der Indianerkriege, des Eisenbahnbaus, der großen Viehtrails und der Organisation des Gesetzes, sondern auch die Zeit, in der sich ein neues Landproletariat herausbildete, in der betrogene Hoffnungen und erfahrene Demütigungen Menschen in großer Anzahl desozialisierten, die so ein riesiges Reservoir für Gesetzlose bildeten. Die Deprivation von Teilen der Bevölkerung, die Ohnmacht vieler Menschen gegen die ausbeuterischen, rücksichtslosen Praktiken der wirtschaftlich Mächtigen schuf die Voraussetzung für die Entstehung legendärer Volkshelden wie Billy the Kid, Jesse James oder Butch Cassidy und Sundance Kid, die ganz im Gegensatz zu den früheren Helden des Westens, Kit Carson, Daniel Boone, Wild Bill Hickok etc., Rebellen gegen die neue Ordnung darstellten. Mit den wirklichen Outlaws, die ziemlich viehische, skrupellose Männer gewesen sein mögen, geprägt vom völligen Fehlen einer inneren moralischen Instanz, wie sich dies in Situationen sozialer Entwurzelung häufig ergibt, werden diese Helden der Legende kaum etwas gemein haben. Zügellosigkeit, wirtschaftliche Anarchie, Ausbeutung und eine gehörige Portion Korruption, auf die sich die Gesellschaft des Westens gründete, kontrastierte mit einer aus dem vorigen Jahrhundert geretteten, eigenen Sensibilität.
«Denn das 18. Jahrhundert ist auch in Amerika die Zeit des Pietismus, der ‹Stillen im Lande›, der Empfindsamkeit, des Sturmes und Dranges und der ‹schönen Seele›. Aus seinem Schoße wurde die politische, soziale und industrielle Revolution entbunden, der moderne praktische Materialismus als Lebenshaltung und eine auf ständig zunehmende Beherrschung der Naturkräfte gegründete bürgerliche und später auch proletarische Fortschrittsideologie. Aber gleichfalls Früchte seines Schoßes sind die Romantik, die daran anschließende mächtige Erneuerung der katholischen Kirche und Lehre, der moderne Nationalismus und der durch den Industrialismus ermöglichte Massenstaat mit seinen irrationalen und messianischen Ideologien» (Heinrich Stammler). In alledem formte sich das Bild vom Westerner, dem Avantgardisten und Vollstrecker der Geschichte und zugleich ihrem Flüchtling.
Der ewige Cowboy
Im Bild des Western-Helden ist die Geschichte Amerikas, von der Flucht aus dem alten Land über die Euphorien und Kulturschocks der Siedler bis hin zur Verbitterung und Verelendung in der Spätzeit des Westens, zusammengefasst. Diese Geschichte hat nicht nur einen nationalen, sie hat auch einen universalen Aspekt. Die Haupttriebkraft der menschlichen Geschichte aus abendländischer Sicht: «Gehet hin und machet euch die Erde untertan!», hat hier die vollständigste und auch modernste Ausdrucksform gefunden; im Western ist zu spüren, ob danach noch gehandelt wird oder ob man daran irre geworden ist.
Den Vorgang der Landnahme und der Durchsetzung des Rechts zeigt der Western nicht als politischen, sondern auch als ökologischen, erotischen und moralischen Prozess. Damit vermittelt das Genre ein Geschichtsbild, das in seinen schlimmen Beispielen perfekte patriarchalische Mythen liefert, in seinen besten aber eine Dialektik zwischen Einzelschicksal und historischer Struktur zeigt, wie sie keine Geschichtsschreibung sonst zu realisieren imstande ist.
In sich vereinigt der Westerner auch alle Heldengestalten, die die Geschichte begleitet haben; von jedem mythischen Mann steckt etwas in ihm, Ahasver, Abraham, Moses, Herkules – er ist der Mensch, dem allzu oft Übermenschliches aufgegeben ist. Zugleich ist er aber auch ein normaler Mensch, jemand, der nichts Besonderes sein will, der lebt wie die anderen, nur gefährlicher und glanzvoller. Der Western-Held ist im Allgemeinen ein Held, der keinen Führungsanspruch erhebt; schon deshalb sind wir eher bereit, seine Gewalt zu akzeptieren als etwa die eines militärischen Führers.
Der Mythos ist eine Methode, Widersprüche, die sich in der Praxis nicht lösen lassen, auf geträumte, vorgestellte, angestrebte Weise zu harmonisieren. Und auch deshalb ist der Western eine so universale Aussage geworden, weil seine Mythen in sich die Widersprüche nicht nur der Geschichte der westlichen Welt, sondern auch solche eines jeden (zumindest jeden männlichen) Individuums in seinem Gesellschaftssystem tragen. Zudem lässt sich das geschichtliche Gleichnis auch als menschliches verstehen: Der Western ist das Drama der Sozialisation, in dem sich der wilde, unzivilisierte Naturzustand dem ordnenden, besitzergreifenden Eingriff nur anfänglich widersetzen kann, um am Ende um so wirksamer kolonialisiert zu werden. Der Western-Held ist nicht derjenige, der das bewerkstelligt, und nicht derjenige, der es erduldet; er ist ein Mittler, er ist der Bote, der dem Alten vom Neuen und dem Neuen vom Alten kündet, ein «Engel der Geschichte».
Der Westerner ist so schwer beladen mit Geschichte, dass er nicht anders als zeitlos werden kann. Der Westerner ist so randvoll mit Psychologie, dass er nicht anders als allegorisch werden kann. Der Westerner ist so beschäftigt, dass er nicht anders als ruhig werden kann. Es gibt kaum einen Traum, kaum eine Hoffnung, kaum eine Angst, kaum eine Ideologie, kaum ein Trauma, kaum einen Zorn, die sich nicht in die Satteltasche eines Western-Helden packen ließen.
Geschichte des Westernfilms
Der Western der Stummfilmzeit
Anfänge
Die Geschichte des Western beginnt mit der Geschichte des Films, der eine Geschichte erzählt. Die Filme der Anfangszeit des neuen Mediums waren vorwiegend kurze, dokumentarische Streifen, denen die Sensation der neuen Abbildungsform von Wirklichkeit aufregend und unterhaltsam genug war. Einer von denen, die die Idee verfolgten, in diesem Medium dramatische Handlungen zu entwickeln, war Edwin S. Porter. Sein erster Handlungsfilm war The Life on an American Fireman (1902), immer noch mit dem Anspruch, einen Teil des wirklichen Lebens wiederzugeben. 1903 drehte er dann den Film, der ihn berühmt machte als Erfinder des Western, The Great Train Robbery.
Es kann nicht überraschen, dass die Essenz dieses Films die Bewegung ist, wie sie für den Western bestimmend werden sollte: Bewegung von und zu der Kamera, am Horizont, von links nach rechts. Und die Geschichte ist eine wirkliche Western-Geschichte: «Der Film beginnt mit einer Innenaufnahme eines Telegrafenbüros. Banditen fesseln den Telegrafisten, und als ein Zug in den Bahnhof einfährt, erklimmen sie ihn. Sie stoppen ihn vor der Stadt und zwingen die Reisenden, ihn zu verlassen. Der Postwagen wird ausgeraubt. Die Banditen verschwinden mit ihrer Beute. Die Tochter des Telegrafisten kommt und befreit ihn. Er alarmiert die Stadtbevölkerung, und ein Trupp wird zusammengestellt. Nach einer wilden Jagd werden die Banditen vom Trupp erreicht; ein shoot-out entspinnt sich. Georges Barnes, in der Rolle eines Desperado, ist in einer Nacheinstellung zu sehen und schießt seinen Revolver mehrere Male in Richtung auf das Publikum ab» (Jon Tuska).
The Great Train Robbery war nicht der erste amerikanische Film, der sich mit dem Leben im Westen beschäftigte. Zu nennen wären etwa Cripple Creek Barroom (1898, Regie: W. K. L. Dickson) oder von Edwin Porter The Life of an AmericanCowboy (1902). Sogar der legendäre Buffalo Bill Cody war für einen kurzen Film vor die Kamera getreten. Aber The Great Train Robbery war nicht nur der erste kreative dramatische Film (William K. Everson), sondern auch derjenige, der die grundlegenden Handlungselemente des Genres entwickelte: Überfall, Befreiung von Gefangenen, wilde Verfolgungen zu Pferde, shoot-out. Dem Film folgten Variationen und Nachahmungen; mit The Little Train Robbery (1905) inszenierte Porter selbst eine Parodie (alle Rollen aus dem ursprünglichen Film wurden mit Kindern besetzt, ansonsten wurde er zum Teil Einstellung für Einstellung nachgedreht); andere Filme waren etwa Great Mail Robbery (1906) oder Pay Train Robbery (1907).
Edwin S. Porter hatte selbst nie so recht begriffen, was er eigentlich mit seinem Film, mit seiner Technik und seiner Story, initiiert hatte. Seine folgenden Filme fielen praktisch hinter das in The Great Train Robbery erreichte Maß an filmischer Grammatik zurück, und es war anderen überlassen, seine Ansätze weiterzuführen. Der Erfolg seines Film brachte ihm den Posten eines Produktionsleiters bei Edison ein, wo er weniger durch seine eigenen Filme als durch die Förderung so verschiedener Talente wie David Wark Griffith, der in Porters Rescued from an Eagle’s Nest (1907) seine erste Filmrolle spielte, und Max Aronson, dem späteren Broncho Billy, die Filmgeschichte und insbesondere die Geschichte des Western beeinflusste.
David Wark Griffith und der Western
Griffith, der ursprünglich Theaterschauspieler war und eine Karriere als Bühnenautor angestrebt hatte, wurde bald mit dem Beruf des Schauspielers unzufrieden. 1908 drehte er seinen ersten Film als Regisseur für Biograf Co., The Adventures of Dolly, und in den nächsten Jahren realisierte er an die 190 Filme. Sein erster Western ist The Redman and the Child (1908), und schon im Titel deutet sich an, welche gleichsam viktorianischen Gefühlswerte Griffith in seinen Filmen anzusprechen versuchte. Auf der einen Seite stehen Jungfrauen und Kinder, im Zustand ständiger Bedrohung und Schutzbedürftigkeit, auf der anderen Indianer und Banditen, von denen, latent oder manifest, neben der materiellen auch eine erotische Gefahr ausgeht. Die bedrohte (erotische, moralische) Unschuld steht in seinen Western, wie in vielen seiner anderen Filme, häufig im Mittelpunkt der Handlung, kontrastiert von den edlen Gefühlen, dem Patriotismus und auch der Sentimentalität seiner Helden.
Wie er später in Birth of a Nation (1915) ein etwas fragwürdiges Bild von der Einigung Amerikas nach dem Bürgerkrieg durch den Zusammenschluss der ehemaligen Kriegsgegner im Ku-Klux-Klan gegen «vergewaltigende und mordende Neger» in die Welt setzte, so waren auch seine Western gelegentlich von ausgesprochen rassistischer Färbung: Der Indianer ist in seinen Filmen ein grausames, unzivilisiertes Wesen ohne Seele; in anderen taucht er als edler, entrückter Wilder auf, schutzbedürftig gegen die Einflüsse böser Weißer, wie etwa Mary Pickford als Indianerprinzessin in Ramona (1910). Allerdings war Griffith alles andere als ein in erster Linie ideologischer Regisseur; er hat zum Beispiel in The Massacre (1912), einer filmischen Rekonstruktion von Custer’s Last Stand, auch die Gefahren der Militärmacht gezeigt und den Aufstand der Indianer als verständliche Reaktion auf eine Abfolge von Verrat und nicht eingehaltenen Versprechungen geschildert.
Griffith drehte eine Reihe von Western-Melodramen, in denen häufig die Situation einer belagerten Blockhütte den Höhepunkt einer erotischen Symbolhandlung bildete: Die Geschichte, die Zivilisation, der Friede, der aus der Verteidigung der Unschuld der Frau resultiert, ist die historische Aufgabe seiner Helden. Manche dieser Filme waren von ungewöhnlichem Aufwand in der Gestaltung und in den Produktionsbedingungen (von Griffiths Film-«Kunst» einmal ganz zu schweigen), und sie sind in diesem Sinne Vorläufer der großen Western-Epen aus den zwanziger Jahren, die im Schicksal Einzelner das Schicksal der Epoche oder einer historischen Bewegung zu spiegeln versuchen.
Für Griffiths Helden sind noch nicht die ungeschriebenen Gesetze und die Werte des Westerners späterer Prägung maßgebend: Freundschaft, Ehre, Autonomie. Es sind oft Helden, nicht weil sie sich behaupten, sondern weil sie sich hingeben, wie etwa der Held in The Last Drop of Water (1911): Ein Siedlerzug ist von Indianern überfallen worden. Ein Mann wird ausgeschickt, die Kavallerie zu alarmieren, die Wüste hält ihn auf. Ein anderer, der Nebenbuhler um die Gunst eines Mädchens, wird ihm nachgeschickt und findet ihn, dem Verdursten nahe. Nur kurz ist sein Zögern, dann übergibt er seinem Rivalen den Wasservorrat und stirbt für ihn. Später in einem Western wird man wissen: Es ist wichtig, dass einer durchkommt, für die Gemeinschaft. Bei Griffith ist wichtig, wer und wie er durchkommt, weil nicht die Besiedlung die Moral, sondern umgekehrt die Moral die Besiedlung bestimmen soll.
Melodramatische Verwicklungen stehen oft am Beginn der Konflikte, das heißt, Missverständnisse, Fehlinterpretationen, der falsche Schein der Dinge, die bloß vermeintliche Bedrohung oder das betrogene Gefühl lösen die Gewalt aus. So geschieht es in einem der aufwendigsten Westernfilme von Griffith, The Battle of Elderbush Gulch (1913).
«Zwei Mädchen, die mit einer Postkutsche in den Westen reisen, um einen Onkel zu besuchen, schließen Bekanntschaft mit einem jungen Paar, das das gleiche Reiseziel hat. In Elderbush Gulch werden die Reisenden herzlich willkommen geheißen. Die beiden Mädchen treffen im Hause ihres Onkels ein und teilen ihm mit, dass sie zwei junge Hunde mitgebracht haben. Der Onkel will sie nicht im Hause behalten, deshalb werden die beiden Tiere aus der Tür gelassen; die jungen Hunde laufen davon und flüchten sich schließlich in die Arme von zwei Indianern. Abends geht das ältere der beiden Mädchen hinaus, um die Hunde hereinzuholen und sie zu sich ins Bett zu nehmen; sie findet sie nicht und beginnt zu suchen. Sie begegnet den beiden Indianern, will ihnen die beiden Hunde wegnehmen, aber die Indianer widersetzen sich; der Onkel kommt hinzu, glaubt an einen Überfall und schießt auf die Indianer, wobei er den Sohn des Häuptlings tötet. Dies fordert den Hass der Rothäute heraus, die Elderbush Gulch belagern. Das junge Paar, das die Mädchen in der Postkutsche kennengelernt hatten, wird voneinander getrennt: Der Ehemann hat das Kind einem Nachbarn übergeben und liegt zu Beginn des Angriffs verwundet im Wald. Die Frau hat sich in die Hütte des Onkels geflüchtet und fleht ihn an, den Mann und das Kind hereinzuholen. Der Siedler, der das kleine Kind bei sich hat, wird beim Versuch, die Hütte zu erreichen, getötet, aber das Kind bleibt unverletzt neben ihm liegen. Das ältere der beiden Mädchen sieht es und riskiert sein Leben, um ihm zu Hilfe zu kommen; es gelingt ihr das Kind zu retten. Schließlich kommen Truppen zum Einsatz, alarmiert von einem Mexikaner, der den Indianern entflohen ist. Sie befreien die Siedler: Der verletzte junge Mann wird wieder mit Frau und Kind vereint, die gesund und munter sind» (Eileen Bowser).
Betrachtet man einmal die erotische Mythologie dieser Handlungsführung, so wird deutlich, dass noch bis in die Blütezeit des adult western ähnliche Strukturen anzutreffen sind. Es gibt das unschuldige Mädchen (hier in der spezifischen Verdoppelung), das durch den kleinen Ungehorsam aus einer Zuneigung heraus den Konflikt heraufbeschwört. (Die weiße Frau macht in der Vorstellung des puritanischen Kolonialisten den Indianer den Neger, den fremden Mann zur Bestie.) Es gibt den Gegensatz zwischen der Stadt und dem Land, wobei eher das Land (die Blockhütte als Symbol der Verbundenheit mit der Natur) als die Stadt zur sicheren Zufluchtsstätte wird. Es gibt die Familie, die durch das Opfer eines anderen Mannes erhalten wird (man denke an Shane) und durch die Tat einer Frau; die Regelung persönlicher Beziehungen inmitten des Kampfes zwischen Weißen als Individuen und den Indianern als Masse. Ansatzweise ist sogar auch die Bewegung nach dem Westen, die Suche nach der neuen Heimat vorgegeben.
Die Begegnung mit der Wildnis, mit dem Indianer, wird zum Prüfstein der Beziehung zwischen Mann und Frau, die sich erst im Sieg über jene patriarchalisch-zivilisiert konsolidieren kann. Seit Griffiths Western steckt in jedem epischen Film des Genres ein Melodram verborgen. Griffith hat, neben bedeutenden technischen und erzählerischen Innovationen, auch dies dem Western hinzugefügt: dass häufig finstere, verstörte paternalistische Träume den Weg der Protagonisten vorschreiben.
Der erste Cowboystar: Broncho Billy
Gilbert M. Anderson (eigentlich: Max Aronson) hatte eine kleine Rolle in Porters The Great Train Robbery gespielt (eigentlich war er sogar für eine Hauptrolle als einer der Banditen vorgesehen, aber als sich herausstellte, dass er kaum reiten konnte, übertrug man ihm nur noch einen bit part). Bei Vitagraph wurde er Schauspieler und Regisseur, und er drehte für diese Firma im Jahr 1907 eine Reihe von one reel western wie Bandit King, The Girl from Montana und Western Justice, denen das Verdienst zukommt, die ersten wirklich im «Westen» gedrehten Filme des Genres zu sein. Als Mitbegründer der Firma Essanay versuchte sich Anderson an einem Konzept, eine mehr oder weniger feststehende Heldenfigur in den Western einzuführen, um so das Publikum an eine Serie von Filmen zu binden, ähnlich wie dies bei den erfolgreichen Slapstick-Komikern der Fall war. (Auch die in dime novels publizierten Western-Erzählungen wiesen zum Teil ja wiederkehrende Heldenfiguren auf.) Erst als seine Suche nach einem geeigneten Darsteller für solche Filme keinen Erfolg gezeigt hatte, entschloss sich Anderson dazu, den Part selbst zu übernehmen.
Der erste eigentliche Broncho Billy-Film war Broncho Billy and the Baby (1908), der nach der Erzählung «Three Godfathers» von Peter B. Kyne entstand. (Diese Geschichte wurde später noch mehrmals verfilmt, unter anderem zweimal von John Ford und einmal von William Wyler.) Die Geschichte von Banditen, die in der Wüste ein todgeweihtes neugeborenes Kind annehmen, um es unter großen Opfern in die Sicherheit der Zivilisation zu bringen, veranschaulicht den Charakter, den Broncho Billy auch in vielen seiner späteren Western darstellen sollte: den good bad man, den Banditen oder Outlaw, der in einer extremen Situation große Menschlichkeit zeigt und für eine aufopfernde Tat wieder in den Kreis der Gesellschaft aufgenommen wird. Zwischen 1908 und 1915 drehte Anderson, als Regisseur, Autor und Hauptdarsteller, mindestens 376 Broncho Billy-Western (einige Quellen sprechen sogar von ungefähr 500).
Dieser Broncho Billy war die erste Identifikationsfigur des Genres, sein erster Star. Dass dies gerade einem Darsteller gelingen konnte, der nicht mehr der jüngste, kein athletischer und auch kein gutaussehender Mann war, verwundert nur, wenn man ihn mehr mit seinen Nachfolgern wie Tom Mix vergleicht als mit dem Männlichkeitsideal des amerikanischen Viktorianismus, das auch in Griffiths Filmen dominiert (und gegen das sich erst in Rudolph Valentino ein Gegenbild behauptete). Broncho Billy ist paradoxerweise ein Action-Star, der eigentlich nur vor dem Hintergrund des Melodrams seine Identität findet, wie ein Westerner, der in seinen Bewegungen all die seelischen Verkrüppelungen puritanischer Moral vor sich her trägt, die durch die Zufälle und Intrigen der Handlung zu einer gewissen Lösung gebracht und zugleich bestätigt werden. Schon die Titel seiner Filme weisen darauf hin, dass er viel weniger den Kampf mit Banditen und Indianern als die Verwirrungen der Gefühle zu fürchten hat, die sich durch seine familiären und emotionalen Beziehungen ergeben. Broncho Billy and the Sisters, Broncho Billy’s Brother, Broncho Billy’s Mexican Wife, Broncho Billy’s Word of Honor – so heißen die Filme, in denen der Held oft verschlungene Wege gehen muss, bevor er durch den Einfluss einer Frau, gelegentlich auch durch das Aufschlagen der richtigen Bibelstelle, seine Entscheidung trifft.
Es gibt, zumindest anfänglich, noch keine Kontinuität in den Broncho Billy- Filmen; der Held ist das erste Mal ein Sheriff, das andere Mal ein Farmer und wieder ein anderes Mal ein bekehrter Bandit. Das Ende des einen Films sah ihn heiraten und sich zur Ruhe setzen, am Beginn des nächsten war er wieder als einsamer Westerner unterwegs; einige Filme verzeichnen sogar den Tod des Helden, ohne dass dies das Publikum davon abgehalten hätte, sein nächstes Abenteuer zu erwarten. (Zur Zeit des Höhepunktes seines Ruhmes kam jede Woche mindestens ein neuer Broncho Billy-Western auf den Markt.)
Mit dem authentischen Westen hatten Anderson-Filme nur sehr wenig zu tun; das Land seiner Abenteuer ist als dime novel-west bezeichnet worden. Es ist ein Westen der Rekonstruktion ohne den «historischen» Mythos der Landnahme. Die Broncho Billy-Western erinnern in ihrer Mischung aus Abenteuer und Romantik an die Abenteuerliteratur des 19. Jahrhunderts, gleichsam versetzt mit einer puritanischen Moral, die noch nicht verinnerlicht oder gar reflektiert war, sondern ganz naiv und direkt zum Ausdruck kam. Als Beispiel hierfür soll, nach einer zeitgenössischen Quelle referiert, die Inhaltsangabe eines typischen Broncho Billy-Western dienen (A Mexican’s Gratitude; 1914, Regie: Gilbert M. Anderson).
Ein Mexikaner wird von einem Sheriff davor bewahrt, als Pferdedieb gelyncht zu werden. Er zieht eine Spielkarte aus der Tasche, schreibt das Wort gratitude (Dankbarkeit) darauf, zerreißt die Karte in zwei Hälften und überreicht die eine seinem Retter. Jahre später: Der Sheriff hat sich in ein Western-Mädchen (also das Gegenteil eines Bürgermädchens aus dem Osten) verliebt. Dem aber wird von einem Cowboy der Hof gemacht, der in der Wahl seiner Mittel nicht eben zimperlich ist. Er arrangiert ein Zusammentreffen des Sheriffs mit einem anderen Mädchen, um seiner Angebeteten dessen Treulosigkeit zu beweisen. Das Mädchen glaubt dem Cowboy und geht mit ihm fort. Etwas später verprügelt aber der Sheriff den Cowboy und zwingt ihn, seinen Verrat zu bekennen; die Sache scheint geregelt. Doch der rachedurstige Cowboy versichert sich der Hilfe zweier Mexikaner, um dem Sheriff eine Falle zu stellen. Sie überwältigen ihn und das Mädchen und bringen beide gefesselt in eine Hütte. Dort wird der Sheriff erst einmal gefoltert, dann schleift der Cowboy das arme Mädchen in einen anderen Raum. Einer der Mexikaner greift in die Tasche des Sheriffs, um sich einen Tabaksbeutel zu angeln, da fällt ihm die halbe Spielkarte mit dem Wort gratitude darauf entgegen. Nachdem er sich versichert hat, dass der Sheriff wirklich sein Retter von damals ist, befreit er ihn, und dieser, nun wirklich zornig, greift sich den Cowboy, und erst das Mädchen kann verhindern, dass er ihn noch übler zurichtet. Nun steht dem Happyend wirklich nichts mehr im Wege.
In den Broncho Billy-Western gibt es eine Sympathieverteilung, die für den späteren Western kaum noch denkbar ist: Mexikaner, die in vielen seiner Filme eine wichtige Rolle spielen, sind zumeist gute Banditen, jedenfalls ehrbarer als viele Yankees. Cowboys sind zumeist als Schurken dargestellt (wie im zitierten Beispiel), eine Tradition, die noch ganz der Furcht der Bürger vor dem Rowdytum der Cowboys in der Wirklichkeit, aber auch dem Bild in den dime novels entspricht. (Insbesondere ist es auch nicht ganz richtig, von Broncho Billy Anderson als dem ersten Cowboy-Star zu sprechen, aber der Begriff hat sich allgemein für die Helden des spezifischen Serien- und B-Western eingebürgert.) Indianer entsprechen dem Bild des edlen Wilden aus der frühen Pionierliteratur wie bei James Fenimore Cooper; es sind mystische Wesen von ganz eigenem, ein wenig märchenhaften Appeal und gelegentlich, in ganz naiver Weise, so etwas wie die Anima des Westerners.
Erinnerungen an den wirklichen Westen: William S. Hart
Den ersten Schritt in Richtung auf eine gewisse Authentizität des Genres hatte Broncho Billy Anderson noch selbst unternommen, indem er seine Produktionsfirma Essanay von Chicago nach Niles in Kalifornien übersiedelte; «der Western war nun dort, wo er hingehörte» (Don Miller). Sein Nachfolger in der Publikumsgunst, William S. Hart, war zugleich die logisch konsequente Fortsetzung des Broncho Billy-Konzepts und eine historische Korrektur. Auch er war in vielen seiner Filme der good bad man, der Bandit, der durch die Liebe einer Frau und seine Bereitschaft, sich selbst für eine gute Sache zu opfern, moralische Absolution erhält. Von dieser melodramatischen Seite seines Wesens (die natürlich auch eine historische Komponente hat) abgesehen, waren die Geschichten um den von ihm verkörperten Westerner weniger naiv und linear als die von Anderson. Wenngleich häufig mit einem Übermaß an Sentimentalität versetzt, waren seine Western dennoch an der historischen Wirklichkeit orientiert (von der er als Kind noch ein wenig erlebt hatte). Harts Western zeigten den Kampf, die Arbeit und auch die glanzlosen Momente im Leben an der Grenze und den schwierigen Prozess der Entwicklung einer Moral für eine neue Gesellschaft.
Typisch für dieses Element in Harts Western ist etwa der Film Hell’s Hinges (1916), die Geschichte der Bekehrung eines Banditen und zugleich, parallel dazu erzählt, die Geschichte vom moralischen Verfall eines Priesters, dessen Tochter der Held beschützt. Pathos und Lakonie gehen eine Verbindung ein, die für den späteren Western wesenseigen werden sollte. Das wird auch in den Dialogen der Untertitel deutlich, die sich um die Rekonstruktion der Cowboysprache bemühen. Von Hell’s Hinges, dem Ort des Geschehens, beispielsweise wird gesagt, es sei «a good place to ride wide of» und die Bekehrung des Helden wird mit den Worten angedeutet: «I reckon God ain’t wantin’ me much, Ma’am, but when I look at you, I feel I’ve been ridin’ the wrong trail». Gott war nie ganz fern, und die Bibel spielt in Harts Western eine fast ebenso bedeutende Rolle wie der Revolver, allerdings kaum als komplementäre Instrumente der Besiedlung, wie es die Geschichte gezeigt hat, sondern als einander ausschließende Symbole von Gut und Böse. Die Bedeutung von Accessoires ist in Harts Western fast immer allegorisch, aber auch in seiner Bildsprache hat er oft eine wirksame Verbindung von Sentimentalität und lakonischem Understatement gefunden. In Hell’s Hinges gibt es eine Szene, in der der Held zum ersten Mal die Bibel liest. Er tut dies, zuerst zögernd, dann immer gebannter, und während er liest, raucht er und trinkt, aber die Bewegung seiner Hände zum Whiskyglas werden immer langsamer, dann bleibt das halbvolle Glas stehen.
In Harts Filmen kam zum ersten Mal zum Ausdruck, dass der Western nicht nur das Land der Abenteuer, sondern auch der Ort einer neuen nationalen Identität war. Staubbedeckt, melancholisch, mit der Erfahrung vieler Jahre im Niemandsland beladen, erschien Hart und schuf Ordnung, indem er sich zuallererst selbst besiegte, seine Vergangenheit, seine Wildheit, seine Freiheit. Ernst, Trauer, aber auch eine gewisse Größe kennzeichnen seine Haltung. Er ist kein strahlender Held, drückt eher etwas von den Widersprüchen aus, die den Western ausmachen, und er ist ein Held, nicht aus natürlicher Bestimmung, wie vor ihm Broncho Billy und nach ihm Tom Mix, sondern ein Held aus inneren und äußeren Zwängen, zu denen auch ein unklares Verhältnis zu Frauen gehört.
Durch Frauen verknüpfen sich, wie später im Genre, unheilvoll, doch unschuldig, die Schicksale von Männern. Typisch für die Struktur von Hart-Western ist die Geschichte von The Troll Gate (1920, Regie: Lambert Hillyer): Hart ist der Anführer einer Gruppe von Outlaws, der von einem seiner Unterführer verraten wird und nur mit knapper Not einer Falle entkommt. Der Verräter schafft sich in der Stadt einen Saloon an. Hart ist hinter ihm her, und als er ihn in der Stadt aufspürt, steckt er seinen Saloon in Brand. Ein Suchtrupp wird zusammengestellt, der Hart in die Wildnis verfolgt. Er versteckt sich zusammen mit einer Frau und ihrem kleinen Sohn, welche der brutale Gatte hilflos in der Wüste zurückgelassen hat. Es stellt sich heraus, dass der Mann, der den Helden verraten hat, und der, der die Frau verließ, ein und derselbe ist. Als der Trupp an ihrem Versteck eintrifft, kommt es zum shoot-out. Hart erschießt den Schurken, und der Sheriff lässt ihn schließlich, als ihm die Zusammenhänge klar geworden sind, ziehen. Die Frau und ihr Sohn schauen ihm nach, als er davonreitet, traurig darüber, dass ein solcher Mann nirgends mehr bleiben kann.
«William S. Harts Westerner ist ein einsamer, harter Mann, von dem mehr als bei allen anderen Western-Stars die Aura einer fast tödlichen Bedrohung ausging. Sein Westen war der eines beständigen Kampfes ums Dasein, nicht nur der realistischste, sondern in gewissem Sinne auch der ‹traurigste› Westen des Stummfilms. Zugleich war Hart aber auch einer der sentimentalsten Western-Helden; die Bekehrung eines ehemaligen Outlaws, das Thema der meisten seiner Filme, ging selten ohne melodramatische Szenen ab. Die Tierliebe seines Helden, vor allem zu seinem Pferd (Fritz war wohl das erste Pferd, das einen credit unter den Schauspielern erhielt), zeigte gelegentlich nahezu rührselige Komponenten, die in Widerspruch zu seiner sonstigen Härte stand» (Jürgen Berger / Georg Seeßlen). Dieser Widerspruch ist bezeichnend für die Entwicklung des Genres, bezeichnend aber auch für die Aufarbeitung der eigenen Geschichte: Zurück in das Goldene Zeitalter des Wilden Westens sehnte man sich, weil man in ihm zugleich Anarchie und Beschaulichkeit verwirklicht sah. Einer von Harts Filmen hat den Titel The Silent Man (1917), ein anderer The Desert Man (1916); Einsamkeit, Schweigen, Hoffnungslosigkeit und Würde begleiten das Wissen um den Verlust einer großen Zeit, mit der Unwiederbringliches dahingegangen war. Mit der neuen, bürgerlichen Gesellschaft konnte er sich nur symbolisch, indem er das Wesen des Gesetzlosen ablegte, aber nicht wirklich verbinden; fast immer reitet er am Ende allein davon, die Frau, die Stadt, den Frieden hinter sich lassend. Mit keinem Western-Helden zuvor und kaum einem danach hat das Publikum so viel Mitleid haben müssen.
«Mit dem Beginn der zwanziger Jahre begann Harts Anziehungskraft nachzulassen. Dass er nun schon fünfzig war, mag nicht der einzige Grund gewesen sein. Harts melancholischer Held gehörte einer Zeit an, die die ‹alten› Werte zumindest noch bewunderte und ihren Niedergang betrauerte. Die leichtfertige Zeit, die nun anbrach, verlangte nach anderen Leitbildern. Erst spätere Dekaden brachten eine Rehabilitierung des Typs – der alte Gary Cooper in High Noon und der alte John Wayne in The Man Who Shot Liberty Valance sind Reinkarnationen Harts» (Enno Patalas). Mit Hart hatte der Western begonnen, ein für Tragik empfängliches Genre zu sein.
Der Glamour-Cowboy: Tom Mix
Tom Mix, der im übrigen schon vor William S. Hart begonnen hatte, als Filmschauspieler aufzutreten, lange Zeit aber vorwiegend supporting roles innehatte, war nicht nur jünger, strahlender, optimistischer, unkomplizierter und athletischer als dieser, er stellte auch eine mythologische Alternative zu dem melancholischen Westerner dar. War Hart das große, tragische, sentimentale Überbleibsel einer gewaltigen Zeit, die so überwältigend gewesen sein musste, dass vieles von ihr im Dunkeln, im Schweigen zu bleiben hatte, so zeigte Tom Mix, wie man auf eine einfache, trickreiche, amerikanische Art die Ideale und das Lebensgefühl des Westens in die Gegenwart fortsetzen konnte, indem man sie einer radikalen Veräußerlichung unterzog.
Wie sich das Leben der Cowboys fortsetzte in der Zurschaustellung ihres Könnens im Rodeo, wo gleichsam aus einem Beruf zunächst ein Sport und aus diesem wiederum ein Teil der Unterhaltungsindustrie wurde, verwandelte sich bei Mix der Westerner in einen Akrobaten und Artisten. Die Kleidung des Westerners, durch viele leichte und manchmal groteske Übertreibungen zu einer Art Fantasiekostüm geworden, sein fantastisch herausgeputztes Pferd Tony und die Aneinanderreihung von spektakulären Reitertricks und anderen Kunststücken mit westerneigenen Requisiten machten aus den Tom-Mix-Filmen in erster Linie ein Schauvergnügen, bei dem es auf die Handlung nur als Vehikel für optische Sensationen ankam. Harts Western erzählten vor allem eine Geschichte; Tom Mix’ Western zeigten vor allem Action.
Mehr als seine Vorgänger war Tom Mix ein Held für das jugendliche Publikum. In seinen früheren Western trat er häufig gemeinsam mit populären Kinderdarstellern auf, und er gehörte zu den ersten jener Filmcowboys, die einen moralischen Kodex peinlich genau befolgten: nicht trinken, nicht rauchen, nicht fluchen und einen Feind nur in äußerster Notwehr mit dem Revolver bedrohen, sich ansonsten lieber auf Fäuste oder Lasso verlassen und in jedem Fall die Gesetze befolgen. Hart musste das Mädchen verlassen. Mix bekam es, aber bei dem wenigen, was er mit ihr anstellen konnte, musste ihm sogar noch sein Pferd behilflich sein, indem es ihm einen kräftigen Schubs in Richtung auf seine Angebetete gab.
Die moralischen Probleme von Andersons und Harts Westerner gab es in Tom-Mix-Filmen nicht; gut und böse waren trefflich unterschieden, häufig schon durch die Kleidung: der Gute hell, der Böse dunkel gewandet. Beider Kämpfe finden immer in landschaftlich reizvollen Gegenden statt; häufig richtete es die Crew der Mix-Filme so ein, dass man im Hintergrund eines der national wonders erkennen konnte, während man im Vordergrund den Kampf des Helden mit seinem Gegner verfolgte, der auf einem fahrenden Zug oder auf einer Postkutsche, am Rande eines Abgrundes oder einer Brücke stattfand. In The Great K & A Train Robbery (1926) beispielsweise bildet eine bekannte Felsenschlucht, die Royal Gorge in Colorado, den Hintergrund. Durch sie führt eine Eisenbahnlinie, die durch eine Serie von Bahnüberfällen in ihrer Existenz bedroht ist. Tom Mix ist Eisenbahndetektiv, der, ohne sich zu erkennen zu geben, versucht, die Züge zu sichern und den Tätern auf die Spur zu kommen. Er entdeckt schließlich, dass ein Verräter direkt vom Vorzimmer des Präsidenten aus die Banditen über die Pläne der Gesellschaft und die wertvollen Frachten informiert. Während Tom (mit viel Action und Stunts) die Banditen zur Strecke bringt, hat er auch noch Zeit, sich in die Tochter des Bahnpräsidenten zu verlieben, die er am Ende heiratet.
Tom Mix’ Westen war genauso exotisch wie sein Kostüm, obwohl er, noch mehr als Hart, den Westen aus eigener Anschauung kannte. Aber da er nicht der Darsteller einer Legende, auch nicht der Darsteller eines Archetyps war, sondern ausschließlich Darsteller seiner selbst, schien dies eine gewisse Folgerichtigkeit zu haben. Die Verwandlung des Westens in Showbusiness war Teil seines Lebens. (Im Film gibt es solche Cowboys nicht mehr, aber wenn man sich die Fantasiekostüme der Country & Western-Sänger betrachtet, die ja auch häufig einen authentischen Hintergrund haben – das heißt eine spezifische Ausstattung einmal als «Arbeitskleidung» benutzt haben –, wird deutlich, welcher Vorgang sich hier abspielt. Die Transponierung des armseligen Westens in eine Glamour-Welt des Zirkus, der Paraden, der Musik, der Rodeos und eben des Films konnte wohl am ehesten von denen geleistet werden, die es anging, ganz so, wie historische Authentizität am ehesten bei denen zu finden ist, die sich einen gewissen Abstand zu den weniger erfreulichen Erfahrungen des Westens haben leisten können. Eine ganz andere, vielleicht tiefere Art der Authentizität findet sich aber in den Träumen und Projektionen, auch in denen von Tom Mix. Mit ihm war geboren, was die Rebellen der Country-Musik heute die «Rhinestone-Cowboys» nennen.)
Historisch ließen sich die Geschehnisse um seinen Helden nicht festlegen; der erlebte das eine Mal Abenteuer mit Indianern und Postkutschen, das andere Mal sprang er von seinem Pferd auf ein fahrendes Auto, um einen ziemlich modernen Schurken zu fangen, sehr oft einen Spion oder eine andere Art von Verräter, weil solch einer weitaus unsympathischer war als ein Bandit. Daneben begab sich der Held auch auf Reisen in ferne Länder, wie zum Beispiel in Tom Mix in Arabia (1922). Aber immer war er The Daredevil (1920), The Untamed (1920), The Trouble Shooter (1924) oder The Circus Ace (1927), ein Draufgänger, der sich in einer Welt durchsetzte, in der dies nicht schwerfiel, solange man seinen Körper fit und seinen Geist von Vergiftungen frei hielt. Die Leichtigkeit der Figur Tom Mix zeigt sich unter anderem auch darin, dass der Held eigentlich nie eigene Probleme löst, sondern immer nur die Schwierigkeiten anderer beseitigt. Das emotionale Engagement hielt sich dabei in Grenzen; so konnte er lachend und leichthin zeigen, was er drauf hatte.
Wie etwa Douglas Fairbanks war Tom Mix eine Verkörperung des Amerikanertums, das historisch wie mythologisch immer ein wenig im Widerspruch zum Wesen des Westerners steht, eines im Kern zutiefst konservativen Archetypus. Tom Mix stellt seine Überlegenheit so auffällig zur Schau, wie es der Verbundenheit des Westerners mit den Lebensumständen, die auch den Gegner mit einbeziehen, und auch seiner bei Hart angedeuteten Verschlossenheit zuwiderlief. Mit dem Mythos des Western, der sich die Vergangenheit gefügig zu machen sucht, hat Mix also viel weniger zu tun als mit einer Gegenwart, die dem Idol des Tatmenschen huldigte und in der das moralische Selbstbewusstsein ungebrochen schien.
In Gestalt von Tom Mix und vieler seiner Nachfolger und Mitstreiter war die Gefährlichkeit des Westens, einer Vergangenheit der Wildheit, der Ausschweifung, des Elends auch zunächst einmal gebändigt. Broncho Billy hatte sich mit Indianern und Mexikanern gemein gemacht, Hart war einmal Bandit gewesen – nichts davon bei Tom Mix, der seine Seele in die Tat gelegt hatte. Seine Ehrlichkeit lag ganz darin, möglichst viele von den Tricks und akrobatischen Nummern in seinen Filmen selbst aufzuführen; eine physische statt spirituelle Kontinuität des Westens.
1915 bis 1925: Western in Serie