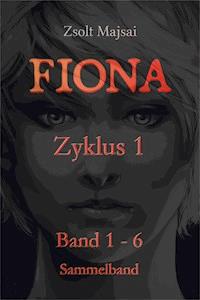Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag 3.0 Zsolt Majsai
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Fiona: XXL Leseprobe
- Sprache: Deutsch
XXL Leseprobe! Während sich Fiona noch nicht damit abfinden will, dass Katharina jeden Kontakt zu ihr abgebrochen hat und ihr aus dem Weg geht, muss sie als Kriegerin für das Gleichgewicht sorgen. Eine durchgeknallte Bankräuberin und ihre sieben Dämonenzwerge entführen Ben Norris und sind auf der Suche nach einem besonderen Spiegel. Appetizer: Die nächsten Tage ziehen wie Wolken an mir vorüber. Nachdem ich beschließe, mich an die Regeln zu halten, weil alles andere nur meinen rebellischen Geist befriedigen und mir außerdem jede Menge Schmerz bescheren würde, werde ich zur persönlichen Blutsklavin von Anne Marie. Sie ist ganz nett. Eigentlich ist sie richtig lieb, und wäre sie keine Vampirin, könnte ich sie sogar mögen. Trotzdem schlafe ich mit ihr. Kristallwelten-Saga: __________________ __________________ Dargks Erwachen (in Planung) _____________________________ Die Legende von Sarah und Thomas: ___________________________________ Die Prinzessin, die ihre Eltern tötete (Band 1) Die tote Welt (Band 2) (in Planung) Die Fiona-Serie: _______________ Zyklus 1: Fiona - Der Beginn (Band 1) Fiona - Entscheidungen (Band 2) ==> Fiona - Gefühle (Band 3) - XXL LESEPROBE Fiona - Wiederkehrer (Band 3.1) Fiona - Leben (Band 4) Fiona - Sterben (Band 5, erscheint im Sommer 2017) Zyklus 2 (in Vorbereitung, erscheint ab 2018): Fiona - Reloaded (Band 6) Fiona - Spinnen (Band 7) Fiona - Liebe (Band 8) Fiona - Götter (Band 9) Fiona - Untergrund (Band 10) Mehr Infos zum Zyklus 2: buch-ist-mehr.de/PWA/blogs/fiona-zyklus-2-von-reloaded-bis-untergrund/
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zsolt Majsai
Fiona
Gefühle
XXL Leseprobe
Verlag 3.0
Zsolt Majsai
Fiona - Gefühle
XXL Leseprobe
Fantasy
ISBN: 978-3-95667-600-0
© 2017 Verlag 3.0 Zsolt Majsai,
53545 Linz am Rhein | buch-ist-mehr
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie gerne eine E-Mail senden an [email protected]
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- und Bildteile sowie der Übersetzung in andere Sprachen.
Lektorat: Hubert Quirbach | sprache-und-auge
Umschlaggestaltung: Clara Vath | vath-art
Die Verwendung der Schrift Belligerent Madness erfolgte mit freundlicher Genehmigung von P. D. Magnus | fontmonkey
Printed in EU
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.ddb abrufbar.
Kristallwelten
Immer wieder beschäftigen sich die Menschen mit der Idee, dass das uns bekannte Universum nur Teil eines größeren Ganzen ist. Unter anderem existiert die Vorstellung von den multiplen Universen – mehreren Parallelwelten, die räumlich und zeitlich voneinander getrennt sind. Und doch, könnte es nicht sein, dass es möglich ist, zwischen ihnen zu reisen?
Ja, es ist möglich. Zumindest theoretisch. Denn in Wirklichkeit ist das uns bekannte Universum nur ein Teil der Kristallwelten. Wie Kristallkugeln sind die Universen aufgereiht, ähnlich den Elektronen in einem Elektronengitter. Zwischen ihnen befindet sich Aylvan, eine invertierte Welt, die aus Visz besteht.
Visz, das göttliche Material, hält die Kristallwelten zusammen, wie ein göttlicher Klebstoff. Ein Stoff, der in der materiellen Welt unzerstörbar ist, von der Ordnungszahl 500 und damit stabiler als jedes andere Material, das je existiert hat und das jemals existieren wird.
Doch was sind die Kristallwelten eigentlich?
Unsere Welt. Und viele andere. Genau genommen sind es sogar viele Universen. Jedes Universum ist ein Kristall, ein Spielfeld der Götter. Zusammen ergeben die Kristallwelten ein Spiel, das die Götter spielen: Monopoly für Götter.
Anders als bei unserem Monopoly entwickeln in diesem Spiel die Figuren allerdings ein eigenes Leben und verhalten sich nicht immer so, wie es die Götter sich wünschen würden. Dass dies bis zur Zerstörung eines Universums führen kann, werden Fiona und ihre Freunde schmerzhaft erfahren.
Weitere Infos zu Fiona und den andere Büchern sind auf der Webseite zu finden.
Kristallwelten: Zeittafel
1980: Fiona wird geboren 1990: Norman, Fionas Bruder, wird geboren 1992: Bernd und Michaela lernen sich kennen (Dargks Erwachen) 1992: Nomén und Kay lernen sich kennen1993: Halpha wird geboren (Dargks Erwachen) 1993: Helena und Jody werden geboren (kommt voraussichtlich (aber wer weiß? ;) ) in keinem Roman vor, aber wichtig für Band 5: Fiona - Sterben) 1994: Nidea, Tochter von Oela und Renroc wird geboren (Dargks Erwachen) 1996: Dargk kommt nach Untes, der Große Krieg findet statt (Dargks Erwachen) 1998: Dargks Erwachen - Teil 21999: Gemeinsame Tochter Dargks und Ryemas wird geboren 2001: Gemeinsamer Sohn von Ryema und Roek wird geboren 2002: Beginn von Die Legende von Sarah und Thomas - Die Prinzessin, die ihre Eltern tötete2003: Ralph, Sohn von Katharina und Dargk, wird geborenZyklus 1
20.06.2003: Norman stirbt (Fiona - Beginn) 2004: Klassentreffen2005: Fiona - Entscheidungen2006: Fiona lernt "Schneewittchen" kennen und wird im Dezember schwanger (Fiona - Gefühle) 09.2006: John Summer25.12.2006: Leslie06.08.2007: Geburt Sandras, Tochter von James und Fiona 2007: Rückkehr von Sarah und Thomas nach Untes. Ende von Die Legende von Sarah und Thomas - Die Prinzessin, die ihre Eltern tötete10.2007: Wiederkehrer2008: Band 4, Fiona - Leben12.08.2009: Sandra, James und Danny kommen bei einem Racheanschlag ums Leben (Band 5: Fiona - Sterben) 2009: Begegnungen zwischen Sarah und Thomas aus Die Prinzessin, die ihre Eltern tötete, Fiona, Katharina und Ryema, Oela aus Dargks Erwachen und DargkZyklus 2
Fiona - ReloadedWas zum Teufel tue ich hier überhaupt? Zu Hause warten James und Danny, und ich stehe hier vor einer Bank herum. Ein paar Meter weiter kotzt sich ein Polizist aus.
Die Sonne scheint, ein herrlicher Spätfrühlingstag.
„Was ist mit euch los?“, erkundige ich mich.
„Komm mit rein, dann weißt du es“, erwidert Ben ungewohnt kurz angebunden.
Ich folge ihm in die Bank. Die Fenster sind abgedunkelt, drinnen Scheinwerfer aufgestellt. Spurensicherer und Ärzte sind schon da. Für die Ärzte gibt es nicht so viel zu tun, für die Spurensicherer umso mehr. Und weil sie schon mal da sind, helfen ihnen die Ärzte. Zu helfen gibt es für sie eine Menge.
Überempfindlichkeit gehört nicht zu meinem Wesen, im Gegenteil. In der kurzen Zeit meines bisherigen Wirkens als Kriegerin hatte ich sehr häufig Gelegenheit, ziemlich unappetitliche Dinge zu sehen. Aber der Anblick, der sich mir hier bietet, lässt meinen Magen rotieren. Zwar nur kurz, aber es reicht, dass Ben die Augenbrauen hochzieht.
„Alles in Ordnung, Fiona?“
Ich nicke. „Geht schon wieder. Ich war nur nicht darauf vorbereitet.“
„Niemand von uns war darauf vorbereitet.“
„Ich weiß.“
Die Bank wurde überfallen, das ist eindeutig. Ob auch Geld mitgenommen wurde, ist mir noch nicht bekannt. Aber wie es aussieht, hat niemand von den Kunden und Mitarbeitern überlebt. Sie wurden nicht erschossen, sie wurden auch nicht erstochen, nicht einmal erschlagen. Sie wurden zerfetzt. Einige von ihnen sehen aus, als wären sie teilweise aufgegessen worden. Auf dem Boden liegen Körperteile herum, die Bissspuren aufweisen.
Überall ist Blut.
Auch an der Wand gegenüber den Kassen. Dort hat jemand mit Blut hingeschrieben: Snow White was here.
„Schneewittchen?“ Ich starre Ben fragend an. Er zuckt nur die Schultern.
„Na schön. Hier waren also ein paar Irre am Werk. Und du meinst, das ist ein Fall für mich?“
„Siehst du das anders?“
Ich seufze. „Ben, nicht alle Irren sind übermenschlich. Ich kenne Typen, die sind ziemlich menschlich und würden trotzdem so was veranstalten.“
„Schließt du denn aus, dass es … nichtmenschliche Wesen waren?“
Ich schüttle den Kopf. „Nein. Aber die wenigsten von denen rauben eine Bank aus. Ist Geld mitgenommen worden?“
„Ja, sogar jede Menge. Etwa eine halbe Million.“
„Das wiederum wirkt menschlich.“ Ich schaue mich erneut um. Etwas gefällt mir nicht. Und das ist nicht nur die Mitteilung an der Wand. „Ich weiß nicht, Ben. Irgendwas passt nicht. Aber ich kann dir nicht sagen, was es ist. Vielleicht hast du recht, und das waren tatsächlich keine Menschen.“
„Vielleicht findet die Spurensicherung Hinweise. Ich halte dich auf dem Laufenden.“
„Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Mann, Mann. So was habe ich noch nie gesehen. Das muss doch aufgefallen sein. Die Schreie. Hat niemand die Polizei gerufen?“
„Doch, wir wurden alarmiert von einem Zeugen. Ein Mann, der von draußen alles beobachtet hat.“
„Und?“
Ben zeigt auf etwas in der Nähe der Tür. Es ist wohl mal ein Mann gewesen. Er wurde mit seinem eigenen Dickdarm erwürgt. „Seine Handynummer stimmt überein.“
„Hm. Ich revidiere meine Ansicht immer mehr. Was hat er denn gesagt?“
„Das war nicht ganz eindeutig. Jedenfalls etwas in der Art, dass sie sie auffressen. Klang wohl ziemlich panisch. Und dann brach plötzlich die Verbindung ab. Die Zentrale hat sofort mehrere Wagen hierhingeschickt, aber als sie eintrafen, fanden sie nur noch das vor.“
Ich habe genug gesehen und gehört. Vorne rausgehen mag ich trotzdem nicht, inzwischen ist auch das Fernsehen da. Schon schlimm genug, dass die Reporter gesehen haben, wie ich mit Ben hier hineingegangen bin. Ich nehme den Hinterausgang und atme tief durch. Bestialisch, der Gestank. Meine Hände zittern, als ich mir eine Zigarette anzünde. Allmählich werde ich ruhiger.
Ben kommt nach draußen und bleibt neben mir stehen, die Hände in den Hosentaschen.
„So möchte ich nicht sterben“, sagt er leise.
Ich werfe ihm einen Seitenblick zu. „Ich bin schon schlimmer gestorben.“
„Schlimmer als das?“
Ich nicke. „Ja.“
Wir schweigen eine Weile vor uns hin, bis meine Zigarette aufgeraucht ist. Ich trete sie aus und wende mich dann Ben zu. „Lass es mich wissen, wenn ihr eine Spur gefunden habt.“
„Du hast keine Idee, wer Schneewittchen sein könnte?“
„Mir ist niemand aus der Szene bekannt, der sich so nennt oder der so ein Massaker anrichten würde. Schon mal gar nicht bei einem Banküberfall.“
Ein tiefer Seufzer entfährt Ben. Dann schlägt er unvermittelt gegen die Tür. Ich betrachte seine Hand.
„Geht schon“, meint er. „Aber das musste raus.“
„Klar.“
„Was ist mit dir? Macht dich das nicht wütend?“
„Doch, sicher. Aber vielleicht stumpfe ich ab.“
„Du? Niemals!“
Jetzt muss ich doch lächeln. „Lieb von dir, Ben. Ich fahre mal nach Hause. Hast du keine Lust, eine Mini-Pressekonferenz zu geben?“
Er braucht nur drei Sekunden, um zu verstehen. Dann nickt er grinsend.
Und ich kann unbemerkt in meinen Wagen einsteigen und wegfahren.
Zu Hause ist niemand. Da der Jaguar schon dasteht, sind die beiden wohl laufen. Ich ziehe mich aus und gehe in die Wanne. Das heiße Wasser entspannt meine verkrampften Muskeln. Mit geschlossenen Augen döse ich weg, bis sie nach Hause kommen.
Als ich die Augen öffne, steht James in der Tür, Danny sitzt neben mir. Beide sehen mich irritiert an.
„Hallo, mein Schatz“, sage ich.
„Was ist los?“ Das liebe ich so an ihm. Immer direkt zur Sache kommen, und du kannst einfach kein Geheimnis vor ihm haben. Nicht nach fast drei Jahren Ehe. Er kennt mich in- und auswendig, fast besser als ich mich selbst.
„Schneewittchen.“
„Hm? War das jetzt eine Anrede?“
„Nein“, erwidere ich kopfschüttelnd. „Sie hatte Hunger. Und hat eine Bank mit einem Schnellimbiss und die Menschen mit Hamburgern verwechselt.“
„Ich verstehe kein Wort.“
Ich schließe wieder die Augen. „Ben rief mich an, ob ich nicht zu ihm kommen wolle. Er möchte mir was zeigen. Eine Bank, sie wurde überfallen. Die Menschen darin … auseinandergerissen, zerfetzt, angefressen. Überall Blut. Und mit Blut an die Wand geschrieben: Snow White was here.“
„Shit.“
„Du sagst es, mein Schatz.“
Er kommt zu mir, hockt sich hin und legt eine Hand ins Wasser. Sie berührt ganz leicht meine Brüste. „Eine Ahnung?“
„Eine ganz düstere.“
„Aber nichts Konkretes?“
„Nichts Konkretes. James, ich bin nicht leicht zu schocken, aber das war hart.“
„Wie haben es die anderen verkraftet?“
„Schlecht.“ Er fragt nicht nach, wie schlecht. Ist ihm sowieso klar. Er kennt mich, und er hat genug Fantasie, sich die Szenerie auszumalen.
„Was für dich?“
„Möglicherweise. Auch gewöhnliche Menschen können so was.“
„In einer Bank? Am helllichten Tag?“
Er stellt immer die unbequemen Fragen, die ich mir stellen müsste. Auch dieses Mal.
„Eher selten.“ Ich sehe ihn an. „Aber warum sollten andere Wesen so was tun? Eine Bank ausrauben, eine halbe Million und ein paar Innereien mitgehen lassen?“
„Sag du es mir!“
„Mir fällt kein Grund ein, der mir gefallen würde.“
„Und ein Grund, der dir nicht gefällt?“
„Dämonen. Aber Dämonen rauben keine Bank aus. Sie brauchen kein Geld.“
„Was ist mit Katharina?“
„Was soll mit ihr sein? Sie hat es nicht nötig, Banken auszurauben!“
„Das stimmt. Sie kauft sie höchstens. Aber sie hat eine Affinität zu Geld. Und ist ein Dämon.“
„Sie frisst keine Menschen.“
„Ich habe ja auch nicht gesagt, dass sie es war. Ich wollte dich lediglich darauf hinweisen, dass es Dämonen gibt, die sich mit Geld abgeben.“
„Ja.“ Ich steige aus der Badewanne.
„Oh je, du hast ja wirklich schlechte Laune.“
Seufzend bleibe ich stehen, dann lasse ich mich von ihm trocken rubbeln. Dass ich dabei an einer Stelle nur noch nasser werde, ist ein eindeutig gewollter Nebeneffekt.
Ich gehe in die Hocke. Hinter dem Gestrüpp bin ich unsichtbar, aber selbst sehe ich alles. Es regnet wie aus einer Gießkanne. Meine Sachen sind völlig durchnässt und kleben unangenehm auf der Haut. Am liebsten würde ich mich nackt ausziehen, aber kalte Windböen halten mich davon ab. Ich drücke den Rücken gegen den Baumstamm hinter mir und lege die Arme um die Beine. Ich zittere, es ist plötzlich kalt. Das Wasser dringt durch die Kleidung, alles an mir ist nass.
Wo bin ich?
Um mich herum Gestrüpp. Ein Baum. Grauer Himmel, aus dem es Bindfäden regnet. Geräusche. Ich wende den Kopf nach rechts und versuche durch die Sträucher hindurch zu erkennen, wo sie herkommen. Da ist ein Weg, schlängelt sich durch den Wald. Eine Prozession kommt, eine Beerdigung. Vorne gehen die Sargträger mit dem Sarg. Dutzende von Schwarzgekleideten.
Etwas ist seltsam. Ich krieche unter dem Gestrüpp auf den Weg zu, um besser sehen zu können. Kinder. Es sind Kinder. Alles nur Kinder, gekleidet wie Erwachsene. Selbst die Sargträger sind Kinder.
Es ist gespenstisch. Bis auf den Regen ist nichts zu hören. Die Gesichter der geschätzt 80 Kinder, die dem Sarg folgen, sind regungslos, wie Masken. Nirgendwo ein Regenschirm, eine Kapuze. Die in Anzüge und Kleider gekleideten Kindern sind genauso nass wie ich.
Ich warte, bis die Prozession vorbeigezogen ist, dann krieche ich auf den Weg. Aufgerichtet folge ich den Kindern. Es fühlt sich an, als würde ich durch einen See waten, so dicht ist inzwischen der Regen. Wenn ich den Mund aufmache, ertrinke ich. Am Wegesrand stehen Laternen, deren Licht sich im Wasser zerstreut.
Die Prozession erreicht ihr Ziel, die Kinder stellen sich um ein ausgehobenes Grab herum auf. Die Sargträger lassen den Sarg hinunter in das Loch, während die anderen Kinder einen seltsamen Singsang anstimmen, wie Kinder im Vorschulalter oft singen. Das Bild ist verrückt: Sie geben sich wie Erwachsene und dann dieser Gesang. Ich erschaudere, während ich die Kinder aus einem Versteck heraus beobachte. Der Regen ist mein Versteck.
Nachdem das Grab zugeschaufelt ist, löst sich die Gruppe auf und die Kinder zerstreuen sich in allen Richtungen. Schließlich bin ich allein. Allein mit den Toten. Ich warte noch ein paar Minuten, bevor ich zum Grab laufe. Für mich wäre es zu klein, aber warum sollten ausgerechnet Tote erwachsen sein in dieser Kinderwelt?
Wer bin ich und was tue ich hier??
Die erste Frage bleibt offen, die zweite beantworte ich mir selbst, indem ich damit beginne, das Grab wieder auszuheben. Mit bloßen Händen ist das eine mühselige und dreckige Arbeit, vor allem, da sich die Erde durch den Regen in einen Sumpf verwandelt. Dennoch habe ich irgendwann endlich den Sarg freigelegt. Ich lege mich auf den Bauch und versuche, den Deckel hochzuziehen. Auf dem nassen Holz rutschen meine Finger immer wieder ab, meine Fingerspitzen bluten schon. Doch schließlich schaffe ich es, den Deckel mit beiden Händen so festzuhalten, dass ich ihn anheben und dann von unten packen kann. Ich ziehe ihn heraus und werfe ihn achtlos zur Seite.
Im Sarg liegt ein Kind, doch es ist zu dunkel, als dass ich viel erkennen könnte. Ich suche meine Taschen ab nach etwas, womit ich Licht machen könnte. Aber selbst wenn ich etwas bei mir gehabt hätte, wäre es inzwischen durch den Regen unbrauchbar geworden. Ich lege mich also erneut in den Schlamm und ziehe stöhnend und ächzend den Sarg aus dem Grab. Jetzt kann ich das Kind besser erkennen.
Ein zehnjähriges Mädchen, die Hände ordentlich auf dem Bauch gefaltet, die Augen verschlossen. Sie sind grau. Das weiß ich sehr genau, denn ich starre entgeistert auf mich selbst.
Graue Augen, die ins Nichts starren. Die Augen einer Toten? Ich trete so weit zurück, dass ich meinen Körper im Spiegel sehen kann. Ist das wirklich eine 26-Jährige?
Bin ich das wirklich?
Mir ist kalt. Als ich die Arme um mich lege, fällt mir auf, dass ich mich umarme. Was ist los mit mir? Wie kann ein Traum mich derart verwirren? Was bedeutet er?
Mir ist klar, dass er eine Botschaft ist. Ich habe als Kriegerin oft genug mit Dingen zu tun, die sich in kein rationales Weltbild pressen lassen, mich eingeschlossen. Aber dieser Traum ist etwas sehr Persönliches. Der Anblick meines Kind-Ichs hat etwas sehr Tiefes berührt, und ich kann nicht einordnen, was das für Gefühle sind, die mich fast in einen Zombie verwandeln. Und das Letzte, was ich jetzt sehen will, ist die Visage des Psychoterroristen. Er weiß eh schon viel zu viel über mich. Ich glaube, er weiß mehr als ich.
Ich lasse die Arme sinken, bis sie einigermaßen locker an den Seiten herunterhängen. Schlanke, sehnige Gestalt, flacher, muskulöser Bauch, kleine, runde Brüste. Kurze Haare. Gefährlich sehe ich wirklich nicht aus. Wer mich nicht kennt, hält mich für ein schüchternes, unsicheres Mädchen. Zumindest wer nicht genau hinschaut, denn ich stehe aufrecht.
Viel wichtiger ist jedoch, dass ich sehr deutlich auch das kleine Mädchen im Spiegel sehe.
Ich trete wieder näher an den Spiegel heran und betrachte mein Gesicht. Die unauffällig vollen Lippen, die fast immer angedeutet diesen zynischen Zug haben. Die gerade, schmale Nase. Und die grauen Augen. Sie sind kalt – ja, fast leblos.
„Wer bist du?“, flüstere ich.
In einem Anfall von Trotz beschließe ich, dass mich der Traum kreuzweise kann und verlasse empört das Badezimmer. James ist gerade fertig mit dem Tischdecken, als ich nackt auftauche. Er mustert mich eindringlich. Ich kenne diesen Blick und mag ihn grad nicht. Er scheint es zu merken, denn die obligatorische Frage kommt nicht. Stattdessen reicht er mir stumm meinen Kaffee.
„Schatz.“ Er mustert mich noch eindringlicher. Wenn ich nackt „Schatz“ sage, scheint das was Bedrohliches zu haben. „Schatz?“
„Ja.“
„Was Ja?“
„Was du auch immer fragst.“
„Wie kommst du darauf, dass ich was fragen will?“
„Weil du 'Schatz' gesagt hast. Mit einem Punkt. Kein Fragezeichen, kein gedehntes 'Schaaaaatz', sondern kurz und knackig 'Schatz'. Das bedeutet, du willst mir eine Frage stellen, und von der Antwort hängt mein Leben ab. Also habe ich schon mal vorsorglich Ja gesagt.“
Ich starre ihn mit offenem Mund an.
„Wie lautet denn nun die Frage?“
„Äh … habe ich vergessen.“
„Glück gehabt. Möchtest du frühstücken, mein Schatz?“
Ich nicke stumm und setze mich. Er grinst. „Das kommt nicht oft vor, dass man dich sprachlos kriegt.“
„Das stimmt. – Meinst du, ich sollte zum Psychoterroristen?“
„Was willst du da?“
„Na ja, vielleicht kann er mir den Traum erklären.“
„Wieso sollte dir ein Psychotherapeut den Traum erklären können?“
„Er hat das gelernt.“
James verschüttet vor Lachen seinen eigenen Kaffee. „Scheiße!“ Dann blickt er mich fassungslos an. „Das glaubst du aber nicht ernsthaft, oder?“
„Wieso nicht? Er hat wirklich was drauf.“
„Das glaube ich dir ja. Aber ein Trauma zu behandeln ist was ganz anderes, als einen Traum zu erklären.“
„Freud hat auch ...“
„Freud! Lass den mal schön aus dem Spiel. Kannst ja deinen Psychoterroristen fragen, was er von dem hält.“
„Nicht viel. – Und wie finde ich jetzt heraus, was mir der Traum sagen will?“
„Hm. Bist du sicher, dass es ein Traum war?“
„Fast. Also, eigentlich ziemlich sicher. Die Stimmung, das Körpergefühl … sehr untypisch für eine Außerkörperlichkeit. Und die Begegnung mit dem Kind … eigentlich nur in einem Traum möglich.“
Mir fällt ein, dass ich frühstücken könnte und nehme ein Brötchen. Als ich hineinbeißen will, nimmt James es mir aus der Hand, schneidet es auf und schmiert Marmelade auf beide Hälften. Dann bekomme ich es zusammengelegt wieder.
„Danke … was symbolisiert ein Kind, das eigentlich mein junges Ich ist und in einem Sarg liegt? Dass ich bald sterben werde?“
„Na, dann brauchst du dir ja keine Sorgen zu machen. Darin hast du nun wirklich viel Übung.“
„Du ...!“ Ich atme laut aus. „Ja. Und ich bin erwachsen.“
„Eben. Kannst ja tagsüber darüber nachdenken oder nächste Nacht das Kind fragen. Ich muss jetzt los, habe in einer Viertelstunde eine Besichtigung.“
„Soll ich heute Danny nehmen?“
„Das wäre super.“ Er gießt den Kaffee hinunter und gibt mir einen Kuss. „Bis heute Abend. Und vergiss nicht, dich anzuziehen, bevor du zur Arbeit fährst.“
Manchmal hasse ich ihn. Fast. Wenigstens ein bisschen. Wie kann ein Mensch nur so zynisch sein? Mich ausgenommen!?
Mit 10 war ich ein Einzelkind. Nachdenklich betrachte ich meine Mutter, während ich lustlos im Essen herumstochere. James unterhält sich angeregt mit meinem Vater, aber ich weiß genau, dass er mitkriegt, wie ich drauf bin. Deswegen unterhält er sich so angeregt mit meinem Vater. Aber er schafft es nicht, auch meine Mutter abzulenken. Sie beobachtet mich eine Weile, ehe sie mich anspricht.
„Was ist los, mein Schatz?“
„Nichts.“ Wir alle wissen, dass das gelogen ist.
„Erzählst du mir, welches Nichts dich so beschäftigt?“
„Du bist fast so zynisch wie ich, Mama.“
„Ja, ich habe viel von dir gelernt.“
Ich grinse. „Echt? Die schlimmen Sachen auch?“ Ich atme tief durch. „Ich habe blöd geträumt, das ist alles.“
„Mein Kind, hast du so wenig Vertrauen zu mir?“
Was soll ich dazu sagen? Mütter sind lästig. Meiner Mutter kann ich nichts vormachen, sie kennt mich viel zu gut. Sie spielt oft und erfolgreich die Gattin des reichen Ex-Unternehmers und Entrepreneurs, aber sie kriegt einfach alles mit. Fast alles.
Ich stehe auf und gehe nach draußen. Es regnet leicht, daher bleibe ich unter dem Terrassendach stehen und zünde mir eine Zigarette an. Meine Mutter legt von hinten ihre Arme um mich.
„In letzter Zeit wirkst du oft traurig“, sagt sie plötzlich.
„Traurig?“
„Ja. Nicht immer. Aber ab und zu.“
„Oft oder ab und zu?“
„Mir kommt es oft vor, aber wahrscheinlich ist es gar nicht so oft, wie ich mir einbilde. – Gibt es Probleme mit James?“
„Mit James?“ Ich schüttle den Kopf. Nein, mit James habe ich keine Probleme. Ich liebe ihn. Mein Problem heißt Katharina. Aber das weiß niemand außer ihr. Ich lehne den Kopf zurück, bis unsere Wangen sich berühren. „Mama, ich weiß es nicht. Ich meine, was mich so traurig macht. Mit James ist alles in Ordnung. Ich liebe ihn.“
„Wann werde ich Großmutter?“
„Was?!“ Ich richte mich auf und starre sie entgeistert an.
„Warum erschreckt dich dieser Gedanke so? Du bist eine junge Frau, und du wärst eine wunderbare Mutter.“
„Ich?“ Als Mutter kann ich mich nun wirklich nicht vorstellen. Kind stillen, wickeln, baden … ich??? „Mama, ich glaube nicht, dass ich eine gute Mutter wäre.“
„Doch, das wärst du. Ich habe gesehen, wie du mit Kindern umgehst. Kinder lieben dich.“
„Weil ich auch ein Kind bin!“
„Du bist doch kein Kind mehr!“
Ich ziehe an meiner Zigarette. „In meinem Traum schon. Ich fand mich als Zehnjährige in einem Sarg liegend.“
„Oh. – Jetzt verstehe ich. Aber es war nur ein Traum. Ein böser Traum.“
„Ja, ein böser Traum … wie auch immer. Ich sollte vielleicht erst einmal erwachsen werden, bevor ich ein Kind bekomme.“
„Dann würde die Menschheit aussterben, wenn das Bedingung wäre.“ Meine Mutter kichert. „Es ist gar nicht so gut, ganz erwachsen zu werden.“
„Du überrascht mich, Mama.“
„Wirklich?“
„Nein.“
„Ich habe mich schon fragen wollen, ob du mich wirklich so schlecht kennst.“
Ich zwinge ein Lächeln auf mein Gesicht. „Mama, im Moment kenne ich nicht einmal mich selbst.“ Seufzend nehme ich einen letzten Zug von der Zigarette, bevor ich sie ausdrücke. „Vor allem verstehe ich nicht, dass ein Traum mich so … depressiv macht.“
„Gegen Depressionen gibt es gute Mittel.“
„Wie den Psychoterroristen?“
„Wieso nennst du ihn eigentlich immer so? Das ist abwertend, und das hat er nicht verdient.“
„Weil er wie ein Terrorist in mein Innerstes eingedrungen ist und dort alles durcheinandergebracht hat.“
„Vielleicht hat er auch nur aufgeräumt.“
„Ja, natürlich. – Nein, Mama, das geht schon. Ich bin bestimmt nicht selbstmordgefährdet. Wüsste sowieso nicht, wie ich das anstellen sollte.“
„Zum Glück ...“ Sie schweigt erschrocken. „Tut mir leid, verzeih mir. So war es nicht gemeint.“
Ich nehme sie in die Arme. „Ich weiß, Mama. Ist schon gut. Ist lieb gemeint, dass du versuchst, mir zu helfen, aber ich muss mit diesem Ding, das sich mein Leben nennt, selbst fertig werden. Irgendwie. Und ich schaffe das schon. Trotzdem, danke.“
Sie streichelt mir mein Gesicht, dann gehen wir wieder hinein. Die Männer sehen uns erwartungsvoll an, aber sie werden enttäuscht. Von uns erfahren sie nichts. Außerdem hätten wir sowieso keine Gelegenheit etwas zu erzählen, denn mein Handy meldet sich lautstark. Auf dem Display steht der Name von Jack. Mein Herz verkrampft sich.
„Hallo Jack.“
„Fiona … tut mir leid, dich zu stören.“
„Hat Schneewittchen wieder zugeschlagen?“
„Ja, wahrscheinlich.“
„Scheiße. Hast du Ben schon Bescheid gesagt?“
Er zögert. „Das geht nicht“, sagt er schließlich. Dann räuspert er sich. „Sie haben ihn entführt.“
„Wen?“ Ich kapiere mal wieder nichts. „Wer hat wen entführt?“
„So wie es aussieht, hat Schneewittchen Ben entführt.“
„Was!? Jack, wo bist du?“
„In Bens Wohnung. Kannst du herkommen?“
„Ja, natürlich. Bin gleich da.“ Ich lege auf und starre James an.
„Habe ich das richtig verstanden, dass Ben entführt wurde?“, fragt er. Ich nicke. „Verdammt. Heftig. Wesen, die Polizisten persönlich angreifen, sind entweder sehr dumm oder sehr gefährlich.“
„Oder beides. Schatz, ich muss hin.“
„Ich weiß.“
Ich gebe ihm einen Kuss, verabschiede mich von meinen Eltern und laufe rüber zu unserem Haus. Kurzerhand nehme ich den Jaguar, weil ich ihn sowieso wegsetzen müsste. Vor dem Haus, in dem Ben wohnt, sehe ich schon von Weitem den üblichen Auflauf. Allerdings ist die Presse noch nicht da, also hat mich Jack ziemlich schnell, nachdem die Entführung Bens entdeckt wurde, angerufen. Ich parke neben einem Krankenwagen, und als ich aussteige, nimmt mich ein junger Polizist in Empfang.
„Der Chief möchte, dass ich Sie zu ihm bringe“, sagt er ohne jede Begrüßung. „Ich finde das unverantwortlich.“
„Wieso?“, frage ich, unwillkürlich schmunzelnd.
„Es sieht nicht schön aus in der Wohnung des Lieutenants.“
„Wieso?“ Mein Herz verkrampft sich. „Ich denke, er wurde entführt?“
„Er schon. Sein … Freund nicht.“ Mehr scheint der Polizist nicht sagen zu wollen. In der Zwischenzeit haben wir das Haus betreten und gehen zu Fuß in die zweite Etage. Ich habe dabei mehrere Déjà-vus. Bleiche Polizisten, die aussehen, als würden sie gleich kotzen. Dank der Andeutungen des jungen Polizisten ahne ich allerdings, was der Auslöser für die allgemeinen Übelkeitsanfälle sein könnte.
Jack erwartet mich vor der Wohnung. Es ist eine dieser Luxuswohnungen in einem Luxusgebäude in einer Luxusgegend. Wo waren die Luxuswachleute des privaten Schutzdienstes? Und wieso kann sich Ben das eigentlich leisten? Zumindest die letztere Frage kann ich mir selbst beantworten: Weil er zurückgezogen lebt und kaum Geld für irgendwas ausgibt, was nicht unbedingt nötig ist.
Ich nehme Jack kurz in die Arme. Dann deute ich auf die Wohnungstür. „Da drinnen muss es ja schlimm aussehen.“
„Ja. Du warst in der Bank?“
Ich nicke.
„Dann wird es für dich nichts Überraschendes in der Wohnung geben. Wusstest du, dass Ben mit einem Mann zusammengelebt hat?“
„Du?“
„Ja. Aber er machte es nie öffentlich.“
„Nun, ich habe es geahnt. Aber wir haben nie über sein Privatleben gesprochen.“
Jack mustert mich mit einem undefinierbaren Ausdruck. Schließlich öffnet er die Tür und geht vor. Bestialischer Gestank schlägt mir entgegen. Die Quelle liegt auf dem Boden zwischen Badezimmer und Küche. Es war mal ein Mann, das kann ich erkennen.
Ich schlucke. „Komisch, dass Menschen kein Problem haben, ein Huhn aus dem Supermarkt anzupacken, aber bei diesem Anblick loskotzen.“
„Du findest das komisch?“
„Nicht wirklich.“ Während ich an den Resten des Mannes, und es sind wirklich nur Reste, vorbeigehe, denke ich daran, dass es eben einen Unterschied macht, ob man ein Huhn als Huhn erkennen kann oder nicht. Nicht ohne Grund werden die Hühner meistens in Einzelteilen und mariniert oder paniert angeboten, um bloß keine Assoziationen zu wecken. Niemand wäre von einem Menschenschnitzel schockiert, wenn er den ursprünglichen Menschen nicht mehr erkennen könnte und auch nicht wüsste, dass es Menschenfleisch ist, was da grad in der Pfanne bruzzelt.
Der Freund von Ben ist als Mensch erkennbar, auch wenn sein Kopf entkernt wurde.
„Was ist passiert?“, erkundige ich mich. Ich stehe nun mit Jack im Wohnzimmer. Es sieht wild aus. Und als ich erkenne, dass eins der Beweisstücke, das neben dem Sessel liegt, ein Teil von einem Fuß ist, halte ich kurz den Atem an, sonst würde selbst mir schlecht werden.
„Soweit wir rausgefunden haben, sind sie durch das Fenster gekommen. Es gab wohl einen kurzen Kampf. Dann haben sie den Freund – er hieß George Wilson – ausgeweidet, vermutlich, als er noch lebte. Und sind wieder durch das Fenster gegangen.“
„Durch das Fenster? Wir sind im zweiten Stock.“
„Das scheint sie nicht gestört zu haben“, erwidert Jack trocken.
Ich trete zum Fenster, bleibe aber in einiger Entfernung stehen, um die Spurensicherung nicht zu stören. Die Scheiben liegen vor dem Fenster, in Tausenden von Scherben. Sie sind nicht durch das Fenster gekommen, sie sind durch das Fenster gesprungen. Bloß wer?
„Gibt es Zeugen? Irgendwelche Hinweise, mit wem oder was wir es zu tun haben?“
Jack schüttelt den Kopf. „Das Ganze hat vielleicht zehn Minuten gedauert, wenn überhaupt. Mehrere Bewohner haben was gehört, es hat ja auch ordentlich gerumst. Bei uns gingen zwei Notrufe ein. Als wir eintrafen, war es schon vorbei. Als unsere Leute die Tür aufbrachen, hat George noch gezuckt.“
„Wie bitte? Er hat doch kein Gehirn mehr!“
Jack zuckt die Achseln. „Anscheinend hatten sie es ihm erst kurz zuvor entfernt. Sein Körper bewegte sich jedenfalls noch.“
Ich erschaudere. Erinnerungen kommen plötzlich hoch. Erinnerungen, die ich gut verschlossen wähnte. Dann merke ich nur noch, dass Jack mich auffängt.
„Fiona? Fiona, was ist los?“
Ich klammere mich an Jack fest und warte darauf, dass die Welt um mich herum sich beruhigt. Das Ganze dauert sicher nicht länger als ein paar Sekunden, aber das reicht, um Jack einen panischen Ausdruck auf sein Gesicht zu zaubern.
„Fiona??“
Ich atme ein paarmal tief durch und richte mich langsam auf. „Sorry … ich … ich habe mich an etwas Unangenehmes erinnert.“
Jack mustert mich, dann nimmt er meinen Arm und zieht mich fort, fort von den neugierigen Blicken seiner Leute, in das Bad, und er schließt die Tür.
„Fiona, das ist das erste Mal, dass ich eine solche Reaktion bei dir erlebe“, sagt er dann langsam.
„Puuh ...“ Ich setze mich auf den Wannenrand und fische meine Zigaretten hervor. „Du auch?“ Und als er den Kopf schüttelt, zünde ich mir eine an. „Das Bild vom zuckenden Kerl … ließ die Frage in mir hochkommen, ob und wie er sich dabei fühlte … und das wiederum in mir mit Urgewalt die Erinnerung daran erwachen, wie sich so was anfühlt.“
„Was anfühlt?“
„Seinen Körper in Stücken zu verlieren.“ Ich ziehe an der Zigarette und bin wieder halbwegs bei mir. „Du weißt doch, wer ich bin.“
„Ja. Aber wir haben uns noch nie über Details unterhalten. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass du auch schon ...“
„Ausgeweidet wurde? Nun, es lief etwas anders. Aber am Ende konnte ich die einzelnen Teile meines Körpers auf dem Boden zerstreut rumliegen sehen, bevor ich endlich das Bewusstsein verlor. – Wie auch immer. Ich habe nicht mit diesem Flashback gerechnet.“
„Vielleicht sollte jemand anderes den Fall übernehmen? Schon allein, weil du persönlich befangen bist.“
„Willst du bei Gott anrufen? – Nein, so läuft das nicht, Jack. Du wirst mit mir vorliebnehmen müssen. Wir sind keine Behörde, bei uns gibt es keinen Notruf, keinen Dienstplan, keine Zuständigkeiten. Ich bin Fiona und zufällig in dieser Wohnung, zufällig in diesem Bad und sitze nur zufällig auf dieser Wanne und rauche zufällig diese scheißverdammte Zigarette!“
„Schon gut, ich habe verstanden.“
„Tut mir leid.“ Ich drücke die Zigarette aus und erhebe mich. „Ich will mir die Spuren draußen ansehen.“
Allerdings nicht die in der Wohnung. Um die kümmern sich schon die Fachleute, die das besser können als ich. Ich gehe vorsichtig nahe an das Fenster heran, während unter meinen Sohlen Glas knirscht. Unter dem Fenster ein größerer Gemüsegarten. Pech für die Hobbygärtner, aber gut für mich, denn zwischen den Tomaten und der Paprika ist sehr gut zu erkennen, wo die Angreifer herkamen.
„Sie scheinen von da unten hier hochgesprungen zu sein“, bemerke ich. „Hm.“
„Hochklettern kommt nicht infrage?“
„Dann hätten sie die Scheibe eingeschlagen, und dann lägen die Scherben ganz anders.“
„Das stimmt“, gibt Jack zu. „Aber wer springt mal eben in ein Wohnung im zweiten Stock durch ein geschlossenes Fenster?“
„Sehr gute Frage.“ Ich schaue mich draußen um. Niemand zu sehen. Bevor Jack reagieren kann, springe ich durch das Fenster und lande im Gemüsebeet. Da ich mich dabei darum bemühe, nicht die Spuren der Entführer zu zerstören, müssen weitere Tomaten dran glauben. Das ist blöd, denn der sich verteilende Saft erschwert etwas die Spurenlese. Während ich mich über die Spuren der Entführer beuge, denke ich flüchtig darüber nach, ob Tomatensaft gut aus Baumwolle rausgeht. Wir werden sehen.
Ich konzentriere mich auf das Riechen. Meinem Anderssein verdanke ich unter anderem wesentlich höher auflösende Sinneswahrnehmungen als normale Menschen. Was normal auch immer sein mag. Neben dem brutal intensiven Geruch der zerstörten Tomaten rieche ich als erstes Angst. Todesangst. Ich rieche Bens Angst.
Und dann ist da ein vertrauter Geruch, nur viel, viel intensiver. Der Geruch von Dämonen. Er ist sehr spezifisch, für geübte Nasen wie meine gut erkennbar. Auch Katharina hat diesen Geruch, allerdings nur dezent. Hier jedoch, in diesem Gemüsegarten, waren Vollblutdämonen unterwegs. Damit ist jeder Zweifel ausgeräumt – es waren keine Menschen. Wie konnte ich das auch nur annehmen? Dieser Geruch hätte mir auffallen müssen in der Bank, wäre er auch ohne den allgegenwärtigen Gestank toter Seelen. Fiona! Ich korrigiere, nicht die Seelen stanken, sondern ihr brutaler Tod.
In der Zwischenzeit sind Jack und zwei Polizisten auch da. Jack sieht mich vorwurfsvoll an, spart sich aber jede Bemerkung bezüglich meiner Stunteinlage.
„Hast du was rausgefunden?“
Ich mustere kurz die beiden Polizisten und deren mitleidigen Gesichtsausdruck, dann wende ich mich Jack zu. „Ja.“ Statt einer weiteren Erklärung folge ich der gut sichtbaren und noch besser riechbaren Spur. Ziemlich eindeutig verließen die Entführer das Grundstück auf demselben Wege, auf dem sie gekommen waren. Der riesengroße Gemeinschaftsgarten des Mietshauses grenzt an einen öffentlichen Erholungspark, durch einen mindestens zwei Meter hohen Maschendrahtzahn davon abgetrennt.
„Auf der anderen Seite geht es weiter“, stellt Jack lakonisch fest.
Ich betrachte den Park. Etwas weiter südlich fließt die Labe, spätestens darin würde ich die Spur verlieren. Außerdem sind in dem Park zu viele Leute unterwegs.
„Manchmal liebe ich deinen Humor, Jack. Hast du hier noch was zu tun?“
„Alle wären froh, wenn ich sie hier nicht bei der Arbeit stören würde. Kann ich dir von unserem hervorragenden Kaffee in der Zentrale anbieten?“
„Sandras Kaffee? Jederzeit.“
Wir fahren in die Polizeizentrale, getrennt. Im Vorzimmer des Polizeichefs werde ich überschwänglich von Sandra begrüßt. Erstaunt stelle ich fest, dass ich Jack überholt habe. Ich lümmle mich in den Chefsessel und lege die Beine auf die Lehne. Dabei fallen mir die roten Tomatensaftflecken auf. Sie sehen wie Blutflecken aus.
Jack und Sandra kommen gleichzeitig, sie mit dem Kaffee. Nachdem sie wieder draußen ist, halte ich fragend meine Zigarettenschachtel hoch. Jack nickt. Ich zünde mir eine Zigarette an und betrachte ihn neugierig.
„Ich habe ein paar Leute angesetzt, Bens letzte Fälle anzuschauen. Oder findest du es nicht seltsam, dass er entführt wurde?“
„Ich finde im Moment alles seltsam“, erwidere ich melancholisch.
„Fiona? Alles in Ordnung?“
„Bestimmt“, versichere ich und nehme einen tiefen Zug. „Jack, ich habe noch nie davon gehört, dass Vollblutdämonen sich mitten am Tag einen Menschen holen. Auf diese Weise nicht einmal nachts. Und noch ungewöhnlicher ist dieser Banküberfall.“